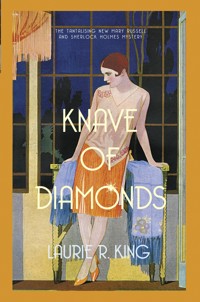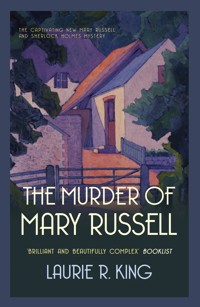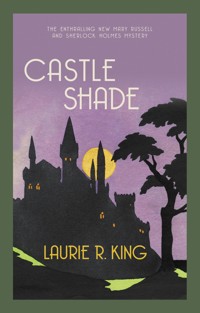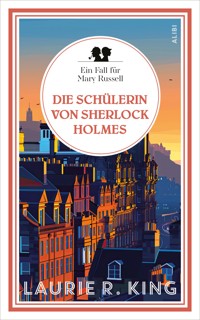
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mary Russell ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mary Russell, ein kluger und eigenwilliger Teenager, wächst nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer ungeliebten Tante auf. Sie staunt nicht schlecht, als sie eines Tages ihren Nachbarn, einen gewissen Sherlock Holmes, kennenlernt. Holmes und seine herzliche Haushälterin Mrs Hudson werden ihre Ersatzfamilie, und der alternde Detektiv beginnt, die talentierte Mary in die Geheimnisse seines Berufs einzuweihen. Bald lösen die beiden erste gemeinsame Fälle, während Mary erwachsen wird und vor dem Hintergrunddes Ersten Weltkriegs ein Studium beginnt. Doch dann sind die beiden plötzlich einer großen Sache auf der Spur, und es geht um Leben und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Laurie R. King
Die Schülerin von Sherlock Holmes
Ein Fall für Mary Russell
Kriminalroman
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Malsch
Alibi
Inhalt
Widmung
Vorwort der Herausgeberin
Vorspiel – Bemerkungen der Autorin
BUCH EINS Lehrzeit
1 Zwei schäbige Gestalten
2 Der Zauberlehrling
3 Die Hundeherrin
4 Mein eigener Fall
BUCH ZWEI Praktikum
5 Zigeunerleben
6 Ein Kind, von seinem Nachtlager verschwunden
7 Ein Gespräch mit Miss Simpson
BUCH DREI Partnerschaft
8 Wir haben einen Fall
9 Das Wild ist auf, folgt eurem Mute
10 Ein menschenleeres Haus und seine Probleme
11 Ein anderes Problem: Die misshandelte Droschke
12 Die Flucht
Ein Exkurs
13 Am Nabel der Welt
BUCH VIER Meisterschaft
14 Das Drama beginnt
15 Trennungsleid
16 Die Tochter der Stimme
17 Mit vereinten Kräften
18 Königliche Schlacht
Nachspiel
19 Heimkehr
Über Laurie R. King
Über Eva Malsch
Für eine andere M.R., meine Mutter, Mary Richardsen
Vorwort der Herausgeberin
Zunächst soll der Leser wissen, dass ich nichts mit dem Buch zu tun habe, das er in der Hand hält. Ja, ich schreibe Krimis, aber sogar die blühende Phantasie einer Romanschriftstellerin hat ihre Grenzen. Mir wäre niemals die Idee gekommen, Sherlock Holmes könnte sich eine aufgeweckte feministische fünfzehnjährige Halbamerikanerin als Assistentin aussuchen. Also wirklich – wenn sogar Conan Doyle nur mühsam der Versuchung widerstand, Holmes von einer hohen Klippe zu stoßen, hätte ein offensichtlich intelligentes junges Mädchen dem Detektiv schon bei der ersten Begegnung den Schädel eingeschlagen.
Aber das erklärt nicht, wieso dieses Buch gedruckt wurde.
Es begann vor einigen Jahren, als die Lieferantin eines Zustelldienstes meine Zufahrt heraufraste und zu meiner Überraschung nicht die erwartete Gemüsesaat ablud, sondern einen riesigen, mit zahlreichen Klebestreifen verschlossenen Karton. Dieser musste das Gewicht, das man der Lieferantin zumuten konnte, bei Weitem überschritten haben, weil sie ihren Handkarren benutzte, um das Ding auf meine Vorderveranda zu manövrieren. Nachdem ich sie vergeblich nach dem Absender befragt und mich vergewissert hatte, dass tatsächlich meine Adresse auf dem Karton stand, unterschrieb ich die Empfangsbestätigung und holte ein Messer aus der Küche, um die Klebestreifen durchzuschneiden.
Schließlich zerschnitt ich noch viel mehr, und nachdem ich die Pappe zerrissen hatte, stand ich knöcheltief in Papierfetzen, und das Messer sah nicht mehr so aus wie zuvor.
Das Paket enthielt einen großen, viel benutzten altmodischen Reisekoffer aus Metall, mit Aufklebern von bekannten und phantastisch anmutenden Hotels (gibt es in Ibadan ein Ritz?). Irgendjemand hatte vorsorglich den Schlüssel mit einem durchsichtigen Klebestreifen am Vorhängeschloss befestigt. Ich riss ihn herunter, drehte ihn im Schloss herum und fühlte mich ein bisschen wie Alice mit der »Trink-mich«-Flasche.
Während ich das Durcheinander im Koffer anstarrte, ging meine Neugier in Angst über. Hastig zog ich meine Hand weg und trat zurück. Gedanken an verrückte Bombenleger schossen mir durch den Kopf. Ich lief die Treppe hinab und ums Haus herum, in der Absicht, die Polizei anzurufen.
Aber als ich durch die Hintertür hineingegangen war, machte ich mir erst mal eine Tasse Kaffee. Dann eilte ich zur Vorderseite des Hauses, spähte vorsichtig durch ein Fenster auf den verbeulten Metallkoffer und den wundervollen violetten Samt, der darin lag und auf dem sich eine meiner Katzen zusammengerollt hatte.
Warum eine schlafende Katze meine Furcht vor einer Explosion so schnell vertrieb, weiß ich nicht. Jedenfalls kniete ich nach wenigen Sekunden nieder, stieß das Tier mit dem Ellbogen beiseite und inspizierte die Sachen im Koffer. Sie erschienen mir ziemlich seltsam – nicht jeder Gegenstand an sich, sondern die Zusammenstellung, die keinerlei System erkennen ließ: verschiedene Kleidungsstücke, darunter das perlenbesetzte Abendcape aus violettem Samt (mit einem Schlitz am Saum), ein schäbiger Herrenbademantel, ein atemberaubender Kaschmirschal, mit Seidenfäden bestickt; eine zerbrochene Lupe; zwei gefärbte runde Glasgegenstände – offenbar dicke, grässlich unbequeme Kontaktlinsen; ein Stoffstreifen, den ein Freund später als auseinandergerollten Turban identifizierte; eine himmlische Kette aus Gold und Smaragden, die wie ein Symbol unvorstellbaren Reichtums an meinem Hals prangte, bis ich den Verschluss löste und ins Haus lief, um sie unter meinem Kopfkissen zu verstecken; eine Krawattennadel, mit Smaragden verziert; eine leere Streichholzschachtel; ein geschnitztes Essstäbchen aus Elfenbein; ein englischer Zugfahrplan aus dem Jahr 1923, genannt ABC; drei merkwürdige Steine; eine fünf Zentimeter lange Schraube, an der Mutter verrostet; eine kleine Holzkassette, geschmückt mit Gravuren und Intarsien, die Palmen und Dschungeltiere darstellten; eine schmale Ausgabe von König James’ Neuem Testament, deren abgegriffener weißer Ledereinband Blattgoldornamente und rote Lettern aufwies; ein Monokel an einem schwarzen Seidenband; eine Schachtel voller Zeitungsausschnitte, teilweise Berichte über Straftaten; und weitere sonderbare Dinge, in die Ecken des Koffers gestopft.
Am Boden lagen Manuskripte. Nur eins ließ sich sofort als solches erkennen, die anderen Papiere, in verschiedenen Größen, waren mit winziger, kaum leserlicher Handschrift vollgekritzelt – gebündelt, von schmalen violetten Bändern umschlungen, mit Wachs versiegelt und mit dem Buchstaben R abgestempelt.
Während der nächsten Wochen kämpfte ich mich durch diese Manuskripte und hoffte, eine Antwort auf die Frage zu finden, wer mir den Koffer geschickt hatte. Ich dachte, die Lösung des Rätsels würde mir wie ein Schachtelmännchen in Gestalt von Worten entgegenspringen. Aber es gab keinerlei Hinweise, nur die Geschichten, die ich teils genüsslich, teils widerwillig las.
Ich versuchte die Identität des Absenders herauszufinden und rief den Zustelldienst an. Doch das New Yorker Büro, in dem das Paket aufgegeben worden war, konnte mir nur mitteilen, ein junger Mann habe es gebracht und die Sendung bar bezahlt. Verwirrt räumte ich das Cape, den Bademantel und die Manuskripte weg und verstaute den Koffer in meinem Schrank. (Den Smaragdschmuck verwahrte ich in einem Banksafe.)
Und da lagen die Sachen, monatelang, jahrelang, bis ich mich eines düsteren Tages – nach zu vielen düsteren Tagen, wo mein Kugelschreiber nichts Brauchbares zustande gebracht hatte und das Geld knapp geworden war – etwas neidisch an die selbstsichere Stimme erinnerte, die aus jenen Manuskripten zu mir gesprochen hatte. Ich holte eins hervor, studierte es erneut, dann begann ich, es umzuschreiben, von schierer Verzweiflung angesichts meines undichten Hausdachs motiviert. Ein wenig beschämt schickte ich es meiner Lektorin.
Als sie mich einige Tage später anrief und den milden Kommentar abgab, der Stil unterscheide sich irgendwie von meinen anderen Werken, verlor ich die Nerven, legte ein Geständnis ab und bat sie um Rücksendung des Manuskripts. Dann starrte ich wieder mein leeres Schreibpapier an.
Am nächsten Tag rief sie noch einmal an und erklärte, sie habe mit dem Verlagsanwalt gesprochen, die Story gefalle ihr. Aber sie wolle das Original lesen und es gern veröffentlichen, falls ich bereit sei, auf mein Honorar zu verzichten, sollte die wirkliche Autorin auftauchen.
Der Kampf zwischen meinem Stolz und der Reparatur meines Dachs war beendet, noch ehe er richtig begonnen hatte. Doch ich besitze eine gewisse Selbstachtung, und so betonte ich, die immer noch in meinem Besitz befindlichen Erzählungen seien an den Haaren herbeigezogen.
Ich weiß nicht, was darin auf Tatsachen beruht und was erfunden ist. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass dies alles wirklich geschehen sein muss, so absurd es auch erscheinen mag. Wie auch immer, ich finde es besser, die Manuskripte zu verkaufen (trotz drohender Verzichtserklärung) als die wundervolle Smaragdkette, die ich vermutlich niemals tragen werde. Und wenn es akzeptabel wäre, sie zu verkaufen, gilt das auch für die Storys.
Hier ist nun das erste dieser Manuskripte, kein bisschen ausgeschmückt, sondern genau so, wie es die Autorin aus der Hand gegeben (und wahrscheinlich geschickt) hat. Ich korrigierte nur ihre ungeheuerliche Rechtschreibung und strich ein paar seltsame Randbemerkungen in Steno durch.
Was ich von alldem halten soll, weiß ich nicht. Ich hoffe nur, die Veröffentlichung von »Die Zellteilung der Königin«, wie die Autorin ihre Geschichte nennt (was für ein schwerfälliger Titel! Offenkundig ist sie keine Romanschriftstellerin), wird das Rätsel lösen und keine Urheberrechtsprozesse heraufbeschwören. Wenn irgendjemand Mary Russell kennt – könnten Sie mich informieren? Sonst bringt mich meine Neugier noch um.
Laurie King
Nach mühsamen Recherchen in der Bibliothek der University of California konnte ich die Zitate vor den einzelnen Kapiteln identifizieren. Sie entstammen der 1901 erschienenen dichterischen Naturbeschreibung Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck.
Vorspiel – Bemerkungen der Autorin
An diesen Ort hatte sich ein alternder Philosoph zurückgezogen … Hier hatte er sein Refugium gebaut, ein wenig müde von der Aufgabe, Menschen zu befragen …
Liebe Leserin, lieber Leser,
da dieses Jahrhundert und ich unser neuntes Jahrzehnt beginnen, muss ich zugeben, dass das Alter nicht immer ein erstrebenswerter Zustand ist. Natürlich leistet die Physis ihren Beitrag zum Leben, aber ein anderes Problem ärgert mich viel mehr. Die Vergangenheit, die mir so real erscheint, beginnt für die Menschen ringsum im Nebel der Geschichte zu verschwinden. Und der Erste Weltkrieg verfällt zu einer Handvoll eigentümlicher Lieder und Sepiabilder, die blutleer dem Tod huldigen. Die Zwanzigerjahre entarten zur Karikatur, die Kleidung, die wir trugen, wird jetzt in Museen ausgestellt, und wir, die den Anfang dieses gottverlassenen Jahrhunderts mit ansahen, stehen mit einem Fuß im Grab. Mit uns werden auch unsere Erinnerungen sterben.
Ich weiß nicht mehr, wann ich merkte, dass der Sherlock Holmes aus Fleisch und Blut, den ich so gut kannte, für den Rest der Welt nur die Erfindung eines phantasiebegabten Arztes und Schriftstellers war. Aber ich entsinne mich, wie mir diese Erkenntnis den Atem nahm. Tagelang schien mein Selbstbewusstsein zu schwinden, wurde immer schwächer, als verwandelte ich mich, von Holmes angesteckt, ebenfalls in eine fiktive Gestalt. Mein Humor rettete mich schließlich vor diesem Zustand, aber es war schon ein sehr seltsames Gefühl gewesen.
Nun ist der Prozess abgeschlossen. Watsons Geschichten, jene blassen Beschreibungen der faszinierenden Persönlichkeit, die wir alle kannten, gewinnen ein eigenes Leben, und der lebendige Sherlock Holmes nimmt die ätherischen, träumerischen Züge einer erfundenen Figur an.
In gewisser Weise ist das amüsant. Männer und Frauen verfassen jetzt Romane über Holmes, bemächtigen sich seiner und versetzen ihn in bizarre Situationen, legen ihm unmögliche Worte in den Mund und verschleiern die Legende noch zusätzlich. Es würde mich nicht überraschen, meine eigenen Erinnerungen in fiktiver Form wiederzufinden und mich selbst im Wolkenkuckucksheim. Welch eine köstliche Ironie …
Jedenfalls muss ich energisch betonen, dass die folgenden Seiten von den frühen Tagen und Jahren meiner tatsächlichen Beziehung zu Sherlock Holmes berichten.
Wer nichts von den Gewohnheiten und dem Charakter des Mannes weiß, wird bei der Lektüre meiner Geschichte vielleicht einige Anspielungen übersehen. Andere Leserschichten bewahren ganze Teile des Conan-Doyle-Korpus (in diesem Zusammenhang ein sehr passendes Wort) im Gedächtnis. Sie werden in meinem Bericht Stellen finden, die vom Text des vorangegangenen Holmes-Biographen, Dr. Watson, abweichen, und wahrscheinlich Anstoß an meiner Darstellung nehmen, die mit dem »richtigen« Holmes in Watsons Werk nichts zu tun hat.
Diesen Leuten kann ich nur sagen, dass sie recht haben. Der Holmes, der mir begegnete, hatte tatsächlich nichts mit dem Detektiv aus der Baker Street Nummer 221B gemein. Offenbar befand er sich schon seit anderthalb Jahrzehnten im Ruhestand und hatte seine Lebensmitte überschritten. Vieles war verändert, die Welt der Victoria Regina existierte nicht mehr. Automobile und Elektrizität ersetzten Droschken und Gaslampen, das Telefon machte sich sogar im Alltag der Dorfbevölkerung breit, und das Grauen des Krieges in den Schützengräben begann am Wesen der Nation zu fressen.
Aber selbst wenn sich die Welt nicht verändert und wenn ich den jungen Holmes kennengelernt hätte, würde ich ihn trotzdem anders porträtieren als der gute Dr. Watson. Dieser sah seinen Freund immer aus einer untergeordneten Position heraus, die seine Perspektive prägte.
Verstehen Sie mich nicht falsch – ich habe große Zuneigung zu Watson entwickelt. Aber er war von Natur aus naiv und brauchte ein wenig zu lange, bis er das Offensichtliche wahrnahm (um es höflich zu formulieren), wenn er auch über bemerkenswerte Weisheit und Menschlichkeit verfügte. Hingegen kam ich als Kämpferin zur Welt, konnte meine schottischen Kindermädchen mit den versteinerten Mienen schon als Dreijährige manipulieren, und sobald meine Pubertät begann, verlor ich die ganze Naivität und Weisheit, die ich vielleicht einmal besessen hatte. Es dauerte einige Zeit, bis ich beides wiederfand.
Holmes und ich waren von Anfang an ein gutes Gespann. Er übertraf mich, was seine Erfahrungen anging, aber seine Beobachtungsgabe und analytischen Fähigkeiten konnten mich nie so beeindrucken wie Watson. Meine eigenen Augen und mein Gehirn funktionierten genauso einwandfrei, und so betrat ich vertrautes Terrain.
Ja, ich gebe es freimütig zu – mein Holmes ist nicht Watsons Holmes. Um bei der Analogie zu bleiben, ich sehe ihn aus einer anderen Perspektive, führe den Pinsel anders, benutze andere Farben und Nuancen. Das Thema ist im Grunde dasselbe; es wird nur von den Augen und den Händen des Malers verändert.
M.R.H.
BUCH EINSLehrzeit
Die Schülerin des Imkers
1Zwei schäbige Gestalten
Wenn man Anzeichen wahren Intellekts außerhalb der eigenen Person entdeckt, fühlt man sich ein wenig wie Robinson Crusoe, als er den Abdruck eines menschlichen Fußes am Sandstrand seiner Insel fand.
Ich war fünfzehn, als ich Sherlock Holmes kennenlernte. Die Nase in ein Buch gesteckt, schlenderte ich durch die Sussex Downs und stolperte beinahe über ihn. Zu meiner Verteidigung muss ich erwähnen, dass mich das Buch ungemein fesselte. Und während des Kriegsjahres 1915 traf man in jenem besonderen Teil der Welt nur selten andere Leute. In meiner siebenwöchigen, der Lektüre geweihten Wanderschaft zwischen Schafen (die mir auswichen) und Stechginstersträuchern (die mich schmerzhaft zu instinktiver Vorsicht erzogen hatten) war ich nie zuvor auf ein menschliches Wesen gestoßen.
Das Buch, das ich an jenem kühlen, sonnigen Apriltag verschlang, stammte von Vergil. Im Morgengrauen hatte ich das stille Bauernhaus verlassen, einen anderen Weg genommen als üblich – nach Südosten, zum Meer – und stundenlang mit lateinischen Verben gerungen. Unbewusst kletterte ich über niedrige Mauern, ging geistesabwesend um Hecken herum, und das Meer hätte ich wahrscheinlich nur bemerkt, wäre ich versehentlich von einer Kalksteinklippe hineingestürzt.
Dass es noch eine andere Menschenseele im Universum gab, erkannte ich erst, als sich eine männliche Kehle vernehmlich räusperte, knapp vier Schritte von mir entfernt. Der lateinische Text fiel zu Boden, woraufhin ich leise fluchte. Klopfenden Herzens bot ich meine ganze Würde auf und starrte durch meine Brille auf die Gestalt hinab, die zu meinen Füßen kauerte: ein dünner, grauhaariger Mann über fünfzig, bekleidet mit einem alten Tweedmantel, einer Mütze und derben Schuhen. Ein fadenscheiniger Army-Rucksack lag neben ihm. Vermutlich ein Landstreicher, der den Rest seiner Habseligkeiten in einem Gebüsch verwahrte. Oder ein Exzentriker. Aber gewiss kein Schäfer.
Er schwieg. Mit trotziger Geste griff ich nach meinem Buch und wischte es ab. »Was machen Sie hier? Liegen Sie auf der Lauer?«
Da hob er eine Braue, schenkte mir ein herablassendes, irritierendes Lächeln und öffnete den Mund, um jenen gedehnten Ton anzuschlagen, der als Markenzeichen eines übermäßig gebildeten englischen Gentleman aus der Oberschicht gilt. Eine hohe, ätzende Stimme. Zweifellos ein Exzentriker. »Man kann mir wohl kaum vorwerfen, ich würde irgendwo ›liegen‹. Offenkundig sitze ich auf einem ganz gewöhnlichen Berghang und kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Das heißt, wenn ich keine Leute abwehren muss, die mich niedertrampeln wollen.« Mit übertrieben rollendem R versuchte er, mich in meine Schranken zu weisen.
Hätte er das nicht gesagt oder denselben Worten einen freundlicheren Klang verliehen, wäre ich mit einer brüsken Entschuldigung weitergegangen und mein Leben hätte einen anderen Lauf genommen. Aber er hatte unwissentlich einen wunden Punkt getroffen.
Um eine Begegnung mit meiner Tante zu vermeiden, war ich schon mit dem ersten Tageslicht aus dem Haus geflohen. Das beruhte auf einem heftigen Streit am vergangenen Abend, heraufbeschworen von der unleugbaren Tatsache, dass meine Füße schon zum zweiten Mal seit meiner Ankunft vor drei Monaten ihren Schuhen entwachsen waren. Meine Tante – klein, adrett, raffiniert, scharfzüngig, geistesgegenwärtig und ungeheuer stolz auf ihre zierlichen Hände und Füße – gab mir stets das Gefühl, ich wäre plump und unförmig. Deshalb entwickelte ich eine unvernünftige Empfindsamkeit, wann immer auf meine Körpergröße und riesigen Füße angespielt wurde. Es kam an diesem Abend aber noch schlimmer: Das Wortgefecht um finanzielle Probleme hatte sie gewonnen.
Die unschuldigen Worte des Mannes und sein keineswegs unschuldiges Gehabe entzündeten meinen schwelenden Zorn wie ein Benzinschwall. Kampflustig straffte ich die Schultern und reckte das Kinn. Ich hatte keine Ahnung, wer er sein mochte, wo ich stand, auf seinem oder meinem Land, ob er ein gefährlicher Irrer, ein entflohener Sträfling oder der Gutsherr war, und das alles kümmerte mich auch gar nicht. »Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Sir«, fauchte ich erbost.
Er ignorierte meine Wut, schien sie nicht einmal zu bemerken und musterte mich nur gelangweilt, so als wünschte er, ich würde endlich verschwinden. »Sie wollen wissen, was ich hier mache?«
»Genau.«
»Ich beobachte Bienen«, erwiderte er kurz angebunden und widmete sich wieder seinem Studium des Berghangs.
In seinem Verhalten ließ nichts auf jenen Wahnsinn schließen, der aus seinen Worten sprach. Trotzdem behielt ich ihn vorsichtig im Auge, als ich mein Buch in die Manteltasche schob und mich in sicherer Entfernung hinsetzte, um das Leben und Treiben zwischen den Blumen zu beobachten. Da waren tatsächlich Bienen, die emsig Pollen in die Körbchen an ihren Hinterbeinen stopften und von Blüte zu Blüte schwirrten.
Ich schaute zu und fand nichts Bemerkenswertes an diesen Insekten, bis ein eigentümliches Exemplar auftauchte. Es sah wie eine gewöhnliche Honigbiene aus, hatte aber einen kleinen roten Fleck am Rücken. Sonderbar – war es dieses Tier, das den Exzentriker interessierte? Ich sah ihn ins Leere starren, dann musterte ich die Bienen etwas gründlicher, gegen meinen Willen fasziniert. Wie ich bald herausfand, war dieser rote Fleck kein natürliches Phänomen, sondern aufgemalt. Denn ich entdeckte eine weitere Biene mit einem ähnlichen, etwas zur Seite gerutschten Punkt, dann noch eine und schließlich eine Biene, die außer ihrem roten auch einen erstaunlichen blauen Fleck aufwies. Zwei rot gefleckte flogen nach Nordwesten, die blau-rote füllte ihr Körbchen und entfernte sich dann in nordöstlicher Richtung.
Eine Zeit lang stellte ich Spekulationen an, dann stand ich auf, ging zum Berggipfel, jagte Mutterschafe und Lämmer auseinander, und als ich ein Dorf und einen Fluss erblickte, wusste ich sofort, wo ich war. Mein Haus lag knapp zwei Meilen entfernt. Reumütig schüttelte ich den Kopf über meine anfängliche Unaufmerksamkeit, dachte noch eine Weile über den Mann nach und stieg dann den Hang hinab, um mich zu verabschieden.
Er blickte nicht auf, also redete ich mit seinem Hinterkopf. »Halten Sie sich lieber an die blauen, wenn Sie einen neuen Bienenstock anlegen wollen. Diejenigen, die Sie rot markiert haben, stammen wahrscheinlich aus Mr. Warners Obstgarten. Die blauen kommen von weiter her und sind vermutlich wilde Bienen.«
Ich zog mein Buch hervor, und als ich ihm zum Abschied einen guten Tag wünschte, starrte er mich plötzlich an, einen Ausdruck in den Augen, der mir die Sprache verschlug – wahrlich keine geringe Leistung. Den Mund sperrangelweit geöffnet, glich er ein bisschen einem gestrandeten Fisch, und er starrte mich immer noch an, als wäre mir plötzlich ein zweiter Kopf gewachsen. Langsam erhob er sich. »Was haben Sie gesagt?«
»Verzeihen Sie – sind Sie schwerhörig?« Langsam und deutlich, mit erhobener Stimme, erklärte ich: »Wenn Sie einen neuen Bienenstock anlegen wollen, sollten Sie die blauen nehmen, weil die roten ganz sicher Tom Warner gehören.«
»Ich bin nicht schwerhörig, aber etwas verwundert mich. Wieso kennen Sie meine Pläne?«
»Das ist doch klar«, entgegnete ich ungeduldig, obwohl ich bereits in meinem zarten Alter festgestellt hatte, dass solche Dinge den meisten Leuten nicht klar waren. »Ich sehe Farbe auf Ihrem Taschentuch und Spuren an Ihren Fingern, die Sie abgewischt haben. Und nach meiner Ansicht markiert man Bienen nur mit Farbflecken, wenn man sie zu ihren Waben zurückverfolgen will. Entweder interessieren Sie sich für den Honig oder für die Bienen selbst. Aber um diese Jahreszeit erntet man keinen Honig. Bei einem ungewöhnlichen Kälteeinbruch vor drei Monaten wurden viele Bienenstöcke vernichtet. Deshalb nehme ich an, dass Sie es auf diese Bienen abgesehen haben, um Ihr eigenes Volk zu ergänzen.«
Das Gesicht, das mich musterte, glich nicht mehr einem Fisch, sondern erinnerte mich erstaunlicherweise an einen gefangenen Adler, den ich einmal in unnahbarer Glorie auf einer Stange hocken gesehen hatte. Kühl und verächtlich blickten die tief liegenden Augen auf mich, das minderwertige Wesen, herab. »O Gott!«, sagte er in ironischer Verwunderung. »Dieses Kind kann denken!«
Beim Studium der Bienen hatte mein Zorn etwas nachgelassen, aber er flammte erneut auf, als ich in so arrogantem Ton beleidigt wurde. Warum musste dieser hochgewachsene, dürre, entnervende alte Mann ein fremdes Mädchen provozieren, das ihm nichts getan hatte?
Wieder hob ich das Kinn. »O Gott! Dieses Kind kann ein anderes menschliches Wesen erkennen, obwohl es beinahe darüber gefallen wäre«, konterte ich und fügte noch hinzu: »Übrigens gewann ich im Laufe meiner Erziehung den Eindruck, alte Menschen hätten anständige Manieren.«
Ich trat zurück, um die Wirkung meiner verbalen Attacke zu beobachten. Und da brachte ich ihn endlich mit gewissen Gerüchten in Verbindung – und mit der Lektüre während meiner langwierigen Rekonvaleszenz. Nun wusste ich, wer er war, und das erschreckte mich.
Wie ich vielleicht erwähnen sollte, hatte ich schon immer vermutet, ein Großteil von Dr. Watsons Lobreden müsste der armseligen Phantasie dieses Gentlemans entsprungen sein. Jedenfalls dachte er stets, der Leser wäre genauso begriffsstutzig wie er selbst. Sehr ärgerlich. Trotzdem – hinter all dem Unsinn, den der Biograph von sich gegeben hatte, ragte die Gestalt eines wahren Genies empor, eine der Geistesgrößen jener Generationen. Eine Legende.
Kaltes Entsetzen packte mich. Da stand ich vor einer Legende, schleuderte ihr Beleidigungen an den Kopf, kläffte ihre Fußknöchel an wie ein Hündchen, das einen Bären zu reizen versucht. Ich unterdrückte das Bedürfnis, mich zu krümmen, und wartete auf die lässige Ohrfeige, die mich niederstrecken würde.
Aber zu meiner Verblüffung und Bestürzung erfolgte kein Gegenangriff. Er lächelte nur gönnerhaft und bückte sich, um seinen Rucksack zu ergreifen, in dem ich die Farbfläschchen leise klirren hörte. Dann richtete er sich wieder auf, schob die altmodische Mütze aus der Stirn und schaute mich mit müden Augen an. »Junger Mann, ich …«
»Junger Mann!« Das reichte nun endgültig. Heiße Wut durchströmte meine Adern. Zugegeben – ich besaß keinerlei weibliche Rundungen und trug praktische, also männliche Kleidung, aber diese Beleidigung war unerträglich. Legende hin, Angst her – das kläffende Schoßhündchen ging wieder zum Angriff über, mit der ganzen Verachtung, die nur ein pubertierendes Wesen aufbringen kann. Triumphierend umklammerte ich die Waffe, die er mir in die Hand gelegt hatte, und trat zurück, um zum Gnadenstoß auszuholen. »Junger Mann?«, wiederholte ich. »Nur gut, dass Sie bereits Ihren Ruhestand genießen – wenn das alles ist, was vom Gehirn des großen Detektivs übrig geblieben ist.« Ich griff nach dem Rand meiner überdimensionalen Mütze, und die blonden Zöpfe fielen auf meine Schultern.
Sein Gesicht spiegelte verschiedene Gefühle wider, reicher Lohn für meinen Sieg. Auf schlichtes Staunen folgte das schmerzliche Eingeständnis einer Niederlage. Und dann, während er an die gesamte Konversation zurückdachte, überraschte er mich. Seine Züge entspannten sich, die schmalen Lippen zuckten, unerwartete Fältchen kräuselten sich um die grauen Augen, dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte schallend.
Zum ersten Mal hörte ich Sherlock Holmes lachen. Und es war keineswegs das letzte Mal. Immer wieder verwunderte es mich, dieses stolze, asketische Gesicht in hilflosem Gelächter aufgelöst zu sehen. Seine Belustigung galt stets, zumindest meistens, seiner eigenen Person, und diese Situation bildete keine Ausnahme. Ich war völlig entwaffnet.
Schließlich zog er das Taschentuch aus seiner Manteltasche, das halb herausgehangen hatte und mir deshalb aufgefallen war, und wischte sich die Augen ab. Ein kleiner blauer Fleck verlagerte sich auf seinen kantigen Nasenrücken. Dann schaute er mich zum ersten Mal richtig an und wies auf die Blumen. »Sie verstehen also etwas von Bienen?«
»Nur ganz wenig«, gab ich zu.
»Aber Sie interessieren sich dafür?«
»Nein.«
Diesmal hob er beide Brauen. »Warum vertreten Sie dann einen so entschiedenen Standpunkt?«
»Soviel ich weiß, sind das geistlose Geschöpfe, im Grunde nur die Werkzeuge des Vorgangs, der Obst an den Bäumen wachsen lässt. Die Weibchen erledigen die ganze Arbeit, die Männchen – nun ja, die tun nicht viel. Und die Königin – die Einzige, die etwas darstellen könnte – wird zum Wohle des Bienenstocks dazu verdammt, ihre Tage als Eierlegemaschine zu verbringen. Außerdem …« – allmählich erwärmte ich mich für das Thema –, »was passiert, wenn eine andere Königin ankommt, mit der sie vielleicht einiges gemeinsam hat? Die beiden werden – zum Wohle des Bienenstocks – zu einem Kampf auf Leben und Tod gezwungen. Die Bienen arbeiten fleißig, das stimmt, aber übersteigt die Produktion eines gesamten Bienenlebens etwa die Honigmenge, die in einen winzigen Dessertlöffel passt? Die Bewohner eines Bienenstocks opfern regelmäßig einige hunderttausend Arbeitsstunden, damit man Honig auf den Toast streichen und Kerzenwachs produzieren kann, statt ihren Ausbeutern den Krieg zu erklären oder zu streiken, wie es jede vernünftige, von Selbstachtung erfüllte Rasse tun würde. Für meinen Geschmack gleichen die Bienen zu sehr der menschlichen Rasse.«
Während meiner Tirade hatte sich Mr. Holmes in die Hocke gesetzt, um ein blau gekennzeichnetes Insekt zu beobachten. Er sagte nichts; als ich verstummt war, streckte er einen langen, dünnen Finger aus und berührte den pelzigen Körper des Tierchens, ohne es zu irritieren. Zwischen uns herrschte Schweigen, bis die mit Blütenstaub bepackte Biene nach Nordosten flog – zum Wäldchen, das zwei Meilen entfernt lag. Daran zweifelte ich nicht.
Er sah sie davonschwirren und murmelte vor sich hin: »Ja, sie ähneln dem homo sapiens. Vielleicht interessieren sie mich gerade deshalb.«
»Ich weiß nicht, wie klug Sie den Durchschnitt der homines finden, aber ich halte diese Klassifizierung für eine optimistische Fehlbezeichnung.« Nun befand ich mich auf vertrautem Terrain, wo es um Intellekt und Anschauungen ging, auf einem geliebten Terrain, das ich monatelang nicht betreten hatte. Einige dieser Ansichten stammten zwar von einem unausstehlichen Backfisch, ließen sich aber nichtsdestoweniger leicht verteidigen.
Zu meiner Freude antwortete er. »Reden Sie vom homo im Allgemeinen oder einfach nur vom vir?«, fragte er so ernsthaft, dass ich argwöhnte, er würde mich insgeheim auslachen. Nun, wenigstens hatte ich ihm eine gewisse Subtilität beigebracht.
»O nein, ich bin zwar Feministin, aber keine Männerhasserin, im Großen und Ganzen ein Misanthrop – so wie Sie vermutlich auch, Sir. Aber im Gegensatz zu Ihnen betrachte ich die Frauen als die etwas rationalere Hälfte der Menschheit.«
Wieder lachte er, etwas dezenter als zuvor, und ich merkte, dass ich ihn zu provozieren versucht hatte. »Junge Dame …« Das zweite Wort betonte er mit sanfter Ironie. »Es ist Ihnen gelungen, mich zweimal an einem einzigen Tag zu amüsieren, was schon lange niemand mehr geschafft hat. Um mich zu revanchieren, kann ich nicht allzu viel Humor aufbieten, aber wenn Sie mich nach Hause begleiten möchten, würde ich Sie wenigstens zu einer Tasse Tee einladen.«
»Es wäre mir ein Vergnügen, Mr. Holmes.«
»Ah, Sie sind mir gegenüber im Vorteil. Offensichtlich kennen Sie meinen Namen, und leider ist niemand anwesend, den ich bitten könnte, mich mit Ihnen bekannt zu machen.« Diese förmlichen Worte klangen etwas lächerlich angesichts zweier schäbig gekleideter Gestalten, die einander auf einem ansonsten menschenleeren Berghang gegenüberstanden.
»Ich bin Mary Russell«, verkündete ich und streckte meine Finger aus, die er mit seinen dünnen, trockenen umfasste. Wir schüttelten uns die Hände, als würden wir einen Friedenspakt schließen, was wahrscheinlich auch der Fall war.
»Mary …« Er ließ den Namen auf der Zunge zergehen und sprach ihn auf irische Weise aus, indem sein Mund die erste lange Silbe fast zärtlich dehnte. »Ein geeigneter orthodoxer Name für ein passives Mädchen.«
»Ich glaube, ich wurde nach Magdalena benannt, nicht nach der Heiligen Jungfrau.«
»Nun, das erklärt alles. Gehen wir, Miss Russell? Meine Haushälterin hat sicher etwas vorrätig, das sie uns servieren kann.«
Eine lange Wanderung führte uns durch die Downs, fast vier Meilen weit. Wir schnitten verschiedene Themen an und sprachen etwas ausführlicher über die Bienenzucht. Auf der Spitze eines kleinen Hügels gestikulierte Mr. Holmes lebhaft, während er die Verwaltung eines Bienenstocks mit Machiavellis Regierungstheorien verglich. Kühe rannten schnaubend davon. Mitten in einem seichten Bach blieb er stehen, um seine Theorie zu illustrieren, indem er das Schwärmen der Bienenvölker mit den wirtschaftlichen Kriegsursachen gleichsetzte und als Beispiele die deutsche Invasion in Frankreich sowie den eingefleischten Patriotismus der Engländer anführte. Den Höhepunkt seiner Rede erreichte er auf einem Gipfel, an dessen anderer Seite er so schnell bergab stürmte, dass er einem flatternden Vogel glich.
Er drehte sich zu mir um, bemerkte meinen steifen Gang, mein Unvermögen, mit ihm Schritt zu halten, sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinn. Und so drosselte er seinen manischen Redefluss ein wenig.
Seine Phantasieflüge schienen auf einer gesunden, praktischen Grundlage zu beruhen, und wie sich herausstellte, hatte er sogar ein Buch über die Imkerei geschrieben, betitelt: »Praktisches Handbuch der Bienenzucht«. Es werde in einschlägigen Kreisen anerkannt, betonte er voller Stolz (und das aus dem Mund eines Mannes, der es, wie ich mich erinnerte, respektvoll abgelehnt hatte, sich von der mittlerweile verblichenen Königin zum Ritter schlagen zu lassen). Seine experimentellen, aber schon jetzt erfolgreichen Neuordnungen im Bienenstock, den er königlichen Hof nannte, hatten den provokanten Untertitel des Werks verursacht: »Mit einigen Kommentaren über die Zellteilung der Königin«.
Wir gingen dahin, er redete, und unter der Sonne und seinem besänftigenden, wenn auch zeitweise unverständlichen Monolog begann sich meine harte innere Verkrampfung zu lösen. Ein Bedürfnis, das ich abgetötet zu haben glaubte, erwachte vorsichtig zu neuem Leben. Als wir sein Cottage erreichten, kam es mir so vor, als würden wir uns schon seit einer Ewigkeit kennen.
Weitere, handfestere Regungen meldeten sich in wachsender Beharrlichkeit. Während der letzten Monate hatte ich gelernt, Hungergefühle zu ignorieren. Aber nach einem langen Tag in frischer Luft und einem einzigen Sandwich am Morgen fällt es einer gesunden jungen Person schwer, sich auf irgendetwas anderes als den Gedanken ans Essen zu konzentrieren. Ich hoffte auf substanzielles Beiwerk zum Tee und überlegte, wie ich dergleichen vorschlagen könnte, sollte es nicht sofort angeboten werden.
Die Haushälterin erschien an der Tür, und vorerst vergaß ich mein Problem, denn es war die leidgeprüfte Mrs. Hudson, die ich stets für die am sträflichsten unterschätzte Gestalt in Dr. Watsons Geschichten gehalten hatte. Ebenfalls ein Beispiel für das beschränkte Denkvermögen dieses Mannes, seine Unfähigkeit, ein Juwel zu erkennen, wenn es nicht in glänzendes Gold gefasst war.
Die liebe Mrs. Hudson sollte mir eine gute Freundin werden. Schon bei der ersten Begegnung bewies sie ihre unerschütterliche Fähigkeit, alle Situationen richtig einzuschätzen. Sie sah sofort, was ihrem Arbeitgeber entging, nämlich meinen verzweifelten Hunger, und leerte ihre Vorratskammer, um meinen unbändigen Appetit zu befriedigen.
Mr. Holmes protestierte, als sie eine Platte nach der anderen herbeitrug – Brot und Käse, Chutneys und Kuchen. Aber dann beobachtete er nachdenklich, wie ich von allen Speisen riesige Portionen auf meinen Teller häufte.
Ich war ihm dankbar, weil er keine Bemerkungen über meinen Hunger machte und mich nicht in Verlegenheit stürzte, was meine Tante sicher getan hätte. Im Gegenteil, er bemühte sich, zumindest scheinbar, mit mir mitzuhalten. Als ich mich zurücklehnte, die dritte Tasse Tee in der Hand, den Bauch befriedigt wie seit vielen Wochen nicht mehr, behandelte er mich immer noch respektvoll. Von sichtlicher Genugtuung erfüllt, räumte Mrs. Hudson den Tisch ab.
»Vielen Dank, Madam«, sagte ich.
»Oh, es gefällt mir, wenn meine Kochkunst gewürdigt wird«, erwiderte sie, ohne Mr. Holmes anzuschauen. »Nur selten finde ich eine Gelegenheit, jemanden zu verwöhnen – es sei denn, Dr. Watson kommt zu Besuch. Dieser da …« Sie neigte den Kopf in die Richtung des Mannes, der mir gegenübersaß und eine Pfeife aus der Brusttasche seines Jacketts holte. »Er isst so wenig, dass eine Katze dran verhungern würde, und er weiß meine Bemühungen wirklich nicht zu schätzen.«
»Aber Mrs. Hudson!«, verteidigte er sich in sanftem Ton, was auf eine langjährige Debatte schließen ließ. »Ich esse, wie ich es immer getan habe. Und Sie pflegen so reichlich zu kochen, als müssten Sie einen Haushalt von zehn Personen verköstigen.«
»Eine Katze würde verhungern«, wiederholte sie energisch. »Aber wie ich erfreut feststelle, haben Sie heute etwas gegessen. Wenn Sie fertig sind, möchte Will ein Wörtchen mit Ihnen reden, bevor er geht. Es hat irgendwas mit der hinteren Hecke zu tun.«
»Die hintere Hecke ist mir egal«, klagte er. »Ich bezahle ihm eine ganze Menge, damit er sich über die Hecken und die Büsche und alles andere aufregt.«
»Jedenfalls muss er mit Ihnen reden.« Energische Wiederholungen waren anscheinend ihre bevorzugte Methode im Umgang mit Mr. Holmes.
»Oh, verdammt! Warum habe ich London je verlassen? Ich hätte meine Bienenstöcke in einen Schrebergarten stellen und in der Baker Street bleiben sollen. Schauen Sie sich meine Bibliothek an, Miss Russell, ich bin gleich wieder da.« Er packte seinen Tabaksbeutel und Streichhölzer und stapfte hinaus, Mrs. Hudson verdrehte die Augen, verschwand in der Küche, ich blieb allein in dem stillen Zimmer zurück.
Sherlock Holmes’ Haus war ein typisches altersloses Sussex-Cottage mit Steinmauern und rotem Ziegeldach. Das Wohnzimmer im Erdgeschoss, ursprünglich zwei Räume, bildete jetzt ein großes Quadrat mit riesigem steinernem Kamin, hohen dunklen Deckenbalken und einem Bretterboden aus Eichenholz, der bei der Küchentür in Schieferplatten überging.
An der Südseite boten erstaunlich große Fenster einen Ausblick auf das Hügelland, das zum Meer hin abfiel. Ein Sofa, zwei Ohrensessel und ein ausgefranster Korbstuhl standen vor dem Kamin, ein runder Tisch und vier Stühle im sonnigen Erker, wo ich saß. Auf einem Schreibtisch am bleiverglasten Westfenster mit den rautenförmigen Scheiben häuften sich Papiere und diverse Gegenstände – ein Raum, der vielen Zwecken diente. Bücherregale und Schränke verdeckten die Wände.
An diesem Tag interessierte mich mein Gastgeber mehr als seine Bücher, und so studierte ich einzelne Buchtitel (Die Plattwürmer auf Borneo steckten zwischen den Gedanken Goethes und Verbrechen aus Leidenschaft im Italien des achtzehnten Jahrhunderts) eher aus Neugier auf seinen Charakter als in der Absicht, mir etwas auszuleihen. Ich unternahm einen Rundgang durch das Zimmer.
Lächelnd entdeckte ich Tabakkrümel in einem Pantoffel vor dem Kamin. Eine kleine Kiste auf einem Tisch zeigte den mit einer Schablone gemalten Schriftzug LIMÓNES DE ESPAÑA und enthielt mehrere auseinandergenommene Revolver. Auf einem anderen Tisch lagen drei fast identische Taschenuhren in penibler Anordnung nebeneinander, die Ketten in parallelen Linien, ein Vergrößerungsglas, mehrere Tastzirkel und ein Schreibblock mit einer Zahlenkolonne am Rand. Schließlich blieb ich vor dem Schreibtisch stehen.
Ich konnte nur einen flüchtigen Blick auf die Notizen in säuberlicher Handschrift werfen, ehe mich seine Stimme von der Tür her aufschreckte. »Setzen wir uns auf die Terrasse?«
Hastig legte ich das Schriftstück aus der Hand, das ich betrachtet hatte. Offenbar handelte es sich um einen Diskurs über sieben Formeln von Gipszusammensetzungen und ihre relative Eignung für die Abnahme von Autoreifenspuren auf verschiedenartigem Erdboden. Dann erklärte ich, im Garten sei es sicher sehr angenehm. Wir nahmen unsere Tassen, aber als ich ihm zur Glastür folgte, erregte ein merkwürdiger, an der Südwand befestigter Gegenstand meine Aufmerksamkeit: Ein hoher Kasten, nur wenige Zentimeter breit, aber fast einen Meter hoch, ragte gut fünfundvierzig Zentimeter ins Zimmer. Er sah wie ein Holzblock aus, aber als ich innehielt, entdeckte ich zu beiden Seiten Schiebetüren.
»Mein Observationsbienenstock«, erläuterte Mr. Holmes.
»Bienen!«, rief ich. »Im Haus?«
Statt zu antworten, griff er an mir vorbei, öffnete eine Schiebetür und enthüllte einen perfekten schmalen Bienenstock mit einer Glasscheibe an der Vorderseite. Fasziniert hockte ich mich davor. Die dicke Wabe, die sich oben und unten verjüngte, wurde von einer Schicht in Orange, Gelb und Schwarz überzogen. Sie vibrierte vor Energie, obwohl die einzelnen Insekten ziellos umherzuschwirren schienen.
Konzentriert versuchte ich, ein System in den scheinbar unsinnigen Bewegungen zu erkennen. Am Boden führte eine Glasröhre ins Gehäuse, durch die Bienen, mit Pollen beladen, hereinflogen und, von ihrer Bürde befreit, hinaussurrten. Dunst benebelte eine kleine Röhre oben an der Decke, und ich nahm an, dass sie der Belüftung diente.
»Sehen Sie die Königin?«, fragte Mr. Holmes.
»Ist sie da? Vielleicht finde ich sie.« Die Königin musste die größte Biene sein, und wie ich wusste, wurde sie – wohin immer sie sich wandte – von einem kriecherischen Gefolge begleitet. Trotzdem brauchte ich beschämend lange, um sie inmitten ihrer etwa dreihundert Töchter und Söhne aufzuspüren. Warum hatte ich sie nicht sofort entdeckt? Doppelt so groß wie die Übrigen, beflügelt von einer stupiden, aber temperamentvollen Zielstrebigkeit, schien sie einer anderen Rasse anzugehören als ihre Gefährten. Ich stellte dem Züchter ein paar Fragen. Wehrten sie sich gegen das Licht? Blieb ihre Anzahl stets gleich, so wie in größeren Bienenstöcken? Dann zog er die Schiebetür wieder vor das lebende Gemälde, und wir gingen hinaus. Zu spät fiel mir ein, dass ich kein Interesse an Bienen hatte.
Durch die Glastür erreichten wir eine breite Terrasse mit Fliesenboden, von einem gläsernen, an die Küche angebauten Wintergarten und Staudenrabatten an den drei restlichen Seiten gegen den Wind abgeschirmt. Hier flimmerte die Luft vor Hitze, und ich atmete erleichtert auf, als Mr. Holmes die Stufen hinabstieg und einige bequeme Sessel im Schatten einer riesigen Rotbuche ansteuerte.
Ich wählte einen Platz mit Aussicht auf den Ärmelkanal und schaute über einen kleinen Obstgarten hinweg, der in einer Senke lag. Zwischen den Bäumen erhoben sich Bienenstöcke, und die Insekten bearbeiteten fleißig die ersten Blüten der Staudenrabatten, die von Mauern geschützt wurden. Ein Vogel sang. Auf der anderen Seite eines steinernen Walls erklangen zwei Männerstimmen und verhallten wieder. Geschirr klapperte in der Küche. Am Horizont erschien ein kleines Fischerboot und glitt langsam auf uns zu.
Plötzlich merkte ich, dass ich meine Konversationspflicht vernachlässigte, stellte die Tasse mit dem erkalteten Tee von der Armstütze meines Sessels auf den Tisch und wandte mich an den Hausherrn. »Ist das Ihr Werk?« Ich zeigte in den Garten.
Ich wusste nicht, ob die Ironie seines Lächelns der Skepsis meines Tonfalls galt oder den gesellschaftlichen Zwängen, die mich bewogen, das Schweigen zu brechen. »Nein, was Sie hier sehen, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Mrs. Hudson und dem alten Will Thompson, dem einstigen Obergärtner des Gutsherrnhauses. Als ich hierher übersiedelte, fand ich eine Zeit lang Gefallen an der Gärtnerei, aber meine übrigen Tätigkeiten nehmen mich zu sehr in Anspruch. Manchmal muss ich für mehrere Tage verreisen, und bei meiner Rückkehr möchte ich keine verdorrten oder von Unkraut überwucherten Beete vorfinden. Nun, Mrs. Hudson genießt die Gartenarbeit, und so hat sie eine andere Beschäftigung, als mir ständig in den Ohren zu liegen und zu fordern, ich müsse ihre Küchenkreationen verspeisen. Ich finde es erholsam, hier zu sitzen und nachzudenken. Außerdem ernährt der Garten meine Bienen. Die meisten Blumen wurden mit Rücksicht auf die Qualität des Honigs ausgewählt, der produziert werden soll.«
»Ja, hier ist es wirklich hübsch. Diese Umgebung erinnert mich an einen Garten, in dem ich als Kind gespielt habe.«
»Erzählen Sie mir von sich, Miss Russell.«
Ich wollte die obligate Antwort geben, mich ein bisschen zieren und dann widerstrebend einen nichtssagenden Lebenslauf herunterrasseln. Doch seine höfliche Gleichgültigkeit hielt mich zurück. Und so grinste ich ihn an. »Warum erzählen Sie mir nichts über mich, Mr. Holmes?«
»Aha, eine Herausforderung?« Jetzt leuchtete Interesse in seinen Augen auf.
»Genau.«
»Also gut, unter zwei Bedingungen. Erstens, Sie verzeihen mir, wenn sich mein altes, abgenutztes Gehirn nur langsam bewegt und immer wieder knarrt, denn die Gedankengänge, die früher mein Leben prägten, rosten ohne ständigen Gebrauch ein. Der Alltag mit Mrs. Hudson und Will ist ein schlechter Wetzstein für einen scharfen Geist.«
»Ich bezweifle, dass Sie Ihr Gehirn zu wenig strapazieren, aber mit dieser Bedingung bin ich einverstanden. Und die zweite?«
»Dass Sie mir was über mich erzählen, wenn ich fertig bin.«
»Wie Sie wollen. Ich werde mich bemühen, selbst wenn ich mich dadurch der Lächerlichkeit preisgebe.« Vielleicht war ich seiner spitzen Zunge doch noch nicht entronnen.
»Wunderbar.« Er rieb sich die dürren trockenen Hände, und plötzlich wurde ich von den forschenden Augen eines Insektenkundlers fixiert. »Vor mir sitzt eine gewisse Mary Russell, nach ihrer Großmutter väterlicherseits benannt.«
Verblüfft zuckte ich zusammen, dann betastete ich das antike Medaillon mit den eingravierten Initialen M.N.R., das zwischen zwei meiner Hemdknöpfe hervorgeglitten war, und nickte.
»Sie ist – mal sehen – sechzehn? Oder fünfzehn? Ja, ich glaube, fünfzehn. Und trotz ihrer Jugend und obwohl sie nicht zur Schule geht, beabsichtigt sie, die Aufnahmeprüfung an der Universität zu bestehen.« Ich berührte das Buch in meiner Tasche und nickte anerkennend. »Offensichtlich ist sie Linkshänderin, ein Elternteil war jüdisch – die Mutter, vermute ich? Ja, eindeutig die Mutter – und sie beherrscht die hebräische Sprache. Im Augenblick ist sie etwa zehn Zentimeter kleiner als ihr amerikanischer Vater – das war doch sein Anzug? Stimmt bis jetzt alles?«, fragte er selbstgefällig.
Meine Gedanken überschlugen sich. »Wie kommen Sie auf Hebräisch?«
»Die Tintenflecken an Ihren Fingern können nur entstehen, wenn Sie von rechts nach links schreiben.«
»Natürlich.« Ich betrachtete die dunklen Spuren in der Nähe meines linken Daumennagels. »Sehr eindrucksvoll.«
Lässig winkte er ab. »Gesellschaftsspiele … aber die Akzente sind nicht uninteressant.« Er musterte mich wieder, dann lehnte er sich in seinem Sessel zurück, die Ellbogen auf den Armstützen, legte die Fingerspitzen aneinander und berührte damit seine Lippen. Langsam schloss er die Augen, dann sprach er weiter. »Die Akzente … Vor einiger Zeit kam Mary Russell aus dem Vaterhaus in den westlichen Vereinigten Staaten hierher, wahrscheinlich aus dem nördlichen Kalifornien. Die Generation vor ihrer Mutter lebte bei den Cockney-Juden, Miss Russell selbst wuchs am südwestlichen Stadtrand von London auf. Ich würde sagen, sie zog innerhalb der letzten zwei Jahre nach Kalifornien. Sprechen Sie bitte das Wort ›Märtyrer‹ aus«, verlangte er, und ich gehorchte. »Ja, zwei Jahre. Irgendwann zwischen jenem Zeitpunkt und Dezember starben beide Eltern, vermutlich bei demselben Unfall, in den Miss Russell im letzten September oder Oktober verwickelt war und der Narben an ihrem Hals, der Kopfhaut und der rechten Hand hinterließ, außerdem eine bleibende Schwäche in dieser Hand und ein etwas steifes linkes Knie.«
Das Spiel war nicht mehr amüsant. Wie erstarrt saß ich da, und mein Herz drohte stehen zu bleiben, während ich der kühlen, trockenen Stimme lauschte.
»Nach der Genesung wurde sie zur Familie ihrer Mutter zurückgeschickt, zu einer knauserigen, gefühllosen Verwandten, die ihr weniger zu essen gibt, als es den Bedürfnissen entspräche. Diese letzte Beobachtung«, fügte er in beiläufigem Ton hinzu, »ist zugegebenermaßen nur eine Vermutung, aber eine nützliche Arbeitshypothese, die erklärt, warum der kräftige Knochenbau von so wenig Fleisch umhüllt wird und warum sie am Tisch eines Fremden etwas mehr konsumiert, als sie es wagen würde, wenn sie sich streng an ihre offensichtlich guten Manieren hielte.« Er öffnete die Augen und sah in mein Gesicht. »Ach, du meine Güte!« Der Klang seiner Stimme verriet eine seltsame Mischung aus Mitleid und Ärger. »Schon oft wurde ich vor meinen allzu gründlichen Analysen gewarnt. Verzeihen Sie, wenn ich Sie deprimiert habe.«
Statt einer Antwort schüttelte ich nur den Kopf. Es fiel mir schwer zu sprechen, meine Kehle war wie zugeschnürt. Mr. Holmes erhob sich und ging ins Haus, wo er ein paar unverständliche Worte mit seiner Haushälterin wechselte, ehe er mit einem Tablett zurückkehrte, auf dem zwei Gläser und eine geöffnete Weißweinflasche standen. Er schenkte ein, reichte mir ein Glas und erklärte, dies sei Honigwein – natürlich sein eigener. Dann setzte er sich wieder, und wir nippten an dem duftenden Getränk. Ich entspannte mich wieder, holte tief Luft und warf meinem Gastgeber einen kurzen Blick zu. »Vor zweihundert Jahren wären Sie verbrannt worden.« Mein Bemühen um trockenen Humor verlief nicht besonders erfolgreich.
»Das hat man mir schon mehrmals gesagt, aber irgendwie kann ich mich nicht in der Rolle eines Hexers sehen, der über einem dampfenden Gebräu hockt und absonderliche Sprüche raunt.«
»Eigentlich fordert das Buch von Leviticus keine Verbrennung, sondern die Steinigung von Männern oder Frauen, die mit Geistern reden. Ein ow, ein Geisterbeschwörer oder Medium, oder ein jidoni, abgeleitet vom Verb ›wissen‹, ist eine Person, die ihre Kenntnisse und ihre Macht nicht durch die Gnade des Gottes Israel bezieht, sondern über Zauberkräfte verfügt.« Meine Stimme erstarb, als ich merkte, dass er mich mit jenem Entsetzen betrachtete, das man normalerweise für redselige Fremde in Eisenbahnabteilen oder Bekannte mit unbegreiflichen und ermüdenden Leidenschaften reserviert. Meine kurze Ansprache war eine automatische Reaktion gewesen, ausgelöst durch die theologische Wende, die unsere Diskussion genommen hatte.
Mit einem schwachen Lächeln versuchte ich, ihn zu beruhigen. Er räusperte sich. »Äh – soll ich zum Ende kommen?«, fragte er.
»Wie Sie wünschen«, entgegnete ich beklommen.
»Die Eltern der jungen Dame waren relativ gut situiert. Und das Erbe der Tochter, verbunden mit ihrem entmutigenden Intellekt, verwehrt es jener knickerigen Verwandten, sie an die Kandare zu nehmen. Also wandert Miss Russell ohne Anstandsdame stundenlang durchs Hügelland und geht erst spätabends heim.«
Er schien sich dem Ende zu nähern, und so ordnete ich meine konfusen Gedanken. »Sie haben völlig recht, Mr. Holmes. Mein Erbe verleiht mir eine gewisse Macht, und ich verhalte mich nicht so, wie es eine junge Dame nach Ansicht meiner Tante sollte. Weil sie den Schlüssel zur Speisekammer verwahrt und meinen Gehorsam mit Essen zu erkaufen versucht, spaziere ich manchmal hungrig durch dieses Hügelland. Aber Ihre Analyse weist zwei geringfügige Fehler auf.«
»Oh?«
»Erstens kam ich nicht nach Sussex, um bei meiner Tante zu wohnen. Das Haus und die Farm gehörten meiner Mutter. Hier verbrachten wir die Sommermonate, als ich noch klein war – und diese Zeit zählt zu den glücklichsten meines Lebens. Als ich aus Amerika nach England zurückgeschickt wurde, stellte ich die Bedingung, wir müssten hierherziehen, sonst würde ich meine Tante nicht als Vormund akzeptieren. Sie besaß kein eigenes Haus, und so stimmte sie widerstrebend zu. Obwohl sie meine Finanzen noch weitere sechs Jahre lang kontrollieren wird, lebt sie genau genommen bei mir, und ich wohne demzufolge nicht unter ihrem Dach.« Einem anderen Zuhörer wäre der Abscheu vielleicht entgangen, der in meinen Worten mitschwang, aber nicht Mr. Holmes. Hastig wechselte ich das Thema, ehe ich noch mehr von meinem Seelenleid verriet. »Zweitens – ich habe genau berechnet, wann ich mich von Ihnen verabschieden muss, um vor Einbruch der Dunkelheit daheim einzutreffen. Also ist der späte Zeitpunkt nicht relevant. Bald muss ich aufbrechen, denn in zwei Stunden wird es dunkel sein, und mein Haus liegt zwei Meilen nördlich von der Stelle, wo wir uns trafen.«
»Nehmen Sie sich nur Zeit für Ihren Beitrag zu unserem Abkommen, Miss Russell«, entgegnete er ruhig und erlaubte mir, das vorangegangene Thema ad acta zu legen. »Einer meiner Nachbarn frönt seiner Leidenschaft für Automobile, indem er einen Taxiservice betreibt, wie er dieses Unternehmen beharrlich nennt. Mrs. Hudson hat ihn bereits gebeten, Sie nach Hause zu fahren. Bis zu seiner Ankunft können Sie sich eine Stunde und fünfzehn Minuten ausruhen, dann wird er Sie in die Arme Ihrer lieben Tante befördern.«
Unbehaglich blickte ich zu Boden. »Mr. Holmes, leider kann ich mir einen solchen Luxus nicht leisten. Mein Taschengeld für diese Woche habe ich bereits für den Vergil ausgegeben.«
»Ich verfüge über ein beträchtliches Vermögen, Miss Russell, und finde nur selten Gelegenheit, Geld auszugeben. Bitte, gestatten Sie mir diese kleine Extravaganz.«
»Unmöglich!«
Als er in mein Gesicht schaute, gab er nach. »Also gut, dann schlage ich einen Kompromiss vor. Ich übernehme die Kosten für diese Fahrt und alle weiteren ähnlichen Aktionen, aber nur auf Leihbasis. Ich vermute, Ihr künftiges Erbe wird ausreichen, um die Schulden zu decken.«
»O ja.« Ich musste lachen, denn ich erinnerte mich lebhaft an die Szene in der Anwaltskanzlei, wo sich die Augen meiner Tante vor Habgier verdunkelt hatten. »Das ist kein Problem.«
Er warf mir einen scharfen Blick zu, dann begann er, zögernd und vorsichtig zu sprechen: »Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische, aber ich neige zu eher skeptischen Ansichten, was die menschliche Natur betrifft. Dürfte ich nach Ihrem Testament fragen?« Ein Gedankenleser mit einem unfehlbaren Gespür für die grundlegenden Dinge des Lebens. Grimmig lächelte ich ihn an.
»Im Fall meines Todes würde meine Tante nur ein angemessenes Jahreseinkommen beziehen, kaum mehr, als sie jetzt erhält.«
Nun schien er erleichtert aufzuatmen. »Ich verstehe. Und jetzt zu dem Kredit, den ich Ihnen anbiete. Ihre Füße werden es Ihnen verübeln, wenn Sie darauf bestehen, in diesen Schuhen nach Hause zu gehen. Benutzen Sie wenigstens heute das Taxi. Wenn Sie es wünschen, werde ich Ihnen sogar Zinsen berechnen.«
In dieser ironischen Offerte schwang ein seltsamer Unterton mit, der aus dem Mund einer anderen, weniger selbstsicheren Person wie eine Bitte geklungen haben mochte. Wir saßen am frühen Abend im stillen Garten, musterten einander, und schließlich kam es mir so vor, als hätte er in dem kläffenden Hündchen eine annehmbare Gefährtin gefunden. Vielleicht las ich in seinen Zügen sogar die Anfänge einer gewissen Zuneigung, und weiß Gott, die Begegnung mit einem so hellwachen, von Vorurteilen völlig unbelasteten Geist wie seinem gefiel auch mir.
Welch ein sonderbares Paar gaben wir ab – ein schlaksiges, bebrilltes Mädchen und ein hochgewachsener, sardonischer Einsiedler, beide gesegnet oder gestraft mit einem messerscharfen, brillanten Intellekt, der alle Leute bis auf die hartnäckigsten Gemüter in die Flucht schlug. Der Gedanke, ich könnte sein Haus nie wieder besuchen, kam mir gar nicht in den Sinn.
Bereitwillig nahm ich das versteckte Angebot seiner Freundschaft an. »Wenn man täglich drei oder vier Stunden auf der Wanderschaft ist, findet man wenig Zeit für andere Dinge. Also möchte ich Ihre Leihgabe dankend akzeptieren. Soll Mrs. Hudson Buch führen?«
»Im Gegensatz zu mir weiß sie peinlich genau mit Zahlen umzugehen. Trinken Sie noch ein Glas Wein und erzählen Sie mir etwas über Sherlock Holmes.«
»Mit mir sind Sie also fertig?«
»Abgesehen von den offensichtlichen Dingen – Ihre Schuhe, Ihre Lektüre zu später Stunde bei unzureichendem Licht sowie die Tatsachen, dass sich Ihre schlechten Gewohnheiten in Grenzen halten und dass Ihr Vater zwar rauchte, aber im Unterschied zu den meisten Amerikanern Wert auf Kleidung von guter Qualität legte – will ich es vorerst dabei bewenden lassen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Aber bedenken Sie, ich will Ihre Meinung hören, also ersparen Sie mir die Informationen, die Sie von meinem enthusiastischen Freund Watson erhalten haben.«
»Nun, ich werde versuchen, auf seine treffsicheren Beobachtungen zu verzichten«, erwiderte ich trocken, »wenn ich mich auch frage, ob es nicht ein zweischneidiges Schwert war, die Storys zu benutzen, um Ihre Biographie zu schreiben. Die Illustrationen können den Betrachter gewiss täuschen. Darauf wirken Sie beträchtlich älter. Ich kann das Alter eines Menschen nicht besonders gut schätzen, aber so, wie Sie aussehen, müssten Sie erst fünfzig sein. Oh, tut mir leid. Manche Leute reden nicht gern über ihr Alter.«
»Ich bin jetzt vierundfünfzig. Conan Doyle und seine Komplizen vom Strand Magazine dachten, ich würde einen würdigeren Eindruck erwecken, wenn sie mich älter machten. Jugend flößt kein Vertrauen ein, was ich zu meinem nicht geringen Ärger feststellte, als ich in die Baker Street zog. Ich war noch nicht einundzwanzig, und zunächst übertrug man mir nur wenige Fälle. Übrigens hoffe ich, Sie werden keine Vermutungen anstellen. Das wäre eine Schwäche, durch Trägheit hervorgerufen, und man sollte es niemals mit Intuition verwechseln.«
»Dann will ich’s vermeiden.« Ich nahm einen Schluck Wein und überlegte, was ich in seinem Wohnzimmer gesehen hatte. Sorgfältig wählte ich meine Worte. »Also, fangen wir an. Sie entstammen einer wohlhabenden Familie, aber Ihre Beziehung zu den Eltern war keineswegs erfreulich. Bis zum heutigen Tag denken Sie über die beiden nach und versuchen jenen Teil Ihrer Vergangenheit zu bewältigen.« Als er eine Braue hob, erklärte ich: »Deshalb verwahren Sie Ihr offizielles Familienfoto in einem Regal nahe Ihrem Sessel, von Büchern fast verdeckt, statt es ganz offen an die Wand zu hängen und Ihre Eltern zu vergessen.«
Oh, wie es mich beglückte, seine anerkennende Miene zu beobachten, sein gemurmeltes Lob zu hören: »Sehr gut, wirklich sehr gut.« Es war wie eine Heimkehr.
»Aus diesem Grund sprachen Sie mit Dr. Watson nie über Ihre Kindheit, denn einem Mann von so eindeutig normaler Herkunft wäre es zweifellos schwergefallen, die besonderen Belastungen eines einzigartigen Talents zu verstehen. Aber ich möchte mich nicht seiner Ausdrucksweise bedienen, deshalb lassen wir diesen Punkt nicht gelten. Ich möchte nicht indiskret sein – aber ich glaube, durch die Probleme mit den Eltern wurde Ihr Entschluss gefördert, sich von Frauen fernzuhalten. Wenn sich ein Mann wie Sie mit einer Frau einlässt, muss diese Beziehung alles einschließen, sämtliche Bereiche in ihrem und seinem Leben, anders als Ihre unausgewogene, etwas schrullige Partnerschaft mit Dr. Watson.«
Sein Gesichtsausdruck war unbeschreiblich, schwankte zwischen Amüsement, beleidigtem Stolz und Ärger. Schließlich entschied ich mich für Skepsis, fühlte mich bezüglich der beiläufigen Kränkungen, die er mir zugefügt hatte, wesentlich besser und fuhr fort: »Ich möchte mich nicht in Ihr Privatleben einmischen. Aber man muss berücksichtigen, welche Beiträge die Vergangenheit zur Gegenwart leistet. Sie haben sich hier in die Einsamkeit zurückgezogen, um der Gesellschaft von Leuten zu entrinnen, die einen minderwertigen Verstand besitzen und einfach nichts begreifen können, weil sie nicht dafür geschaffen sind. Vor zwölf Jahren traten Sie erstaunlich früh in den Ruhestand, allem Anschein nach, um die Perfektion und Einzigartigkeit der Bienen zu studieren und an Ihrem großen Opus über detektivische Methoden zu arbeiten. Wie ich dem Bücherregal neben Ihrem Schreibtisch entnehme, haben Sie bisher sieben Bände vollendet, und darunter stehen Schachteln voller Notizen und weisen auf eine ähnliche Anzahl hin, die das Werk abschließen sollen.«
Er nickte und goss uns beiden noch etwas Wein ein. Die Flasche war fast leer.
»Aber aus dem Material, das Sie selbst und Dr. Watson mir liefern, lässt sich wenig folgern. Trotzdem will ich es versuchen. Zum Beispiel glaube ich kaum, dass Sie Ihre chemischen Experimente aufgegeben haben, denn der Zustand Ihrer Manschetten zeugt von Aktivitäten in jüngster Zeit – die Brandstellen, durch den Umgang mit Säure verursacht, sind noch frisch und wären nach mehrmaliger Wäsche ausgefranst. Sie rauchen keine Zigaretten mehr, das zeigen mir Ihre Finger, dafür benutzen Sie um so öfter Ihre Pfeife. Wie mir die Schwielen an Ihren Fingerspitzen verraten, spielen Sie weiterhin Geige. Bienenstiche beschäftigen Ihre Gedanken ebenso wenig wie Finanzen und Gärtnerei, denn Ihre Haut weist die Spuren alter und neuer Stiche auf. Und wie mir Ihre uneingeschränkte Beweglichkeit verrät, muss man die Theorie über Bienenstiche als Therapie gegen Rheumatismus ernst nehmen. Oder ist es Arthritis?«
»In meinem Fall Rheumatismus.«
»Außerdem halte ich es für möglich, dass Sie Ihr Leben nicht völlig geändert haben. Die Haut an Ihrem Kinn ist etwas heller, also ließen Sie sich irgendwann im letzten Sommer einen Spitzbart wachsen, den Sie später abrasierten. Danach schien die Sonne zu selten, um den Unterschied zu verwischen. Da Sie normalerweise keinen Bart tragen und nach meiner Ansicht auch nicht gut damit aussähen, kann ich nur annehmen, dass Sie sich in diesem besonderen Fall für mehrere Monate tarnen wollten. Wahrscheinlich hing es mit den Anfangsphasen des Krieges zusammen. Vielleicht mussten Sie dem Kaiser nachspionieren.«
Ein paar Sekunden lang musterte er mich mit völlig ausdruckslosen Augen, und ich unterdrückte ein verlegenes Lächeln. Endlich brach er das Schweigen. »Ich habe es selbst heraufbeschworen, nicht wahr? Sind Sie mit Dr. Sigmund Freuds Arbeit vertraut?«
»Ja. Allerdings finde ich die Errungenschaften der nächsten Generation nützlicher. Freud ist übermäßig besessen von extremen Verhaltensweisen. Das mag Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen, aber der Allgemeinheit kann es kaum helfen.«
Plötzlich bewegte sich etwas im Blumenbeet. Zwei orangegelbe Katzen sprangen heraus, rasten über die Wiese und verschwanden durch eine Öffnung in der Gartenmauer. Holmes schaute ihnen nach und blinzelte in die tief stehende Sonne. »Vor zwanzig Jahren«, murmelte er. »Sogar noch vor zehn. Aber jetzt und hier?« Er schüttelte den Kopf und fixierte mich wieder. »Was wollen Sie an der Universität studieren?«
Unwillkürlich lächelte ich. Denn ich wusste schon jetzt, wie bestürzt er reagieren würde. »Theologie.«
Er enttäuschte mich nicht. Seine Bestürzung war genauso heftig, wie ich es erwartet hatte. Wir schlenderten durch das Zwielicht zu den Klippen, und ich betrachtete das Meer, während er sich mit meinem Plan auseinandersetzte. Als wir zum Haus zurückkehrten, hatte er entschieden, ein solches Studium sei nicht schlimmer als irgendein anderes, aber er hielt es für reine Zeitverschwendung, und das sagte er auch. Ich gab keine Antwort.
Kurz danach traf das Automobil ein, und Mrs. Hudson kam heraus, um den Fahrer zu bezahlen. Zu ihrer Belustigung erklärte Holmes unser Abkommen, und sie versprach, den Betrag zu notieren.
»Heute Abend muss ich noch ein Experiment beenden«, verkündete er, »also müssen Sie mich jetzt entschuldigen.« Schon nach wenigen Besuchen fand ich heraus, dass es ihm widerstrebte, Abschied zu nehmen. Ich streckte meine Hand aus und riss sie beinahe zurück, als er sie an die Lippen zog, statt sie nur wie zuvor zu schütteln. Seine kühlen Lippen berührten meine Finger, dann ließ er sie los. »Bitte, kommen Sie zu uns, wann immer Sie wollen. Übrigens besitzen wir ein Telefon. Aber fragen Sie die Telefonistin nach Mrs. Hudson. Manchmal beschließen die guten Damen, mich zu schützen, indem sie vorgeben, mich nicht zu kennen. Aber wer immer nach meiner Haushälterin verlangt, wird verbunden.« Er nickte mir zu und wollte sich abwenden, aber ich hielt ihn zurück.
»Mr. Holmes …« Ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen stieg. »Darf ich Sie was fragen?«
»Gewiss, Miss Russell.«
»Was passiert am Ende vom ›Tal der Angst‹?«, platzte ich heraus.
»Vom – was?«, rief er verblüfft.
»Vom ›Tal der Angst‹. Im Strand Magazine. Ich hasse diese Serien, und diese geht nächsten Monat zu Ende. Könnten Sie mir schon jetzt sagen, wie?«
»Ich nehme an, das ist eine von Watsons Geschichten?«
»Natürlich. Der Fall von Birlstone und den Scowrers und John McMurdo und Professor Moriarty und …«
»Ja, ich glaube, ich entsinne mich des Falls. Übrigens habe ich mich oft gefragt, warum Conan Doyle, der Pseudonyme so liebte, Watson und mir selbst nicht auch eins verpasst hat.«
»Also, wie ging die Geschichte aus?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Da müssten Sie Watson fragen.«
»Aber Sie wissen doch sicher, welchen Abschluss der Fall fand«, entgegnete ich erstaunt.
»Sicher. Aber was Watson daraus gemacht hat, kann ich nicht einmal erraten, abgesehen von Blutströmen und wilden Leidenschaften und heimlichem Händeschütteln. Ach ja, und natürlich ein Liebespaar. Ich ziehe Schlussfolgerungen, Miss Russell, und Watson gestaltet alles um. Guten Abend.« Mit diesen Worten kehrte er in sein Cottage zurück.
Mrs. Hudson, die diesem letzten Gespräch gelauscht hatte, gab keinen Kommentar ab. Stattdessen drückte sie ein Päckchen in meine Hände. »Eine kleine Wegzehrung.« Nach dem Gewicht des Proviants zu urteilen, würde ich viel länger brauchen, um ihn zu verspeisen, als die Fahrt dauern konnte. Aber wenn es mir gelang, das Paket irgendwie an meiner Tante vorbeizuschmuggeln, wäre es eine willkommene Ergänzung meiner kargen Rationen. Warmherzig dankte ich ihr.
»Und ich danke für Ihren Besuch, liebes Kind«, erwiderte sie. »So lebendig habe ich Mr. Holmes schon monatelang nicht mehr gesehen. Bitte, kommen Sie bald wieder.«
Das versprach ich und kletterte ins Automobil. Auf knirschenden Kieselsteinen brauste der Chauffeur davon, und so begann meine lange Bekanntschaft mit Mr. Sherlock Holmes.
*
An dieser Stelle muss ich meine Erzählung unterbrechen und einige Angaben über eine Person machen, die ich ursprünglich weglassen wollte. Aber ihre Abwesenheit würde ein bedeutungsschweres Vakuum hinterlassen, eine Wichtigkeit, die ihr nicht zustünde. Ich spreche von meiner Tante.
Knapp sieben Jahre lang, vom Unfall meiner Eltern bis zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag, wohnte sie in meinem Haus, gab mein Geld aus, manipulierte mein Leben, schränkte mich in meiner Freiheit ein und tat ihr Bestes – oder Schlimmstes –, um mich zu kontrollieren. Während dieser Zeit musste ich mich zweimal an den Testamentsvollstrecker meiner Eltern wenden und gewann in beiden Fällen, was mir die rachsüchtige Feindschaft der Frau eintrug.
Genau weiß ich nicht, wie viel von meinem Erbe sie entwendet hat. Eins steht jedenfalls fest: Nachdem sie mich verlassen hatte, kaufte sie ein Reihenhaus in London, obwohl sie fast mittellos zu mir gekommen war. Ich gab ihr zu verstehen, ich würde dies als Lohn für ihre langjährigen Dienste betrachten, und ließ es dabei bewenden. Ein paar Jahre später ging ich nicht zu ihrem Begräbnis und richtete es so ein, dass ihr Haus an eine arme Cousine fiel.
Meistens ignorierte ich sie, während sie bei mir lebte, was ihren Zorn noch schürte. Ich glaube, sie war klug genug, um die Talente anderer zu erkennen, aber statt sich großzügig zu zeigen, versuchte sie, alle Menschen, die ihr überlegen waren, auf ihre eigene Ebene herabzuziehen. Ein unglückseliger Charakter und ein sehr trauriger Fall, aber ihre Handlungsweise kurierte mich von meinem Mitleid. Deshalb werde ich sie in meinem Bericht weiterhin ignorieren, wann immer sich eine Gelegenheit ergibt. Das ist meine Rache.
Ihre Einmischung störte mich nur in meiner Bekanntschaft mit Mr. Holmes. Während der nächsten Wochen wurde es offensichtlich, dass ich etwas gefunden hatte, das mir viel bedeutete, und – in den Augen meiner Tante noch schrecklicher – dass mir ein Leben in Freiheit geboten wurde, weit weg von ihr.
Uneingeschränkt nutzte ich den Kredit, den ich von Holmes bekam, und Mrs. Hudson führte Buch darüber. Als ich volljährig wurde, hatte sich eine beträchtliche Summe angesammelt. (In der Anwaltskanzlei unterschrieb ich sofort einen Scheck über den Betrag, den ich Holmes schuldete, plus fünf Prozent für Mrs. Hudson. Ich weiß nicht, ob sie das Geld der Wohlfahrt oder dem Gärtner gab, jedenfalls nahm sie es.)
Um meine Beziehung mit Holmes zu unterminieren, setzte meine Tante eine ganz besondere Waffe ein. Sie drohte, üble Gerüchte in der Nachbarschaft zu verbreiten, die sehr unangenehm gewesen wären, was sogar ich zugeben musste. Etwa einmal pro Jahr sprach sie diese Drohungen aus, zunächst subtil, dann ganz unverblümt, bis ich schließlich zum Gegenangriff übergehen musste, indem ich sie erpresste oder bestach.