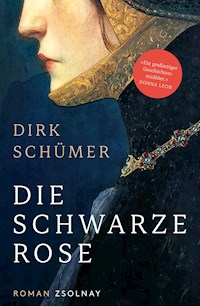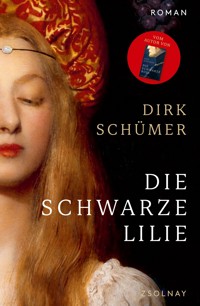
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach „Die schwarze Rose“ die Fortsetzung von Dirk Schümer – dem „großartigen Geschichtenerzähler“ (Donna Leon) 1348: In der Finanzmetropole Florenz wütet die Pest, während die Söhne des mächtigen Bankiers Pacino Peruzzi nacheinander ermordet werden. Wittekind Tentronk, den es als Agent des Patriarchen aus Avignon an den Arno verschlagen hat, erkennt zu spät einen blutigen Wettlauf um Geld und Rache, den er nur verlieren kann. Wie in seinem vielbeachteten Roman "Die schwarze Rose" spannt Dirk Schümer einen Bogen in die Gegenwart. Er erzählt von der größten Bankenpleite vor 2008, von der schlimmsten Pandemie aller Zeiten, vom Krieg auf der Krim, aber auch von Wittekinds Liebe zu der schönen Marktfrau Cioccia und einem illustren Freundeskreis um den erfolglosen Poeten Boccaccio und Dantes versoffenen Sohn Jacopo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1000
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
1348: In der Finanzmetropole Florenz wütet die Pest, während die Söhne des mächtigen Bankiers Pacino Peruzzi nacheinander ermordet werden. Wittekind Tentronk, den es als Agent des Patriarchen aus Avignon an den Arno verschlagen hat, erkennt zu spät einen blutigen Wettlauf um Geld und Rache, den er nur verlieren kann.Wie in seinem vielbeachteten Roman »Die schwarze Rose« spannt Dirk Schümer einen Bogen in die Gegenwart. Er erzählt von der größten Bankenpleite vor 2008, von der schlimmsten Pandemie aller Zeiten, vom Krieg auf der Krim, aber auch von Wittekinds Liebe zu der schönen Marktfrau Ciocca und einem illustren Freundeskreis um den erfolglosen Poeten Boccaccio und Dantes versoffenen Sohn Jacopo.
Dirk Schümer
Die schwarze Lilie
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Dieses Buch ist den Toten gewidmet, in deren Träumen wir umherirren.
»In meinem Schlaf sah ich eine gotische Stadt inmitten eines Ozeans erstarrter Wogen wie in einem Glasfenster. Ein Meeresarm teilte die Stadt in zwei Teile; das grüne Wasser erstreckte sich bis zu meinen Füßen; es umspülte am gegenüberliegenden Ufer eine orientalische Kirche, dann Häuser, die sich noch im vierzehnten Jahrhundert befanden, so dass zu ihnen zu gehen bedeutet hätte, den Fluss der Zeiten empor zu steigen.«
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Prolog
Spitzes Metall bohrte sich in seine Haut. Es war das Erste, was er spürte. Dann kam der Schmerz. Er riss den Kopf zur Seite und sah eine Hand mit einem Hammer, der einen Nagel durch seine Knochen trieb. Wo war er? Was tat man ihm an? Er wollte schreien. Doch das ging nicht. In seinem Mund steckte ein Knebel und drückte seine Zunge nach unten. Er wollte aufstehen, weglaufen, sich wehren. Doch alles Zerren und Schluchzen nützte nichts. Er lag gefesselt auf einem Balken. Vom Boden aus schaute er in ein altes Gewölbe. Nein!, wollte er schreien. Nein! Aber durch den Knebel kam nur ein Röcheln.
Als ein Nagel in seinen anderen Arm drang und das Blut aus dem Puls schoss, spürte er einen ekligen Metallgeschmack im Mund. Der Schmerz raubte ihm kurz die Besinnung. Während er wieder zu sich kam, zersplitterte ein dritter Nagel seine übereinander gebundenen Fußknöchel. Er konnte es nicht sehen, aber das Krachen seiner Knochen vernahm er genau. Der Schmerz, der jetzt im ganzen Körper von den Beinen bis in seinen Kopf herauf pulsierte, war fürchterlich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Fetzen von Gehörtem und Gelesenem stiegen in ihm auf, doch er konnte nicht mehr denken und nicht mehr beten. Er konnte nicht einmal um sein Leben betteln. An den Händen spürte er warmes Blut, das aus ihm rann und ihm jede Kraft entzog.
Mit einem Ruck richtete sich der Balken auf, und seine Gedärme sackten nach unten, so dass er kaum noch Luft bekam. Sein Kopf sank ihm auf die Brust, sein Herz hämmerte wild, und seine Lungen drohten zu platzen. Er winselte durch die Nase und drehte den Kopf hin und her wie ein wundes Wild. Immer weiter ruckte der Balken in die Senkrechte.
Seine Augen traten aus den Höhlen, seine Arme rissen an den Nägeln, und seine Füße rutschten auf ein Brett, auf dem er etwas Halt fand. Nun erblickte er seinen Henker, der ruhig und kräftig am Seil zog. Schließlich glitt der Balken mit einem Ruck in ein Loch und stand aufrecht. Viel Blut tropfte auf den Boden. Er spürte das Reißen der Knochen in seinen Armen. Man hatte ihn gekreuzigt. Er nahm die letzte Kraft zusammen und schrie all seinen Schmerz und seine Angst in den Knebel, doch es erscholl nur ein Winseln.
Aus dem Halbdunkel tretend, baute sich nun eine Figur in rotem Umhang vor dem Kreuz auf und betrachtete ihn von oben bis unten. Die Figur nickte zufrieden. Wer war das? Er erinnerte sich nicht. Vor seinen Augen verschwamm das Bild. Höllisch rote Feuerzungen flackerten. Noch einmal riss er seine Augen auf. Die Gestalt stand immer noch da und begann jetzt, mit hoher Stimme zu lachen. Er starrte auf den aufgerissenen Mund und begriff mit einem Mal, wer das war. Unmöglich, das konnte nicht sein! Es konnte einfach nicht sein! Doch die Hölle, die ihn umschloss, war Wirklichkeit. Und die einzige Ewigkeit, die ihm jetzt noch blieb, war seine Angst.
Das Lachen hörte nicht mehr auf und schmerzte ihn schlimmer als die Nägel in seinem Körper. Er begriff nun, dass es für ihn keine Gnade und keine Auferstehung gab. Er würde hier am Kreuz sterben. Durch das Schwarze, das vor seinen Augen immer größer wurde, nahm er jetzt nur noch die lachende Fratze wahr. Schrill hallte ihre Stimme durch seinen Kopf, während seine Glieder zuckten und er in einem Feuer aus Schmerz verbrannte.
Kapitel 1
Florenz, September 1348
Schweißgebadet wachte ich auf. Angst krampfte mir das Herz zusammen, bis ich merkte: Es war alles nur ein böser Traum. Cioccia war fort, und wie so oft in den vergangenen Monaten hatten mich die Totengräber mit ihrem Geschrei geweckt:
Leichen! Schafft eure Leichen auf die Straße!
War es ein Wunder, wenn mich im allgemeinen Sterben und Verwesen Albträume plagten? Die Schmerzen des Heilands am Kreuz. Die machtlose Ohnmacht der Gottesmutter. Märtyrer, denen die Folterknechte Nägel durch Arme und Beine trieben. Todesqualen, Pein, Hölle. Welche Bedeutung hatten die grausamsten Visionen der Bibel und der Bußpredigten noch gegen das Verrecken der Menschen, in dem wir uns eingerichtet hatten?
Ich schob die Läden auf und blickte nach rechts auf die Straße. Die Totengräber schoben ihren Karren auf die Piazza Santa Croce; drei leblose Körper lagen darauf, nackt, übereinandergeworfen mit Gliedmaßen, die seitlich herabbaumelten. Es war ein vertrauter Anblick. Vor wenigen Wochen erst hatte es noch schlimmer ausgesehen. Da karrten die Totengräber unserer Nachbarschaft jeden Morgen dutzende von Leichen zum Arno, wo sie Massengräber ausgehoben hatten. Als ich einmal vorbeikam, beförderten sie die Körper mit Schwung in die Grube, immer mit etwas Erde und ein paar Händen Kalk dazwischen, genauso wie die Köche Lasagne schichten, nur dass sie statt Käse Erde nahmen. Immer wieder Fleisch und Erde, Fleisch und Erde.
Seit Monaten herrschte der Tod in den Straßen von Florenz, und leer war es geworden in den Buden und Werkstätten, in den Kirchen und auf den Märkten. Gedränge gab es nur mehr in den Massengräbern, wo sich die raren Lebenden der zahllosen Toten entledigten. Dies war die fürchterlichste Pest, die das Menschengeschlecht seit Anbeginn der Welt mitgemacht hatte.
War es das Ende der Welt? In jedem Land begann das große Sterben, niemand konnte fliehen. Hier in Florenz war inzwischen beinahe jeder Zweite tot, und es war noch nicht vorbei. Unter entsetzlichen Qualen wurden die Kranken dahingerafft, mit Beulen in der Leiste und unter den Armen, mit offenen Wunden und blutigem Husten, schreiend vor Pein und fluchend auf den Schöpfer, der ihnen solche Schmerzen bereitet hatte. Nach spätestens zwei Tagen, wenn die Beulen mit einem Gurgeln aufplatzten, konnten die Todgeweihten nur noch winseln. Und schweißiger Gestank drang ihnen aus Mund und Nase, als hätte das Aas, das sie bald sein würden, bereits seit Tagen in der Sonne gefault.
Ich schüttete aus einem Krug Wasser in die Schüssel und wusch mir den bösen Traum aus den Augen. In wachem Zustand wollte ich keine Sterbenden mehr sehen. Ich wollte leben. Denn noch niemals war ich so glücklich gewesen wie zur Zeit der Pest. Was ich jetzt brauchte, war ein Frühstück. Zum Purgatorio waren es nur ein paar Schritte. Meo, der Wirt, hatte die Schankräume auch während der schlimmsten Tage der Pest nicht dichtgemacht. Er allein wusste, wo er frisches Bier und sauberes Fleisch auftrieb, selbst als die Priori im Sommer die Stadttore verrammeln ließen und allen Wirtsleuten befahlen, die Türen zu schließen. Meo hatte sich nicht daran gehalten und ließ Stammkunden wie mich durch die Hintertür herein. So hatte er die Pest auf seine Weise besiegt: indem er so tat, als sei sie nicht da.
Lästermäuler behaupteten, Meo beziehe seinen Lampredotto aus den Speisekammern der Toten und plündere nachts die verlassenen Weinkeller. Aber auch solche Lästerer kamen ins Purgatorio, weil sie wussten, dass es nirgendwo in Santa Croce günstigeres Essen gab. Und die Gespräche mit Meo gab es umsonst dazu. Ich ging jeden Tag hin, um zu essen, zu trinken, um mir die Zeit zu vertreiben. Vor allem jedoch weil ich an der Piazza hoffen konnte, Cioccia bei der Arbeit zu sehen. Sie hatte es mir verboten, doch an diesem Morgen konnte ich nicht anders, als zu ihrem Gemüsestand an der Ecke zu gehen. Sie war nicht da. Wahrscheinlich kaufte sie gerade frische Ware bei den Booten unten am Arno, während der Junge, der ihr seit ein paar Wochen beim Verkauf half, auf den Stand aufpasste.
Ein Rundblick durchs Halbdunkel der Schankstube genügte, um festzustellen, dass an diesem Morgen die Stammgäste versammelt waren. Nie war ich freudiger begrüßt worden als zu Pestzeiten, nie hatte ich mich meinerseits mehr gefreut, meine Trinkkumpane gesund und munter anzutreffen. Wobei munter vielleicht nicht das richtige Wort war, denn jeder, der mich mit kurzem Wink gegrüßt hatte, saß an diesem Morgen auf seiner Bank schweigend vor einem Becher gewürztem Wein, nahm ab und zu mit heiligem Ernst einen Schluck, um sich Kraft anzutrinken für einen weiteren Tag. Wir hatten wieder eine Nacht überlebt.
Die Ärzte mit ihrer Medizin können dir nicht helfen, hatte Meo schon zu Ostern gesagt, als die Seuche über die Stadt herfiel. Die Pfaffen mit ihren Gebeten können dir auch nicht helfen. Die Priori mit ihren Verboten können es ebenso wenig. Kein Mensch weiß, was die Pest ist und woher sie kommt. Darum trink, Wittekind! Trink viel! Mein Wein ist der einzige Schutz. Und wenn du doch sterben musst, dann stirbst du wenigstens im Rausch.
Den ganzen Sommer über hatte ich mich an Meos Rat gehalten. Arbeiten musste ich nur dann und wann, Geld war kein Problem, und allein zu Hause wäre ich verrückt geworden. Wenn man in diesen Zeiten nicht wenigstens mit anderen Menschen zusammensaß und sich gegenseitig etwas erzählte, dann konnte man sich gleich auf den Karren der Totengräber legen. Wer redet, ist nicht tot, sagte Meo immer. Und wer mit einem Becher in der Hand dem Tod zuprostet, der liebt das Leben. Der Teufel säuft Blut, aber keinen Wein, so sagen wir bei uns in Siena.
Seit ich Cioccia kennengelernt hatte, trank ich weniger. Sie wollte, sagte sie, sich nicht zu einem Säufer ins Bett legen. Du riechst nach Wein aus dem Mund, genau wie früher mein Mann, hatte sie nachts geflüstert, wenn sie heimlich zu mir herüberkam. Das ist widerlich. Würdest du abends mit uns singen und beten, dann wärst du erfüllt von der Gnade der Jungfrau, und du müsstest nicht saufen wie ein Deutscher.
Mein Hinweis, dass ich ein Deutscher war und deswegen gerne trank, machte auf sie keinen Eindruck. Und über die Gnade einer Jungfrau, die ich um keinen Preis mit der wenig jungfräulichen Gnade Cioccias vertauscht hätte, machte ich ihr gegenüber besser keine Witze. Sie war dann imstande, aus meinem Bett aufzustehen und wieder in ihre Kammer hinüberzusteigen. Ich hatte es erlebt.
Cioccias Heilmittel gegen die Pest bestand in ihrer Gemüsesuppe mit viel Knoblauch und Rosmarin, die sie alle zwei Tage in einem großen Topf kochte und an ihre Schützlinge verteilte. Diese Brühe schmeckte wirklich gut. Brav kam dann auch ich, um meine Ration von ihr in Empfang zu nehmen; das gab kein Gerede. Ich war Cioccias Nachbar, ich konnte getrost mit den Kindern und den Armen von Santa Croce aus ihrem Topf essen, solange es tagsüber geschah und in aller Öffentlichkeit. Nachts konnte ich Cioccia für ihre Kochkünste loben und sie mich für meine Enthaltsamkeit beim Trinken. Denn nun roch ich, vor allem wenn ich mir den Mund gespült und meine Zähne mit einem Riechholz geputzt hatte, nur noch nach Cioccias Knoblauch. Mein Morgengebet gegen die Pest, das tägliche Frühstück bei Meo mit Würzwein und Lampredotto, hatte ich mir trotzdem nicht nehmen lassen.
Ins Inferno mit allen Ärzten und Studierten! Merkt ihr denn nicht, wie sie uns betrügen mit ihrer Klugschwätzerei? Brennen sollen sie!
Der Mann, der das rief, gehörte zu den Stammkunden im Purgatorio. Wir alle kannten die Ausbrüche von Jacopo. Lang und mager, steckte der Mann stundenlang seine Adlernase in den Becher und fing dann plötzlich an zu schreien. Trotz der frühen Stunde wirkte er betrunken. Meo brachte mir gerade meinen Napf mit Lampredotto und zog die Brauen hoch. Dann ging er zu Jacopos Bank und legte ihm beschwichtigend den Arm auf die Schulter. Jacopo stieß ihn weg und schrie:
Es sind die Ratten! Merkt ihr es nicht? Die Ratten bringen die Pest, mit ihren spitzen Zähnen, mit ihren roten Augen! Sie sind schuld am großen Sterben. Erst wenn wir alle Ratten töten, wird die Pest verschwinden. Warum glaubt mir denn keiner?
Meo hatte solche Ausbrüche von Wahn schon oft erlebt. Er kannte Jacopo seit ihrer gemeinsamen Jugend in Ravenna, wo ihre Väter einst im Exil gestrandet waren. Beide, Cecco Angiolieri und Dante Alighieri, waren Toscaner und waren zu ihrer Zeit berühmte Dichter gewesen, Cecco aus Siena, Dante aus Florenz. Ehrfürchtig wurden ihre Namen geflüstert, wenngleich ihre Werke kaum jemand las. Verwickelte, teuflische, gefährliche Poesie, so urteilten die Kenner. Die Söhne der Dichter hatten sich wohlweislich andere Gewerbe gesucht, was sie später in Florenz wieder zusammenführte. Meo war ein Schankwirt geworden, Jacopo ein Säufer.
Meo brachte noch einen Becher Wein: Jacopo, lass die armen Ratten in Ruhe! Sie sterben an der Pest wie alle Tiere. Morgens liegen sie mit blutigen Schnauzen in der Gosse. Hunde sterben an der Pest. Katzen, Hühner und Schweine gehen ein wie die Fliegen, sicher auch die Kamele im Orient und sogar die Flöhe auf deinem Kopf. Wenn die Ratten etwas mit der Pest zu tun hätten, könnten die Ärzte das herausfinden. Aber das Einzige, was sie gefunden haben, sind die üblen Dämpfe der Pestluft. Eiasmen! Die bringen uns um. Und dagegen hilft nur mein Wein. Trink!
Ich lasse mir von einem ungebildeten Wirt gar nichts sagen, rief Jacopo. Ich habe die Gabe des Sehers von meinem Vater geerbt. Er konnte Gott und die Heiligen im Paradies besuchen und mit allen Verdammten der Hölle einzeln disputieren, ich kann das bezeugen. Mein Vater ist lebendig aus dem Jenseits zurückgekehrt. Und jetzt sehe ich, sein Sohn, mit meinen eigenen Augen, wie die Ratten uns das Inferno der Pest bescheren!
Wann stopft dem Sauflappen endlich jemand das Maul? Noch einen Becher Wein, und mit seinem Zinken sieht er selber aus wie eine Ratte. Zeig mir mal deine Nagezähne, Alighieri!
Der das sagte und dabei seine letzten Zähne klappern ließ, war Michele Scalza, noch einer von der Morgengemeinde im Purgatorio. Alle in Florenz kannten den dicken Michele mit seinem bunten Gewand und der Bommelmütze. Er saß den ganzen Tag in den Schänken und gab den Spaßmacher. Wenn er auch zuweilen im Suff das Regiment der Priori lächerlich machte, so landete er doch nie in den Verließen der Stinche. Viele hielten ihn für einen Agenten. Mir war es gleich. Wenn Scalza spionierte, dann war er dabei wenigstens nicht langweilig.
Jacopo war aufgesprungen und reckte seine Fäuste: Komm nur, mein Freund, ich schlag dir deine paar Zähne aus! Von einem Trottel wie dir lass ich meinen Vater nicht beleidigen!
Meo stellte sich dazwischen und gab mir einen Wink. Ich nahm Michele Scalza fest am Arm und ging mit ihm vor die Tür, damit wir unsere Becher in Frieden austrinken konnten. Die Sonne, die hinter den noch unfertigen Mauern der Kirche aufgestiegen war, tat uns gut.
Die Pest wird die Menschheit ausrotten, meinte Michele nach dem letzten Schluck. Alle tot! Das wäre das Beste. Oder was findest du?
Ich antwortete nicht. Scalza machte mit dem Arm eine große Geste über die Piazza hin bis zur Baustelle von Santa Croce, wo ein paar Arbeiter Steine klopften, während ihnen Franziskanermönche Anweisungen gaben. Auf dem Platz schnüffelten Schweine im Dreck.
Schau genau hin!, sagte Scalza, wie kriechen die Leute durch die Welt und sind froh, wenn sie auch nur einen Tag weiterleben. Und wozu? Was hat die Menschheit davon? Leid und Elend. Am glücklichsten sind die, die sie unten am Fluss grade in die Grube werfen. Die haben es hinter sich. Habe ich nicht recht?
Ich sah Cioccia, wie sie einen Korb Äpfel zu ihrem Stand trug und dem Jungen eine Frucht anbot. Sie hatte mir verboten, ihr zuzuzwinken, wie ich es am liebsten getan hätte. Die Leute, sagte sie, reden auch so genug. Wo eine Fliege sitzt, sehen sie einen Misthaufen. Ich sah nur Cioccia.
Gut, räumte Michele ein, meinem Blick folgend. Nicht alle Menschen machen durch den Tod ein gutes Geschäft. Diese Gemüsehändlerin da, für die würde ich eine Ausnahme machen. Sie ist kein junges Mädchen mehr, ganz und gar nicht. Aber wenn ich mir ihre Beine unter dem Gewand vorstelle, sie geht so grade und straff. Was für Beine müssen das sein! Und der ganze Rest, diese frechen Augen! Schau die Strähne, die ihr aus der Haube gerutscht ist, was für glänzendes Haar! Unsere Cioccia würde sogar der strafende Gott verschonen. Und wenn wir beide nicht schon alt wären und schwach, dann wüssten wir, wo wir unsere Nächte verbringen würden, was?
Michele kicherte. Ich schaute ihn streng an: Cioccia ist eine ehrbare Witwe. Und sie arbeitet härter als wir beide zusammen. Wenn du sie mit deinem dummen Gerede in Verruf bringst, ist das eine Sünde gegen einen Menschen, der dir nie das Geringste angetan hat. Und Cioccia ist fromm, sie singt jeden Abend drüben mit den Kindern bei den Laudesi. Wenn du weiter Gerüchte streust, hast du sämtliche Beginen auf dem Hals. Diese Pinzocchere wirken friedlich, aber einem Verleumder wie dir kratzen sie die Augen aus. Du hockst den ganzen Tag beim Weinfass, während Cioccia sich abplagt. Einer Frau wie ihr reichst du doch höchstens bis zur Achsel. Also halt den Mund.
Meinetwegen, beschwichtigte mich Michele, du bist ihr Nachbar und ihr Hauswirt. Du musst es ja wissen. Und ich darf wenigstens nach dem ersten Morgenbecher von der Liebe träumen. Zu mehr sind wir Alten sowieso nicht in der Lage. Was meinst du?
Ich fragte mich, ob ich in seiner Stimme Spott überhört hatte. Cioccia hatte recht, in Florenz hatten die Steine Ohren. Und es gab mehr Verleumder als Mönche und Priester zusammen. Doch Michele, der sich sonst über alles und jeden lustig machte, war diesmal kein Hohn anzumerken. Er wandte seinen wehmütigen Blick von Cioccia ab, die gerade einen Eimer Brunnenwasser hochhievte, und ging zurück in die Schankstube.
Gerne hätte ich Cioccia den Eimer zu ihrem Stand getragen, aber das wäre aufgefallen. Ihr junger Knecht kam zu ihr, und gemeinsam schleppten sie das Wasser, mit dem Cioccia ihr frisches Obst gegen die Sonne besprenkelte: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Feigen. Daneben lagen Spinat und Fenchel. Bei Cioccia bekam man das beste Obst und Gemüse von Santa Croce. Jetzt, da das Sterben nachließ, lieferten die Bauern des Contado wieder ihre Ernte in die Stadt. Im Juli, als die Priori Karren voller Melonen durch die Tore rollen ließen, damit es zum großen Melonenfest wenigstens etwas Ablenkung gab, da hatten die Leute noch solche Angst vor der Ansteckung, dass die meisten Früchte auf den Plätzen verrotteten und am Ende die Schweine sich damit die Bäuche vollschlugen. Dass der Handel mit Grünzeug inzwischen wieder florierte, nahm ich als gutes Zeichen. Die Pest war, so schien es, auf dem Rückzug. Nur lag inzwischen so manche von Cioccias Kundinnen im Grab.
Niemand wusste, wie es mit der Menschheit weitergehen würde, wie viele Knechte und Herren, wie viele Priester und Huren übrig blieben für das Leben danach. Ich war vor zwei Jahren nach Florenz gekommen, in die reichste und schönste Stadt der Welt. Der gewaltige Mauerring war gerade fertig, ebenso wie der Priorenpalast mit seinem stolzen Turm. Am Dom, an Santa Croce, eigentlich an allen Kirchen wurde nach kühnen Plänen immer weitergebaut. Florenz war das neue, das bessere und vor allem das reichere Rom. Das alte Rom, die Stadt am Tiber, hatten die Päpste verlassen. Die Ewige Stadt zerfiel im Bürgerkrieg.
Hier am Arno ließen die Priori jedes Jahr dreihunderttausend Florin schlagen, die beste Münze der Welt. Von Palästen gleich ums Eck aus regierten Kaufleute und Banchieri ihre Handelsimperien, die von Britannien bis Tunis, von Zypern bis Spanien reichten. Jeden Tag trieben Hirten Herden von Ochsen, Lämmern und Schweinen durch die Tore, damit sie noch vor dem Abend geschlachtet, gebraten und aufgegessen würden. Auf dem Arno legten dutzende Boote am Tag Richtung Pisa ab, meist mit kostbaren Wolltüchern für alle Welt, aber auch mit Schwertern und Rüstungen für Arabien, mit Ballen Seide für den Norden, mit silbernem Besteck und Monstranzen für den Papsthof in Avignon. Feinste Waren wurden in den Mauern der Stadt von tausenden Werkleuten hergestellt und dann für die Ausfuhr verpackt. Hochbezahlte Boten ritten durch die Porta al Prato oder die Porta San Gallo mit Wechselbriefen, die Unsummen in Paris, in Barcelona oder in Nürnberg von einem Besitzer zum anderen verschoben, und mit denen die Banchieri immer kostbarere Güter für das stolze Florenz anschafften.
Das war erst einmal vorbei. Jetzt lagen etliche Baustellen verödet, ein paar Gerüste waren in Sommergewittern umgestürzt. In vielen Gärten an den Mauerringen, wo in den kommenden Jahren eigentlich neue Stadtviertel für die nächsten hunderttausend Florentiner entstehen sollten, wucherte mannshoch das Unkraut. In Straßen, in denen sich ein verrammelter Laden an den nächsten reihte, spielte kein Kind mehr Fangen, hockte kein Greis in der Abendsonne. Der Tod hielt Hof in der Stadt. Im Leichengestank des Sommers war ich mir sicher gewesen, dass ich mit allen anderen in Florenz untergehen würde. Nicht einmal die Sterbeglocken durften die Pfaffen noch läuten. Die Priori hatten es verboten, damit die Menschen unter dem endlosen Gelärme der Begräbnisse nicht vollends verzweifelten. Bald wagte niemand mehr, die Toten mit dem hergebrachten Pomp, mit Klageweibern und großen Wachskerzen zu beerdigen. Im Massengrab endeten alle gleich. Anfangs hatten noch fanatische Prediger gegen die Seuche gewettert. Gott, schrien sie von den Kanzeln, strafe die sündige Menschheit. Wir sollten umkehren, sollten unseren verderblichen Luxus aufgeben. Wir mussten allen Reichtum der Kirche stiften und vor allem die Juden totschlagen. Doch es gab keine Juden in Florenz. Viele Zuhörer sanken in Tränen und Zerknirschung auf die Knie, doch ebenso viele überlebten ihre Bußübungen nur um einige Stunden. Bald waren die Kirchen genauso verwaist wie die Märkte.
Nur ein paar Mutige trauten sich im Mai noch vor die Tür und versuchten, mit Schwert und Knüppel so viele Hunde und Katzen wie möglich zu erschlagen, weil die Haustiere, so hieß es, als Erste von der Pest verseucht waren und die Menschen umbrachten. Das schrille Todesjaulen der Tiere war schwerer zu ertragen als das Stöhnen der Kranken und der Sterbenden. Gleichzeitig wurden Hühner mit Gold aufgewogen, weil ein paar Ärzte Hühnersuppe als Medizin gegen die Pest entdeckt hatten. Wer ein Ei ergattern konnte, fühlte sich wie der König von Frankreich. Es wurde gefährlich in der Stadt; man konnte sich bei der Suche nach Essbarem die Seuche holen, aber auch einen Messerstich ins Herz.
Es gab zu viele Menschen, die nichts mehr zu verlieren fürchteten, nicht einmal das Leben. Irgendwann ging keiner mehr vor die Tür, der im Keller ein paar Esswaren und etwas Wein gelagert hatte. Reiche flohen auf ihre Landhäuser, doch der Tod war ihr heimlicher Begleiter und holte sie trotzdem. Und mit der ersten Sommerhitze begann die große Stille der Angst, es begann das Horchen auf die Todesschreie in der Nachbarschaft. Und am Morgen, so schien es, erschollen die Rufe der letzten Lebendigen auf Erden. Das waren die Totengräber.
In diesem Sommer, als alles egal schien, hatten Cioccia und ich uns zusammengetan. Ob es die letzten Tage oder Stunden im Leben waren, oder ob unsere heimliche Liebe eine Zukunft hatte — ich dachte nicht darüber nach und saugte jeden Augenblick auf wie eine Medizin. Verloren wie die letzten Menschen auf der Welt klammerten wir uns in jenen Nächten aneinander, hielten uns fest, küssten einander die Tränen aus den Augen und leckten an unserem Schweiß, der nach Leben roch und nicht nach Tod.
Leben! Ich war beinahe ein alter Mann, schon über vierzig Jahre hatte ich hinter mir. Ich hatte mehr von der Welt gesehen und länger ausgehalten als die meisten. Ich konnte mich nicht beklagen, sollte mich die Pest holen. Cioccia war kaum jünger als ich, und auch sie hatte ihr Leben gelebt, mit Mann und Kindern in einer anderen Stadt. Und gerade diese Frau ließ mich an die Liebe glauben, was mir in all den Jahren zuvor niemals beschieden war.
Wenn diese Seuche das Ende der Welt bedeutete, dann hatte sich das Leben gelohnt. Einzig wegen Cioccia. Und wenn das Leben nach der Pest weiterging, dann konnte ich es mir ohne Cioccia nicht mehr vorstellen. Ob es ihr genauso erging, da war ich mir nicht sicher. Sie war eine Frau, die sich ein Mann verdienen musste. Hatte ich Cioccia verdient?
Zu meiner Überraschung kam sie jetzt auf mich zu. Das hatte sie kaum jemals getan, höchstens dann und wann erschien sie am Nachmittag im Purgatorio, um vor dem Abbauen ihres Standes ein Glas Wein zu trinken, gemischt mit viel Wasser. Cioccia stemmte die Hände in die Hüften. Ich konnte ausnahmsweise am hellen Tag ihre Schönheit bewundern, aber ich durfte mit keiner Geste zeigen, dass wir ein Paar waren. Leider waren wir ja auch kein Paar. Cioccia sprach absichtlich so laut, dass es auch die neugierigen Säufer im Purgatorio mitbekamen. Sie sollten Zeugen sein für Angelegenheiten zwischen Mieterin und Hauswirt:
Hör, Wittekind, du musst endlich Ordnung in deinen Haushalt bringen! Ab heute hast du einen Knecht, der sich um all das kümmert, was du verwahrlosen lässt.
Ich blickte Cioccia entgeistert an.
Wenn du es nicht verstehst, sagte sie, dann erkläre ich es dir. Du brauchst einen Jungen für alles, wofür du selbst nicht genug Zeit hast und was sich nicht schickt für einen Mann deines Ranges. Ein Knecht versorgt jetzt dein Reittier und holt Holz für den Ofen, denn bald wird es wieder kalt. Und dann kannst du kochen.
Ich koche nicht, ich gehe ins Purgatorio, protestierte ich.
Das ist auch so eine Gewohnheit, die sich mit deinem Rang nicht verträgt. Wenn du als Ausländer die Achtung der Nachbarschaft gewinnen willst, dann darfst du nicht verdrecken. Und du musst regelmäßig am eigenen Tisch essen.
Ich verdrecke nicht, entgegnete ich, das siehst du doch. Und ich verhungere nicht. Ich erledige alles allein.
Cioccia blickte mich streng an: Beim Putzen und Kochen darfst du dich schon gar nicht sehen lassen, das ist keine Arbeit für einen Ritter.
Du weißt genau, dass ich kein Ritter bin. Ich habe nur ein Pferd, und das ist noch nicht einmal ein richtiges Pferd.
Das läuft auf dasselbe hinaus. Dieses arme Tier, das dir gehört, braucht Pflege, auch wenn du keine Zeit hast.
Wenn ich unterwegs bin, erklärte ich, dann nehme ich Patroklus mit, um ihn kann ich mich ganz gut alleine kümmern. Das geht schon länger so. Außerdem, wo soll ich denn einen Pferdeknecht herzaubern, wo die halbe Stadt tot ist?
Cioccia schaute mich mit einem Strahlen an, das ich in ihren Augen nachts nur erahnen konnte. Ab heute, verkündete sie, wird Lapo für dich arbeiten. Ausschließlich für dich und deine Bedürfnisse. Du bist ein glücklicher Mann.
Ich beugte mich zu Cioccia und flüsterte: Der einzige Mensch, den ich brauche, bist du. Das weißt du genau.
Sie trat einen Schritt zurück, schaute mich unbeeindruckt an und sagte besonders laut: Dann ist das also abgemacht. Lapo fällt dir nicht zur Last, ganz im Gegenteil, er schläft nachts bei den Laudesi. Ich oder eine andere in der Nachbarschaft, wir kochen ihm Suppe, außerdem gebe ich ihm übrig gebliebenes Obst. Du schuldest ihm für seine Dienste ein paar Quattrini Lohn die Woche, oder etwas mehr, wenn du nicht genauso ein Geizhals sein willst wie diese Peruzzi.
Ich widersprach: Das hast du schön geregelt, ohne mich auch nur zu fragen. Dein Lapo da drüben ist vielleicht ganz lieb, aber leider ein Trottel. Außerdem zieht er einen Fuß nach. Du willst einen Krüppel loswerden und bindest ihn mir auf den Hals.
Cioccias Augen wurden stumpf, eher traurig als wütend. Dieser Blick traf mich noch mehr als der strahlende. Und ich bereute sofort, was ich gesagt hatte. Gut, sagte ich, dein Lapo ist kein Krüppel, nur ein armer Tropf.
Willst du, dass ich dir ernstlich böse bin? Willst du das?, fragte Cioccia.
Komm mal her, rief sie zu dem Jungen, der die ganze Zeit herübergeschielt hatte, während er mit einem kleinen Besen die Fliegen von Cioccias Grünzeug vertrieb.
Mit dem leichten Humpeln, an dem man diesen Jungen schon von weitem erkannte, kam er zu uns. Er war vielleicht vierzehn, dicklich, recht groß für sein Alter. Er hielt die Hände vor dem Bauch gefaltet und blickte schräg auf den Boden.
Ich bin Lapo, ich bin etwas blöd, sagte er leise. Willst du mich nehmen? Cioccia hat gesagt, dass du mich nehmen willst.
Ich wusste nicht, was antworten. Cioccia ergriff Lapos Arm, zog ihn zu mir heran und hielt mir seine Rechte entgegen: Zur Abmachung der Knechtschaft gilt in Florenz der Handschlag, danach ist Wittekind dein Herr. Ich habe alles mit ihm besprochen. Und vergiss eins nicht, ich habe es dir schon oft gesagt: Du bist nicht blöd!
Fast ohne es mitzubekommen, hielt ich dem Jungen die Hand hin, er fasste sie. Dann schaute er mir einen kurzen Moment lang mit schüchternem Lächeln in die Augen und blickte sofort wieder zu Boden.
Ich sagte: Hör mal, Cioccia, und Lapo, du auch! Ich brauche eigentlich keinen Knecht, aber wir können es auf Probe versuchen. Ich habe ein Pferd, also eigentlich ein Maultier, das steht bei den Peruzzi drüben im Stall, Patroklus heißt es. Um das kannst du dich kümmern, ich gebe dir die Bürste und ein paar Quattrini für Heu und Hafer.
Und dann, fiel Cioccia mir ins Wort, haben wir einen Abort hinterm Haus, der dringend ausgeräumt gehört. Die Scheißeputzer sind jetzt alle zu Leichenträgern geworden. Aber, Lapo, du kannst das mit ein paar Eimern selber schaffen. Der Arno ist nicht weit. Danach muss Wittekind dir dann neue Sachen kaufen, so ist der Brauch zwischen Herr und Knecht. Und du musst Wittekind jeden Tag hier aus dem Brunnen frisches Wasser zum Waschen bringen. Was dann noch an seinem und meinem Haus auszubessern ist, das müssen wir noch im Einzelnen beraten. Aber es gibt für die nächste Zeit genug zu tun.
Cioccia war noch nicht fertig: Eine Küchenmagd habe ich dir auch besorgt, Wittekind. Es ist kein Zustand, dass du immer in diesem Schankhaus hockst. Monna, so heißt das Mädchen, kann deine Küche saubermachen und dir etwas kochen. Und die Flöhe aus deinem Strohsack einsammeln.
Leise und mit einem Lächeln fügte sie hinzu: Die stören dich doch nachts so sehr.
Inzwischen waren Meo, der Wirt, und Michele Scalza angelockt worden und hörten unserem Gespräch, das ja eigentlich eine Ansprache Cioccias war, aufmerksam zu.
Recht hat sie, meinte Meo, du bist doch einer der wenigen hier in der Nachbarschaft, der genug Geld hat für Knecht und Magd. Wozu sparen? Denk auch mal an deinen Rang.
Ich wusste nicht, ob Meo das ernst meinte oder ob er sich mit Michele über mich lustig machen wollte. Meo nämlich führte mit seiner rastlosen Frau Chiara das Purgatorio ohne fremde Hilfe und steckte abends viele Quattrini in den Beutel. Eher noch hätte er an seine Chiara Dienstboten herangelassen, aber niemals an seinen Kessel voller Lampredotto. Und an seine Kasse schon gar nicht. Als Lehrmeister der Großzügigkeit kam Meo Angiolieri für mich nicht in Frage. Trotzdem nahm Cioccia seine Worte dankbar auf: Fegen, Asche wegbringen, deine Kleider neu säumen, deine Gewänder putzen — dafür brauchst du ein Mädchen. Es wird höchste Zeit, dass du endlich herumläufst wie ein toscanischer Kaufmann und nicht wie ein abgerissener Deutscher auf der Reise.
Ich bin kein Kaufmann, widersprach ich und blickte an mir herab. War ich in Cioccias Augen ein abgerissener Deutscher?
Ich brauche wirklich keine Magd, fuhr ich fort. Die Arbeit kann doch Lapo erledigen, er ist jetzt mein Knecht.
Genau, er ist dein Knecht, aber nicht deine Magd, betonte Cioccia und schickte den verlegen herumstehenden Lapo wieder zum Gemüsestand. Sie schaute mich vorwurfsvoll an:
Dass ich dir allen Ernstes deine Pflichten erklären muss! Die Pest hat viele Eltern ohne Kinder zurückgelassen, aber auch umgekehrt tausende Kinder ohne Eltern. Wer soll sich denn um die kümmern, wenn nicht wir? Hast du je darüber nachgedacht, wie wenig ich noch verdiene, jetzt, da mir die Hälfte meiner Kundinnen weggestorben ist? Wir in Santa Croce müssen zusammenhalten.
Ich kam näher und flüsterte: Wer stundet dir denn seit Monaten deine Miete, wenn nicht ich? Wir beide können, wenn es nach mir geht, gar nicht genug zusammenhalten. Aber ich möchte mir schon aussuchen, mit wem.
Cioccia schüttelte den Kopf: Das Schicksal lässt uns keine Wahl. Gott hat uns in eine fürchterliche Zeit geworfen, nun müssen wir uns an die von ihm vorgeschriebenen Tugenden halten. Ein bisschen Mildtätigkeit — nichts anderes ist es, was ich von dir verlange. Ich habe diesem armen Lapo jetzt über einen Monat lang zu essen gegeben. Aber von Obst allein kann keiner leben. Die frommen Pinzocchere sorgen schon den ganzen Sommer für andere Waisen, damit sie nicht auf der Straße verhungern. Jetzt bist du an der Reihe.
Cioccia zeigte nach links, wo neben der Franziskanerkirche die Gebäude der Bruderschaft der Laudesi lagen: Heute Morgen sind da drüben schon wieder zwei Waisenkinder angekommen. Wo sollen wir mit denen hin? Das Mädchen ist zierlich, scheint mir aber nicht dumm. Das ist Monna, sie wird deine neue Magd. Sie und ihr Bruder essen sich gerade satt und kriegen von den Frauen saubere Kleider. Heute Nachmittag kommen die Kinder zu uns.
Cioccia hatte alles geplant, ich musste nicht gefragt werden.
Dino, Monnas Bruder, fügte sie hinzu, ist kräftiger als Lapo. Also wird mir Dino künftig beim Kistenschleppen helfen. Ich bin kein junges Mädchen mehr. Und keine Angst, schlafen werden die Kinder bei den Laudesi.
So wurde mir klargemacht, dass ich tagsüber Lapo, der hinkte, und ein Mädchen namens Monna, das ich noch nicht einmal gesehen hatte, bei mir beschäftigen musste, wenn meine Nächte weiter Cioccia gehören sollten. Es gab keine Wahl. Cioccia wusste, dass ich nicht widersprechen würde. Ich liebte sie. Ich liebte sie auch, wenn sie meine Liebe ausnutzte. Ich nickte zum Einverständnis und lächelte Cioccia an.
Wie ein treuer deutscher Hund, hatte sie in solch raren Augenblicken zu mir gesagt. Ich hatte nicht herausbekommen, ob das in den Augen einer Frau aus Neapel als Kompliment gemeint war oder als Beleidigung. Wahrscheinlich beides.
Komm sofort mit! Los, der Padrino will mit dir sprechen!
Ich fuhr zusammen, als ich eine Hand auf meiner Schulter spürte und eine raue Stimme hinter mir hörte. Ich drehte mich um und erblickte Uguccione dal Pozzo. Und mein Lächeln erstarb.
Kapitel 2
Nach ein paar Schritten war von der Morgensonne nichts mehr zu spüren. Die Peruzzi hatten sich für ihren Palast die Ruinen des römischen Amphitheaters ausgesucht. Darum verliefen die Gassen hier im weiten Bogen der Arena; sogar die Paläste und Wehrtürme der Sippe passten sich der Rundung an. Unter den schmalen Arkaden, wo einst Gladiatoren und wilde Tiere um ihr Leben kämpften, hatten Handelsgehilfen ihre Buden aufgesperrt, klappten die Läden herunter und breiteten bis zur Mitte der Gasse im Schatten ihre Waren aus. Tuch und Schwerter, Gewürze und Lederzeug suchten Käufer. Fremdes Geld wollte gewechselt werden. Das Geschäft ging weiter.
Uguccione, wie stets mit braunem Kapuzenhemd und einem Dolch am Gürtel, nahm auf die Händler und ihre Kunden keine Rücksicht. Der Wächter des Palazzo Peruzzi stapfte mit breitem Schritt geradewegs zum Haupttor und bahnte mir dabei den Weg. Ich schaute kurz auf zu den beiden großen Reliefs mit dem Wappen der Sippe, die dieses Stadtviertel kontrollierte: sechs steinerne Birnen, übereinander, erst drei, dann zwei, dann eine, allesamt herabhängend wie Kirchenglocken. Die beiden Wachen, die mit Schwert und Knüppel rechts und links vom Portal den Eingang besetzten, nahmen von uns keine Notiz. Uguccione dal Pozzo konnte kommen und gehen, wann und mit wem er wollte.
Vorbei an Wagen, Pferden, Fässern, Holzstapeln marschierten wir vom Innenhof die Außentreppe hinauf. Mein Begleiter stieß eine breite Holztür auf, als handele es sich um einen Seidenvorhang. Dass jetzt ein langer Gang kam bis zu den Gemächern des Padrino, war mir wohlbekannt, wenn ich auch seit ein paar Wochen nicht hier gewesen war. Es war dunkel, aus der angrenzenden Gasse fiel nur noch durch Schießscharten etwas Licht auf den Fliesenboden. Vor der Eichentür am Ende des Gangs wies Uguccione auf einen ausgesparten Steinsitz an der Wand: Du wartest hier!
Ich blieb allein zurück und stellte mich auf eine längere Wartezeit ein. Ob der Padrino wirklich beschäftigt war oder nicht — seinem Ansehen war es nicht förderlich, wenn jedermann sofort Zutritt zu seinem Kontor erhielt. Ich hatte hier schon öfter gesessen. Einmal schickte man mich sogar unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Ins finstere Herz des Bankhauses Peruzzi gelangte nicht jeder.
Was würde diesmal mein Auftrag sein? Vor fünf Wochen war es ein Transport mit kostbaren Tuchballen von Prato in die Zentrale. Die Faktoren in Prato hatten Hinweise auf einen geplanten Überfall bekommen, doch als ich dann mit drei bewaffneten Reitern und fünf Fußknechten die Ware abholte, gab es keinerlei Zwischenfälle. Nur war ich kurz vor Florenz vom Pferd gefallen, das mir die Peruzzi gestellt hatten. Schnell sollte es gehen, das Tier war jung und ungebärdig. Mit dem geduldigen Patroklus wäre das Unglück nicht geschehen. Nun wollten die Schmerzen in meinem Rücken nicht besser werden, vor allem, wenn ich in den Sattel stieg.
Zwei Wochen nach dem Ritt nach Prato musste ich mitten im großen Sterben oben in Fiesole bei einem Advokaten Urkunden über Hauskäufe in Empfang nehmen. Offenbar empfanden die Peruzzi den Botengang als gefährlich. Oder sie hatten Angst vor der Pest. Für solche heiklen Aufgaben hatten sie mich.
Leise öffnete sich direkt neben mir eine Tür, und ein Mädchenkopf lugte vorsichtig nach rechts und links. Außer mir war niemand zu sehen, und das Mädchen — vielleicht dreizehn Jahre alt, edel gekleidet in ein Brokatgewand und mit ausrasierter Stirn nach Pariser Mode — kam ein paar Schritte hervor und wandte sich flüsternd an mich:
Pass auf, dass Palamede nichts zustößt! Ich bitte dich von ganzem Herzen! Ich bin nur eine Frau, und niemand verrät mir etwas, aber ich weiß genau, dass er in Gefahr ist.
Was ist mit Palamede?
Seine Brüder hassen ihn. Und sein Vater hasst ihn auch. Ich habe es Palamede selbst gesagt, aber er will nichts davon wissen. Er ist so gut und hat immer Vertrauen, sogar zu seinen Feinden. Wenn ihm etwas passiert, dann …
Was dann?, wollte ich wissen.
Das Mädchen blickte ängstlich zur Eichentür des Kontors, von wo das Geräusch von Schritten zu uns drang, und sagte schnell:
Dann ist alles egal, stieß sie hervor. Wenn ich mich nicht umbringe, dann tun sie es.
Damit hatte sie auch schon die Tür hinter sich zugezogen. Uguccione streckte den Kopf aus dem Kontor, als hätte er etwas gehört. Dann wies er mir den Weg ins Kontor.
Drinnen wurde es wieder hell, denn der gewölbte Raum ging auf eine Loggia. Pacino Peruzzi brauchte Licht, um seine Briefe und Handelsbücher zu studieren, darum war die gesamte Front zum Innenhof mit Glas verkleidet. So etwas gab es sonst nur bei Fürsten oder in Kathedralen. Die Peruzzi waren es gewohnt, Auge in Auge mit den Herrschern der Welt zu verkehren. Wenn es darauf ankam, sogar mit Gott persönlich.
Obwohl wir im September noch warme Tage hatten, saß das Oberhaupt der Peruzzi an seinem Pult, keine drei Schritte neben einem Kamin, in dem die Scheite prasselten. Ich begann zu schwitzen. Pacino Peruzzi hatte eine Decke um die Knie gewickelt und trug seine Wollkappe bis in die Stirn gezogen. Der Alte verzog den Mund zu einer Art Lächeln, als er mich sah. Seine zusammengezogenen Brauen wirkten, als sehe er nicht mehr gut. Ich wusste aber genau, dass er auch mit über siebzig Jahren Augen hatte wie ein Luchs.
Sei mir willkommen, Wittekind!, sagte er mit müder Stimme, als drücke ihn die Last der Arbeit und der Verantwortung bereits am Morgen nieder.
Ich hoffe, du hast schon gefrühstückt, fügte er an. Bei mir gibt es nichts. Ich esse noch vor Tagesanbruch ein Ei …
Ich weiß, Padrino, fiel ich ihm ins Wort, und dazu ein Stück altes Brot, einen Becher Brunnenwasser und dann erst wieder einen warmen Hirsebrei zu Mittag. Ich wünsche euch einen guten und gesunden Tag!
Pacino Peruzzis Lippen schürzten sich zufrieden, als ich ihn an seine kargen Essgewohnheiten erinnerte. Ich wusste, dass ich diesen Mann getrost unterbrechen durfte, solange dies aus Respekt für seine Sparsamkeit geschah.
Du hast ein gutes Gedächtnis, das schätze ich an dir. Und du hast nichts übrig für unnötiges Geschwätz, genau wie ich. Also kommen wir gleich zur Sache.
Ich nickte dem Padrino aufmunternd zu. Er war der Mann, der mich bezahlte, er war der Mann, der in Santa Croce jeden Winkel kontrollierte, er hatte das Sagen.
Es ist kein großer Dienst, den ich heute von dir verlange, begann er nach einem kurzen Räuspern und schob eine Urkunde zur Seite. Mein Sohn Ruffo ist gestern mit Messer Bortolo, unserem Advokaten, zu meinem Gut in San Donato a Torri hinausgeritten, um ausstehende Pachtgelder einzutreiben.
Und er ist nicht zurückgekommen, daher soll ich ihn suchen und hier im Kontor abliefern, beendete ich Pacinos Worte.
Ich kannte Ruffos Gewohnheiten, es war nicht das erste Mal, dass er verschwand und dass ich ihn nach Tagen aus Oltrarno oder bei der Porta al Prato aus einer Kneipe oder einem Hurenhaus wieder in die Botmäßigkeit seines Vaters zurückbefördern musste. Der alte Mann wies auf die hinterste Ecke des Kontors, in deren Schatten ich erst jetzt ein mageres Männlein erblickte. Pacino fuhr fort mit leidendem Tonfall, als berichte er seinem Arzt von einer Krankheit:
Wir kennen alle Ruffos Laster, darum hatte ich Messer Bortolo gebeten, ihn zu begleiten und auf ihn aufzupassen. Eigentlich keine große Aufgabe, hatte ich gemeint, doch für unseren Advokaten immer noch zu groß.
Ich kann nichts dafür, verteidigte sich Messer Bortolo, der in seinem roten Gewand von der Bank aufgesprungen war und mit den Armen zu fuchteln begann, als stünde er vor Gericht. Genau genommen stand er vor Gericht.
Mich trifft keine Schuld, wiederholte er mit näselndem Singsang. Wir hatten die Pachtgelder bei vier Gutshöfen eingesammelt, dann haben wir mit unseren Bauern besprochen, dass sie noch in dieser Woche die reifen Äpfel, die Birnen und die letzten Feigen mit einem Karren hier im Palazzo abzuliefern haben. Wir haben die Menge geschätzt und den Bauern diese — zwanzig Pfund Birnen, vierzig Pfund Äpfel und drei Kisten Feigen — genau vorgeschrieben. Dann wurde es Abend. Ich habe mich sogleich in unserer Kammer hingelegt und auf Ruffo gewartet. Es gab da oben fast noch mehr Mücken als hier in Santa Croce, müsst ihr wissen. Und als es dunkel wurde …
Wir müssen gar nichts wissen, außer wo Ruffo geblieben ist, unterbrach ihn der Padrino harsch. Wo steckt mein Sohn?
Messer Bortolo blickte beleidigt drein und erzählte den Rest: Ich habe es heute Morgen schon einmal berichtet. Bei Tagesanbruch war Ruffo immer noch nicht aufgetaucht, ich habe ihn mit drei Bauern auf dem ganzen Hof und den umliegenden Feldern gesucht. Ich habe mir die Kehle heiser geschrien. Und als er dann immer noch nicht erschien, bin ich gleich hierher geritten. Ein guter Advokat in Diensten der Peruzzi hat in diesen Zeiten wahrlich anderes zu tun, als bei den Bauern im Heu herumzustöbern. Ich muss heute Mittag noch zum Priorenpalast, um die Erbschaft dieser Witwe Reparata aus Santa Maria Novella zu beglaubigen, die uns nach dem Hausverkauf noch drei Florin schuldet. Jetzt ist sie tot, und wer muss sich kümmern? Natürlich, der Advokat!
Pacino warf seinem Anwalt einen verächtlichen Blick zu: Mir — und nicht dir — schuldet sie die drei Florin und hat sich in eine andere Welt davongemacht. Wenigstens sollten die Leute vorher ihre Angelegenheiten regeln.
Dafür gibt es Advokaten wie mich, warf sich Bortolo in die Brust. Ich verspreche euch, dass ich die volle Summe aus dem Vermögen herausbekomme. Und die Zinsen, heute noch.
Der Anwalt wischte sich die Stirn. Auch ich fühlte, wie mir hinter dem besonnten Glas und vor dem flackernden Kamin der Schweiß an Brust und Beinen herunterrann. Dem Padrino konnte es nicht warm genug sein. Er richtete mit einem Ruck seine schwere Decke und gab Uguccione, der die ganze Zeit an der Tür gewartet hatte, einen Wink, neue Scheite nachzulegen.
Der massige Aufpasser nahm das zum Anlass und mischte sich ein, während er sich aus einem Korb mit Holz bediente: Padrino, ich verstehe nicht, warum ihr immer diesen Deutschen kommen lasst. Die Casa Peruzzi ist mächtig und groß, wir haben Männer genug, um Ruffo zu suchen.
Halt den Mund, sagte der Padrino nicht übermäßig laut. Ich entscheide, wer was zu tun hat. Du, Uguccione, sollst nicht denken, sondern meinen Palast bewachen. Du dienst mir nicht als mein Berater. Und damit du es weißt: Die Casa Peruzzi hat vielleicht genügend Männer, um Ruffo zu suchen, aber nicht, um ihn zu finden.
Uguccione wollte protestieren, während er sich mit den Händen den Holzstaub vom Wams wischte. Doch er schluckte seine Worte herunter und warf mir einen drohenden Blick zu. Pacino Peruzzi wandte sich zu mir:
Wittekind, du hast mir in den letzten zwei Jahren mehr gedient als ein ganzer Stall von Hausknechten. Ein deutscher Jagdhund ist besser als toscanische Katzen. Die können Mäuse fangen im Kontor, aber mehr auch nicht.
Und zu seinen Hausgenossen gewandt: Wenn dieser Fremde hier meinen Sohn Zanobi samt unseren Faktoren unverletzt aus Neapel herausholen konnte, und wenn er meinen Sohn Amerigo am Ende der Welt ausfindig gemacht hat, dann wird er wohl auch meinen Sohn Ruffo in unserem Gehöft am Arno aufstöbern. Ruffo hat augenscheinlich vergessen, dass wir in Zeiten der Pest Wichtigeres zu tun haben als herumzuhuren. Wir müssen unser Geld zusammenhalten! Ich werde es ihm noch einbläuen.
Pacino Peruzzi wusste wie kein Zweiter, wie man sein Geld zusammenhält. Er schickte mit knappen Worten Messer Bortolo zur Testamentseröffnung der Witwe Reparata aus Santa Maria Novella. Dann gab er Uguccione del Pozzo genaue Anweisungen, wo der Alaun gelagert werden sollte, der gestern in einem Konvoi aus Ancona angeliefert worden war. Vorher sollte Uguccione noch Zanobi Peruzzi aus dem Kontor im Erdgeschoss heraufrufen; der Padrino wollte das Bilanzbuch prüfen, wie jeden Vormittag.
Auch meine Audienz war beendet; ich hatte genug geschwitzt. Pacino versenkte seinen Blick wieder in die Handelsbriefe auf seinem Pult und verabschiedete mich, ohne den Blick zu heben:
Wenn du noch vor Sonnenuntergang mit meinem Sohn hier eintriffst, sind drei, nein, zwei Florin von deiner Schuld getilgt.
Kapitel 3
Auf dem Gang war von dem verängstigten Mädchen, das mich an der Pforte angesprochen hatte, nichts mehr zu sehen. Das war zu erwarten; Frauen hatten beim Kontor nichts verloren. Ich konnte mir auf das Kind, das ich im Palazzo noch nie zuvor bemerkt hatte, keinen Reim machen. Sie ängstigte sich um Palamede. Der war der jüngste Sohn des Padrino und ganz anders als sein Vater: still und zurückhaltend. Ich kannte ihn von der Piazza Santa Croce, wo der hübsche Kerl fast jeden Abend mit ein paar Jungen Ball spielte. Oder er saß auf dem Brunnenrand und schaute mit versonnenem Blick, wie sich das Abendrot auf den Steinen der großen Kirche ausbreitete, die bis zur Pest jeden Tag ein Stückchen gewachsen war. Bei solchen Gelegenheiten hatten wir einander gegrüßt, weil wir wussten, wer der andere war und dass wir beide dem Padrino zuzuarbeiten hatten. Palamede im Kontor, ich draußen auf den Straßen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, wieso das Leben dieses Jünglings in Gefahr sein sollte. Warum hatte sich seine Schwester — denn mit den feinen Gewändern konnte es sich um keine Magd oder Sklavin handeln — ausgerechnet an mich gewandt? Ich war nicht der Leibwächter des Padrino oder seiner Söhne. Ich hatte nur die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, die sich ihren Geschäften in den Weg stellten. Ab und zu war ich auch in heikler Mission über den Appenin unterwegs, mit eingenähtem Gold im Saum für die Niederlassung der Bank in Mailand oder Venedig. Oder ich überbrachte persönlich die Abberufung eines ungetreuen Faktors, samt der Anklage bei den Behörden, damit er auf Wunsch des Padrino in Ketten gelegt würde. So war es in Genua und in Rom geschehen. Es war unangenehm genug, aber niemals hatte sich Pacinos genau formulierten Urkunden einer seiner Handelspartner widersetzen können.
Was hinter der Fassade des Palazzo Peruzzi geschah, ging mich wenig an. Warum sollte einer der Brüder ausgerechnet dem Jüngsten, der nach Pacinos Tod die Macht in der Bank sowieso nicht erben würde, nach dem Leben trachten? Wie verrückt musste das Mädchen sein, mich gegen die Peruzzi aufzustacheln?
Das Schicksal hatte mein Leben mit dem Wohlergehen der Casa Peruzzi zusammengeschweißt. Ich war durch Pacinos Gunst zu mehr Wohlstand gekommen als die meisten Leute in meiner Nachbarschaft. Die Peruzzi gaben mir als Ausländer den nötigen Schutz, ohne den ich in Florenz nicht überleben konnte. Deutsche waren nicht beliebt in der Stadt, die seit ewigen Zeiten dem Papst treu war und den deutschen Kaiser bekämpfte. Außer einigen deutschen Söldnern, die bei Santa Maria Novella in ihren Hütten bei Huren und Wucherern saßen und mit ihresgleichen aus Savoyen, aus der Provence, aus Flandern darauf warteten, sich im Dienst der Republik in Stücke hacken zu lassen, gab es in der riesigen Stadt keine Landsleute. Ich hatte keine Freunde in meiner neuen Heimat, doch ich war Hausgenosse des großen Pacino Peruzzi. Sein Ansehen garantierte meine Unversehrtheit.
Das Bankhaus, dem Pacino vorstand, zählte zu den größten seiner Art. Noch nie hatte es dergleichen Handel von einem Ende der bewohnten Welt zum anderen gegeben. Nur die Bank der Bardi, die in ihrem eigenen Quartier jenseits des Arno saßen, tätigte noch größere Geschäfte. Die Bardi und die Peruzzi hatten vom englischen Monarchen die Schafschur und deren Ausfuhr in die Hände bekommen und versorgten Flandern, aber auch Florenz selbst mit der begehrten Wolle — zu ihren Bedingungen.
Das ging so lange gut, bis vor gut fünf Jahren der englische König beim Ausplündern von Flandern und Frankreich entscheidende Schlachten verlor und seine Schuldzahlungen an die Banken von Florenz aussetzen musste. Das ganze Gebäude der gegenseitigen Sicherungen und Kredite brach nach und nach zusammen. Zuerst waren kleinere Häuser wie die Acciaiuoli bankrottgegangen, dann die Peruzzi, zuletzt die Bardi. Zahllose Anleger in ganz Italien und sogar bis nach Avignon und Griechenland, die über Jahre hübsche Renditen aus ihren investierten Summen bezogen hatten, verloren auf einen Schlag alles. Reiche Kaufleute mussten betteln gehen; wohlhabenden Witwen blieb nur der Abstieg ins Bordell; die Kirchtürme großer Klöster, die mit dem Gewinn bei den Bardi oder Peruzzi gebaut werden sollten, standen heute noch mit offenem Dach im Regen. Fromme Stiftungen für Alte und Waisen hörten von einem Tag auf den anderen auf zu existieren, weil Einlage und Rendite verschwunden waren. Niemand wagte es in diesen schlimmen Zeiten, mit England oder Neapel Handel zu treiben. Es kam zu Hungersnöten. Und die volle Kasse der reichsten Stadt der Welt, die berühmte Münzstätte von Florenz, war plötzlich leer wie die Bettelschale eines Franziskaners. Die reichsten Bankhäuser hatten die Welt arm gemacht.
Doch wundersam — gerade die beiden größten Banken, die den Ruin so vieler Menschen verursachten, konnten sich aus dem allgemeinen Untergang retten. Die Bardi saßen immer noch in ihren Palästen im Oltrarno. Und dass hier bei den Peruzzi weiter Güter, Geld und Wechselbriefe in die ganze Welt geschickt wurden und Einkünfte erbrachten, erfuhr ich Tag für Tag.
Ich schlenderte ohne Eile zurück zur Piazza Santa Croce. Es könnte ein schöner Tag auf dem Land werden. Der Ritt ins Arnotal, um Ruffo von einer Bäuerin zu zerren, bedeutete kein Problem. Vorher wollte ich mir noch eine Portion vom heißen Brei genehmigen, den Meos Frau zu Mittag in einem Kupferkessel zubereitete. Sie wusste, was die Bauleute, die Träger, die Färber und die Handelsfaktoren aus Santa Croce am liebsten aßen. Mal gab es Grütze mit Stücken scharfer Wurst, mal war Flussfisch aus dem Arno drin, an anderen Tagen sogar Fetzen von gebratenem Wildschwein. Auf jeden Fall hielt Chiaras gut gewürzter Brei vor bis zum Abend, und das war genau, was ich brauchte. Ich kannte San Donato a Torri noch von vor der Pest, als ich Provianttransporte in den Palazzo organisieren musste. Ob ich in diesem entlegenen Gehöft der Peruzzi irgendetwas Essbares auftreiben würde, war mehr als ungewiss.
Im Purgatorio wies ich mit dem Zeigefinger auf den dampfenden Kupferkessel.
Aal, rief Meo und steckte sich den Finger in die Backe. Das gab es nicht oft, und Aalgrütze war eines unserer Lieblingsessen. Ich nahm Platz auf einer Bank beim Tresen. Unweit hockte ein junger Mann und begann, auf einer Handorgel zu spielen. Vor ihm stand ein leerer Holznapf. Endlich hatten die Priori Musik und Tanz in den Schänken wieder erlaubt. Der junge Musiker spielte sein Instrument mit unglaublicher Fingerfertigkeit, mit der rechten Hand schlug er Akkorde und streute immer wieder neue Melodien ein, während er unter der linken Achsel den Blasebalg betätigte. Mit dem Fuß stampfte er den Rhythmus dazu, obendrein sang er auch noch mit einer überraschend hohen Stimme, fast wie eine Frau:
Dunque, se la state manca
e vien su la fredda brina,
la brigata devien franca:
ognun’ si parte a testa china …
Das passte gut zu diesen Tagen: Der Sommer ist vergangen, bald kommt der erste Frost, wir ziehen fort mit gesenktem Haupt …
Die Gäste an anderen Tischen hörten auf zu reden und staunten über den Jüngling, der statt kirchlicher Litaneien fröhliche Tanzweisen und Liebeslieder zum Besten gab, die wir während der Seuche beinahe vergessen hatten. Wie lange hatten wir alle keine Musik mehr gehört! Nach all den Bußpredigten, den Klagen der Kranken und Sterbenden und dem Krakeelen der Totengräber stieg endlich wieder eine Ahnung von Harmonie in mir auf.
Der Säufer Jacopo hatte die ganze Zeit mit dem Kopf auf der Tischplatte geschlafen, nun wurde er von der Orgel geweckt, sprang mit einem Ruck auf und schrie:
Wer wagt es, in diesen Zeiten der Heimsuchung liederliche Musik zu spielen? Ruhe, sage ich! Niemand als der Tod lädt uns Sünder noch zum Tanz! Wir Menschen müssen büßen und haben keine Liebeslieder zu singen!
Der Organist war ganz in seinen Gesang vertieft, die letzten Verse brachte er mit Verzierungen und einem langen Schlussakkord seiner Orgel zu Ende, die Augen geschlossen. Da stand auch schon Jacopo vor ihm, holte mit der Faust aus und wollte dem Musiker ins Gesicht schlagen. Ich sprang hoch, hielt Jacopo am Arm fest und schob ihn in die Ecke des Purgatorio. Auch Meo lief herbei, schüttelte seinen Gast und drückte ihn unsanft in Richtung Ausgang:
Lass dich heute nicht wieder sehen, es sei denn, du bist endlich einmal nüchtern. Jacopo, was ist nur aus dir geworden! Dein Vater würde sich deiner schämen.
Mein Vater, mein Vater, stieß Jacopo hervor. Du hast ihn gekannt. Der war kein bisschen besser als ich.
Der Organist hatte sich die ganze Zeit nicht von seiner Bank erhoben. Ich wunderte mich, dass er bei dem Wutgeschrei nicht weggelaufen war, dass er nicht wenigstens seinen Arm erhoben hatte, um sein Gesicht vor dem wütenden Jacopo zu schützen. Der Musiker beugte nur den Oberkörper fürsorglich über seine Orgel, als wäre sie ein schlafendes Kleinkind, dem auf keinen Fall Schaden zugefügt werden durfte. Ohne eine Miene zu verziehen, starrte der junge Mann an die Decke des Schankraumes. Da merkte ich, dass dieser Künstler blind war. Ich legte ihm sachte meine Hand auf die Schulter, setzte mich zu ihm und sagte:
Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Der Schläger ist fort. Und du kannst ruhig weiterspielen.
In dem Moment stellte Meo zwei Näpfe voller Aalgrütze auf unseren Tisch, dazu zwei Becher Wein, und grinste mir dankbar zu: Das geht auf mich.
Der Organist lächelte scheu an mir vorbei.
Ich heiße Wittekind, sagte ich, während ich ihm seinen Löffel in die eine und seinen Napf in die andere Hand drückte. Bevor er zu essen begann, stellte sich auch der Organist vor: Mein Name ist Francesco Landini.
Wir kauten in aller Ruhe, die fetten Aalstücke waren mit Salbei und getrockneten Pflaumen abgeschmeckt. Ich winkte Chiara, die hinter dem Tresen stand, und steckte anerkennend einen Finger in meine Wange. Die Wirtin lächelte.
Bist du zum ersten Mal im Purgatorio?, fragte ich.
Die Schänke macht ihrem Namen alle Ehre, erwiderte Francesco. Man muss sich in diesem Fegefeuer das Paradies erst verdienen. Ich war tatsächlich vorher noch nie hier, aber ich brauche Geld. Man sagte mir, dass hier großzügige Menschen verkehren.
Stimmt, entgegnete ich, vor allem der Wirt, Meo Angiolieri, ist ein guter Mann. Er hätte nicht zugelassen, dass dir ein Haar gekrümmt wird.
Du auch nicht, sagte Francesco Landini. Ich konnte es zwar nicht sehen, aber mir scheint, du hast den Schläger rechtzeitig festgehalten. Wir Blinden sehen so manches mit den Ohren. Bestimmt hätte mich auch Isotta beschützt.
Erst jetzt bemerkte ich unter der Bank einen grauen Hirtenhund.
Hast du denn sonst niemanden, der dich durch die Stadt begleitet?, wollte ich wissen.
Seine Hand suchte unter dem Tisch und streichelte das Tier.
Isotta sorgt dafür, dass ich nicht umgestoßen werde und selber nichts umstoße. Später kommt meine kleine Schwester, um mich abzuholen. Wir wohnen hinten bei Santo Spirito.
Wo hast du gelernt, die Orgel zu spielen?, wollte ich wissen.
Als kleiner Junge war ich mir sicher, dass ich später Maler werden würde, wie mein Vater. Dann habe ich die Pocken gekriegt. Als ich aus dem Fieber erwachte, konnte ich nichts mehr sehen. Erst mit der Zeit merkte ich, dass die Musik meine Gabe ist. Ich habe immer gegen meine Angst im Dunkeln angesungen. Das gefiel den Leuten, und mein Vater gab mich zum Organisten von Santo Spirito. Der hat mir alles beigebracht. Ich kann auch Flöte spielen, und Laute.
Ich nickte dem jungen Mann zu, bis mir einfiel, dass er die Geste gar nicht sehen konnte. Es kam mir wie ein Wunder vor, dass jemand ohne Hilfe der Augen solch komplizierte Melodien und Akkorde auf der Tastatur hervorbringen konnte. Das sagte ich Francesco auch. Er schien sich über mein Lob zu freuen.
Francesco erzählte: Leider ist mein Unterricht vorbei, seit mein Lehrer an der Pest gestorben ist. Unser Vater hat meiner Schwester und mir etwas Geld zurückgelassen, aber das geht nun zur Neige. Meine Schwester ist drüben zu den barmherzigen Pinzocchere gegangen, um etwas zu essen zu erbetteln. Ich dachte, ich kann es endlich wieder mit Musik versuchen. Ein fröhliches Lied, heißt es, füllt Herz und Magen. Und schau mich an, es hat schon geklappt!
Kümmert sich dein Vater nicht um euch?, fragte ich.
Er ist im März, also noch vor der Seuche, in die Berge gezogen, um in seiner Heimatstadt Poppi die Burg auszumalen. Du musst wissen, mein Vater ist Maler. Jacopo del Casentino, ein Schüler des berühmten Giotto. Meine Schwester und ich haben seit Monaten nichts von meinem Vater gehört. Vielleicht lebt er noch und hat Angst zu reisen, oder der Graf von Poppi lässt ihn nicht fort. Ich finde, dass ich jetzt alt genug bin, um unser Brot selber zu verdienen.
Die Rede wirkte trotzig, als müsste sich Francesco Mut zusprechen. Wenn die Pest auch manche Organisten und Sänger getötet hatte, würde es gewiss nicht einfach für einen Blinden, eine Anstellung zu finden. Als hätte er meine Gedanken erraten, setzte Francesco fort:
Ich muss natürlich noch viel studieren und üben. Wenn ich Komponist sein will, dann muss ich die Philosophie beherrschen und noch mehr Instrumente kennen. Ich will sogar mit den eigenen Händen welche bauen.
Und du glaubst, dass dir das ohne Augen gelingt?
Francesco nickte: Meine Schwester Nella ersetzt mir die Augen. Sie liest mir gerade die Werke des großen Philosophen Occam vor. Musik ist Logik in Form von Tönen, ich muss all das studieren. Aber du kennst dich sicher nicht aus mit Philosophie?
Kann sein, antwortete ich, dass ich den Namen Occam schon einmal gehört habe. Aber meine Stärken sind andere. Ich arbeite für das Bankhaus Peruzzi als Agent. Da kommt man mit Philosophie nicht weit.