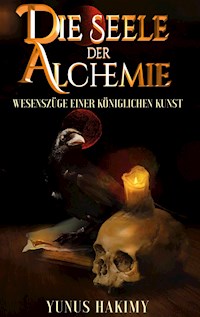
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein alter Meister und seine Raben, grobschlächtige Golems, dienstbare Homunculi und mächtige Elixiere aller Art... eine aberwitzige Reise in die Stadt der Hundert Türme zu Zeiten einer längst verklungenen Epoche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
- Inhalt -
Die Dinge nehmen ihren Lauf
Von Antwerpen nach Prag
Eine Stadt zeigt sich von ihrer besten Seite
Haudrauf und Huckebein
Auf dem Astronomischen Turm
Zu Gast bei den Jelíneks
Das Goldene Gässchen
Kleine Laborlehre für Anfänger
Die Seele der Alchemie
Kabbala
Die Bibliothek der Rachegeister
Keltische Kreuze
Artemisia absinthium
Viele Antworten auf viele Fragen
Duell um Mitternacht
Epilog
Auszug aus der Satzung des Prager Kaiserlich-Königlichen Institutes für Alchemie & alte Schriften
Die Züchtung eines Homunculus ist allein dem Institut und den von ihm autorisierten Alchemisten gestattet. Vorsätzliche Zuwiderhandlung, auch unter Zwang oder Fremdeinfluss jeglicher Mixturen und willensverändernder Substanzen, wird mit lebenslang gültiger Exmatrikulation geahndet.
Paragraph 381a
Die körperliche Misshandlung und Androhung von Gewalt gegenüber Homunculi der Klasse VI und darüber ist ein Verbrechen gegen die Würde alles Lebenden und wird ebenso mit unbegrenzter Exmatrikulation bestraft.
Paragraph 381b
Die Alchemie ist Wissenschaft und Kunst zugleich. Der Ausübende hat sich seiner Verantwortung und ihrer Bedeutung bewusst zu sein. Ihren Namen durch Wort und Tat in den Schmutz zu ziehen ist nicht nur ein Verbrechen gegen das Institut, sondern gegen die gesamte Alchemistenschaft.
Paragraph 522
Das Erschaffen eines Golem (vgl. Paragraph 635) und dessen Belebung ist den hauseigenen Gelehrten des Instituts im Range eines Rabbiners und deren Gehilfen vorbehalten. Verstöße gegen diesen Grundsatz werden ohne Ausnahme mit hohen Geldstrafen und/oder Entzug der Alchemielizenz belegt.
Paragraph 604
Den Befehlen und Verordnungen des Magisters auch gegen persönliches Gutdünken Folge zu leisten ist unbedingte Pflicht eines jeden Alchemisten. Missachtung kommt einem Verrat gegen das Institut gleich.
Paragraph 999
- Eins - - Die Dings nehmen ihren Lauf -
Die Geschichte, die ich Ihnen, werter Leser, heute zu erzählen beabsichtige, ist eine überaus seltsame. Schlichtweg alles an ihr vermag einem aberwitzig zu erscheinen; ihr bloßer Verlauf und ihre Anhäufung an Zufällen und Begebenheiten, ihre Protagonisten und Antagonisten (sowie selbstverständlich auch alle anderen Charaktere von mehr oder minderer Wichtigkeit, die hie und da an verschiedenen Stellen ihren Anteil an den Geschehnissen tragen) und all die Schicksale, die sie geschickt zu verweben und in sich zu vereinen weiß. Deshalb wäre ich auch nicht im Geringsten eingeschnappt oder dergleichen, wenn Sie, mein werter Leser, nach einigen Seiten feststellen mögen, dass es sich hierbei mitnichten um die Art von Lektüre handelt, die Sie gewöhnlicherweise vorzuziehen pflegen. Ich bin kein nachtragender Mensch, nicht im geringsten Maße; und verbindlich ist das Verhältnis zwischen Autor und Publikum schon drei mal nicht. Herrje, ich kenne Sie ja nicht einmal! Also keine falsche Scheu. Der bloße Erwerb dieses Werkes allein verpflichtet zu gar nichts. Lesen Sie oder lassen Sie es bleiben, doch seien Sie noch einmal mit freundlichen Worten und gutgemeinter Absicht darauf hingewiesen, dass Ihnen so einiges ja geradezu phantastisch erscheinen könnte (was den einen oder anderen selbsterklärten rationalen Geist sowie die anderweitig Engstirnigen unter Ihnen eventuell verschrecken dürfte). Zwar mag ich mich vielleicht an einigen wenigen Stellen meiner künstlerischen Freiheiten bedient haben, um ein wenig zu schönen oder im Interesse der Dramatik zu überspitzen, aber lassen Sie sich davon keinesfalls über den Wahrheitsgehalt meiner Erzählung hinwegtäuschen. Genau jetzt lasse ich Ihnen also den Freiraum zu überlegen, ob sich dieses bescheidene Schriftstück nicht vielleicht doch an den nächstbesten unliebsamen Verwandten abtreten ließe. Wenn Sie allerdings an dieser Stelle immer noch veritables Interesse zeigen sollten, dann nur zu! Eine persönliche Empfehlung am Rande, ganz nebenbei bemerkt (den Grad, in dem sie diese dann allerdings auch tatsächlich beherzigen wollen, können Sie ganz zwanglos mit sich selbst ausmachen): fangen Sie mit dem Anfang an! ...denn das einzige, dass hier ganz und gar gewöhnlich ist, ist nunmal der Anfang. Es ist sogar ein besonders unscheinbarer Beginn für eine Geschichte von solchen Ausmaßen und einer solchen Tragweite. Vergessen Sie nicht, dass nicht nur Sie hier eine Reise antreten (die zwar für Sie nur auf rein gedanklicher Ebene stattfinden, aber durchaus nicht weniger abenteuerlicher Natur sein wird, soviel sei Ihnen versprochen)! Denn noch ist mein Werk nicht geschrieben – auch ich beginne gerade erst in diesem Moment, diese Zeilen zu verfassen - und der Handlungsbogen mit all seinen Facetten und unzähligen Details liegt vor mir wie ein komplex verwobenes Teppichwerk, das es erst noch auszurollen gilt. Eines aber sei Ihnen mit Gewissheit versichert: Es ist bei weitem die beste Geschichte, die ich kenne.
Unsere Reise beginnt in Antwerpen, jenem altehrwürdigen Zeugnis vergangener Zeiten am Rande Europas, in der es in jeder Straße nach Meer riecht und jedes Schiff, das im seichten Wasser der Schelde vor Anker liegt, ein Stückchen der weiten Welt zu ihr trägt. Stellen Sie sich nun eben jene Stadt vor! Spüren Sie schon, wie sich die Bilder und Vorstellungen in ihrem Kopf zu einem begreifbaren und anfassbaren Gesamtkunstwerk zusammenfügen, dass Sie mehr und mehr in seinen zauberhaften Bann verstrickt? Lassen Sie sich doch zu einem kleinen Spaziergang verführen; mit meinen Worten als Ihren verlässlichen Begleiter, der Sie sanft durch das geschäftige Treiben einer Stadt in ihrer goldensten und ruhmreichsten Zeit leiten wird. Die tanzenden, grauen Wogen klatschen im unsteten Takt einer stummen Melodie an die Hafenkante, am Flussufer duftet es nach Kaffee und nach Tee, der aus fremden Gefilden hierher gelangt war, und der Wind trägt das bedrohliche Knarren der Schiffsplanken im Wellengang an die Piere. Viele Menschen hat der Handel mit fernen Kontinenten zu reichen Männern gemacht, und die zahllosen Kleinode und kostbaren Minerale aus dem tiefsten Afrika haben ihre Habsucht nur noch befeuert. Man möge sich erst einmal ausmalen, wie groß die Gewinne sind, die Geschickte mit ein wenig Verstand und Hinterlist bei diesem riskanten Spiel zu ergattern vermögen! Einer dieser Glücksritter, die sich im harten Geschäft mit den Kolonialwaren einen Namen gemacht hatten, war Monsieur Hugo Dupont. Er war ein großer, hagerer Mann mit eingefallenen Wangen und silbrig-grauen Haaren, die immer ordentlich gekämmt waren, und er war buckelig und ging gebeugt und zittrig wie eine vom Alter gezeichnete Kanalratte. Wenn er durch die Straßen spazierte - immer auf seinen Gehstock gestützt und vom steten Klacken dessen Holzes auf dem Pflaster begleitet - wurde er weder gegrüßt, noch grüßte er irgendjemanden aus freien Stücken.
Dupont selbst war zu betagt und zu gebrechlich, um zur See zu fahren, doch der Reichtum, den er damit gemacht hatte, war legendär. Hinter seinem Rücken wurden Gerüchte über die schieren Ausmaße seines Vermögens gesponnen, und Waschweib wie Gossenjunge zerriss sich über seine Kauzigkeit und seinen Geiz den Mund. Sein Morgenbad nähme er nur in einer Wanne aus reinem Silber, und alle seinen Türknäufe seien mit Diamanten besetzt, hieß es hier; er tränke seinen Wein exklusiv aus vergoldeten Trinkpokalen, die einst die Tafeln namhafter Monarchen geschmückt hatten, hieß es dort. Stellen Sie sich nun zunächst also den erwähnten Mann vor, in einem hohen, luxuriösen Sessel mit Nerzpolstern sitzend. Er war soeben von einem ausgedehnten Spaziergang zurückgekehrt - die dünnen, spinnenfingrigen Hände waren vor Kälte ganz taub geworden - und nun erhob er sich ächzend, um einen weiteren Holzscheit in das knisternde Kaminfeuer zu werfen. Sein Kontor in der Antwerpener Rue des Marchands bot sämtliche Vorrichtungen, die notwendig waren, um die Geschäftemacherei für einen Mann seines Alters so angenehm wie möglich zu gestalten.„Mon chéri, du bist zurückgekehrt!“, flötete eine schrille Stimme aus dem Nebenzimmer. Sie gehörte der Madame Dupont, einer gierigen und gefallsüchtigen Frau.
Hugo hatte sie vor drei Jahren geheiratet, doch nicht aus Liebe, sondern aus purem Nutzen. Ein Haufen Ahnungsloser hatte sie damals als „gute Partie“ tituliert, und für seine Naivität musste Hugo nun herhalten. Sie kam aus hohem Hause und war eine wichtige Konstante auf seiner beinahe fantastisch anmutenden Karriereleiter gewesen, da sie ihm durch ihre Beziehungen Tür und Tor zum Geldadel der Stadt geöffnet hatte, doch sie war ebenso herrisch und heuchlerisch wie sie charmant und glamourös sein konnte. „Claudette, ich bitte dich“, stöhnte er entnervt und streifte seine schneeweißen Satinhandschuhe ab.„Ich versuche, etwas Ruhe zu finden. Begib dich in Gesellschaft, tratscht, lästert, oder schmiedet irgendwelche Ränke, aber in Gottes heiligem Namen, verschone mich.“ „Eine Frechheit!“, hauchte sie entrüstet, die goldenen Augen weit aufgerissen. Sie raffte ihren Rocksaum und stampfte ins Kaminzimmer. „Ich bin eine geborene Fournier! Mein Vater wird dir schon Manieren beibringen!“ Hugo Dupont lachte leise in sich hinein. „Dein Vater wird gar nichts tun, wenn ich es nicht genehmige. Er ist, wie so viele andere in dieser Stadt, kaum mehr geworden als eine meiner unzähligen Marionetten.“ Sie rümpfte die Nase.„Du wirst schon sehen.“ Dann zog sie von dannen, wüste Verfluchungen in sich hinein nuschelnd. Boudewijn, der treuherzige, betagte Bernhardinerhund, kam auf leisen Pfoten über den Teppich geschlichen und ließ sich von seinem Herrchen tätscheln. Sein Fell war weich und angenehm zwischen den Fingern, so dass Hugo sich wieder in seinen Gedanken verlieren konnte. Der heutige Tag sollte einer der wichtigsten in der finanziellen Chronik des Hauses Dupont werden. Ein gewisser Jacques Delacroix aus Brüssel, der mit dem Handel von Diamanten zu schnellem Reichtum gekommen war, spielte seit einigen Wochen mit dem Gedanken, Anteile an Hugos Flotte zu kaufen. Sie standen in stetem Briefwechsel, beiderseits darauf bedacht, einen möglichst großen Gewinn einzufahren, und jeder der beiden glaubte, den jeweils anderen gnadenlos übers Ohr gehauen zu haben. Heute Abend sollte in genau diesem Zimmer bei Kerzenlicht und Fasan das finale Abkommen unterzeichnet werden, und Hugo leckte sich schon die Finger nach den vielen Franc, die es ihm einbringen würde. Schwerfällig erhob er sich von seiner komfortablen Sitzgelegenheit und wankte zum Fenster hinüber. Die schweren, speckigen Gardinen waren zugezogen, und mit vor Altersschwäche knirschenden Gelenken zog er sie schwerfällig zur Seite. Von seinem Kontor aus bot sich ein wunderschöner Blick über die Stadt. Die Schelde zog sich durch das Häusermeer wie ein breites, graues Band, und die windschiefen Dächer und hohen Fassaden wurden vom erhabenen Turm der Liebfrauenkathedrale überragt. Der Winter kündigte sich langsam an, und die knorrigen, alten Bäume standen kahl und nackt da. Das Singen der Vögel war nun vollends dem betriebsamen Lärm des Hafens gewichen, und der Himmel lag über dem Land wie eine farblose, weite Decke. Alphonse, der Hausdiener, ein stocksteifer Mann mit ausdruckslosem Gesicht und spärlichem Haarkranz, trat ins Zimmer. „Ich erwarte untertänigst Ihre Anordnungen, maître“, deklarierte er monoton und verneigte sich leicht.
„Ah, Alphonse, mein Guter. Ich wollte gerade nach Ihnen rufen lassen.“ Dupont drehte sich angestrengt ächzend zu ihm um. „Bereiten Sie alles vor. Monsieur Delacroix wird in einer guten halben Stunde vor meiner Tür stehen, also ist Eile geboten.
Und sagen sie Babette, sie soll den Fasan nicht wieder zu lange im Ofen lassen, sonst wird er zu zäh.“ „Wie Sie wünschen“, entgegnete er, ohne das Gesicht zu verziehen, und verneigte sich zum zweiten Mal. Er machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Kaminzimmer zum Entree hin.„Ach, und Alphonse?“ „Ja, maître?“, fragte dieser, den langen, dünnen Hals durch den Türrahmen streckend. „Richten Sie Alexandre aus, dass er gefälligst am Tisch zu sein hat, wenn der Besuch eintrifft.“ Alphonse blickte drein, als hätte man ihn in eine saure Zitrone beißen lassen. „Ich muss Sie, so leid es mir tut, enttäuschen, maître. Der junge Herr Dupont ist nicht auf seinem Zimmer.“
„Haben Sie ihn gehen hören?“ „Zu meinem Bedauern, nein.“ Hugo biss sich vor lauter Wut auf die Zunge. „Dieser Nichtsnutz von einem Sohn.“
Alexandre Dupont kam höchstens noch in Sachen Statur nach dem Herrn Vater… doch da hörten die Gemeinsamkeiten schon auf. Er war ein großer, dünner Junge von neunzehn Jahren, mit kastanienbraunem Haarschopf. Seine großen, funkelnden Bernsteinaugen stachen aus seinem blassen, spitzbubenhaften Gesicht hervor und wanderten unaufhörlich in der Gegend umher. Die Taschen seines knielangen, abgetragenen Mantels schienen stets mit allerlei Krimskrams vollgestopft zu sein, und auch seine Stiefel hatten ihre besten Jahre schon merklich hinter sich gelassen. Er war ein ungestümer und unendlich wissbegieriger Mensch, sehr zuvorkommend und immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wer ihm auf der Straße entgegenkam, den grüßte er, ganz egal, ob er ihn kannte oder andersherum, und manchmal wurden seine Schritte vor schierer Lebensfreude zu ausgelassenen Hüpfern oder zu tolldreisten Luftsprüngen, die denkbar deplatziert erschienen und ihm so manchen verständnislosen Blick bescherten. Er liebte das Leben und all seine Facetten, die guten wie die schlechten, und so hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, es zu erhalten. In jeder freien Minute mischte er Tinkturen, Seren und Elixiere, braute Medizin, stellte gewagte Formeln auf, extrahierte, destillierte und pulverisierte. Sein Zimmer, dass er über die Jahre zu seinem eigenen, kleinen Apothekerlabor ausgebaut hatte, sah aus wie die Werkstatt eines Wahnsinnigen. Allerlei Niederschriften, Laborgerät, Kräuter und verkorkte Fläschchen lagen auf den Tischen verstreut, und durch die verschlossene Tür drang ständig der stete Geruch einer Komposition aus Äther, Salbei und Alkohol. Seinem Vater, der ihn als seinen einzigen Sohn lieber mit dem Rechenschieber als mit Mörser und Stößel gesehen hätte, war dies natürlich ein Dorn im Auge. Überhaupt waren die beiden grundverschieden. Die Geschäftswelt hatte Hugo kälter als Stein werden lassen, und über die Jahre war er ein verbitterter Pessimist und Menschenfeind geworden, während sein Sohn in allem nur das Gute sah und sehen wollte.
Alexandre ließ sich nicht vom Gewimmel der Stadt stören, nein, er freute sich viel eher an den wenigen Tieren, die noch geblieben waren, an den letzten Eichhörnchen, die durch die Baumkronen huschten und an den Katzen, die in den Gassen streunten. An diesem Vormittag war Antwerpen ruhiger als gewöhnlich, und hinter den reich verzierten Giebeln der flämischen Bürgerhäuser herrschte noch die allmorgendliche Trägheit. Der Junge zog lächelnd und ziellos durch die Straßen, mit einer locker-leichten Melodie auf den Lippen.
Von einem Augenblick auf den anderen zerriss die zarte Idylle, und er nahm ein Geräusch war, das ihm ganz und gar nicht behagte: das eines weinenden Kindes. Sofort spitzte er die Ohren und versuchte ausfindig zu machen, von woher das steinerweichende Klagen zu ihm drang. Tatsächlich! An der nächsten Straßenecke saß ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und roten Pausbäckchen auf dem Gehweg und hielt sich wimmernd den Arm. Ihre Großmutter, die tat, was sie konnte, um ihren jungen Schützling doch endlich zur Besinnung zu bringen, schien mit dieser Aufgabe sichtlich überfordert zu sein. „Was ist passiert?“, fragte Alexandre ruhig und freundlich. Die alte Frau sah auf.„Oh, meine Enkelin... sie ist hingefallen. Schauen Sie nur, ihr Ellenbogen ist ja ganz aufgeschürft!“ Der junge Mann beugte sich zu dem Mädchen hinunter. „Wie heißt du, mein Kleines?“, fragte er mit honigsüßer, kindlicher Stimme. Diese sah verwirrt auf und blinzelte eine Träne aus dem Augenwinkel.
„Camille“, sagte sie nur. „Schöner Name. Camille, magst du mir deinen Arm zeigen?“ Sie nickte zaghaft und schob vorsichtig den Saum ihres puppenhaften Rüschenkleides zurück. Die Haut war an einigen Stellen aufgerissen und schmutzig und blutete leicht.„Das haben wir gleich. Mach dir keine Sorgen.“ Er griff in seine Manteltasche und holte ein Seidentuch hervor, dass er in einer durchsichtigen Lösung tränkte. „Zur Desinfektion“, sagte er erklärend zu der Frau. „Das wird ein wenig brennen. Beiß einfach die Zähne zusammen.“ Die kleine Camille tat, wie ihr geheißen. Sie zuckte nur ein wenig, als der Alkohol mit ihrer Verletzung in Berührung kam. Dupont zählte bis Drei und rieb den gröbsten Dreck heraus. „Sehr schön.“ Dann zog er eine gläserne, daumengroße Phiole aus dem Innenfutter. „Das hauseigene Panacium No. 1, selbst gebraut aus Aniswurzel und einem die Blutgerinnung und die epitheliale Wundheilung stimulierenden, gering dosierten Kreatinkonzentrat. Kleinere Verletzungen schließt es in unter drei Minuten. Mein ganzer Stolz.“ Mit einem schmatzenden Ploppen entfernte er den Korken und ließ ein wenig von der Substanz auf den Arm tröpfeln.„Nicht bewegen“, mahnte er ernst. „Es wird dir gleich besser gehen.“ Behände zog er seine Taschenuhr an der Kette hervor und fixierte das Ziffernblatt mit starrem Blick. „So“, verkündete er schließlich. „Nun zeig mal her.“ Camille streckte wortlos ihren Ellbogen vor. Dort, wo ihre Schürfungen gewesen waren, war jetzt neues Gewebe entstanden. Nur auf den zweiten Blick ließ sich ein kleiner Farbunterschied ausmachen, denn es war ein bisschen heller als das alte.„Ein Wunder!“, keuchte ihre Großmutter.
„Sie... Sie hat der liebe Gott geschickt!“ Sie bekreuzigte sich hastig. „Ein Engel sind Sie, jawohl, ein Engel, geben Sie's doch zu!“ Camille rappelte sich lächelnd auf und klopfte sich den Staub aus den Kleidern. Sie stand noch etwas wackelig auf den Beinen, aber der Schmerz war offensichtlich vergessen. „Nichts zu danken!“, lächelte Alexandre bescheiden und lief etwas rot an. „Wenigstens weiß ich mich jetzt abermals darin bestätigt, dass auf mein gutes, altes Panacium No. 1 immer Verlass ist.
Einen schönen Tag noch, wünsche ich!“ „Ihnen auch, Ihnen auch!“, rief sie noch, dann war der seltsame Fremde auch schon hinter der nächsten Straßenecke verschwunden. Für Alexandre hingegen war dieser Tag einer wie jeder andere gewesen. Welch wichtige Rolle dieses Ereignis noch zu spielen hatte, wurde unserem Helden selbstverständlich in jenem Moment noch nicht offenbar. Während er nämlich sein medizinisches Wunderwerk verrichtete, war er hoch oben im Wipfel eines hässlichen, alten Baumes von einem greisen Kolkraben beobachtet worden. Ein Rabe, werden Sie jetzt spotten. Was soll an diesem Raben denn so besonderes zu finden sein? Nun, ich werde es Ihnen sagen. Nach außen hin schien er zwar freilich nur dazusitzen, erstarrt wie ein Ölgötze, kreischte nicht und putzte sich nicht das Gefieder... und doch nahm er die Geschnisse zu seinen Füßen - pardon, Krallen - mit wachendem Blick wahr, und nicht das kleinste Detail entging ihm. Bei diesem Raben (dessen Name übrigens Ptolemäus war, auch wenn diese Geringfügigkeit für den weiteren Verlauf der Geschichte keine große Rolle spielt) handelte es sich nämlich um ein sehr intelligentes Tier, und der Auftrag, mit dem sein Meister ihn betraut hatte, war von größerer Wichtigkeit, als man es bei einem Vogel von seiner klapprigen, mattfiedrigen Gestalt vermuten würde.
Nun, da er gesehen hatte, was er zu sehen brauchte, breitete er die Flügel aus und rauschte davon, unbemerkt und schweigend. Wohin sein Flug ihn führen würde, soll zunächst einmal ein Geheimnis bleiben.
Richten wir an dieser Stelle also unser Hauptaugenmerk wieder auf das weitere Ergehen des Monsieur Dupont senior. Nachdem im Speisezimmer also der Tisch gedeckt, die Kerzen angezündet und die Servietten gefaltet worden waren, erwartete das Hauspersonal den hohen Gast in geschäftiger Anspannung. Als es schließlich an der Tür schellte, eilte Adéláde, das Dienstmädchen, ins Foyer, um den Besuch mit einem adretten Knicks in Empfang zu nehmen.„Jacques!“, rief der Hausherr überspitzt und lief ihm mit ausgestreckten Armen entgegen. „Hugo, mein Guter.“ Sie umarmten sich eilig. „Gestatten Sie“, kokettierte die Frau Gemahlin gleich mit einem sehnsüchtigen Wimpernschlag.
„Madame Claudette Dupont.“ „Sehr erfreut, sehr erfreut.“ Delacroix reichte Alphonse Hut und Gehrock, die dieser mit fließenden, eleganten Bewegungen an die Garderobe brachte. Ein kleiner Junge, der vielleicht acht Jahre zählen mochte und für sein Alter schon sehr starr und dünkelhaft dreinschaute, folgte ihm durch den Türrahmen.
„Mein Sohn.“ Er wandte sich an das Kind.„Jules, sei so freundlich und reiche den Herrschaften die Hand.“ „Guten Tag“, sagte der Junge nasal und zog die Augenbrauen hoch, als er bemerkte, wie überfreundlich Madame Dupont ihn begrüßte.
„Ein anständiger und gut erzogener Knabe!“, lobte sie entzückt und seufzte.„Wenn ich nur dasselbe über unseren Alexandre sagen könnte, ach nein, ach nein!“ „Sie müssen wissen“, merkte Hugo, peinlich berührt von der Offenherzigkeit seiner Frau, an, „dass unser Alexandre nicht immer ganz...“ - er rang nach Worten - „den allgemeinen Erwartungen entspricht.“ Sie geleiteten die beiden an die reich gedeckte Tafel. Der Hausdiener zog den Herrschaften zuvorkommend den Stuhl zurück, und Adéláde bemutterte sie nach Kräften, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. „Etwas Wein, Jacques?“ „Kommt drauf an.“ „Was sagen Sie zu einem Côte Rôtie, jahrelang gereift in Bordelaiser Eichenfässern? Passt hervorragend zum Hauptgang.“ Er zog eine dickbauchige, olivgrüne Flasche hervor, deren Etikett von Hand beschrieben war. „Dazu kann ich ja nun schwerlich nein sagen“, entgegnete sein Handelspartner und lachte heiser. Hugo schenkte ihm höchstpersönlich ein, mit einer ungeheuerlichen Gewissenhaftigkeit, die wohl aus seinem wahnsinnigen Streben nach Perfektionismus entstammte. Wie gerufen kam dann auch schon Alphonse mit den Speisen in den Salon. Es gab Fasanenbrust, sorgsam angerichtet auf einem Silbertablett mit gepfefferten Lorbeerblättern und Champagnerkraut, dekoriert mit einem Kranz aus Trauben und Äpfeln. Den Anwesenden lief das Wasser im Mund zusammen, als der würzig-deftige Geruch sich verteilte und begann, ihre Nasen zu umschweben. Ihre Manieren nicht vergessend, sprachen sie zuerst ein Tischgebet, um dann sorgfältig und beflissen zum Akt des Schmausens voranzuschreiten. Das Fleisch war exzellent, und Hugo nahm sich fest vor, der Köchin Babette ein Lob auszusprechen, wenn Jacques und sein hochnäsiger Sohn erst wieder verschwunden waren. „Ausgezeichnet“, bekräftigte der Gast mit vollem Mund. „Ganz ausgezeichnet. Wenn ich wohl noch etwas von der Fasanenbrust bekommen dürfte?“ Nachdem sich dann schließlich bei jedem der Versammelten ein annäherndes Gefühl der Sättigung eingestellt hatte, räumten die Bediensteten das benutzte Geschirr ab. Kurz darauf wurde das Dessert gereicht, eine Torte mit viel Marzipan, Sahne und einer kleinen Walnuss obenauf. Nachdem auch diese restlos verzehrt worden war, wagte der Hausherr den entscheidenden Schritt.„Wollen wir nun zum Geschäftlichen voranschreiten?“ „Aber liebend gerne“, antwortete Delacroix mit einer Spur von Amüsement, die in seiner Stimme mitschwang. Sie gingen ins Kaminzimmer, wo sie auf den Sesseln Platz nahmen. Hugo befeuerte die heruntergebrannte Glut im Ofen ein wenig mit frischen Scheiten, woraufhin es wieder angenehm zu knistern begann und vor lauter Behaglichkeit die Tristesse des herannahenden belgischen Winters vergessen ließ. „Hier ist der Kontrakt.“
Jacques nahm das Blatt in die Hand, drehte und wendete es und überflog das Kleingedruckte summend.„Schön, schön.“ Er zückte einen versilberten Füllfederhalter und setzte an, um seinen Namen darunter zu setzen. Genau in diesem Moment klopfte es an der Tür, und Jacques unterbrach sein Werk, um aufzusehen. Hugo knirschte verärgert mit den Zähnen. Die Klinke wurde nach unten gedrückt, und Alexandre trat ein. Seine Haare waren vom Wind zerzaust und er trug noch seine Stiefel, was im Hause eine Ungeheuerlichkeit war; und er brachte diesen eigentümlichen, unangenehm eindringlichen Geruch mit, den jemand zu eigen hatte, wenn er durch die Kälte gewandert war. „Guten Tag“, rief er freundlich und unbekümmert und lief mit ausgestreckter Hand auf den Gast zu. Sein Vater rollte die Augen und versuchte, den ungebetenen Störfaktor mit seiner Gestik und Mimik aus dem Raum zu scheuchen. Alexandre schien das nicht einmal zu bemerken. Plötzlich erhob sich der faulpelzige Boudewijn, der bis eben unbemerkt auf dem Teppich gelegen und geschlafen hatte, und streckte sich mit einem behäbigen Grunzen. Dupont junior, der das Tier gar nicht wahrgenommen hatte, stolperte über diesen, fiel der Länge nach hin und hielt sich an einer Kommode aus Zedernholz fest, um sich wieder aufzurichten. Dabei kippte die Kommode und das darauf stehende chinesische Porzellan zersprang mit einem Klirren in tausend Stücke. „Oh!“, machte Delacroix und sprang sofort auf, um den tollpatschigen Jungen beim Auflesen der Scherben behilflich zu sein. Hugo rief puterrot an und drohte beinahe, in einen unberechenbaren Tobsuchtsanfall auszubrechen. Alexandre hingegen, der aufstand, um sich nach einem Besen oder ähnlichem umzusehen, traf mit seinem Kopf das Kinn des über ihn gebeugten Jacques, der daraufhin hintenüber fiel, sich den Kopf an der Sessellehne stieß und stöhnend zu Boden ging. „Ach du liebes bisschen!“, lamentierte der Junge erschrocken und hastete in die Küche, um ein rohes Stück Fleisch zu ergattern, mit dem er die Beule des Verletzten kühlen konnte. Eilig hastete er ins Kaminzimmer, stolperte abermals über den sich reckenden und streckenden Boudewijn und stürzte geradewegs auf den auf dem Boden liegenden und sich den Schädel reibenden Gast. Er landete genau auf dessen Bauch, woraufhin dieser gepeinigt aufschrie. „Runter von mir!“, zischte er unter Schmerzen. „Ich habe hier genau das Richtige für Sie“, beschwichtigte Alexandre und versuchte, dem sich windenden Monsieur Delacroix das Fleisch auf die Beule zu legen. Dabei entglitt das saftige Stück seinen Händen und klatschte genau in das Gesicht des armen Jacques. „GENUG!“, brüllte der Hausherr, nun vollends den letzten Rest seiner Beherrschung verlierend.„ZUM TEUFEL MIT IHNEN! RAUS HIER! RRRRRAUS!“ „Nun gut“, reagierte sein Geschäftspartner eingeschnappt und erhob sich schwerfällig. „Was immer Sie wünschen, Monsieur Dupont. Dann sehe ich mich gezwungen, mein Geld wohl anderweitig investieren zu müssen.“
„HALTEN SIE DEN MUND!“, schimpfte Hugo und scheuchte ihn zur Tür hinaus, die er scheppernd hinter ihm in Schloss warf. „Und du!“ Er fixierte mit wahnsinnigem Blick seinen Sohn, der vergeblich versucht hatte, sich unbehelligt aus dem Staub zu machen, während der Hund unter zufriedenem Sabbern das direkt vor seiner Schnauze gelandete Filethäppchen vergenussferkelte. „Pack deine Sachen. Es wird Zeit, dass du lernst, auf eigenen Beinen zu stehen.
Ich will dich nie wieder hier sehen, hast du verstanden?“ Er zog eine Augenbraue hoch, um zu untersuchen, ob seine Worte auf Verständnis gestoßen waren. Alexandre nickte nur kleinlaut.
„Wie Sie wünschen, père.“ „Nenn mich gefälligst nicht so.“ Als er durch das Entree ging, um die Treppe hinauf in sein Zimmer zu nehmen, sah er gerade noch, wie Jacques und dessen Sohn beleidigt durch die Haustür abzogen. Sein Zimmer erwartete ihn wie ein alter, treuer Freund, in dessen vertrautem Schutze er erleichtert aufatmen konnte.
Er ließ sich auf einen Hocker plumpsen und nahm ein Buch zur Hand. Es war ein alter, speckiger Wälzer mit vergilbten Seiten und zerfleddertem Einband, war es doch von allen seinen Büchern das, das er am häufigsten gelesen hatte. Leben und Werk des Hippokrates von Kos, stand in goldgeprägten Lettern auf dem königsblauen Buchdeckel aus Leinen. Er seufzte, blätterte es missmutig durch und stellte es dann zurück ins Regal. Dieses Mal war es seinem Vater ernst gewesen, das wusste er. Vielleicht war es ja auch nur zu seinem eigenen Besten, wenn er sich auf den Weg machte, um die weite Welt kennenzulernen.
Er dachte an all das Wissen, das dort draußen nur auf ihn wartete; die Art von Wissen, die in keinem Buch, sondern nur in der Begegnung mit dem Leben selbst zu finden war. Doch wohin gehen?, fragte er sich. Er öffnete sein Fenster und atmete die klare, kühle Luft ein. Von irgendwo her vernahm er das unverkennbare Kreischen eines Raben, und dann dessen unsteten Flügelschlag, der immer und immer näherzukommen schien. Er streckte den Kopf heraus und sah sich verwirrt um, nur um ihn im nächsten Augenblick bereits wieder erschrocken einzuziehen. Ein Kolkrabe mit pechschwarzem Gefieder befand sich im Sturzflug, genau auf ihn zu, landete gekonnt auf dem Sims seines Fensters und musterte ihn mit seinen kleinen, grauen Perlaugen. Im Schnabel trug er einen Brief, der von Wind und Wetter ganz aufgeweicht war, ließ ihn fallen und war sofort wieder verschwunden. Vorsichtig näherte sich Alexandre dem mysteriösen Schriftstück und betrachtete den Umschlag. J. S. stand in krakeliger Handschrift darauf, sonst nichts. Er öffnete ihn und entfaltete das Papier.
Marienplatz Nummer Fünf, Prag.Ich erwarte dich am dritten Novemberfreitag, bei Einbruch der Dunkelheit.
Gezeichnet, ein alter Freund.
Ungläubig schüttelte er den Kopf. Ein alter Freund. Er hatte nicht den Hauch einer Ahnung, um wen es sich handeln mochte, doch der Brief war an ihn adressiert, keine Frage; an den hochverehrten Monsieur Alexandre Dupont stand groß in der Kopfzeile. Es war ein Wagnis, diesem ominösen Lockruf leichtfertig zu folgen, dessen war er sich wohl bewusst, und unvernünftig sowieso, da ihm der Absender und dessen Absichten gänzlich unbekannt waren. Der dritte Novemberfreitag? Aber das war ja schon übermorgen! Was für ein hoffnungsloses Unterfangen also, rechtzeitig in Prag zu sein bis zum besagten Zeitpunkt. Aber... wenn es sich nun wirklich um eine Angelegenheit von solcher Wichtigkeit und unaufschiebbarer Dringlichkeit handelte, dass ihm gar keine andere Wahl blieb? Er wägte die Für- und Gegenargumente sorgsam ab, doch wie es der Natur des Menschen nun einmal zu eigen ist, nahm schließlich und endlich die Neugier überhand. So war der Entschluss schnell gefasst, zumal der Brief ihn wie durch ein Wunder gerade dann erreicht hatte, als er ein Zeichen, einen Ratgeber, einen Richtungsweiser, mehr als alles andere benötigt hatte. Er öffnete den Kleiderschrank und begann, seine Garderobe unwirsch in den Reisekoffer zu verfrachten. Nun war klar, was er zu tun hatte: Seine Reise würde ihn nach Böhmen führen, mitten hinein in die alten Mauern und verwinkelten Gassen der Goldenen Stadt.
- Zwei - - Von Antwerpen nach Prag -
In aller Herrgottsfrühe stieg Alexandre aus seinem Bett, schlüpfte eilig in Hemd, Hose und Stiefel und warf den Mantel über. Vorsichtig schloss er seine Zimmertür auf und warf einen Blick in den Korridor. Niemand war zu sehen. Mucksmäuschenstill schlich er über die alten Dielen, ohne den kleinsten Laut von sich zu geben. Als er im Foyer angekommen war, verharrte er einen Moment unter der Freitreppe und lauschte. Nichts. Hugo und Claudette schliefen also noch tief und fest, genau wie das Hauspersonal. Im Entree lag der schwermütige, alte Boudewijn auf den Marmorfliesen und schnarchte.„Psssst“, machte der Junge und legte den Zeigefinger an die Lippen, als würde es etwas nützen. Auf leisen Sohlen arbeitete er sich vorwärts, immer näher und näher heran zur Tür. Der Bernhardiner schüttelte sich im Schlaf und Alexandre fürchtete für einen unheilvollen Moment, er würde tatsächlich aufwachen. Umso erleichtert war er, als er die allmorgendliche Tortur hinter sich gebracht hatte und die Haustür hinter ihm ins Schloss fiel.
Endlich aufatmend wischte er sich mit den Handrücken ein paar imaginäre Schweißtropfen von der Stirn. Diese ewige Geheimniskrämerei machte ihm zu schaffen, aber sie war zwingend erforderlich. Was für ein Skandal es wäre, wenn die Sache mit... aber er mochte gar nicht daran denken. Es jedoch gänzlich zu unterlassen... nein, das konnte er nicht. Er steckte seine Hand in die Manteltasche und prüfte sie auf ihren Inhalt. Zu seinem Glück waren noch ein paar belgische Franc darin, die ihm sehr zupass kamen. Wie unhöflich, wenn er mit leeren Händen aufkreuzen würde! Er schüttelte sich und eilte die Rue des Marchands herunter. Die Straße war kurz, breit und eben gepflastert, und zu beiden Seiten rahmten sie hoch aufragende Hansekontore, pragmatische Backsteinspeicher und prunksüchtige Kaufmannshäuser ein. Antwerpen so früh am morgen war bei weitem das Schönste, das er sich hätte vorstellen können. Die Alleen waren wie leergefegt, und über den Dächern vertrieb der zarte Aquarellhauch der Morgendämmerung das nächtliche Schwarz. In einer kleinen Seitenstraße fand er eine alte, gebeugt gehende Frau mit Kopftuch, die Rosen verkaufte, und ihn mit zitternder, dünner Stimme darum anflehte, doch Gnade walten zu lassen mit einem greisen Mütterchen wie sie es war. Er kaufte ihr, zufrieden über diese Fügung des Schicksals, gleich den ganzen Strauß ab. Sein Weg führte ihn nun geradewegs zum Großen Markt, dem Hauptplatz der Stadt. Er wurde an zwei Enden durch die hohen Gildehäuser begrenzt, die an der Ostseite wie ein Winkel zusammenliefen, und im Westen durch die breiten, prächtigen Flügel des Rathauses mit den goldenen Figuren auf dem Giebel. Im Zentrum des Ganzen erhob sich ein unförmiges Wasserspiel, vor dem ein Mädchen wartete. Sie war jung und wunderschön, hatte ein rundes, blasses Gesicht und eine kleine Nase, hochgesteckte, schwarze Locken und Augen, die ihn anstrahlten wie Smaragde. Sie trug ein langes, scharlachrotes Kleid aus Pariser Seide, dessen Ärmel ganz aus edler Spitze waren und zu den Händen hin in weiße, ellenbogenlange Satinhandschuhe übergingen. „Désirée“, seufzte Alexandre und küsste ihre Hand. Sie zog ihn an sich und küsste zweimal, links und rechts seiner Wange, in die Luft. „Hier“, sagte er und reichte verlegen die Rosen. Sie nahm sie ihm ab, warf einen kurzen Blick darauf, ohne sich zu bedanken, und wandte sich dann wieder ihm zu. „Ich hasse es, dass wir uns immer zu so früher Stunde treffen müssen...“, flüsterte er dann, um die Stille zu überbrücken. „Jedes mal, wenn ich mich aus dem Haus schleiche, fürchte ich aufs Neue, entdeckt zu werden.“ „Ich auch“, entgegnete sie tonlos. „Aber es gibt keinen anderen Weg… und schon bald werden wir uns wohl überhaupt nicht mehr treffen können.“ Er spürte, wie sich seine Muskeln verkrampften.„Warum?“, brachte er nur heraus, um nicht allzu entrüstet zu klingen. Er wollte sich nicht anmerken lassen, wie sehr diese Worte seine Kehle in Wirklichkeit zuschnürten.. „Meine Eltern werden mich verheiraten.“ Sie ließ die Worte verhallen, schluckte hörbar und senkte den Kopf.
„Mit diesem schmierigen François van Dijk.“ Die Nachricht traf ihn wie ein Schlag. „Der Sohn des Bürgermeisters?“ „Genau der. Meine Eltern wollen so ihren Einfluss vergrößern. Es ist meine Pflicht, sagen sie. Für das Wohl des Hauses Lafayette. Wenn du mich fragst, mir kann diese ganze Bagage gestohlen bleiben.“ „Aber... mein Vater ist Hugo Dupont! Der reichste Mann in ganz Antwerpen! Mit mir wäre deine Zukunft gesichert.“ Sie kicherte hell und warmherzig. „Du weißt, dass das nicht stimmt. Wenn Monsieur Dupont stirbt, wird sein Handelsimperium mit ihm begraben. Es ist meinen Eltern nicht entgangen, dass du keinerlei Interesse daran zeigst, sein Lebenswerk fortzuführen, wenn er sich dazu nicht mehr imstande sieht.“ Es klang nicht wie ein Vorwurf. Viel eher klang es stolz und bewundernd, dass er immer noch tat, was ihm gefiel, trotz der unaufhörlichen Missbilligung durch seine Eltern. „Da hast du nur allzu recht.“ Er verschränkte die Finger und ließ die Gelenke knacken. „Ich kann es einfach nicht ändern. Mein Interesse sind und bleiben die Arzneien. Es ist einfach... etwas, das ich gut kann. Etwas, worauf ich stolz sein darf.“ Sie nickte verständnisvoll. Dafür liebte sie ihn. Er wusste, was er wollte, selbst wenn es nicht immer den Anschein hatte. Egal, wie tölpelhaft sich ihr Alexandre manchmal gebärdete, er blieb stets überzeugt von dem, was er tat, und unerschütterlich im Innersten. Auch wenn sie seine Begeisterung für Medizin und dergleichen nie hatte teilen können, war ihr doch nicht entgangen, wie viel sie ihm bedeuteten. „Désirée?“ Er riss sie aus ihren Gedanken.„Ja?“ Alexandre blickte drein, als würde ihm etwas Wichtiges auf der Zunge liegen, das er einfach nicht über die Lippen bringen konnte. Es schien ihn sichtlich Überwindung zu kosten. Er hüpfte immer wieder von einem Fuß auf den anderen - links, recht, links, rechts - und atmete geräuschvoll aus. In der Kälte gefror sein Atem augenblicklich und stieg gen Himmel empor, wo er sich langsam verflüchtigte. „Es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss.“ Désirée Lafayette musterte ihn schweigend mit ihren großen, unbegreiflichen Augen. „Leider verhält es sich folgendermaßen... bereits heute Abend werde ich nicht mehr in Antwerpen sein. Ich fahre nach Prag.“ „Nach Prag?“ Sie sagte das, als wäre es eines der schlimmsten nur erdenklichen Verbrechen.
„Genau. Versteh mich nicht falsch. Ich fliehe nicht. Na ja, in gewisser Weise schon... Aber... das ist nicht der eigentliche Grund.“ Er seufzte traurig.
„Ich will dich nicht im Stich lassen... vor allem nicht jetzt.“ „Nach Prag?“, fragte sie noch einmal mit Nachdruck. „In Gottes Namen, aber warum?“ „Du magst mich jetzt vielleicht für verrückt halten, aber... ich habe nicht die geringste Ahnung. Es gibt eben Wagnisse im Leben, die man eingehen muss.
Weil man weiß, dass einen die Frage, was passiert wäre, wenn man es doch getan hätte, in den Wahnsinn treiben wird.“ Er lächelte so unschuldig wie ein Kind. „Zumal ich keine große Wahl habe.
Bis heute Abend muss ich mein Zimmer geräumt haben.“ Désirée schaute ihn verständnislos an, dann lachte sie herzhaft und schallend.„Oh, Alexandre. Du bist... du bist so ein kleiner Junge.
Ich kann es einfach nicht wahr haben. Du, ganz alleine, in so einer großen Stadt.“ In ihrer Stimme schwang echte Besorgnis mit. „Versprich mir nur eins.“ „So?“, machte er und sah sie fragend an.
„Vergiss mich nicht.“ Dann fiel sie ihm in die Arme.
Am Abend, als die versinkende Sonne den Horizont in das Rot von glühenden Kohlen übergehen ließ, begleitete Hugo Dupont seinen Sohn zum Zentralbahnhof. Dieser blickte der nahenden Abreise mit gemischten Gefühlen entgegen. Neugier, da er beim besten Willen nicht wusste, was nun auf ihn zukommen würde. Er brannte darauf, den Absender des Briefes ausfindig zu machen und zu ergründen, wie dessen Beweggründe waren. Angst, falls es sich nur um einen Dummerjungenstreich handelte, dem er blindlings folgte. Und zu guter letzt Stolz darauf, dass er gerade im Begriff war, sich ohne zu zögern ins Abenteuer zu stürzen. Wobei dies auch dem Wahnsinn zuzurechnen sein könnte. Seine schweißigen Hände umklammerten den Griff des schweren Reisekoffers fester. Sie wanderten die Avenue de Keyser, die belebte Hauptstraße der Stadt, herunter, und Hugo, der sich auf seinen Gehstock stützte und die vorbeiziehenden Passanten argwöhnisch musterte, sagte kein Wort.
Das Bahnhofsgebäude war schrecklich protzig und beinahe riesenhaft zu nennen, mit viel Goldornamentik und hohen Fenstern. Über dem ganzen steinernen Gebilde thronte eine gigantische Kuppel. Die Empfangshalle war von unbeschreiblicher Wucht und Größe, der Boden mit Marmor gefliest und die Wände verziert mit Säulen, Statuetten, Stuck und Wappen aus Blattgold. Alexandre legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben, wo sich das Innere der Kuppel über ihm aufbaute.
Über den Durchgängen zu den Gleisen in südlicher Richtung war eine Bahnhofsuhr mit römischem Ziffernblatt angebracht, die tickend ihrem monotonen Tagewerk nachging. „Dein Zug fährt in sechs Minuten an Gleis Dreizehn, Richtung Brüssel.“ Er sah seinen Sohn missgünstig an. „Hast du das verstanden?“ Alexandre war wieder heillos in Gedanken versunken.„Hast du das verstanden?“, fragte er ungeduldig.„Ja. Natürlich, Monsieur.“ „Gut.“ Er drückte ihm seine Fahrkarte und ein dickes Bündel belgischer Franc in die Hand. „Verliere es nicht.
Und jetzt verschwinde.“ Dann machte er auf dem Absatz kehrt und entfernte sich mit eiligen Schritten, ohne sich umzudrehen. Alexandre würdigte ihn keines Blickes mehr und hielt stattdessen Ausschau nach dem entsprechenden Gleis. Der Zug, eine klapprige Lokomotive, deren Schlot die Luft mit mehr Ruß verpestete als ein Stahlwerk, wartete pfeifend und schnaufend auf den Schienen, bereit zur Abfahrt. Der uniformierte Schaffner, der Uhrzeit entsprechend kauzig und grob, überprüfte wenig enthusiastisch die Karte und winkte ihn durch. Die Wagons waren schlicht und ordinär, die hölzernen Sitze unbequem. Außer ihm waren ein altes Ehepaar (der bullige, halslose Mann - mit einem ordentlichen Schnauzbart - trug einen Zwicker und einen Zylinder; die Frau hingegen war sehr groß und dünn, mit eingefallenen Wangen und langen Wimpern, sie trug einen exklusiven Schlapphut aus Samt und eine rabenschwarze Federboa - die beiden sprachen kein Wort, und obwohl sie nebeneinander saßen, waren sie verkrampft und schienen sich auch sonst





























