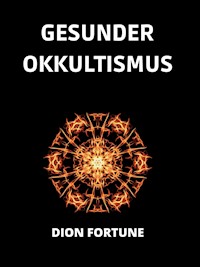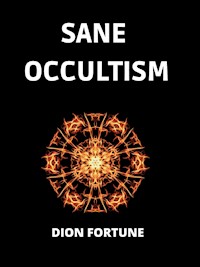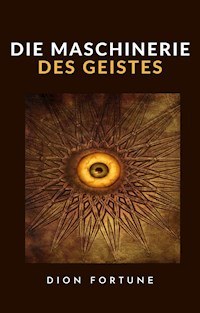Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser fantastische Roman von Dion Fortune, der bekannten englischen Autorin, führt die LeserInnen in die Mythologie der Kelten, das sagenhafte Atlantis und zu einer faszinierenden Frauengestalt: Vivian le Fay Morgan. Mit den Geheimnissen der Magie vertraut, verwandelt sie sich in ihre Namensschwester Morgan le Fay, die Seepriesterin von Avalon, Pflegetochter von Merlin, dem Zauberer aus der Artussage. Schauplatz dieser dramatischen Geschichte ist ein einsames Fort an der Küste Cornwalls. Wilfred Maxwell, ein von Mutter und Schwester gegängelter Junggeselle, verliebt sich in Morgan und folgt ihr auf der Suche nach dem Geheimnis der Magie zu einem alten Kult, wo sie die spirituelle Bedeutung der Magie des Mondes und das Mysterium von Tod und Wiedergeburt erfahren. Die SEEPRIESTERIN, 1938 erstmals in englischer Sprache erschienen, gehört zu den klassischen spirituellen Werken des 20. Jahrhunderts und gilt als einer der schönsten Romane, der je über Magie geschrieben wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dion Fortune
Die Seepriesterin
Mystic Fantasy
Aus dem Englischen neu bearbeitet von
Mara Ordemann
Smaragd Verlag
Bitte fordern Sie unser kostenloses Verlagsverzeichnis an:
Smaragd Verlag e.K.
Neuwieder Straße 2
56269 Dierdorf
Tel.: 02689.92259-10
Fax: 02689.92259-20
E-Mail: [email protected]
www.smaragd-verlag.de
Oder besuchen Sie uns im Internet unter der obigen Adresse und melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Originaltitel: „The Seepriestess“
Erstauflage Dion Fortune 1938
© Smaragd Verlag, 56269 Dierdorf
Deutsche Erstausgabe September 1989
Vollständig überarbeite Neuauflage Januar 2017
© Cover: kevron2001 - fotolia.com
Umschlaggestaltung: preData
Satz: preData
ISBN (epub) 978-3-7418-8120-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, übernehmen wir für deren Inhalt keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1
Ein Tagebuch zu führen ist für die meisten unserer Zeitgenossen eine schlechte Angewohnheit, jedoch eine Tugend in den Augen unserer Vorfahren. Ich muss mich zu dieser Untugend bekennen, wenn es überhaupt eine Untugend ist, denn eine ganze Reihe von Jahren habe ich recht ausführlich Tagebuch geführt. Ich liebte die Beobachtung, aber es fehlte mir an Fantasie. Ich wäre lieber der Chronist einer großartigen Geschichte gewesen, aber eine solche ist mir leider nicht untergekommen. Ich mache mir keinerlei Illusionen, mein Tagebuch sei Literatur, aber es hat mir als Ventil gedient zu einer Zeit, als ein Ventil dringend nötig war. Ich glaube, ohne dieses wäre es mehr als einmal zu einem Skandal gekommen.
Man sagt, Abenteuer seien für die Abenteuerlustigen, aber man kann schlecht auf Abenteuersuche gehen, wenn es Menschen gibt, die von einem abhängig sind. Hätte eine junge Frau sich auf das Abenteuer, mit mir zu leben, eingelassen, wäre diese Geschichte anders verlaufen; aber meine Schwester war zehn Jahre älter und meine Mutter behindert, und das Familienunternehmen brachte gerade genug ein, uns alle drei in meinen wilden Jugendjahren über Wasser zu halten. Abenteuer waren daher nichts für mich, es sei denn, mit einem Risiko für andere, was, wie ich meine, nicht vertretbar gewesen wäre. Daher also die Suche nach einem Ventil.
Die alten Tagebücher liegen Band für Band in einer Blechkiste auf dem Dachboden. Ab und zu habe ich hineingesehen, aber sie sind langweilig; meine einzige Freude lag darin, sie zu schreiben. Sie sind eine objektive Chronik von Ereignissen, durch die Brille eines Geschäftsmannes aus der Provinz gesehen, und daher sehr dünnes Bier, wenn ich das mal so sagen darf.
Aber an einem gewissen Punkt gibt es eine Wendung. Das Subjektive wird objektiv. Aber wo und wie, kann ich nicht genau sagen. Bei dem Versuch, Klarheit in die Angelegenheit zu bringen, begann ich, die späteren Tagebücher systematisch durchzulesen und schließlich abzuschreiben. Es ist eine seltsame Geschichte daraus entstanden, und ich behaupte nicht, sie zu verstehen. Ich hatte gehofft, beim Schreiben mehr Klarheit zu gewinnen, aber das war unmöglich: im Gegenteil, die Sache ist noch verwirrender geworden, und hätte ich nicht die Angewohnheit mit dem Tagebuch gehabt, wäre vieles in Vergessenheit geraten. Das Gedächtnis hätte dann die Geschehnisse nach dem eigenen Gutdünken betrachtet, um den bereits bestehenden Vorstellungen zu entsprechen, und das Unverständliche wäre unbeachtet ad acta gelegt worden.
Aber da die Dinge schwarz auf weiß vor mir lagen, war dieses nicht möglich, und ich musste ihnen als Ganzes gegenübertreten. Ich halte sie fest, so, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Ich selbst kann ihren Wert nicht beurteilen. Auch wenn es nicht Literatur ist, so erscheint mir das, was geschehen ist, alleine von den Tatsachen her schon ein interessantes Kapitel unserer Geistesgeschichte zu sein, und wenn ich aus dem Nach-Erleben so viel lerne, wie ich aus dem Erleben selbst gelernt habe, hat es sich für mich gelohnt.
Es begann mit einer Auseinandersetzung über Geld.
Unser Unternehmen ist ein Immobilienbüro, das ich von meinem Vater geerbt habe. Ich war stets ein guter Geschäftsmann, aber bei Spekulationen geriet ich regelmäßig in Schwierigkeiten. Mein Vater hatte niemals dem Versuch widerstehen können, ein Geschäft zu ergattern. Wenn also ein Haus, von dem er wusste, dass der Bau zehntausend Pfund gekostet hatte, für zweitausend wegging, musste er es haben. Aber niemand wollte diese großen weißen Elefanten haben, und so erbte ich eine ganze Herde von ihnen. In meinen Zwanzigern und auch noch weit über die Dreißiger hinaus mühte ich mich mit diesen Biestern ab, ging mit ihnen Stück für Stück hausieren, bis das Geschäft wieder gesund war und ich in der Lage, das zu tun, was ich schon lange hatte tun wollen – es verkaufen, – denn ich hasste es und das ganze Leben in dieser todlangweiligen Stadt; ich wollte das Geld verwenden, um mich in einen Verlag in London einzukaufen. Das, so dachte ich, würde mir den Einstieg in ein Leben verschaffen, das mich faszinierte. Außerdem schien mir dieser Plan keine wilde Spekulation zu sein, denn Geschäft ist Geschäft, ob man nun Ziegelsteine oder Bücher verkauft. Ich hatte jede Biografie gelesen, derer ich habhaft werden konnte und die sich mit der Welt der Bücher beschäftigte, und glaubte, dies könnte etwas für jemanden sein, der mit Geschäftsdingen vertraut war. Es mag natürlich sein, dass ich mich irrte, hatte ich doch keinerlei Erfahrung mit Büchern und ihren Machern aus erster Hand, aber so sah es damals für mich nun einmal aus.
Ich gab die Idee an meine Mutter und Schwester weiter. Sie waren nicht dagegen, vorausgesetzt, ich wollte nicht, dass sie mit mir nach London kämen. Das war eine Gunst, die ich gar nicht erwartet hatte, fürchtete ich doch, ein Haus für sie mieten zu müssen, denn meine Mutter würde sich nie mit einer Wohnung zufriedengeben. Ich sah meinen künftigen Weg vor mir, so, wie ich ihn mir nie zu erträumen gewagt hätte – ein Junggesellenleben in Künstlerkreisen, als Clubmitglied und Gott weiß nicht was alles. Aber dann kam der große Knall: Die Geschäftsräume unseres Unternehmens lagen in einem Teil des alten georgianischen Hauses, in dem wir immer gelebt hatten. Es war unmöglich, das Geschäft ohne das Grundstück zu verkaufen, denn es war die beste Lage in der Stadt, aber die beiden Damen wollten nicht zustimmen.
Ich denke, ich hätte es durchboxen und das Haus über ihre Köpfe hinweg verkaufen können, aber das wollte ich nicht, da mich meine Schwester, aber auch meine Mutter hinreichend bearbeiteten, und so gab ich schließlich nach und beschloss, zu bleiben, wo ich war.
Und so gelang es schließlich Mutter und Schwester, mich zum Blieben zu ‚überreden‘.
Mein eigentliches Problem war, dass mir gleichgesinnte Freunde fehlten, und die Aussicht, diese jemals zu bekommen, hatte mich auf die Verlagsidee gebracht. Dennoch, Bücher sind kein schlechter Ersatz, und vielleicht wäre ich sehr enttäuscht worden, wenn ich nach London gegangen wäre und versucht hätte, Freunde zu gewinnen. Schließlich stellte es sich heraus, dass es gut gewesen war, dieses Abenteuer nicht zu wagen, denn kurz darauf brach mein Asthma aus, und ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, den Trubel in London zu ertragen.
All das klingt nicht nach einer geschäftlichen Sensation. Und eine solche gab es bei der tatsächlichen Entscheidung auch gar nicht. Die Sensation kam, nachdem alles geklärt war und ich mich entschieden hatte, zu bleiben.
Es war Sonntag und Abendbrotzeit. Nun, ich mag kein kaltes Abendbrot, und der Vikar hatte an diesem Abend eine wirklich alberne Predigt gehalten. Meiner Mutter und Schwester hatte die Predigt jedoch gefallen. Sie sprachen darüber, fragten mich nach meiner Meinung, mit der ich nicht freiwillig herausrücken wollte, und dann, Narr, der ich war, sagte ich, was ich dachte und bekam eins drauf, und dann, aus Gründen, die ich nie habe herausfinden können, ging ich bis zum bitteren Ende und schrie: „Solange ich hier die Brötchen verdiene, werde ich bei Tisch das sagen, was ich sagen will!“ Da ging es erst richtig los. Nie in ihrem ganzen Leben hatte jemand meinen beiden Damen eine solche Kost geliefert, und sie schmeckte ihnen gar nicht. Sie waren beide in der Gemeindearbeit erfahren, und nach dem ersten Zusammenprall war ich ihnen nicht mehr gewachsen. Ich verließ den Raum, knallte die Tür hinter mir zu, schoss die Stufen, drei auf einmal nehmend, hinauf, das schrecklich kalte Sonntagabendessen im Magen, und bekam, als ich halb oben war, meinen ersten Asthmaanfall.
Mutter und Schwester fanden mich schließlich, halb über dem Treppengeländer hängend, und waren entsetzt. Auch ich war entsetzt. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Asthma ist eine beängstigende Sache, selbst wenn man daran gewöhnt ist.
Es war jedoch nicht mein Ende, sondern der Beginn einer unglaublichen Geschichte.
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich nach dem Anfall im Bett lag. Ich glaube, man hatte mich unter starke Narkotika gesetzt; jedenfalls war ich halb bewusstlos und hatte das Gefühl, aus meinem Körper herausgetreten zu sein. Sie hatten vergessen, die Vorhänge zu schließen, und das Mondlicht lag voll auf meinem Bett. Ich war zu schwach aufzustehen und das Fenster abzudunkeln, und so beobachtete ich, wie der Vollmond durch den Dunstschleier einer Wolke über den nächtlichen Himmel glitt und fragte mich, wie wohl die dunkle Seite des Mondes wäre, die niemand je gesehen hat und jemals sehen wird. Der nächtliche Himmel hatte schon immer eine starke Faszination auf mich ausgeübt, und nie hatten das Wunder der Sterne und das noch größere Wunder des Weltraums für mich ihre Faszination verloren, denn für mich liegt im Weltraum der Anfang aller Dinge. Die These von Adam, der aus rotem Lehm geschaffen worden sein sollte, hatte mich nie überzeugt. Warum hatte Gott nicht nach den Regeln der Geometrie gearbeitet?
So lag ich dort, betäubt und erschöpft und halb hypnotisiert vom Mond. Ich ließ meinen Geist jenseits der Zeit bis an den Urbeginn reisen und sah die unendliche Weite des unendlichen Weltalls, indigoblau in der Nacht der Götter, und mir schien, dass in dieser Dunkelheit und in diesem Schweigen der Keim liegen müsse. Und da dieser Keim in sich die werdende Blume trägt und diese wieder die Saat für eine neue Blume, musste alle Schöpfung im unendlichen Raum liegen, und ich war ein Teil des Ganzen.
Es kam mir wie ein Wunder vor, dass ich dort, hilflos an Geist und Körper, lag und dennoch meine Verbindung zu den Sternen verfolgen konnte. Bei diesem Gedanken überflutete mich ein seltsames Gefühl, und meine Seele schien in die Dunkelheit hinauszusteigen. Angst hatte ich nicht.
Ich fragte mich, ob ich tot wäre, so, wie ich geglaubt hatte, ich würde sterben, als ich über dem Geländer hing, und ich war froh, denn dies bedeutete für mich Freiheit.
Aber dann wusste ich, dass ich nicht gestorben war und auch nicht sterben würde, sondern sich durch die Schwäche und die Medikamente die Fesseln meiner Seele gelöst hatten. In jedem Menschen liegt eine Seite verborgen, wie auch der Mond seine dunkle Seite hat, aber mir wurde die Gnade geschenkt, sie zu sehen. Es war wie im Weltraum zwischen den Sternen in der Nacht der Götter, und dort lagen die Wurzeln meines Seins.
Mit dieser Erkenntnis kam ein tiefes Gefühl der Befreiung. Ich wusste, die Fesseln meiner Seele würden sich nie wieder ganz schließen. Ich hatte einen Weg zu der dunklen, unbekannten Seite des Mondes gefunden und erinnerte mich an die Worte von Browning:
„Gott sei gedankt, selbst die Seele des Geringsten seiner Sterblichen hat zwei Seiten: Eine, die er der Welt zeigt, und eine andere, die er der Frau offenbart, die er liebt.“
Es war eine eigenartige Erfahrung; aber sie ließ mich sehr glücklich zurück, und gestärkt, meine Krankheit mit Gleichmut zu ertragen: Für mich schienen sich geheimnisvolle Türen geöffnet zu haben. Viele Stunden lag ich allein und hatte kein Verlangen, mich mit meinen Büchern zu beschäftigen ─ aus Angst, der Zauber könnte sich verflüchtigen. Am Tag döste ich vor mich hin, und wenn es auf die Dämmerung zuging, wartete ich auf den Mond, und wenn er kam, war ich mit ihm verbunden.
Ich weiß nicht mehr, was ich zum Mond gesagt habe oder er zu mir gesagt hat. Es ist auch nicht wichtig, jedenfalls wurde ich sehr vertraut mit ihm und gewann den Eindruck, dass er über ein Königreich verfügte, das weder materiell noch spirituell, sondern sein eigenes seltsames Mond-Königreich war. In diesem Königreich bewegten sich die Gezeiten, niemals aufhörend, immer in Bewegung – auf und nieder, vorwärts und zurück, steigend und fallend; zurückkommend mit der Flut, abfließend mit der Ebbe; und diese Gezeiten beeinflussten unser Leben. Sie beeinflussten Geburt und Tod und alle Vorgänge im menschlichen Körper. Sie beeinflussten die Paarung der Tiere, das Wachsen der Vegetation und die heimtückischen Vorgänge der Krankheit. Sie beeinflussten auch die Reaktion auf Medikamente, und ein Teil davon war die Lehre von den Heilpflanzen. Alle diese Dinge erfuhr ich bei meiner Verbindung mit dem Mond, und ich war sicher, wenn ich mit dem Rhythmus und der regelmäßigen Wiederkehr seiner Gezeiten vertraut würde, dann würde ich sehr viel verstehen. Aber das war nicht erlernbar für mich; er konnte mich nur abstrakte Dinge lehren, und Einzelheiten schon gar nicht, weil sie für meinen Verstand nicht zu begreifen waren.
Je länger ich bei ihm verweilte, desto mehr wurde ich mir des Wechsels von Ebbe und Flut bewusst, und mein ganzes Leben begann, sich ihm anzupassen. Ich spürte, wie meine Lebenskraft stieg und sank und wieder stieg und sank. Und sogar als ich dieses meinem Tagebuch anvertraute, schrieb ich im Einklang mit seinem Rhythmus, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Erzähle ich jedoch von den Dingen des täglichen Lebens, so schreibe ich auch in den Stakkato-Rhythmen des täglichen Lebens. Nun gut, ich lebte im Einklang mit dem Mond in einer sehr seltsamen Weise, als ich dort krank daniederlag.
Meine Krankheit nahm ihren Verlauf, und ich kroch nach einigen Tagen wieder nach unten, mehr tot als lebendig. Meine Familie war sehr besorgt. Sie hatte einen heftigen Schock erlitten und machte viel Aufhebens um mich. Als die Neuigkeit jedoch ihren Glanz verloren hatte, nicht mehr so spektakulär war und zur Routine wurde, wurde die Geschichte langweilig. Der Doktor versicherte ihnen, ich würde an diesen Anfällen nicht sterben, auch wenn es sehr danach aussähe; so nahmen sie sie mehr und mehr mit Gelassenheit hin und ließen mich alleine mit ihnen fertig werden. Mir jedoch gelang es niemals, sie mit Gleichmut zu nehmen, und ich geriet jedes Mal neu in Panik. Man mag theoretisch wissen, dass man nicht daran stirbt, aber es ist einfach zu beängstigend, wenn man keine Luft bekommt. Wer würde da nicht in Panik geraten!
Nun, wie gesagt, alle gewöhnten sich daran, und schließlich wurde die Sache sogar lästig. Es war ein langer Weg mit dem Tablett vom Erdgeschoss bis zu meinem Schlafzimmer. Auch ich war es leid, denn wenn ich unter Atemnot litt, kam ich kaum die Treppe hinauf. So überlegten wir, ob ich das Zimmer wechseln sollte. Die einzige Alternative war eine Art Verlies mit Aussicht auf den Hof – oder ich hätte jemandem das Zimmer wegnehmen müssen. Ich muss jedoch gestehen, die Aussicht auf das Verlies erfüllte mich mit Unbehagen.
Dann fielen mir plötzlich die alten Ställe am Ende eines langen engen Streifens ein, den wir aus Höflichkeit Garten nannten; dort musste es möglich sein, eine Junggesellenwohnung einzurichten. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los, und ich machte mich auf den Weg durch eine Wildnis von Lorbeer, um herauszufinden, was sich daraus machen ließe.
Alles war scheußlich überwuchert, aber ich bahnte mir einen Weg und folgte der Spur eines längst verlorenen Pfades. Schließlich kam ich zu einer kleinen Tür mit einem Spitzbogen, einer Kirchentür nicht unähnlich, daneben eine Mauer aus verwitterten rötlichen Ziegelsteinen. Die Tür war verschlossen; ich hatte keinen Schlüssel, aber ein Druck mit der Schulter genügte, und ich fand mich in einem Wagenschuppen wieder. Auf der einen Seite lagen die Pferdeställe, auf der anderen war der Sattelraum. In der Ecke führte eine Wendeltreppe nach oben und verlor sich in Spinngeweben und Dunkelheit. Die Treppe kam mir recht wackelig vor, und so kletterte ich vorsichtig hinauf und landete oben auf dem Heuboden. Dieser war ganz in Dunkelheit gehüllt und nur durch einige Lichtstrahlen, die sich durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden hineinstahlen, erhellt.
Ich öffnete einen der Fensterläden und – hielt ihn in der Hand; er hinterließ einen breiten Spalt, durch den Sonnenlicht und frische Luft in das modrige Dunkel hereinbrachen. Ich lehnte mich hinaus und war sogleich begeistert von dem, was ich sah.
Der Name unserer Stadt, Dickford, bedeutet, dass sie an einem Fluss liegt; vermutlich der Fluss, der bei Dickmouth mündet, einem Seebad, etwa zehn Meilen entfernt. Also war der Fluss hier wahrscheinlich der River Dick, und obwohl ich hier geboren und aufgewachsen war, hatte ich ihn nie wirklich wahrgenommen. Er verlief durch eine kleine verwilderte Schlucht und musste ein ganz beachtlicher Fluss sein, nach dem zu urteilen, was ich durch die Büsche erkennen konnte. Ein Stück weiter verlief er offensichtlich unterirdisch, und die Häuser, die die alte Brücke ein wenig unterhalb säumten, verdeckten die Sicht auf den Fluss. Deshalb war mir nie aufgefallen, dass Bridge Street nicht nur von Brücke abgeleitet wird, sondern tatsächlich eine Brücke ist. Das hier war sogar ein richtiger Strom, etwa zwanzig Fuß breit, überhangen von Weiden wie ein totes Wasser an der Themse. Das war die Überraschung meines Lebens. Wer hätte gedacht, dass irgendjemand, und dazu noch ein Junge, sein ganzes Leben einen Steinwurf von einem Fluss entfernt lebt und nicht weiß, dass es ihn gibt? Aber mir war auch nie ein Fluss begegnet, der sich so gut versteckt hätte, denn die rückwärtigen Teile der langen schmalen Gärten endeten unmittelbar an der Schlucht, die mit denselben alten Bäumen und hängenden Büschen überwuchert war wie unser sogenannter Garten. Ich nehme an, alle Jungens von hier kannten ihn, aber ich war ordentlich erzogen worden, und in einer solchen Wildnis zu spielen, gehörte sich nicht für einen Jungen aus ‚gutem Hause‘.
Nun, es gab ihn, und man hätte sich durchaus einbilden können, auf dem Land zu sein, denn nicht einmal ein Kamin ragte über die schwer beladenen Bäume hinaus, die beide Ufer säumten, so weit das Auge reichte, bis zu der Stelle, wo das Wasser in einem Tunnel aus Grün verlief. Jetzt wusste ich auch, warum ich diesen Fluss in meiner Jugend nicht entdeckt hatte: Er hätte mich wahrscheinlich so fasziniert, dass ich vor Aufregung hineingefallen wäre.
Und so erkundete ich die Gegend genauer. Mein künftiges Quartier war solide gebaut, im Queen-Anne-Stil, wie das Haus auch, und es würde kein großer Aufwand sein, den weitläufigen Dachboden in eine Reihe von Räumen und ein Badezimmer umzubauen. An der einen Stelle gab es bereits einen Kamin, und unten hatte ich Wasserhahn und Abfluss gesehen. Ganz begeistert von meiner Entdeckung, kehrte ich zum Haus zurück, wo ich mit der üblichen kalten Dusche empfangen wurde. Die Diener würden mit den Tabletts nicht herauskommen, wenn ich mal wieder krank war. Ich hatte das Verlies zu nehmen, und damit basta! Ich sagte: „Der Teufel soll die Diener holen!“, und: „Zum Teufel mit dem Verlies!“, (seit meiner Krankheit war es mit meiner Laune nicht zum Besten bestellt), nahm das Auto, machte eine übliche Geschäftsrunde und ließ die Familie in ihrem Saft schmoren.
Das Geschäft lief nicht ganz so gut. Wir mussten versuchen, in den Besitz einer Reihe von Cottages zu gelangen, die abgerissen werden sollten, um Platz für eine Tankstelle zu schaffen. Eine alte Dame wollte nicht mitmachen, und ich musste mit ihr verhandeln. Ich ziehe es vor, solche Dinge selbst zu erledigen und nicht Gerichtsvollziehern oder ähnlichen abscheulichen Typen zu überlassen, denn ich hasse es, diese alten Leutchen vor den Kadi zu zerren. Das ist eine unangenehme Sache für alle Beteiligten.
Früher waren das Bauernhäuser gewesen; die Stadt war um sie herum gewachsen, und in dem letzten von ihnen lebte seit dem Jahr X eine alte Dame namens Sally Sampson, die nicht weg wollte. Wir hatten ihr eine andere Wohnung angeboten, mit allem Drum und Dran. Es sah so aus, als würde es doch noch eine Sache für das Gericht werden. So klopfte ich mit dem kleinen Messingklopfer an Sallys grüne Tür und entschloss mich, mein Herz zu verhärten, worin ich nicht sehr gut bin; aber besser ich als der Gerichtsvollzieher.
Sally öffnete die Tür etwa einen halben Zoll an einer schrecklich klirrenden Kette, an der man ihre ganze Hütte hätte wegziehen können, und fragte, was ich wollte. Hoffentlich hatte sie keinen Schürhaken in der Hand! Wie es das Unglück wollte, war ich nach dem steilen Gartenpfad so außer Atem, dass ich kein Wort herausbrachte; ich konnte mich nur gegen ihren Türpfosten lehnen und wie ein Fisch nach Luft schnappen.
Das reichte. Sally öffnete die Tür, legte den Schürhaken weg, zerrte mich hinein, setzte mich in ihren einzigen Sessel und drückte mir eine Tasse Tee in die Hand. Anstatt Sally zu vertreiben, trank ich Tee bei ihr.
Wir besprachen die ganze Angelegenheit, und was kam heraus? Sie hatte nichts außer ihrer langjährigen Rente, aber in dieser Hütte konnte sie ein wenig Geld verdienen, indem sie für vorbeikommende Radfahrer Tee kochte. In der Behausung, die wir ihr angeboten hatten, war das nicht möglich, und wenn sie nicht etwas zu tun hätte, um Körper und Seele zusammenzuhalten, dann wäre sie reif für das Armenhaus. Kein Wunder, dass die alte Dame störrisch war.
Da hatte ich den nächsten geistreichen Einfall. Wenn das Dilemma mit meiner Junggesellenwohnung das Dienstbotenproblem war, dann lag hier die Lösung. Ich erzählte Sally von meinen Plänen, und sie weinte lange, einzig und allein aus Freude. Ihr Hund war vor kurzem gestorben. Seitdem fühlte sie sich tagsüber sehr einsam und nachts sehr unsicher. Offensichtlich sollte ich den Platz ihres Hundes einnehmen. So regelten wir die Sache auf der Stelle. Ich wollte unser neues Quartier ausbauen, und dann würden Sally und ich einziehen und einen gemeinsamen Haushalt führen, und die Tankstelle könnte in Ruhe gebaut werden.
Triumphierend ging ich nach Hause und informierte die Familie. Aber auch diese Lösung behagte ihr nicht. Sie sagten. „Die Leute werden reden!“ Ich entgegnete: „Eine alte Rentnerin ist genau die Richtige für ein Techtelmechtel. Die Leute werden nur dann tratschen, wenn ihr selbst es tut! Der Platz ist von der Straße aus nicht einsehbar, und niemand wird wissen, dass ich umgezogen bin.“ Sie gaben nicht auf: „Die Dienstboten werden klatschen“, und ich antwortete: „Zur Hölle mit den Dienstboten!“ Sie ließen nicht locker: „Schließlich hast du nicht die Hausarbeit am Hals, wenn die Dienstboten kündigen. Also schick sie nicht gleich zur Hölle!“ Ich versuchte, sie zu überzeugen: „Es gibt keinen Diener, der bei einem Skandal kündigt, versteht ihr das denn nicht, er will doch das Ende der Geschichte erleben. Versteck ein Gerippe im Schrank, und du kannst dich vor Personal nicht retten!“ Meine Schwester gab nicht auf: „Was sollen die Friendly Girls denken, wenn du mit Sally am Ende des Gartens in Sünde lebst, auch wenn du es nicht zugibst.“
„Zur Hölle mit den Friendly Girls!“, und dabei blieb es. Als meine Schwester jedoch Sally in ihrem besten schwarzen Hut mit Federn sah, räumte sie ein, zu weit gegangen zu sein. So begann unser gemeinsames Leben – Sally in den Pferdeställen und ich auf dem Speicher – eine Art Garten Eden, bevor die Schlange kam.
***
2
Ich war sehr glücklich in meinem neuen Zuhause. Mein Wohnzimmer hatte vier Dachfenster, alle nach Süden, mein Schlafzimmer ging nach Osten, und die Sonne weckte mich jeden Morgen. Ich baute einen großen Herd aus Ziegelsteinen und gebranntem Torf aus der Marsch, brachte an beiden Seiten Regale an und konnte jetzt endlich all die Bücher anschaffen, die ich schon immer hatte haben wollen. Das war bisher nicht möglich gewesen, weil es in meinem Schlafzimmer nicht genug Platz gab und mir die Vorstellung zuwider war, meine Bücher im Haus verstreut zu haben. Die eigenen Bücher sind eine sehr intime und persönliche Angelegenheit. Sie enthüllen so viel von der eigenen Seele, und ich hatte keine Lust, meine Bücher offen zur Schau zu stellen, denn meine Schwester hätte ohnehin nur auf ihnen herumgehackt. Außerdem hätten sie wahrscheinlich die Friendly Girls verdorben und die Dienstboten zum Klatschen angeregt.
Zugegeben, es war schäbig von mir, aber der Gedanke, meine Schwester würde mich in meinem Stall besuchen, passte mir überhaupt nicht in den Kram. Sie ist in ihrer Art ja ganz annehmbar, in der Stadt sogar sehr angesehen, aber wir haben nichts gemeinsam. Meine Mutter nannte mich immer den Wechselbalg: Gott weiß, warum ich in diese Familie geboren wurde. Meine Schwester und ich sind immer wie Hund und Katze gewesen, und seit ich mit Asthma zu kämpfen hatte, verhielt ich mich meistens wie die Katze. Jedenfalls wollte ich meine Schwester nicht dort haben. Doch der Versuch, sie fernzuhalten, war zum Scheitern verurteilt, und so war alles, was ich tun konnte, ein Patentschloss an der Tür anzubringen und sie anklopfen zu lassen, wenn sie herein wollte.
Die Dinge ließen sich besser an, als ich befürchtet hatte, auch wenn meine Schwester von Anfang an Sally wegen ihrer Arbeit anraunzte. Sally war nicht gerade ein Putzteufel, aber eine hervorragende Köchin. Bei meiner Schwester verhielt es sich umgekehrt. Sally erklärte ihr: „Ich arbeite für Mr. Maxwell und nehme nur von ihm Anweisungen an, und damit basta!“ Meine Schwester kam zu mir und forderte Sallys Kopf. Ich blieb stur: „Ich bin mit Sally zufrieden und werde sie nicht hinauswerfen. Außerdem: Ich mag Staub, er macht die Wohnung so gemütlich!“
Meine Schwester schnappte ein, wie immer: „Na schön, dann verreck doch in deinem Stall. Aber denk ja nicht, ich komme, wenn dein letztes Stündlein geschlagen hat.“
„Das ist ganz in meinem Sinne“, gab ich ihr Recht. Dabei beließen wir es, und sie hat Wort gehalten.
So kam es, dass mein Partner Scottie und der Doktor die einzigen Menschen waren, die ihren Fuß über meine Schwelle setzten, und die fühlten sich wohl bei mir. Das Problem war nur: Wenn sie kamen, blieben sie hocken und fanden kein Ende. Sie waren jedoch in Ordnung, vor allem Scottie; es gab ein paar anständiger Kerle in der Stadt und Umgebung – Jungens, zu denen man gehen konnte, wenn man Schwierigkeiten hatte. Ich kannte sie alle und war zu jedermann freundlich, das gehörte zum Geschäft. Echte Freunde hatte ich jedoch nicht, ausgenommen vielleicht Scottie in seiner verschrobenen Art. Auch Scottie und ich haben nichts gemeinsam, und jeder von uns geht seinen Weg, aber ich kann mich in jeder Notlage auf ihn verlassen. Es gibt schließlich schlechtere Gründe für eine Freundschaft als diesen.
Scottie ist ein seltsamer Vogel mit einer noch seltsameren Geschichte. Seine Eltern waren Bühnenleute. Als sie hier auf Tournee waren, bekamen sie die Grippe und starben, und Klein-Scottie wurde ins Armenhaus gesteckt. Schon im zarten Alter von drei Jahren war sein schottischer Akzent voll ausgeprägt. Er hat ihn nie verloren, und alles weitere entwickelte sich aus diesem Samenkorn: Er nahm den örtlichen Dialekt der Armen an, und dann waren – um dem Ganzen die Krone aufzusetzen – sein Lehrer und dessen Frau Cockneys; das Mischmasch, was dabei herausgekommen ist, – Sie müssten es hören. Nur gut, dass er ein wortkarger Mensch ist.
Aber mit seiner außergewöhnlichen Schweigsamkeit und meiner Abneigung gegen harte Geschäftspraktiken hatten wir einen großartigen Ruf der Redlichkeit in unserer Gegend erworben, was für uns auf lange Sicht besser war, als eine schnelle Mark zu machen. Dennoch schäumte meine Schwester vor Wut, als sie von einigen dieser Abschlüsse hörte. Hätten wir tauschen können, dann hätte sie das Geschäft geführt und ich die Friendly Girls.
Scottie war erzogen worden wie alle, aber das Schottische kam immer wieder durch, und so machte er das Beste daraus. Wenn ihm jemand ein Stipendium spendiert hätte, wäre er wahrscheinlich weitergekommen, aber diesen Jemand gab es nicht, und als er die Schule hinter sich hatte, verschaffte man ihm eine Stelle als Bürojunge und ließ ihn für sich selbst sorgen.
Auch meine Erziehung war die herkömmliche. Man schickte mich auf eine örtliche Akademie für die Söhne feiner Leute, und das sagt schon alles. Es war eine Einrichtung, die Körper und Geist schwächte. Für mich ist nichts Gutes dabei herausgekommen, so weit ich das beurteilen kann; andererseits glaube ich nicht, dass es mir besonders geschadet hat. Die Schule schloss ihre Pforten, als der Rektor mit der Zuckerpuppe aus dem Süßwarenladen auf und davonging. Ein angemessenes Ende, schließlich wurde in dem Etablissement nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ verfahren: Strenge Vorschriften in den Klassenräumen und lose Sitten in den Schlafsälen. Selbst im zarten Alter von damals fragte ich mich, ob der Schulleiter jemals jung gewesen war. Ich schnappte alle wörtlichen Weisheiten auf, wie sie Jungens unter derartigen Umständen einfallen, aber vielleicht ist das besser als gar nichts. Ich war nie von Hause weg gewesen, und wenn, dann nur ganz kurz.
Als ich meine Tätigkeit im Büro unter meinem Vater aufnahm, hatte Scottie sich schon häuslich eingerichtet und das Aussehen eines ältlichen Bürovorstehers angenommen, der seit Generationen bei der Firma beschäftigt war. Er sprach von meinem Vater immer nur als „Mr. Edward“, als wenn er diese Stellung unter seinem Vater dort gehabt hätte. Und auch wenn er an meinem Bett saß, nannte er mich immer nur „Mr. Wilfred“. Wir waren ungefähr gleichaltrig, aber während Scottie bereits Erfahrung als Geschäftsmann hatte, war ich noch ein junger Dachs.
Ich mochte Scottie von Anfang an, aber mein Vater verhinderte jede Art persönlicher Freundschaft am Arbeitsplatz. Als beim Tod meines Vaters alles durcheinandergeriet, war es Scottie, der die Dinge wieder ins Lot brachte, während sich unser alter Bürovorsteher seinen Tränen überließ. Scottie und ich, obwohl so jung, mussten ihn aufrichten. Jeder erwartete, dass er mich beraten würde, und wenn man ihn später, als alles vorüber war, reden hörte, hatte er das Geschäft gerettet, während es in Wirklichkeit Scottie war.
Als mein Asthma ausbrach, wurde mir schnell klar, dass ich ein sehr unsicherer Faktor für das Geschäft geworden war, und selbst bei Routinearbeiten konnte man sich nicht mehr auf mich verlassen. Ich bin nie ein guter Auktionator gewesen, nicht einmal in meinen besten Zeiten. Zum Versteigern muss man geboren sein, es ist eine Gabe Gottes. Außerdem sehe ich schlecht, und manches Mal bin ich von wütenden Kundinnen der Günstlingswirtschaft bezichtigt worden, wenn ich ihre Gebote verpasst hatte oder den Zuschlag Leuten gab, die ihn gar nicht haben wollten. Einmal habe ich fünf Posten an ein unglückliches Geschöpf mit laufender Nase verkauft, bevor mir dämmerte, dass seine Äußerungen ein Niesen waren und kein Gebot. Meine Fähigkeit liegt im Taxieren. Ich taxiere alles, ausgenommen Bilder.
Der Doktor, der meine Entwicklung sah, riet mir, einen Partner zu nehmen. Ich bat ihn, meine Familie behutsam darauf vorzubereiten. Er tat es, und sie stimmten zu. Die Abwicklung ihrer Geschäfte würde nach wie vor über mich laufen. Was ihnen jedoch nicht passte, war der Partner, den ich auswählte, nämlich Scottie. Sie hatten gehofft, wir würden irgendein Mitglied einer Adelsfamilie in die Firma nehmen, das seine Finanzen aufpolieren wollte.
Wie ich erwartet hatte, machten sie ein furchtbares Geschrei. Zugegeben, Scottie ist schrecklich gewöhnlich; seine Art, sich zu kleiden ist geschmacklos und seine Aussprache undeutlich, aber er ist ehrlich, tüchtig, freundlich und verdammt fleißig.
Ich glaubte nicht, dass er für die Firma eine schlechte Visitenkarte war, denn unsere Kunden pflegen nicht unbedingt persönliche Kontakte mit ihren Immobilienmaklern. Mit uns haben sie es jedenfalls nicht getan, und ich habe mich nie der Illusion hingegeben, sie würden es tun, im Gegensatz zu meiner Schwester.
Leute für den ‚Flag-Day’1*) auftreiben zu wollen ist eine Sache, das Vergnügen ihrer Gegenwart eine andere. Es gibt niemanden, den ich nach einem Asthmaanfall lieber bei mir hätte haben wollen als Scottie, und das ist ein guter Test. Er sitzt da wie eine Glucke und sagt kein Wort, aber es tut gut, dass er da ist. So nahm ich ihn als Partner, und sicherlich hatte ich nicht den schlechteren Teil gewählt. Es ist ein eigenartiger Charakterzug meiner Familie, dass sie erbittert gegen eine Sache angeht, selbst wenn sie nichts Besseres anzubieten hat.
1*) Gedenktag der US-Flagge am 14. Juni
Kurz nachdem er mein Partner geworden war, heiratete Scottie. So etwas verändert eine Freundschaft, selbst wenn man die Frau mag. Ich mochte sie nicht. Sie war in Ordnung und ganz nach dem Herzen meiner Schwester, die sie für ein anständiges Mädchen hielt – sie war die Tochter des örtlichen Beerdigungsunternehmers. Nun, Versteigerer stehen eine Stufe über Leichenbestattern – ich weiß gar nicht, wen ein Leichenbestatter eigentlich heiraten sollte –, und ich hätte eher vermutet, dass meine Schwester diese Ehe als geschäftsschädigend ansehen würde, aber weit gefehlt! Ist es nicht eigenartig? Scotties Gewöhnlichkeit stört mich nicht, wohl aber die seiner Frau, während es auch hier bei meiner Schwester umgekehrt ist.
Scotties Heirat hinterließ eine Lücke dort, wo ohnehin nicht viel gewesen war; er war mehr als ein Kamerad, er war ein Freund.
Nachdem Scottie in das Geschäft eingetreten war, gab ich mich nicht mehr mit Routinearbeiten ab, sondern einzig und allein mit dem Taxieren, also dem Teil des Geschäfts, der mir lag. Er führte mich über Land und ließ mich interessante Leute treffen, vor allem bei Gerichtsverhandlungen, denn sehr oft zog man mich als Sachverständigen hinzu, was viel Spaß macht, wenn man Sinn für Humor hat. Manchmal ließ mich der eine Anwalt aussagen und manchmal ein anderer, und der, der mir bei der einen Verhandlung das letzte Wort ließ, versuchte bei der nächsten, mich in den Schmutz zu ziehen. Und anschließend gingen wir alle gemeinsam ins George essen. Der Wirt, ein Freund von mir, legte es darauf an, uns betrunken zu machen. Bei mir ist es ihm nie gelungen, jedenfalls nicht allzu sehr. Da ich es für ihn ersteigerte, kannte ich sein Gesöff; manches war gut, manches nicht. Wir beide hatten eine stillschweigende Vereinbarung getroffen...
Das war genau nach meinem Geschmack, aber die Anwälte waren heute hier und morgen dort, und obwohl ich viel Spaß mit ihnen hatte, wurden wir nie Freunde. Zu guter Letzt gab ich mich mehr oder weniger mit Sally, meinen Büchern und dem Radio zufrieden. Jeder sagte, ich wäre verdammt ungesellig, aber Gott weiß, ich war es nicht, sofern ich die Art von Gesellschaft haben konnte, die ich wollte. Also spielte ich mein Asthma weidlich aus.
Ich las die unterschiedlichsten und erstaunlichsten Sachen, eine Menge über Theosophie, was im Haus früher nicht möglich gewesen wäre, jedenfalls nicht in Ruhe. Einiges sagte mir zu, anderes nicht. Die Lehre von der Wiedergeburt akzeptierte ich; sie war das Beste, was mir je begegnet war und half mir sehr. Mein jetziges Leben sah nach einem Reinfall aus, und so hoffte ich auf das nächste. Wenn ich nichts Besseres zu tun hatte, dachte ich über das letzte nach.
Ein Asthmaanfall fesselte mich immer ein oder zwei Tage ans Bett. Nach einer Weile ist man seine Bücher leid, Besucher hatte ich nicht einmal in meinen guten Tagen ermutigt, und jetzt war ohnehin keine gute Zeit für mich. Außerdem hätte ich wahrscheinlich gar nicht reden können. So lag ich nur da, grübelte und amüsierte mich damit, meine vergangenen Leben zu rekonstruieren.
Es ist schon eigenartig: Ich, der ich nicht einmal in der Lage bin, die Handlung für einen Roman zusammenzubringen, konnte ausgeklügelte und fantastische Inkarnationen der Vergangenheit erfinden. Und wenn ich mich den ganzen Tag mit ihnen beschäftigt hatte, so, wie ich es nach einem Asthmaanfall tat, begann ich, davon zu träumen. In dem Zustand nach einer Morphiumspritze tauchten diese Bilder in meinen Träumen mit außergewöhnlicher Lebhaftigkeit auf. Ich lag zwischen Schlafen und Wachen und hätte mich nicht bewegt, auch wenn das Haus unter mir abgebrannt wäre. In diesem Zustand schien mein Geist keine Mauern oder Grenzen zu kennen. Normalerweise schwebte ich über den Dingen und hatte ein Brett vor dem Kopf wie die meisten meiner Mitmenschen. Meine Gefühle waren für mich ein rätselhaftes Durcheinander aus dem, was ich sein sollte, und dem, was ich ernsthaft versuchte zu sein. Aber wenn ich betäubt im Bett lag, gab ich mich keinen Selbsttäuschungen hin.
Das Eigenartige an diesem Zustand war sein seltsam verdrehter Sinn für Realität. Normale Dinge waren weit weg und nicht wichtig, aber in dem inneren Reich, wie ich es nannte, das mir der Einstich einer Spritze beschert hatte, waren meine Wünsche Gesetz; ich konnte alles schaffen, was ich wollte, allein durch meine Vorstellungskraft.
Ich kann sehr gut verstehen, warum Leute Drogen nehmen: Sie setzen ihr Leben für eine Traumwelt aufs Spiel und entfliehen dem Alltag, ohne ihn je zu vermissen. Einen großen Teil meiner Entwicklung verdanke ich dem Betäubungsmittelgesetz. Am besten lässt sich mein Leben mit einer vitaminlosen Diät vergleichen – jede Menge nahrhaftes Zeug, aber das kleine bisschen, das für die Gesundheit entscheidend ist, fehlte. Ich glaube, meine Krankheit war geistiger Skorbut. Mit meinen Halluzinationen und theosophischen Büchern kam ich Peter Ibbetsons Vorstellung von Hellsichtigkeit sehr nahe. Allmählich lernte ich den Kniff mit dem Tagträumen, und obwohl ich nicht dieselbe Klarheit erreichte wie unter Rauschgift, so war das besser als nichts; ab und zu jedoch ging ein Tag-Traum in einen Nacht-Traum über, und es kam etwas wirklich Sinnvolles heraus.
Was ich tat, war etwas Ähnliches wie einen Roman zu lesen, aber auf höherer Ebene, denn schließlich lesen wir Romane zur Bereicherung des täglichen Lebens. Denken Sie nur einmal an ein Zugabteil und schauen Sie dem Mann, der am harmlosesten aussieht, über die Schulter. Sie werden feststellen, dass er den blutrünstigsten Roman liest.
Je harmloser der Mann, desto blutiger der Roman. Und erst die Damen...! Und was ist mit dem braungebrannten Typen, der aussieht wie ein harter Kerl und gerade aus der Südsee zu kommen scheint? Er liest wahrscheinlich ein Gartenbuch.
Thriller sind für mich ein Versuch, unsere spirituelle Diät mit Vitaminen anzureichern, wobei das Problem ist, das richtige Rezept für einen Thriller zu finden. Man mag sich vielleicht noch mit dem Helden als Ersatz für ein Abenteuer identifizieren können, aber die Heldinnen..., meistens sind sie albern.
Ich wurde mehr und mehr zum Experten, meine eigenen romantischen Rezepte auszutüfteln, während die vorgeschriebenen für mich immer langweiliger wurden. Beinahe freute ich mich auf meine Asthmaanfälle, denn sie verhießen eine Dosis Rauschgift. Dann würden die Fantasien Wirklichkeit werden und die Überhand gewinnen, und ich würde ‚Leben sehen’ in außergewöhnlicher Form.
Allmählich entwickelte ich auch die Fähigkeit, mit der Natur zu ‚fühlen’. Meine erste Erfahrung machte ich, als ich während meiner ersten Attacke zufällig mit dem Mond in Verbindung kam. Später las ich einige Bücher von Algernon Blackwood; außerdem von Muldoon und Carrington: ‚Die Aussendung des Astralkörpers‘. Das brachte mich auf eine Idee: Muldoon ging es gesundheitlich schlecht. Wenn er durch die Krankheit geschwächt war, konnte er aus seinem Körper heraustreten. Asthma bedeutet auch eine Schwächung des Körpers. Mystiker, die Visionen haben wollen, fasten; jeder Asthmatiker, der nachts schlafen möchte, schläft mit leerem Magen. Nehmen Sie alle drei Dinge zusammen – das Asthma, die Drogen und den Hunger –, und Sie haben alle Voraussetzungen, aus Ihrem Körper herauszugehen, zumindest scheint es so zu funktionieren. Das einzige Problem war das Zurückkommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, es hätte mir nicht sehr viel ausgemacht, nicht zurückzukommen – zumindest theoretisch, obwohl ich die ein oder zwei Male, als es riskant wurde, wie ein Besessener um mein Leben kämpfte.
Hoffentlich langweile ich Sie nicht; ich fand es damals jedenfalls sehr interessant. Aber es ist ohnehin nicht möglich, es allen Recht zu machen. Warum soll ich mir dann nicht wenigstens selbst diesen Spaß gönnen?
***
3
Nun möchte ich aber weitererzählen. Ich hatte Ihnen erklärt, ich würde immer besser mit meinen Reinkarnations-Fantasien. Das ist richtig und wiederum auch nicht. Diese Fähigkeit entwickelte sich schubweise. Eine Weile passierte gar nichts, und plötzlich kam ich einen Schritt vorwärts, dann wieder eine Weile Stillstand, und dann erneut ein Schritt nach vorn.
Bei den Theosophen habe ich gelesen, die beste Möglichkeit, sich an vergangene Inkarnationen zu erinnern sei, abends im Bett zu liegen und den Tag zurückzuverfolgen. Ich habe es versucht, glaube aber nicht, dass es so funktioniert. Man denkt nicht wirklich zurück, sondern erinnert sich an eine Reihe zusammenhangloser Bilder rückwärts, was nicht dasselbe ist. Zumindest versuchte ich es. Wenn jemand eine bessere Idee hat, würde ich sie gerne erfahren. Ehrlich gesagt glaube ich, dass vieles Augenwischerei ist.
Ich war immer schon vom alten Ägypten fasziniert, und da es im Reich der Fantasie ja nichts kostet, amüsierte es mich, mir nun einzubilden, in einer vergangenen Inkarnation ein Ägypter gewesen zu sein; also eine ganz schöne Zeitspanne zwischen jetzt und damals, während ich bei den Würmern schlief – eine langweilige Beschäftigung! Und so entschied ich mich, auch ein Alchimist gewesen zu sein, der, ich brauche es eigentlich nicht zu erwähnen, den Stein der Weisen entdeckte.
Eines Sonntagabends ging ich mit der Familie zur Kirche, wie ich es gelegentlich um des lieben Friedens willen und aus geschäftlichen Gründen tue, man muss sich schließlich anpassen, wenn man in einer kleinen Stadt lebt. Ein Gastpfarrer hielt die Predigt, und das nicht schlecht. Bisher war mir nicht aufgefallen, wie wundervoll die Bibelversion von 1611 ist. Es ging um die Flucht nach Ägypten, um Gold, Weihrauch und Myrrhe, und um die Drei Heiligen Könige, die von einem Stern geleitet wurden. Ich war beeindruckt. Als ich nach Hause kam, suchte ich die Bibel, die ich bei der Taufe geschenkt bekommen und nie mehr angeschaut hatte, außer unter Zwang, und las alles nach, über Moses und die Weisheit der Ägypter, und über Daniel und die Weisheit der Babylonier.
Wir hören eine Menge über Daniel in der Löwengrube, aber wir erfahren nichts über seine offizielle Tätigkeit als Belsazar, Hauptmagier beim König von Babylon und Statthalter von Chaldäa. Auch die eigenartige Geschichte von der Schlacht im Tal der Könige, vier gegen fünf, interessierte mich – Amraphel, König von Shinar; Arioch, König von Ellasar; Chedorlaomer, König von Elam, und Tidal, König der Nationen. Ich wusste nichts über sie, aber ihre Namen waren wundervoll und spukten in meinem Kopf herum. Dann die noch eigenartigere Geschichte von Melchisedek, König von Salem, Priester des allerhöchsten Gottes, der sich aufmachte, Abraham zu suchen, der Brot und Wein brachte, nachdem der Kampf vorüber war und die Könige in den Schlammgruben versunken waren. Wer war dieser Priester eines vergessenen Kults, den Abraham verehrte? Es wird viel Aufhebens um die Helden des Alten Testaments gemacht. Im Allgemeinen finde ich sie nicht bewunderungswürdig. Aber diese hier faszinierten mich. So fügte ich eine Inkarnation in Chaldäa in den Zeiten Abrahams meiner Sammlung bei.
Dann erlitten meine Bemühungen einen Rückschlag. Auf einem Plakat entdeckte ich die Ankündigung eines Vortrags über Wiedergeburt. Veranstalter war die Loge der Theosophischen Gesellschaft am Ort; ich ging hin. Der Vortrag war gut. Am Ende der Diskussion stand eine Dame auf und verkündete: „Ich bin die wiedergeborene Hypatia!“ „Das ist nicht gut möglich“, hielt ihr der Vorsitzende entgegen, „Mrs. Besant ist es!“
Da begann die Dame zu argumentieren. Um ihre Stimme zu übertönen, hämmerte jemand auf dem Klavier herum. Ich ging bedeppert nach Hause und warf Chedorlaomer und Co. in den Papierkorb.
Eine Zeitlang mied ich die Reinkarnations-Fantasien und nahm meine früheren Versuche, mit dem Mond in Verbindung zu treten, wieder auf. Der kleine Fluss unter meinem Fenster hatte Flut, und wenn ich genau hinhörte, wusste ich, was die Flut unten an der Küste anrichtete. Direkt über unserem Garten war ein Wehr, es markierte das Ende des Tidenwassers. Wenn die Flut hoch stand, war es ruhig, war sie niedrig, gab es einen hübschen silbrigen Wasserfalleffekt. Es lag dann ein anderer Geruch, nach dem Meer, in der Luft, den ich sehr mochte, auch wenn er wahrscheinlich ungesund war. Es erstaunte den Doktor immer wieder, wieso ich, ein angeblicher Asthmatiker, so nahe am Wasser wohnen konnte, und er erklärte es sich damit, dass es sich um Salzwasser handelte. Ich aber glaube, dass mein Asthma durch das Theater mit meiner Familie ausgebrochen ist, und es wurde zum ersten Mal besser, nachdem ich die Tür hinter mir zugeschlagen hatte und in die Ställe gezogen war. Schließlich ist Asthma nicht dasselbe wie Bronchitis.
Jedenfalls mochte ich den Duft nach Seetang, der bei Niedrigwasser bis zu mir hinaufkam. Der Nebel, der aus dem Wasser der tiefen Schlucht emporstieg und nie meine Fenster erreichte, bildete eine Landschaft aus Teichen und Lagunen, vom Licht des Mondes übergossen, und die Bäume ragten heraus wie Schiffe unter vollen Segeln. Wenn die Flut sich an der Bucht zurückzog, das Salzwasser frisches Wasser zurückbrachte und bis zum Wehr hochdrückte, sodass sich die Schleusen beim Wechsel der Flut öffneten, mischte sich eine seltsame Stimme in das gurgelnde und strudelnde Wasser, wie eine unaufhörlich streitende Stimme, als ob sich Land und See in den Haaren lägen.
Oft lauschte ich dem Versuch des Landwassers, das Seewasser zurückzudrängen und erinnerte mich an das, was ich von unserem hiesigen Archäologen gelesen hatte: Dieser Teil der Welt war überschwemmtes Land gewesen. Wenn die Flut hochstand, erhoben sich die Kuppen wie Inseln aus der salzigen Marsch und den Wasserläufen im Schlamm, denn die ganze Erde hier ist Schlick, von den Hügeln in Wales herabgeschwemmt. Wenn die Seedämme bis an die Bucht gingen, wäre das Schwemmland sechs Fuß tief. Wilhelm von Oranien baute die Dämme; einmal brachen sie, und das Wasser kam hinauf bis zur Kirche. Deshalb gibt es in Dickmouth Schleusen, die sich nur bei Halbtide öffnen.
Zwischen uns und der See liegt salzige Marsch; die Stadt steht auf der ersten Anhöhe. Dahinter erhebt sich ein bewaldeter Kamm, über den die Straße führt. Wenn man in der Dämmerung nach Hause kommt, sieht man die neblige Marschlandschaft viele Meilen weit. Im Mondschein wirkt sie wie Wasser, und man könnte glauben, die See wäre erneut gekommen, das Land zu überfluten.
Die Geschichte der legendären Stadt Lyoness, die mit ihren Kirchen im Wasser versunken ist und deren Glocken aus der unergründlichen Tiefe läuten, hat auf mich immer eine seltsame Faszination ausgeübt. Ich bin von Dickmouth aus im Ruderboot draußen gewesen und habe durch das klare ruhige Wasser einer Nippflut deutlich die Mauern und Türme eines alten Klosters gesehen, das überflutet wurde, als der Fluss in einer Sturmnacht über die Ufer getreten war.
Oft habe ich auch an die bretonische Legende der verlorenen Stadt Ys und ihrer Magier gedacht, wie in einer Nacht durch Verrat die Schlüssel übergeben wurden, und wie die See hereinkam und alles überschwemmte. Ich stellte Vermutungen über das Rätsel von Carnac an, über unser Stonehenge und über die Menschen, die es einst gebaut haben und warum. Dabei kam mir der Gedanke, es müsste zwei Kulte geben, einen Sonnenkult und einen Mondkult, und dass meine Liebe zum Mond und zur See die ältere war, und sie für die einen dasselbe bedeutet wie das andere für uns. Ich konnte mir gut vorstellen, dass die Druiden, die Priester des Sonnenkults, auf die seltsamen Seefeuer eines vergessenen Kults geschaut hatten wie wir auf ihre Hügel und Hünengräber.
Irgendwie, ich weiß nicht warum, kam mir in den Sinn, dass die, die den Mond anbeteten, bei Niedrigwasser große Feuer anzündeten, die bei hereinkommender Flut mitgerissen wurden. Ich sah vor mir, wie einmal im Jahr ein Scheiterhaufen auf dem nackten Felsen brannte: schwarzer Felsen, bedeckt mit Schlamm aus der tiefsten Tiefe, und riesiger Tang und große, aus der Tiefe emporsteigende Schalentiere, die keinen Fischer fürchteten. Ich sah den hohen Haufen brennend herabtreiben, mit blau züngelnden Salzflammen, und als die Flut stieg, beleckten ihn die langsam heranrollenden Wellen. Es zischte und wurde unten schwarz, bis der hohe feurige Kamm schäumend ins Wasser stürzte. Dann war wieder alles ruhig, außer den langsamen ruhigen Schlägen der dunklen Wellen gegen die Felsen, die den riesigen Tang und die großen Schalentiere mit sich zurück in die Tiefe nahmen. Manchmal waren diese Visionen des nach innen schauenden Auges seltsam wirklich und echt, und dann gelang mir das, was in einem Traum selten geschieht: Ich hatte den eigentümlichen bitteren Geruch des brennenden, vom Salzwasser gelöschten Holzes in der Nase…
***
4
Es ging mir so wie immer, eher ein bisschen besser. Im Vorfrühling nach einem teuflischen Asthmaanfall hatte ich am Quartal – einem Tag, an dem wir im Büro sehr beschäftigt waren – ein seltsames Erlebnis. Bevor es allzu schlimm wurde, hatte mich der Doktor vorsorglich mit Drogen vollgepumpt (bei meiner letzten ‚Vorstellung‘ hatte ihn der Sturm aufgehalten). Ich lag in meiner üblichen Verfassung, dem Sterben näher als dem Leben, danieder, und es war mir egal, ob der Himmel auf mich herabstürzte, als ich zwischen Schlafen und Wachen eine eigenartige Vision hatte.
Ich trat aus meinem Körper heraus und ließ ihn hinter mir, so, wie es Muldoon beschreibt, und fand mich wieder im Schwemmland in der Gegend von Bell Head. Mit einem Gefühl der Überraschung bemerkte ich, dass es feste, flache gelbe Sandbänke waren anstatt des dunklen angeschwemmten Schlammes wie sonst. Offensichtlich gab es keine Seedeiche. Wo Wasser war, war wirklich Wasser, und wo Land war, war wirklich Land und nicht das Misch-Masch der Marsch von heutzutage.
Ich hatte den Eindruck, auf einer felsigen Stelle zu stehen, umgeben von nistenden Seevögeln, und oberhalb meines Kopfes auf einer hohen Stange hing ein Feuerkorb. Hinter mir am kahlen Strand lag ein kleines Ruderboot oder, besser gesagt, ein Paddelboot, und es sah genauso aus wie die primitiven Boote aus Weidengeflecht, mit Häuten überzogen, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt. Ich wartete neben dem Feuerstoß, bereit, diesen anzuzünden, wenn ein Schiff über den Kanal durch die Marsch kommen würde; seit Tagen hatten wir die Ankunft dieses Schiffes herbeigesehnt, denn es kam von einer langen Seereise zurück, und ich wurde des Wartens allmählich müde. Plötzlich entdeckte ich, unerwartet nahe im Nebel und in der Dämmerung, das Schiff. Es war ein langes, flaches Boot ohne Deck, mit Ruderern, einem einzigen Mast und einem großen purpurfarbenen Segel, von den verblassenden Resten eines hochrot eingestickten Drachens geziert.
Als das Schiff beidrehte, schrie ich – aber es war zu spät, den Stoß anzuzünden. Sie holten schnell das Segel ein und ruderten rückwärts, um das Boot von der Sandbank fernzuhalten. Als sie zurückfuhren, sah ich, einen Steinwurf von mir entfernt, eine Frau hoch oben auf dem Heck in einem geschnitzten Stuhl sitzen. Sie hatte ein großes Buch auf dem Schoß. Bei dem Durcheinander um das Segel hob sie den Kopf, und ich nahm ihr blasses Gesicht mit den scharlachroten Lippen wahr, und ihr langes dunkles Haar, von einem goldenen, mit Juwelen besetzten Band gehalten, erinnerte mich an das Aussehen von Seetang bei Ebbe. Einen kurzen Moment, als das Boot von der Sandbank abdrehte, sah ich ihr direkt ins Gesicht. Sie gab meinen Blick zurück, und ihre Augen waren wundersam wie die einer Seegöttin. Jetzt fiel es mir wieder ein: Das Boot, auf das wir warteten, sollte vom Land jenseits des Sonnenuntergangs eine fremde Priesterin bringen, die wir für unseren Kult gerufen hatten. Die See brach die Deiche und überschwemmte das Land, und es wurde gemunkelt, sie habe die Kraft, die See zu beherrschen. ‚Nun‘, dachte ich, ‚das ist die Seepriesterin, auf die wir gewartet haben.‘
Nachdem sie den Blickkontakt gelöst hatte, glitt sie in ihrem Boot an mir vorbei und verschwand im Nebel und in der Dämmerung. Da wurde mir klar, ihr Ziel war der Hügel, der sich einige Meilen landeinwärts aus dem Schlick erhob. Auf seiner Kuppe stand ein offener Tempel aus Steinen mit einem ewigen Feuer, der Sonne geweiht; unten lag eine Höhle, in der das Wasser hochstieg und die Opfer mit sich nahm, die lebend an die Felsen gebunden waren. Es ging das Gerücht, die Seepriesterin würde für ihre Göttin viele Opfer fordern, und als ich mich an ihre kalten, seltsamen Augen erinnerte, hatte ich keinen Zweifel daran, dass es stimmte.
Leider musste ich mich von meinen Fantasien losreißen und Scottie bei der vierteljährlichen Abrechnung helfen und hatte keine Zeit mehr für Tagträume von Seepriesterinnen oder ähnliche Hirngespinste.
Ich erinnerte mich, damals, zu Großvaters Zeiten, hatte es einen alten Herrn namens Morgan gegeben, dem eine Menge Land in dieser Gegend gehörte, und als er alt wurde, vertraute er es unserer Firma an. Dann starb er und hinterließ eine alte Schwester. Die hatte eine Gesellschafterin, eine Nichte, eine fremdländisch aussehende junge Frau, vermutlich französischer Abstammung. Nach ihrem Namen zu urteilen, müssen die Morgans Waliser gewesen sein. Wie dem auch sei, obwohl seit unzähligen Generationen hier ansässig, hatten sie nie richtig nach hier gehört. Die alte Dame hinterließ ihrerseits ihren gesamten Besitz ihrer Gesellschafterin, unter der Bedingung, den Namen Morgan anzunehmen. Diese ging darauf ein und nannte sich von nun an Le Fay Morgan, denn ursprünglich war sie eine Miss Le Fay gewesen. Natürlich kam die Nachbarschaft nie mit dem Namen Le Fay Morgan zurecht, und als die Generation, die sie unter dem Namen Miss Le Fay gekannt hatte, ausgestorben war, wurde sie von der nächsten Generation einfach Miss Morgan genannt.
Mein Vater, der für die alte Miss Morgan gearbeitet hatte, verpfändete das gesamte Ackerland, auf das der alte Oberst Morgan sein Vertrauen gesetzt hatte, und kaufte dafür in Dickmouth Grundstücke in dem Glauben, es würde ein aufstrebendes Seebad werden, denn die Eisenbahnstrecke war schon bis zu uns gediehen und sollte bis zur Küste verlängert werden. Wie es das Schicksal so wollte, kam es zu einer Wirtschaftskrise, und die Eisenbahn blieb, wo sie war. Mein Vater hatte also alles, was gut und teuer war, verscherbelt und wertloses Zeug erstanden. Zu seinem Glück starb die alte Dame: Ich möchte nicht wissen, was er von ihr zu hören bekommen hätte.
In Erwartung des Booms, den Dickmouth als Seebad erleben würde, hatte er in alle Richtungen reihen- und terrassenförmig prunkvolle Einfamilienhäuser gebaut. Es gab Geschäfte und ein scheußliches Gewölbe an dem Platz, der für den Bahnhof vorgesehen gewesen war. Selbst die Stelle für einen Pier war bereits ausgesucht, der Gott sei Dank jedoch niemals gebaut wurde. Mit dem Aufkommen der Kraftfahrzeuge war Dickmouth später aufgeblüht, und schließlich hatten wir praktisch alles vermietet, –aber zu welch einem Preis! Selbst nachdem wir das Ganze aufgemöbelt hatten, warf der Besitz fast nichts ab, und so blieb der Gesellschafterin der alten Dame, die eigentlich hätte fein heraus sein müssen, gerade genug, um Körper und Seele zusammenzuhalten und sie in schwarzen Seidenkleidern herumlaufen zu lassen.
Nachdem wir alle Pachten, die auf 21 Jahre liefen, weit unter Preis abgewickelt hatten, taten die Herren von der Eisenbahn den letzten Schritt, und als unsere Fünfundsiebzig-Pfund-Pachten in andere Hände übergingen, brachten sie vier oder fünfhundert ein. Alles kam wieder ins Lot, selbst die Pachtverträge, und jetzt waren wir am Zug. In den vergangenen Quartalen hatte ich Morgan der Zweiten einige Schecks mit ganz hübschen Summen schicken können, und es sah so aus, als ob sie in ihren letzten Lebensjahren noch ein wenig Glück haben würde, als Ausgleich für die ungewöhnlich schlechten Zeiten.