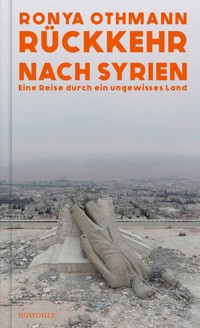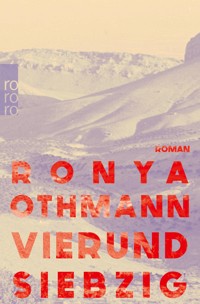Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leyla ist die Tochter einer Deutschen und eines jesidischen Kurden… Das ergreifende Debüt der Gewinnerin des Publikumspreises des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs (2019) über das Dasein zwischen zwei Welten Das Dorf liegt in Nordsyrien, nahe zur Türkei. Jeden Sommer verbringt Leyla dort. Sie riecht und schmeckt es. Sie kennt seine Geschichten. Sie weiß, wo die Koffer versteckt sind, wenn die Bewohner wieder fliehen müssen. Leyla ist Tochter einer Deutschen und eines jesidischen Kurden. Sie sitzt in ihrem Gymnasium bei München, und in allen Sommerferien auf dem Erdboden im jesidischen Dorf ihrer Großeltern. Im Internet sieht sie das von Assad vernichtete Aleppo, die Ermordung der Jesiden durch den IS, und gleich daneben die unbekümmerten Fotos ihrer deutschen Freunde. Leyla wird eine Entscheidung treffen müssen. Ronya Othmanns Debütroman ist voller Zärtlichkeit und Wut über eine zerrissene Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Das Dorf liegt in Nordsyrien, nahe zur Türkei. Jeden Sommer verbringt Leyla dort. Sie riecht und schmeckt es. Sie kennt seine Geschichten. Sie weiß, wo die Koffer versteckt sind, wenn die Bewohner wieder fliehen müssen. Leyla ist Tochter einer Deutschen und eines jesidischen Kurden. Sie sitzt in ihrem Gymnasium bei München, und in allen Sommerferien auf dem Erdboden im jesidischen Dorf ihrer Großeltern. Im Internet sieht sie das von Assad vernichtete Aleppo, die Ermordung der Jesiden durch den IS, und gleich daneben die unbekümmerten Fotos ihrer deutschen Freunde. Leyla wird eine Entscheidung treffen müssen. Ronya Othmanns Debütroman ist voller Zärtlichkeit und Wut über eine zerrissene Welt.
Ronya Othmann
Die Sommer
Roman
Carl Hanser Verlag
Ji bo bavê min, ji bo malbata min, ji bi xwişkên min.
Berxwedan jîyane.
AN DER HAUPTSTRASSE gab es ein Schild, auf dem in abgeplatzten Buchstaben ein Name stand: Tel Khatoun. Das Schild stand schief, vielleicht vom Wind. Nur wenige Meter hinter ihm zweigte ein schmaler Schotterweg von der Hauptstraße ab. Er führte an Gartenzäunen entlang in das Dorf. Das Dorf hatte früher einen anderen Namen gehabt. Es hieß erst Tel Khatoun, seit auch alle anderen Dörfer und Städte in der Gegend neue Namen bekommen hatten.
Es war bloß ein Dorf von vielen Dörfern zwischen Tirbespî und Rmelan. Eines, in das niemand sich einfach so verirrte. Eines, in das man nur kam, wenn man die Menschen kannte, die dort lebten.
Leyla konnte den Weg ins Dorf im Kopf gehen. Vom metallenen Schild Tel Khatouns zehn Schritte bis zur Abzweigung, dann fünfzehn Schritte bis zum Garten der Großeltern, dort dann zwischen dem Garten der Großeltern und dem Garten der Nachbarn dreihundert Schritte auf dem Schotterweg, wo einem meist schon die Hühner entgegenkamen, schließlich links am Brunnen vorbei zum Haus der Großeltern.
Das Haus der Großeltern lag am Anfang des Dorfes. Sein Garten schob sich wie eine lange grüne Zunge in die Landschaft hinein. Ging man an den Olivenbäumen, Orangenbäumen, Beeten und Tabakpflanzen vorbei bis zum hinteren Maschendrahtzaun, konnte man zurück auf die Hauptstraße blicken, von der man gekommen war. Ringsum lagen Felder, und hinter den Feldern erhob sich in der Ferne eine Bergkette, die Grenze zur Türkei.
Hätte Leyla nicht gewusst, was sich an dieser Grenze abgespielt hatte, vielleicht hätte sie die Berge schön gefunden.
Das Haus war aus demselben Lehm wie die Landschaft und hatte auch ihre Farbe. Allerdings war Leyla immer nur in den Sommern im Dorf gewesen. Vom Vater wusste sie, dass das Land im Frühling grün bewachsen war, dass viel mehr Pflanzen blühten, dass die Erde feucht und klumpig war. Das Gras blich erst im Lauf der Sommermonate unter der Sonne aus, die Hitze trocknete die Erde, der Wind trieb immer mehr Staub vor sich her. Jedes Jahr verödete die Landschaft, je weiter die Sommer voranschritten.
Ganze Tage hatte Leyla damit verbracht, auf den dünnen Schaumstoffmatten im Haus zu liegen und an die Decke zu starren. Die Deckenbalken waren dicke Baumstämme, deren Äste abgeschnitten und deren Rinde abgehobelt war. Über ihnen wölbte sich das Stroh. Darüber war das Dach mit einer Schicht Lehm abgedeckt, damit kein Regen einsickerte. Die Fenster waren klein und tief, die Wände dick gegen die Hitze im Sommer und die Kälte im Winter. Es gab nur zwei schmale Türen. Die eine aus Metall führte zum Hof und zur Straße, die andere aus Holz nach hinten in den Garten.
Um das Haus zu bauen, waren irgendwann vor vielen Jahren alle Männer des Dorfes zusammengekommen. Sie hatten Ziegel aus Lehm gebrannt, sie geschleppt und gestapelt. Drei Tage lang hatten sie gearbeitet, bis das Haus stand.
Im Hof neben dem Haus lebten Hühner, wie in allen Höfen des Dorfes. Überall lag ihr versprenkelter Kot auf dem staubigen Boden. Zwei Hochbetten auf hohen, schmalen Metallfüßen standen dort, das waren die Sommerbetten. Im Winter schliefen sie auf den Schafwollmatratzen und Teppichen drinnen im Haus.
Das Haus war nicht groß, nur zwei Zimmer und ein kleiner Durchgangsraum. Es gab keine Möbel, nur auf dem Boden Kissen mit Löchern im Bezug und die dünnen Matratzen. Die Wände waren weiß gestrichen, aber die Farbe bröckelte herunter. Unter ihr kam ein Gemisch aus Lehm und Stroh zum Vorschein, das man über die gebrannten Lehmziegel gestrichen hatte. In der Mitte beider Räume hingen große Ventilatoren an der Decke, die sich die Sommer über unablässig drehten.
Zum Hof der Großeltern gehörten kleinere Häuschen, die nicht zum Wohnen da waren. In einem befanden sich Küche und Dusche, in einem anderen die Speisekammer. Eine Hütte war für die Hühner, eine weitere für die Bienen, und irgendwann später in einem Sommer gab es sogar ein Plumpsklo.
Das Dorf war so flach wie die Landschaft, die es umgab. Nur in der Dorfmitte gab es einen Berg, für die Toten. Es war nicht wirklich ein Berg, eher ein kleiner Hügel. Leyla fragte sich oft, ob dieser Hügel von Menschen errichtet worden war oder ob die Menschen sich den Hügel ausgesucht hatten, um rings um ihn herum ihr Dorf zu errichten. Oder aber, ob er langsam angewachsen war, angestiegen durch die Generationen von Toten, die hier im Laufe der Jahrhunderte beerdigt worden waren. Denn auch in anderen Dörfern gab es solche Hügel.
Den Tag, an dem man die Kleider wechselt, nannte die Großmutter das Sterben. Leyla stellte sich immer wieder vor, wie all den Sterbenden Stapel frisch gewaschener Kleidung überreicht wurden, ihr Stoff grob und ihre Farbe wie die von Erde.
Dieser Satz der Großmutter über den Tag, an dem man seine Kleider wechselt, fiel ihr jetzt plötzlich wieder ein, als sie die leere Straße entlangging. Es regnete nicht, aber die Luft war feucht.
An der Haltestelle zeigte die Tafel nur noch fünf Minuten. Außer ihr warteten drei Männer. Der eine saß auf der Bank und tippte etwas in sein Handy, der andere trug eine orange Warnweste und hielt einen dampfenden Kaffeebecher in der Hand. Der dritte stand einfach nur da, rauchte und sah in die Luft. Sie bewegten nicht einmal den Kopf, als Leyla sich zu ihnen stellte. Die Minuten fielen auf der Anzeigetafel von fünf auf vier, von vier auf drei, von drei auf zwei, von zwei auf eins. Dann kam die Straßenbahn.
Leyla setzte ihren Rucksack wieder auf.
Eine Geschichte, dachte sie, erzählt man immer vom Ende her. Auch wenn man mit dem Anfang beginnt.
1
JEDEN SOMMER FLOGEN sie in das Land, in dem der Vater aufgewachsen war. Das Land hatte zwei Namen. Der eine stand auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren.
Den anderen Namen benutzten sie in der Familie.
Beiden Namen konnte man jeweils eine Fläche zuordnen. Legte man die Flächen der beiden Länder übereinander, gab es Überschneidungen.
Das eine Land war Syrien, die Syrische Arabische Republik. Das andere war Kurdistan, ihr Land. Kurdistan lag in der Syrischen Arabischen Republik, reichte aber darüber hinaus. Es hatte keine offiziell anerkannten Grenzen. Der Vater sagte, dass sie die rechtmäßigen Besitzer des Landes waren, dass sie aber trotzdem nur geduldet waren und oft nicht einmal das.
Leyla würde Kurdistan später im Schulatlas suchen, vergeblich. Die Europäer sind daran schuld, sagte der Vater und knackte einen Sonnenblumenkern zwischen seinen Zähnen, genauer gesagt Frankreich und Großbritannien, die es vor hundert Jahren mit Druckbleistift und Lineal am Zeichenbrett unter sich aufgeteilt haben. Seitdem erstreckt sich unser Land über vier Staaten.
Du darfst den Namen des Landes niemandem verraten, sagte der Vater. Wenn dich jemand fragt, wohin wir unterwegs sind, dann sagst du, zu deinen Großeltern.
Die Reise in das Land der Großeltern war lang. Immer mussten sie an mehreren Flughäfen umsteigen. Manchmal hatten sie nur ein paar Stunden Aufenthalt, manchmal einen ganzen Tag oder noch länger. Leyla machte das nichts aus, im Gegenteil, sie wäre gerne länger an den Flughäfen geblieben. Sie liebte die aufgeräumten, klimatisierten Wartehallen, die Transitbereiche mit den Duty-free-Shops, in denen man teure Parfüms, teures Make-up und teuren Alkohol kaufen konnte, die langen Gänge, durch die täglich hunderte Menschen gingen ohne Spuren zu hinterlassen, aus allen Himmelsrichtungen und in alle Himmelsrichtungen. Leyla liebte, dass sich alle hier gleich fremd waren, das Personal den Passagieren, die Passagiere den anderen Passagieren, in gewisser Weise sogar die Flughäfen ihren Umgebungen. Wenn sie dann endlich ankamen und aus dem Flugzeug stiegen und ihnen ein heißer Wind entgegenblies — wie sehr liebte Leyla diesen Moment. Sie blieb jedes Mal für ein paar Sekunden auf der Gangway stehen, atmete tief ein und sah hinaus in die Landschaft. Sie wäre dort oben auch länger geblieben, hätten die Passagiere hinter ihr nicht gedrängt und hätte die Mutter sie nicht am Arm gepackt und weitergezogen.
Die Palmen hinter der Landebahn, die trockene Erde. Die große Glasfront mit den Sternornamenten, der glatte Fliesenboden. Die lebensgroßen, in Gold gerahmten Porträts des Präsidenten und des Präsidentenvaters, war das in Aleppo oder in Damaskus gewesen, sie wusste es nicht mehr. Heute gab es dort nur noch Inlandsflüge, wenn überhaupt, sie hatten ja auch auf den Flugplätzen gekämpft. Militärflugzeuge waren dort gestartet und gelandet, sie hatte die Bilder im Fernsehen gesehen, sie wollte nicht an sie denken. Davon war damals nichts zu ahnen gewesen, als sie in allen Sommerferien zu ihren Großeltern reiste. Oder doch? Ihr fielen die Männer dort an den Flughäfen ein, alle beim Geheimdienst, wie der Vater sagte, mit ihren Bundfaltenhosen, den gebügelten Hemden, den nach hinten gekämmten Haaren. Der Vater bestach sie, damit sie aufhörten, Fragen zu stellen, und sie passieren ließen. Damals hatte sie nicht verstanden, warum der Vater den Männern wortlos Whiskyflaschen über den Tisch schob, ihnen Feuerzeuge und Taschenlampen zusteckte. Die Beamten erwarteten das wie eine Bezahlung, als eine Gebühr, die weder mündlich eingefordert wurde noch schriftlich festgehalten war, von der aber jeder wusste, dass man sie zu zahlen hatte, um durchgelassen zu werden. Damit sie keine Probleme machen, wie der Vater dazu sagte.
Leyla beachtete die Schikanen der Beamten und die Bestechungsgeschenke des Vaters nie groß. Die Beamten und er sprachen Arabisch miteinander, und Leyla verstand kein Arabisch. Sie war beschäftigt damit, ihr neues Kleid zurechtzuzupfen und in ihren schwarzen Lackschühchen mit den weißen Schleifen über die glänzenden Fliesen zu springen. Wer die Fugen berührte, war tot, ihr Spiel, das sie unterwegs immer spielte, ungeduldig, dass es weiterging.
Mit den neuen Lackschühchen, mit den weißen Strümpfen mit dem Tüllbesatz, mit dem neuen Kleid mit seinem schwingendem Saum, seinen weißen Punkten und dem Spitzenkragen kam sich Leyla vor wie eine Prinzessin, zu schön für den Staub im Dorf. Kamen sie an, schickte die Großmutter sie als Erstes zum Umziehen, bevor sie mit den Cousins spielen durfte.
Der Vater hatte ihr das Kleid gekauft, in Qamishlo. Am liebsten ging Leyla mit ihm oder mit der Tante einkaufen. Die Mutter hätte ihr ein solches Kleid nie gekauft. Sie hätte gesagt, was willst du damit, das ist aus Plastik. Das wird sofort dreckig. Das hält nicht warm. Darin schwitzt du nur. Das ist unpraktisch. Für die Mutter mussten die Dinge immer praktisch sein. Das hatte auch mit ihrem Beruf zu tun, die Mutter war Krankenschwester. Und im Krankenhaus war alles praktisch, von der Arbeitskleidung, den Betten und den Handdesinfektionsmitteln bis zum Gebäude. Praktisch stand auf derselben Stufe wie vernünftig. Ob etwas praktisch war, zählte viel mehr, als ob es schön war. Aber was die Mutter praktisch fand, fand Leyla hässlich. Das schloss sich aus, fand sie. Entweder man fror oder man schwitzte, entweder man konnte sich bewegen oder man war schön. Alles zugleich ging nicht.
Weder in der Familie der Mutter noch in der Familie des Vaters war irgendwer schön. In der Familie der Mutter, der Schwarzwaldfamilie, waren es vielleicht gerade noch so die Urgroßmutter und ihre Schwestern gewesen, als sie junge Frauen waren. Leyla betrachtete die alten Sepiafotografien von ihnen gerne. Wäscherinnen waren die Schwestern gewesen und hohlwangig, mit fiebrigem Glanz in den Augen und schwachem Lächeln auf den Lippen.
Sie selbst stand oft vor dem Spiegel im Badezimmer und versuchte, dieses Lächeln nachzuahmen. Doch wie sie sich auch bemühte, es wurde eine Grimasse.
Nach dem letzten Krieg in Deutschland hatte man in der Familie der Mutter viel gegessen, es waren die fünfziger und sechziger Jahre gewesen. In der Küche von Leylas Eltern gab es ein Kochbuch, das die Schwarzwaldgroßmutter der Mutter zur Hochzeit geschenkt hatte, Leyla konnte sich nicht erinnern, dass die Mutter jemals daraus gekocht hatte. In der ordentlichen Handschrift der Schwarzwaldgroßmutter standen in dem grünen linierten Buch Meine Lieblingsrezepte: Maultaschen, Schupfnudeln und Sülze. Landjäger, kalte Platte, Ochsenbrust in Meerrettichsoße. Vanilleecken, Pfannkuchen, Pudding.
Die Fettleibigkeit war man in der Familie der Mutter nicht mehr losgeworden. Im Alter litten ihre Verwandten an Diabetes, starben an Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Waren sie jünger, versuchten sie eine Diät nach der anderen, gaben dann schließlich auf und kauften nur noch weite Kleidung. Die Mutter war eine Ausnahme, sie hatte mit den Traditionen ihrer Familie gebrochen. Schön war sie trotzdem nicht, fand Leyla. Immer hatte sie denselben zweckmäßigen Haarschnitt, benutzte niemals Make-up oder Nagellack, trug im Krankenhaus ihre weißen Kittel und zu Hause ähnlich praktische Kleidung, bloß in Farbe.
In der Familie des Vaters arbeiteten alle auf dem Feld, und in Deutschland dann auf dem Bau, oder, wenn sie vorangekommen waren, in eigenen Dönerbuden. Die Verwandten des Vaters hatten rissige Hände, krumme Rücken, verhärmte Gesichtszüge. Sie rauchten fast ausnahmslos, rauchten zu Hause, rauchten auf dem Weg zur Arbeit, rauchten in allen Arbeitspausen. Ihre Körper waren ihr Werkzeug, das bald schon Spuren von Abnutzung und Verschleiß trug. Sie stemmten ihre Hände in die Hüften, rieben sich mit den Fäusten die Schultern, sagten, mir tut der Rücken weh. Vom vielen Stehen schmerzten ununterbrochen ihre Füße.
Schlimmer waren die Arbeitsunfälle. Oder das, was Onkel Nûrî passierte, und das in der Familie des Vaters immer wieder erzählt wurde, sobald von Arbeit die Rede war. Damals arbeitete Onkel Nûrî im Straßenbau. Eine Knochenarbeit, sagte der Vater dazu. Es war Herbst, der Onkel erkältete sich. Eine harmlose Erkältung, er dachte, es werde schon vorübergehen. Aber die Erkältung blieb.
Morgen gehe ich zum Arzt, sagte der Onkel zu seiner Frau. Und am nächsten Tag wieder, morgen gehe ich wirklich zum Arzt. Aber statt zum Arzt ging der Onkel immer weiter zur Arbeit.
Irgendwann fuhren die Eltern mit Leyla nach Hannover und besuchten Onkel Nûrî im Krankenhaus. Da lag er schon im Koma. Eine Erkältung, sagten die Ärzte. Eine Erkältung, die der Onkel so lange verschleppt hatte, bis sie in den Kopf gewandert und eine Hirnhautentzündung geworden war.
Es dauerte einige Tage, bis der Onkel aus seinem Koma erwachte, und ein paar Monate, bis er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, aber gesund wurde er nie mehr. Onkel Nûrî vergaß, und vergessen ist das Schlimmste, sagte der Vater. Wenn Onkel Nûrî zu Mittag gegessen hatte, konnte er sich eine Stunde später nicht mehr daran erinnern.
Kam der Vater von der Arbeit nach Hause, kam er wortlos zur Tür herein, anders als Leylas Mutter, die jedes Mal ein lautes Ich bin wieder da rief. Er hatte dann den Staub der Baustellen in seinen Haaren, auf seiner Haut, in seiner Kleidung. Er duschte und zog sich um, bevor er sich müde an den Küchentisch setzte und hastig aß.
Danach ging er in das Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Er guckte die Abendnachrichten in drei verschiedenen Sprachen. Er sagte, Leyla, hol mir die Sonnenblumenkerne aus der Küche, Leyla, hol mir ein Glas Wasser. Und Leyla ging in die Küche, holte die Sonnenblumenkerne und das Glas Wasser und durfte mitgucken, bis sie müde wurde und einschlief und die Mutter sie ins Bett trug. Eine Zeit lang versuchte die Mutter, feste Bettzeiten durchzusetzen, wie im Krankenhaus, wo alle Besuchszeiten klar geregelt waren und die Nachtruhe um neun begann. Die Mutter liebte klare Regelungen. Den Vater wiederum kümmerten sie nicht. Wenn die Mutter Nachtschicht hatte, durfte Leyla so viele Süßigkeiten essen, wie sie wollte. Der Vater ließ Leyla auch Cola trinken, kaufte ihr Döner und Chicken Nuggets. War die Mutter nicht da, schlief Leyla vor dem Fernseher ein.
An manchen Abenden aber blieb der Vater länger am Küchentisch sitzen. Er griff nach der Tüte mit den gesalzenen Sonnenblumenkernen, knackte sie zwischen seinen Zähnen, spuckte die Schalen auf einen Teller. Die Schalen häuften sich, während der Vater sprach.
Auf eine Papierserviette malte er mit einem Kugelschreiber kleine Kreuze.
Die Kreuzchen sind Minen, sagte Leylas Vater. Es war, sagte er, immer nur ein Meter zwischen dem einen Tod und dem anderen. Alle Tode zusammen ergaben ein quadratisches Muster. Wer trittsicher war, konnte den Tod überlisten. Wer aber danebentrat, der verlor einen Arm, ein Bein, sein Leben.
Der Vater sagte, dass nachts oft Leute über die Grenze gingen. Sie hatten Familie und Freunde auf der anderen Seite und trieben Handel. Die Grenze war nah. Explodierte eine Mine, hörte man es im Dorf.
Es gab Personenminen und es gab Panzerminen, sagte der Vater. Die Panzerminen sahen aus wie Plastikteller. Einmal fand mein Nachbar so einen Teller. Er dachte, so etwas kann man immer gut gebrauchen, als Wassertränke für die Hühner zum Beispiel. Er hatte Glück, er hat nur eine Hand verloren.
Leyla dachte daran, wie sie noch im Sommer hinaus in die Felder gerannt war. Der Vater sagte zwar, die Minen seien vor Jahren entfernt worden. Aber was, dachte sie, wenn man auch nur eine einzige Mine vergessen hatte?
Es war, als hätte der Vater ein Buch im Kopf, das er nur aufzuschlagen brauchte, dachte Leyla. Sie musste ihm nur ein einziges Stichwort geben, solange er noch am Küchentisch saß und nicht schon ins Wohnzimmer gegangen war, und schon lachte der Vater auf, griff nach der Tüte mit den Sonnenblumenkernen und begann zu erzählen.
Erzähl mir die Geschichte von Aziz und den Hühnern, sagte Leyla.
Heute nicht mehr, sagte der Vater. Ich bin so müde von der Arbeit.
Bitte, sagte Leyla. Nur die eine.
Der Vater seufzte. Na gut, sagte er, nur die eine, aber danach ist Schluss, und ich mache es kurz.
Nur wenige im Dorf konnten Arabisch, fing der Vater an, stand auf, goss sich ein Glas Wasser ein, setzte sich wieder. Auch wenn er nur kurz sagte, Leyla wusste, dass es länger werden würde.
Eigentlich konnten nur die Jüngeren Arabisch, sagte der Vater, die, die eine Schule besucht hatten. Und unser Nachbar Aziz hatte wie meine Eltern nie eine Schule besucht.
Wie mein Vater hatte auch er ein kleines Radio, eines, das mit Batterien betrieben wurde und das er mit auf die Felder nahm oder wie mein Vater auf das Hausdach, weil dort der Empfang am besten war.
Alle paar Tage rief er mich zu sich, damit ich ihm die Abendnachrichten übersetzte. Er sagte seiner Frau, sie solle mir Tee und Kûlîçe bringen, weil er wusste, wie gern ich ihre Kekse aß. Für Kûlîçe war ich immer bereit zu übersetzen, sagte der Vater.
Es war der späte Sommer 1973. Ich war zwölf Jahre alt und ging schon in der Stadt zur Schule. Wenn ich frei hatte, spielte ich auf der Saz und träumte davon, eines Tages in Aleppo oder Damaskus zu studieren. Zwischen Israel und Syrien gab es Krieg.
Die Juden sind grausam, hatte der arabische Lehrer in der Schule gesagt. Sie ermorden Kinder. Mich interessierte das damals nicht, mir war noch nie ein Jude begegnet. Es gab zwar in Qamishlo eine jüdische Familie, aber die brachte ich nicht mit den Juden zusammen, von denen unser Lehrer ständig sprach. Die Juden in Qamishlo, das war die Familie Azra, sie sind dort bis heute Gewürzhändler. Du kennst sie, Leyla, wir kaufen bei ihnen ein, wenn wir in Qamishlo sind. An der Familie Azra war nichts Besonderes. Ihre Gewürze schmeckten wie alle anderen auch.
Die Lage damals war angespannt, das spürte auch ich. Deshalb wollte Aziz, dass ich jeden Abend vorbeikam, um die Nachrichten zu übersetzen. Als ob er so Kontrolle über die Situation haben könnte, saß er wie ein Besessener ununterbrochen vor dem Radio und schaltete es nicht mehr aus, und ich musste übersetzen.
Nach ein paar Tagen hatte ich keine Lust mehr.
Es waren die großen Ferien. Meine Freunde verabredeten sich jeden Nachmittag hinter der Schule zum Fußballspielen und blieben dort, bis die Sonne unterging.
Und ich saß immerzu mit Aziz vor dem Radio. Im Radio redeten und redeten die Nachrichtensprecher, das Regime war so siegessicher, als ob der Krieg schon längst gewonnen wäre. Das ärgerte mich. Und auch Aziz ärgerte mich, wie er da in einem fort vor seinem Radio saß, unruhig und ängstlich wie ein Kind. Ich dachte nicht nach, als ich ihm übersetzte: Israel ist gerade in Syrien einmarschiert.
Aziz ließ die Gebetskette, deren Perlen er eben noch zwischen seinen Fingern hin- und hergeschoben hatte, aus der Hand fallen. Es war zu spät.
Was passiert jetzt, fragte er und sah mich erschrocken an.
Warte, sei still, sie reden noch, ich muss mich konzentrieren, sagte ich.
Mir fiel nichts ein.
Aziz wurde ungeduldig, nun sag schon, was sagen sie.
Mittlerweile war der Nachrichtensprecher beim Wetter angelangt.
Sie sind schon in Damaskus, sagte ich. Auf dem Weg haben sie die Schafe von siebzehn Hirten beschlagnahmt.
Aziz sah mich entsetzt an. Was nun, fragte er.
Was nun, wiederholte ich.
Was machen die Juden mit den Schafen?
Was weiß ich, sagte ich, was sollen die Israelis schon mit den Schafen machen, vermutlich essen.
Das hört sich nicht gut an, sagte Aziz.
Am nächsten Abend kam ich wieder. Die Frau von Aziz brachte Tee und Kekse. Aziz schaltete das Radio an.
Die Israelis sind nun in Homs.
Wieder am nächsten Tag sagte ich, sie sind nun in Aleppo. Sie sind auf dem direkten Weg hierher. Morgen werden sie in Raqqa sein und übermorgen in Hasake.
Hasake, wiederholte Aziz mit Panik in der Stimme, dann sind sie ja schon fast bei uns.
Ich nickte. Überall, wo sie hinkommen, sagte ich, nehmen sie Schafe, Ziegen, Kühe, Esel mit.
Was ist mit meinen Hühnern, fragte Aziz aufgeregt. Meinst du, sie werden uns meine Hühner wegnehmen.
Natürlich, sagte ich. Sie werden dir alle deine Hühner wegnehmen.
Als ich am nächsten Abend zum Übersetzen kam, fand ich Aziz nicht im Haus. Auch im Hof war es merkwürdig still. Aber aus dem Garten kamen Lärm und großes Geschrei. Ich ging nach hinten, und auf der Erde war eine riesige Blutlache. Überall Hühnerköpfe, Federn, dazwischen Aziz’ Frau mit dem Schlachtmesser und die Kinder, die umherliefen und die letzten noch lebenden Hühner einfingen. Inmitten des Chaos Aziz, der mich grimmig begrüßte und noch ein Huhn festhielt.
Was passiert hier, fragte ich, obwohl ich genau wusste, was passiert war. Aziz, sind das alle deine Hühner?
Aziz nickte. Komm morgen vorbei, zum Essen, sagte er.
Du hast doch nicht alle deine Hühner —, fragte ich und sah, was ich angerichtet hatte. Aziz unterbrach mich. Natürlich, sagte er. Lieber essen wir sie, als dass die Feinde sie bekommen.
Drei Tage später, ich war gerade im Wohnzimmer, sah ich Aziz quer über den Hof auf unser Haus zukommen. Er hatte beide Hände zu Fäusten geballt. An seinem Gang konnte ich erkennen, wie aufgebracht er war. Er brüllte meinen Namen. Silo, wo bist du, schrie er. Komm raus, Silo, ich werde dir den Kopf abreißen, wie meinen Hühnern!
Ich sprang weg vom Fenster, verließ das Haus nach hinten in den Garten, kletterte über den Zaun und rannte über die Felder in das Nachbardorf, wo ich einen Freund besuchte und bis zum nächsten Tag blieb. Bis sich, hoffte ich, Aziz beruhigt hatte.
Die Mutter kam früher von der Arbeit. Sie hatte sich den Nachmittag freigenommen, holte Leyla aus der Schule ab, sie fuhren zusammen in die Innenstadt. Leyla hatte keine Lust, wie jeden Sommer in den Wochen vor dem Aufbruch mit der Mutter durch die Kaufhäuser und Supermärkte zu ziehen und, wie die Mutter das nannte, vernünftige Geschenke zu suchen. Während Leyla ständig hängen blieb, bei der Unterwäsche, die sie seltsam fand, bei den Stöckelschuhen, wo die Mutter sie weiterzog, mach nichts kaputt, sonst müssen wir das noch bezahlen.
Als Erstes gingen sie zu Karstadt, dann in kleinere Kleidungsgeschäfte, kauften Strickjacken, T-Shirts und Pullover, arbeiteten sich vor zu Kaufhof und am Ende dann zu Veneto. Dort bekam Leyla zwei Kugeln Eis, weil sie tapfer durchgehalten hatte, wie die Mutter sagte. Was noch fehlte, besorgten sie in den Supermärkten bei ihnen um die Ecke, je nach Angebot. Sie kauften alles, worum man sie das Jahr über am Telefon gebeten hatte. Ölhaltige Salben für Schrunden an den Füßen, Medikamente, Fotokameras, Mixer, Fritteusen und diese elektrischen Zahnbürsten aus der Werbung der deutschen Fernsehsender, die man über die Satellitenschüsseln auch im Dorf empfing. Alle im Dorf wussten immer, was es in den deutschen Kaufhäusern gab. Süßigkeiten und Kinderspielzeug, Strampelhosen für die Babys, die im Lauf des Jahres geboren worden waren und die auf den nach Deutschland geschickten Videokassetten stolz in die Kameras gehalten wurden.
Die Wünsche änderten sich. Im einen Jahr waren im Dorf Vitamintabletten besonders gefragt, im anderen Eisentabletten. Mal hieß es, die Frau von Xalil habe dieses Jahr eine Mikrowelle von ihrem Bruder aus Deutschland bekommen, mal, ich habe von Kawa gehört, dass es bei euch Pürierstäbe zu kaufen gibt.
Am bescheidensten waren die Wünsche der Großeltern. Der Vater musste jedes Mal mehrfach nachfragen, und jedes Mal sagten die beiden, sie bräuchten nichts. Mit nichts kommen wir nicht, sagte der Vater, und dann erwiderte der Großvater irgendwann, er könne einen Hut gegen die Sonne brauchen und die Großmutter ein neues Taschenmesser.
Und am Ende kauften Leylas Eltern die Whiskyflaschen, die blinkenden Feuerzeuge und das Parfüm, um die Beamten zu bestechen.
Zu Hause stopfte die Mutter alles in Koffer und Tüten und legte die Klamotten dazu, aus denen Leyla im Laufe des Jahres hinausgewachsen war. Für Bücher war dann kaum noch Platz, gerade mal für ein oder zwei. Nimm eines mit, das du mehrmals lesen kannst, sagte der Vater. Leyla konnte sich nicht entscheiden, legte alle ihre Bücher auf den Boden vor sich und griff blind zu. Sara, die kleine Prinzessin.
Das Reisegepäck war auf zwanzig Kilogramm pro Passagier begrenzt. War es etwas mehr, ließ Syrian Air mit sich reden, aber Bücher waren schwer. Leyla rechnete aus, wie viele Seiten pro Tag sie haben würde. Die Tage im Dorf waren lang, und die Mittagshitze drückte. Alle Familien zogen sich in ihre Häuser zurück, lagen unter den Ventilatoren und schliefen. Es gab nichts zu tun, und Leyla langweilte sich. Nur mit Büchern konnte sie die langen Mittagsstunden füllen.
Weil sie so viel las, sagten die Leute im Dorf, Leyla sei ein ernstes Mädchen. Auch Zozan, ihre Cousine, hielt sie für altklug und arrogant. Zumindest kam es Leyla so vor. Vielleicht war Zozan aber auch nur neidisch. Leyla war das einzige Kind im Dorf, das Bücher besaß.
Jahre später fragte sie sich, warum sie und Zozan nie Freundinnen geworden waren. Es hatte doch alles dafür gesprochen. Sie waren fast im selben Alter, zwei Cousinen, die alle Sommer miteinander verbrachten.
Die Bücher waren nicht das Einzige, das Leyla von den anderen Kindern trennte. Es war auch ihr Stolpern, wenn sie mit Zozan im Dorf unterwegs war. Sie wusste nicht, wo die Gräben verliefen und man springen musste beim Rennen, beim Fangenspielen. Die anderen Kinder kannten alle Gräben, in denen das Abwasser floss, die offene Kanalisation des Dorfes, vom Frühjahr an unsichtbar, wenn das Gras hoch gewachsen war. Alle machten sie einfach einen Satz darüber, ohne nachzudenken. Ihre Füße wussten die Wege auch nachts, im Dunkeln, wenn der Strom ausfiel und Leyla immer wieder in den Morast tappte und sich schämte. Zozan sagte, Leyla habe keine Augen im Kopf, und erzählte jedem im Dorf davon, ob die anderen es wissen wollten oder nicht. Die ach so schlaue Cousine aus Deutschland, Almanya, wie Zozan dazu sagte, sei doch tatsächlich in den dreckigen Schlamm gefallen.
Und es waren auch die Wörter, die Leyla beim Sprechen fehlten, und ihre Aussprache, dass sie das R nicht so rollen konnte wie alle anderen. Sie klang so albern, dass Zozan sie nachäffte, wenn sie sich mit ihren Freundinnen traf und Leyla mitbrachte, weil die Großmutter gesagt hatte, nimm Leyla mit, doch Zozan tat es nur widerwillig und dachte, Leyla würde sie nicht verstehen. Leyla stand neben Zozan und ihren Freundinnen und kam sich vor wie ein stummer Hund, trottete ihnen einfach nur hinterher. Irgendwann sprach sie nur noch, wenn sie angesprochen wurde.
Zozan war zwei Jahre jünger, wusste aber alles besser. Wenn Leyla in der großen Blechwanne im Hof die Wäsche wusch, nahm Zozan ihr das Seifenstück aus der Hand und sagte, so geht das nicht, das macht man so. Wenn Leyla Tee kochte, sagte Zozan, du lässt ihn viel zu lange ziehen. Wenn Leyla Gurken für den Salat schnitt, waren die Stücke zu groß, wenn Leyla Weinblätter rollte, fielen sie beim Kochen auseinander, wenn sie auf den kleinen Cousin aufpasste, der damals noch ein Säugling war, fing er sofort an zu weinen.
Außer Zozan waren alle freundlich zu Leyla, und mehr als das. Kamen die Cousinen zweiten oder dritten Grades, die unzähligen echten Tanten, angeheirateten Tanten, Schwestern und Cousinen der angeheirateten Tanten aus der Stadt zu Besuch, dann überhäuften sie Leyla mit Komplimenten und Geschenken. Sie behängten sie mit Plastikarmbändern, Ketten, Haarspangen in Blümchen- oder Schmetterlingsform und glitzernden Schals, die sie an ihren Armen und Hälsen und in ihren Haaren trugen und einfach abnahmen, um sie Leyla aufzudrängen. Leyla machte das alles immer verlegen, sie fühlte sich schlecht, wenn man so großzügig zu ihr war.
Pah, sagte Zozan dazu, das machen die doch nur, weil dein Vater ihre Familien mit Geld versorgt. Täte er das nicht, würden sie verhungern. Er hat die Arztrechnung von Bêrîvans Großvater bezahlt, er hat Kawa Geld für den Schlepper gegeben, damit Kawa nach Deutschland gehen konnte.
Vielleicht hatte Zozan recht gehabt, dachte Leyla später. Und dass auch sie selbst arrogant und neunmalklug gewesen war, mindestens so sehr wie Zozan. Sie hatte auf alle herabgesehen, weil ihr Englisch besser war als Zozans bisschen Dorfschulenglisch, hatte Zozan auch dafür belächelt, wie sie sich immerzu ihre Hochzeit ausmalte, welches Kleid sie tragen, welche Frisur sie haben, wie schön geschminkt sie sein würde. Ich, hatte Leyla in einem der Sommer zu Zozan gesagt, habe andere Ziele im Leben, als einen Mann zu finden, sieben Kinder zu gebären und Brot zu backen. Wie überheblich sie damals gewesen war. Heiraten, Kinder kriegen, das war alles, wovon Zozan sich zu träumen erlauben konnte. Gegen Leylas von Nachhilfestunden geschliffenes Englisch, gegen das, was der Vater für Leyla vorgesehen hatte, Abitur, Studium, Medizin oder Jura, kam Zozan nicht an.
Aber Zozan hatte ihr auch oft die Haare geflochten, erinnerte sich Leyla. Sie saß still, während Zozan ihre Haare kämmte und bearbeitete, dabei vor sich hin summte. Als sie Zozan einmal fragte, woher sie so viele schwierige Flechtfrisuren konnte, sagte Zozan, sie habe sie sich alle ausgedacht. Irgendwann, in einem der letzten Sommer, erzählte sie Leyla, dass sie eigentlich gerne Friseurin werden würde, dass das ihr Geheimnis sei. Sie steckte Leyla Blumen aus dem Garten in die Haare und redete davon: Eines Tages werde ich meinen eigenen Friseursalon in Qahtaniyya eröffnen. Und Leyla schämte sich. Sie schämte sich dafür, wie sie, das Einzelkind aus Almanya, jeden Sommer in das Dorf gekommen war, vorsichtig aus dem Auto steigend und in ihren Lackschühchen und ihrem frischen Kleid über die staubige Erde auf die anderen zustaksend wie eine Prinzessin auf Staatsbesuch.
Die größte Auffälligkeit aller Auffälligkeiten an Leyla aber war ihre Mutter. Die so anders war als alle anderen Mütter im Dorf, die anders roch, anders redete, auch anders aussah mit ihren schulterlangen hellbraunen Haaren, die sie immer nach hinten band, weil praktisch, wie sie dazu sagte, und die nie wie die anderen Frauen im Dorf Röcke trug. Arabisch und Kurdisch sprach sie, weil sie vor der Heirat bei einer Hilfsorganisation als Krankenpflegerin gearbeitet hatte und erst lange in den Libanon und später in den Iran und dann den Irak geschickt worden war. Dort hatte sie während der Anfal-Operation, Saddam Husseins Völkermord an den Kurden, kurdische Flüchtlinge versorgt und ein notdürftiges Kurdisch gelernt, das anders als das Kurdisch war, das man im Dorf sprach, und sie in den Augen der Dorfbewohner noch merkwürdiger machte. Hinzu kam für alle, dass sie schweigsam war und nie tratschte, und schon gar nicht über die Dinge redete, die sie im Irak gesehen hatte.
Deine Mutter ist eine Spionin, hatte Zozan einmal gesagt. Wer sagt das, hatte Leyla gefragt. Das Dorf sagt das, sagte Zozan.
Als die Behörden dem Vater einmal sein Sondervisum nicht ausstellten, mit dem er sicher ein- und ausreisen konnte, und Leyla noch zu klein war, um allein zu reisen, beschloss die Mutter, mitzufahren. Sie packte einen Koffer wie für einen ihrer früheren Einsätze, mit Medikamenten, Verbandsmaterial, sterilen Kompressen und Impfungen.
Schon nach ein paar Tagen kamen die ersten Frauen aus dem Dorf. Sie sagten, sie hätten gehört, dass eine Krankenpflegerin aus Almanya da sei. Die Mutter lernte schnell. Unter ihr notdürftiges Kurdisch aus dem Irak mischten sich bald schon neue Wörter aus dem Dorf. Essen, Trinken, müde, Schmerzen, Kinder und Tomaten sagte sie nun im Dorfdialekt, benutzte dazu ihre Brocken Arabisch, die sie im Libanon und an der Volkshochschule gelernt hatte. Ihr Sprachgemisch war so praktisch wie ein Notkrankenhaus, das man einfach irgendwie in die Landschaft gesetzt hatte und das funktionierte, obwohl an allen Ecken etwas fehlte, alles schnell gehen musste und keine Zeit blieb, Höflichkeitsfloskeln oder Sprichwörter auszutauschen. Mit der Zeit gewöhnte sich die Mutter an das Dorf und das Dorf sich an sie. Die Frauen im Dorf sagten später in den Sommern mit ihr, sie sei zwar eine Spionin, aber eine, die auch Spritzen setzen könne.
Der Großvater saß die meiste Zeit auf einem Teppich, schlief, drehte Zigaretten, rauchte und aß gesalzene Sonnenblumenkerne. Er war immer dort, wo sich die Familie gerade aufhielt, wanderte an seinem Gehstock mit seiner Tabakdose, der Kette mit den großen runden Perlen, die er, während er sprach oder einfach nur dasaß, immerzu zwischen seinen Fingern hin- und herschob, mit Kissen, Teppich und Matte, die man ihm hinterhertrug, vom Haus in den Garten oder in den Hof und wieder zurück.
Er hatte immer dieselbe Kleidung an, şal û şapik, wie es die meisten alten Männer im Dorf trugen, eine weite Hose und ein Hemd in Braun, Olive oder Grautönen, für ihn genäht von der Großmutter, die Hose mit einem breiten, meterlangen Stoffschal um die Taille gewickelt. Immer trug er einen Hut und hatte seinen Gehstock aus Holz dabei. Seine Augen waren trüb, Leyla fand, dass es aussah, als habe jemand Milch über die Augäpfel gegossen. Leyla dachte, es liege an dieser Milch in den Augen, dass der Großvater blind war, er könne nicht hindurchsehen. Seine Augen hatten nicht immer diese trübe Farbe gehabt. Die Großmutter sagte, früher seien sie dunkelbraun gewesen, die Farbe von Walnüssen, fast schwarz.
Niemand wusste sein genaues Alter, nicht einmal er selbst. Wie auch die Großmutter nicht wusste, wie alt sie war, so wenig wie alle anderen alten Leute im Dorf. Lange dachte Leyla, der Großvater wäre der älteste Mensch der Welt. Er erinnerte sich an Dinge, die vor hundert, zweihundert Jahren passiert waren. Er konnte von Kriegen erzählen, von Schlachten, von Mem û Zîn, als wäre er selbst dabei gewesen. Er musste ganz einfach bei alldem dabei gewesen sein, so gut kannte er sich aus. Die Geschichte von Mem û Zîn war die traurigste Geschichte, die Leyla je gehört hatte. Der Schreiber am Hof Mem aus der Alan-Familie und die Prinzessin Zîn aus der Botan-Familie verliebten sich. Sie wollten heiraten, doch wurde das durch eine Intrige verhindert. Bakir, ein böser Mensch, tötete Mem. Als Zîn von Mems Tod erfuhr, brach sie an seinem Grab zusammen und starb ebenfalls. Womit die Geschichte nicht zu Ende war: Der Tod von Mem und Zîn sprach sich rasend schnell herum, das Volk wurde wütend und tötete zur Rache den bösen Bakir, der als Demütigung unter den Füßen von Mem und Zîn begraben wurde. Aber ein Dornbusch, genährt von Bakirs Blut, wuchs aus ihm heraus. Die Wurzeln des Dornbusches griffen so tief in die Erde und schoben sich so wuchtig zwischen die Gräber von Mem und Zîn, dass die beiden auch im Tod voneinander getrennt waren.
Manchmal bekam der Großvater Besuch von einem Freund, an dessen Namen sich Leyla später nicht mehr erinnern konnte. In der Familie hatten sie ihn nur den Armenier genannt. Er kam ins Dorf, blieb zum Tee oder auch für ein paar Tage. Der Armenier war in derselben Gegend aufgewachsen wie der Großvater, Beşiri hieß sie, in der Nähe von Batman. Ob die zwei sich schon damals gekannt hatten oder nur ihre Familien miteinander in Verbindung standen, wusste Leyla nicht.
Der Armenier hatte auch andere Bekannte im Dorf, die ihn einluden. Doch eigentlich kam er nur, um den Großvater zu besuchen. Sie saßen stundenlang im Hof oder im Wohnzimmer, rauchten, tranken Tee und aßen Obst, das ihnen Zozan, die Großmutter oder Leyla brachten, und manchmal setzte Leyla sich dazu. Solange sie still saß, durfte sie bleiben, der Großvater und der Armenier beachteten sie nicht weiter. Sie waren vollkommen damit beschäftigt, ihre Erinnerungen abzugleichen, sprachen über Familien, Dörfer und Namen, die Leyla noch nie gehört hatte. Der Armenier war ein paar Jahre jünger als der Großvater. Heute wusste Leyla, dass beide, der Großvater und der Armenier, die von ihnen ausgesprochenen Namen, die Familien und Dörfer auch nur aus Erzählungen kennen konnten, weil sie alle schon lange verschwunden waren, als die zwei geboren wurden. 1915, 1916, las Leyla Jahre später, als sie studierte, und hatte plötzlich Jahreszahlen für das, worüber die beiden immer wieder gesprochen hatten.
Von den Armeniern erzählte der Großvater, die im Dorf ihre Nachbarn gewesen waren und die in den Nachbardörfern gelebt hatten, in Kurukanah und Maribe, und in den nächsten Städten, in Kars, Diyarbakir, Van, die Handwerker gewesen waren und Öfen gebaut hatten, die Familie Tigran, die Familie Gasparyan, die Familie Gagarjah, oder hieß sie anders? Aber das waren Schreiner gewesen, und die Familie Soundso Schmiede. Manche waren Bauern und hielten sich Vieh, genau wie die Familie des Großvaters. Es war eine gute Gegend für Landwirtschaft gewesen, die Böden in der Nähe des Tigris waren fruchtbar. Bis zu jenem Tag, sagte der Großvater, an dem die Soldaten in die Dörfer und Städte kamen. Es war Sommer, sie kamen auf Pferden. Die Hufe ihrer Pferde schlugen dumpf auf den Boden und wirbelten Staub hoch. Die Soldaten trieben die Familien zusammen. Nur wenige konnten sich verstecken, unter anderem Frau Sona, selbst der Vater konnte sich noch gut an sie als alte Frau erinnern. Bis zu ihrem Tod kam sie immer wieder in das Dorf, um ihre Familie zu besuchen, wie sie sagte, Mutter, Vater, Schwestern und Brüder, allerdings nicht ihre leibliche Mutter, ihr leiblicher Vater, ihre leiblichen Schwestern und Brüder. Sie hatten ihr als kleines Mädchen êzîdische Kleider angezogen, lange weiße Hosen unter dem Rock, ein weißes Kopftuch, und sie als Tochter einer êzîdischen Familie vor den Soldaten versteckt. Frau Sona blieb bei der Familie, bis sie heiratete, hatte keinen anderen Ort, an den sie zurückkehren konnte, weil alle anderen in die großen Gräber getrieben worden waren, die sie zuvor unter Aufsicht der Soldaten ausheben mussten, bei vierzig Grad, im Hochsommer. Dort wächst bis heute nichts mehr, sagte der Großvater, weil der Boden blutgetränkt ist. Und andere, sagte er, starben in der syrischen Wüste, oder im Tigris, wo die Soldaten all jenen, die sich an Grasbüscheln und Sträuchern festklammerten, um nicht vom Strom mitgerissen zu werden, mit ihren Säbeln die Hände abschlugen.
Aus einem Dorf in dieser Gegend kam auch der Sänger Karapetê Xaço, dessen Lieder der Armenier und der Großvater manchmal zusammen hörten und die der Großvater mitsang. Karapetê Xaços Dorf in der Provinz Batman hieß Bileyder. Außer ihm überlebten nur ein Bruder und zwei Schwestern, Xaço war damals fünfzehn Jahre alt. Er ging zur französischen Fremdenlegion, blieb dort die nächsten fünfzehn Jahre, heiratete eine Frau aus Qamishlo und zog schließlich mit seiner Familie nach Erevan. Er war einer der besten Dengbêj, die es je gegeben hatte. Jeden Tag um Viertel vor vier am Nachmittag und um Viertel vor neun, sagte der Großvater, bin ich, als wir endlich ein Radio hatten, ein kleines tragbares, mit Batterien, Nûrî hat es mir gekauft, auf das Dach gestiegen, weil dort der Empfang am besten war, und habe die kurdische Sendung von Radio Erevan gehört. Zweimal am Tag eine halbe Stunde. Dort habe ich Xaços Stimme gehört, immer wieder. Arm ist er gestorben, sagte der Großvater. Ich singe für vierzig Millionen Kurden, vierzig Millionen Kurden können mich nicht ernähren, soll er gesagt haben. Seine Stimme, wie die einer Nachtigall. Leyla, hast du schon mal etwas so Schönes gehört, fragte der Großvater, und der Armenier und der Großvater sahen sie an.
Das Gehen fiel ihm schwer. Er schaffte nur noch wenige Schritte, nach vorne gebeugt und auf seinen Stock gestützt. Mit der anderen Hand tastete er nach der Hauswand, den Schultern seiner Kinder und Enkelkinder, suchte Halt. Hatte er etwas gefunden, klammerte er sich mit zitternder Hand daran, so dass seine Knöchel weiß hervortraten.
Immer rief er nach der Großmutter, wenn er etwas brauchte oder sich einfach nur langweilte. Und er langweilte sich oft, glaubte Leyla, er konnte ja kaum gehen und war blind, Leyla hatte ihn nie anders kennengelernt.
Aber früher, sagte die Großmutter, sei er so beschäftigt gewesen wie sie, mit den Feldern, mit den Tieren, mit dem Tee und dem Tabak, den er hinüber in die Türkei gebracht habe, um ihn dort zu verkaufen. Seit der Großvater erblindet und erlahmt war, sagte der Vater, arbeitete die Großmutter doppelt so hart. Oder sogar dreimal so viel, weil der Großvater ja ständig ihre Hilfe brauchte, nicht einmal ankleiden konnte er sich mehr selbst.
Leyla, setz dich zum Großvater, sagte der Vater, er freut sich, wenn du bei ihm bist. Und Leyla saß auch gerne beim Großvater, aber nach einiger Zeit wurde ihr immer langweilig, und sie begann dann, ihre Mückenstiche aufzukratzen oder die Flusen vom Teppich abzuzupfen. Der Großvater tastete nach seinem Tabak, ich kann meinen Tabak nicht finden, Leyla, hast du meinen Tabak gesehen? Er tastete nach seiner Tasse, die Tasse war leer, Leyla, kannst du mir Wasser bringen, ich habe Durst?
Leyla holte ihm Wasser, setzte sich wieder neben ihn. Er streckte seine Hand aus, befühlte ihr Haar, Zozan, nein, Leyla, du bist es. An der Länge der Zöpfe unterschied der Großvater seine Enkeltöchter.
Er begann, über seine Schwiegertochter Havîn zu reden, sie sei so faul. Immer ist sie so faul. Kannst du mir erklären, warum sie so faul ist, Leyla? Schon einen Tag, sagte der Großvater, nachdem Memo sie geheiratet hat, habe ich gesagt, wir schicken sie wieder zurück, sie ist den Brautpreis nicht wert. Havîn war eines seiner Lieblingsthemen, der Großvater wurde nicht müde zu erzählen, was sie schon wieder falsch gemacht hatte. Ihre Kûlîçe schmecken nicht, sagte der Großvater, wenn sie schon backt, was sie ja selten tut, weil sie so faul ist. Aber sie schmecken einfach nicht. Was er nicht verstehe, denn Kûlîçe backen sei ja wirklich nicht schwer. Selbst Zozan könne das besser als ihre Mutter.
Leyla glaubte, dass das Schimpfen die Lieblingsbeschäftigung des Großvaters war, meist über Menschen, die Leyla nicht kannte. Dieser oder jener würde lügen, diese oder jene hätte zwei Gesichter, sagte der Großvater, und Leyla, du stimmst mir doch zu? Und Leyla nickte für sich und sagte laut Ja, obwohl sie nicht wusste, von wem der Großvater sprach.
Ständig rief er die Großmutter zu sich. Meist kam sie dann auch gleich, aber manchmal, wenn sie beschäftigt war oder keine Lust hatte, tat sie so, als hätte sie ihn nicht gehört. Sie lief dann einfach an ihm vorbei, während er nach ihr rief, Hawa! Hawa! Quer über den Hof ging sie und schaute über ihn hinweg, und er kriegte nichts mit in seiner Blindheit. Leyla fand das manchmal so komisch, dass sie lachen musste, und der Großvater wurde dann wütend, was ist denn so lustig, hör auf zu lachen.
Jeden Morgen zu Sonnenaufgang, wenn alle anderen noch schliefen, stand die Großmutter auf und sprach ihre Morgengebete. Leyla wurde von ihrer leisen Stimme wach. Sie brauchte immer einen Moment, bis sie begriff, was die Großmutter da tat. Die Großmutter war die Einzige in der Familie, die betete. Leyla hatte nie zuvor jemanden beten gesehen. Sie war fasziniert.
Als er ein Kind gewesen war, habe auch der Großvater gebetet, sagte die Großmutter, als Leyla sie danach fragte. Aber dann seien seine beiden Schwestern gestorben, plötzlich, an sinnlosen Kinderkrankheiten. Gott gibt das Leben und er nimmt es wieder, sagte die Großmutter. Der Großvater war von da an Einzelkind. Und konnte nur noch über Gott schimpfen.
Zwei schöne Schwestern habe ich gehabt, mit langen schwarzen Haaren und zarten Gesichtern, rief der Großvater. Warum hat Gott mir nicht wenigstens eine einzige Schwester lassen können?
Da der Großvater auf Gott nicht gut zu sprechen war, war die Großmutter für alle religiösen Verpflichtungen der Familie zuständig. Sie fastete, kochte für die Festtage und versorgte die Sheikhs, Pîrs und Qewals, wenn sie zu Besuch kamen. Mittwochs wusch sie sich nicht. Vor vielen Jahren hatte sie sogar einmal mit ihrem jüngsten Sohn Memo eine Pilgerreise nach Lalish unternommen, obwohl sie sonst nie das Dorf verließ. Ihren Kindern und Enkelkindern brachte sie bei, die Hymne von Sherfedîn zu singen, nicht zu fluchen, nicht auf den Boden zu spucken und niemals die Farbe Blau zu tragen.
Nach dem Morgengebet, das sie sitzend im Bett verrichtete, stand sie auf, vorsichtig, um die neben ihr schlafenden Enkelkinder nicht zu wecken, stieg die Leiter vom Hochbett hinunter in den Hof und ging die Hühner füttern, das Frühstück zubereiten, Tee kochen, den Garten bewässern, Brot backen, Unkraut jäten, Beete umgraben, säen, ernten, den Zaun reparieren. Wurde es heißer, ging sie ins Haus, flickte Kleidung, bereitete das Mittagessen zu, aß und schlief, bis es wieder kühler war. Dann ging sie wieder raus, füllte den Wasserkanister in der Küche, pflückte Weintrauben, sortierte die überreifen Trauben für den Raki aus, fädelte Okraschoten auf Garn, hängte sie zum Trocknen in die Speisekammer, kümmerte sich um die Bienen. Zwischendurch kochte sie Tee für die Nachbarn, die zu Besuch kamen, versorgte den Großvater mit Essen und Wasser, wusch ihn, hütete die Enkelkinder. Sie tröstete sie, wenn sie sich wehgetan hatten und weinten, deckte sie mit einer Decke zu, damit sie sich nicht verkühlten, wenn sie unter dem Ventilator eingeschlafen waren, zog Mîran und Roda auseinander, wenn diese in einen Streit geraten waren und sich prügelten, wiegte den kleinen Roda in ihren Armen, bis er einschlief.