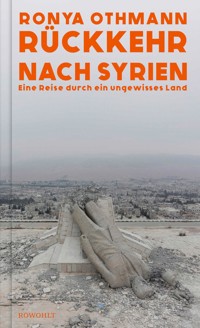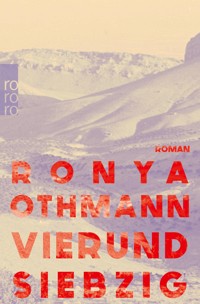
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Am 3. August 2014 ist der Himmel nicht auf die Erde gefallen, aber trotzdem war es das Ende.» Ronya Othmann will eine Form finden für das Unaussprechliche, einen Genozid, den vierundsiebzigsten, verübt 2014 in Shingal von Kämpfern des IS. «Vierundsiebzig» ist eine Reise zu den Ursprüngen, zu den Tatorten: in die Camps und an die Frontlinien, in die Wohnzimmer der Verwandten und von deutschen Gerichtssälen weiter in ein êzîdisches Dorf in der Türkei, in dem heute niemand mehr lebt. «‹Vierundsiebzig› ist vieles in einem – Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Geschichtsschreibung in Echtzeit – und dennoch ein organisches Ganzes. Ein literarischer Befreiungsschlag.» Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ronya Othmann
Vierundsiebzig
Roman
Über dieses Buch
«Ich habe gesehen. Das Ich ist ein Zeuge. Es spricht, und doch hat es keine Sprache.» So beschreibt Ronya Othmann in ihrem neuen Roman den Vorgang des Erzählens. Sie will eine Form finden für das Unaussprechliche, den Genozid an der êzîdischen Bevölkerung, den vierundsiebzigsten, verübt 2014 in Shingal von Kämpfern des IS.
Vierundsiebzig ist eine Reise zu den Ursprüngen, zu den Tatorten. Der Weg führt in die Camps und an die Frontlinien, in die Wohnzimmer der Verwandten und weiter in ein êzîdisches Dorf in der Türkei, in dem heute niemand mehr lebt. Es geht darum, hinzusehen, zuzuhören, Zeugnis abzulegen, Bilder und Berichte mit der eigenen Geschichte zu verweben, mit einem Leben als Journalistin und Autorin in Deutschland.
Ronya Othmann erschafft ein Werk von ungeheurer Dichte, notwendiger Klarheit und Härte, eine radikal poetische Form dokumentarischen Erzählens. Ihre Stimme ist eine der Diaspora, die auch in den Lesenden tiefe Spuren hinterlässt.
Vita
Ronya Othmann, als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-êzîdischen Vaters 1993 in München geboren, schreibt Lyrik, Prosa, Essays und arbeitet als Journalistin. Für Die Sommer bekam sie 2020 den Mara-Cassens-Preis zugesprochen, für den Lyrikband die verbrechen (2021) den Orphil-Debütpreis, den Förderpreis des Horst-Bienek-Preises sowie den Horst Bingel-Preis 2022. Ein Auszug aus Vierundsiebzig, ihrem zweiten Roman, wurde 2019 mit dem Publikumspreis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2024 by Ronya Othmann
Covergestaltung Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Sammlung Eugen Wirth (CC-BY-NC-SA)
Karte © Daniel Sauthoff
ISBN 978-3-644-01689-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt.
Am 3. August 2014 ist der Himmel nicht auf die Erde gefallen, aber trotzdem war es das Ende.
Ich schreibe: Eine Frau aus dem Shariya-Camp hat das zu mir gesagt.
Ich schreibe:
Im August 2014 sitze ich vor dem Fernseher. Ich sehe Frauen in den Kleidern meiner Großmutter, meiner Tante, meiner Cousinen, sehe Männer wie meinen Großvater, meinen Vater, meine Onkel, meine Cousins um ihr Leben rennen. Es ist Hochsommer. In den Bergen von Shingal verdursten Kleinkinder, Alte, Kranke. Shingal sei umzingelt, heißt es. Die Männer und die älteren Frauen, die es nicht schaffen, zu fliehen, töten sie. Die jüngeren Frauen und Kinder nehmen sie mit als Kriegsbeute, verkaufen sie weiter auf Sklavenmärkten an Kämpfer des IS. Frauen, die meinen Namen tragen, den meiner Schwester, meiner Cousine.
Ich lese, dass sie ihnen als Erstes die Armbänder abschneiden. Es sind dieselben Bänder, die wir jedes Jahr zu Çarşema Sor, dem Roten Mittwoch, dem êzîdischen Neujahr, bekommen. Sie sollen uns schützen. Man darf sie nicht abschneiden. Wenn sie sich lösen, soll man sie an den Ast eines Baumes binden und sich etwas wünschen.
An den August 2014 kann ich mich nicht mehr erinnern. Später schreibe ich: Ich sitze vor dem Fernseher, weil ich weiß, dass ich vor dem Fernseher saß. Ich weiß auch, was ich sah. Aber an das, was ich sah, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich schreibe, dass ich auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Eltern sitze, dass ich erst dusche oder esse, wenn mir auffällt, wie lange ich es nicht mehr getan habe.
Jedes Schreiben ist für mich Fiktion. Ob ich über mich schreibe, meinen Vater, meine Großmutter oder eine Figur, der ich einen Namen gebe und eine Geschichte.
2014 habe ich die êzîdische Abgeordnete Vian Dakhil bei ihrer Rede vor dem irakischen Parlament gesehen. Ich habe gesehen, wie sie versuchte, das, was in Shingal geschah, in Worte zu fassen, und wie sie dann mitten in ihrer Rede zusammenbrach und, von zwei Parlamentarierinnen gestützt, aus dem Saal gebracht wurde. Ich habe den Moderator und den zugeschalteten Reporter im kurdischen Fernsehen gesehen, die, anstatt von Shingal zu berichten, zu weinen anfingen.
Angesichts der Gräueltaten, und ich streiche das Wort Gräueltaten, angesichts der Verbrechen, und ich streiche das Wort Verbrechen, weil sowohl das Wort Gräueltaten als auch das Wort Verbrechen nicht tragen. Angesichts dessen, was 2014 in Shingal geschah und was die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament später Völkermord nannten, versagt die Sprache. Ich habe mir beide Videos, das von der êzîdischen Parlamentarierin und das von dem Moderator und dem Reporter, wieder und wieder angesehen. Beide, die Parlamentarierin und der Reporter, beginnen mit den Fakten. Sie tragen vor, was wo, wie und wann geschah, und brechen dann mitten in ihrer Rede ab.
2018, nicht einmal vier Jahre nach dem Genozid, fliege ich zu meiner Familie nach Kurdistan. Wir besuchen das Camp Ashti, was Frieden bedeutet. Das Camp liegt bei Arbat, etwa eine halbe Stunde von der Stadt Silêmanî, Sulaymaniyah, entfernt, an der iranischen Grenze.
Ich schreibe: Ich sitze neben Lara und Lava auf der Rückbank. Lara und Lava sind schlecht gelaunt. Lara sagt, sie habe keine Lust, ständig würden sie ins Camp fahren. Wir nähern uns, eine Straße, biegen ab, Schotterweg, inmitten einer weiten, flachen, von Bergen umgebenen Landschaft. Unter dem blauen Vormittagshimmel ein Wachhäuschen. Man kennt uns hier und winkt uns durch.
Wir besuchen Freunde im Camp. In einem der Zelte lebt eine Familie, die selbst in IS-Gefangenschaft war, oder das, was von einer Familie übrig ist. Zwei Jungen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, die so stumm dasitzen, wie ich noch nie Kinder in ihrem Alter habe dasitzen sehen. Ihre Mutter, die mir Fotos ihres verschleppten Vaters, ihres verschleppten Mannes, ihrer verschleppten Tochter zeigt und in ein lautes Weinen ausbricht. Meine Cousine neben mir hat das Smartphone ihrer Mutter in die Hand genommen, sieht sich angestrengt Katzenvideos an.
Sieh dir diese Frau an, sagt meine Tante. Und in der Ecke des Zeltes sitzt eine alte Frau mit weißem Haar, weißem Kopftuch und Kleid. Ich habe noch nie einen Menschen so dasitzen sehen wie diese Frau, Schultern und Kopf nach vorne gebeugt, eingesunken. Ich kann ihr Gesicht kaum erkennen.
Seitdem der IS in ihr Dorf kam, sagt meine Tante, hat diese alte Frau kein einziges Wort mehr gesprochen. Nicht nur nicht gesprochen, sie war nicht mehr ansprechbar.
Die Sprachlosigkeit hat sich in den Körper dieser Frau eingeschrieben. Sie sieht kein einziges Mal auf, nicht als wir das Zelt betreten, nicht als wir sitzen und nicht als wir gehen. In ihrer linken Hand hält sie, und das sehe ich erst, als wir uns verabschieden, einen winzigen Kieselstein.
Ein paar Tage später sind wir bei dem Sheikh unserer Familie zu Besuch. Der Sheikh erzählt die Geschichte von einem Jungen, der sieben Jahre alt war, als IS-Kämpfer seinen Vater vor seinen Augen köpften, nachdem dieser sich geweigert hatte, zum Islam überzutreten. Dem siebenjährigen Jungen drückten sie den Kopf seines Vaters in die Hand und sagten: Nun, da du gesehen hast, was wir mit deinem Vater gemacht haben, willst du zum Islam übertreten.
Der Sheikh zündet sich eine Zigarette an und erzählt dann eine zweite Geschichte. Nach der zweiten Geschichte erzählt er eine dritte. Nach der dritten Geschichte verstummt er und sagt: Ich könnte ewig so weitererzählen, vierundzwanzig Stunden können wir hier sitzen, und ich kann euch vierundzwanzig Stunden solche Geschichten erzählen.
Die Parlamentarierin, die bei ihrer Rede zusammengebrochen ist, die Reporter, die angefangen haben zu weinen, die alte Frau, die verstummt ist, und der Sheikh, der eine Geschichte nach der anderen erzählte, der sagte, er könne vierundzwanzig Stunden weitererzählen, ohne zu einem Ende zu kommen, zeigen, dass es keine Sprache gibt für das, was im August 2014 geschah. Selbst das Aneinanderreihen der Fakten, das Zählen der Toten, selbst das Datum, 3. August 2014, oder 74. Ferman, wie wir Êzîden den Genozid nennen, bleiben ein Platzhalter für etwas, wofür wir keine Worte haben. Die Sprachlosigkeit liegt noch unter der Sprache, selbst wenn ein Text da ist. Die Sprachlosigkeit ist das Unbeschreibliche, und sie ist selbst Teil des Textes. Die Sprachlosigkeit strukturiert den geschriebenen Text, legt seine Grammatik fest, seine Form, seine Worte.
Ich schreibe: Ich bin in einer Landschaft gewesen. In der Landschaft war ein Camp. In dem Camp ein Zelt und in dem Zelt eine alte Frau. Und in der Hand der alten Frau war ein Kieselstein.
Ich schreibe: Ich habe gesehen. Das Ich ist ein Zeuge. Es spricht, und doch hat es keine Sprache.
Im Juni 2018 sitze ich im Flugzeug und kaue Kaugummi gegen den Druck in den Ohren und gegen meine Nervosität. Das Flugzeug ist schon im Sinkflug. Ich sehe aus dem Fenster und sehe ockerfarbene Erde, Häuser mit flachen Dächern, Straßen. Ich mache ein Foto.
Was ich im Irak will, fragt der Mann, der vier Stunden schweigend neben mir gesessen hat und sich nun vorstellt mit einem typisch amerikanischen Namen, den ich gleich wieder vergesse. Thomas, Michael oder vielleicht Marc. Was ich bloß in diesem Land wolle, fragt er mich.
Familie besuchen, sage ich und habe keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich sagen soll. Nicht einmal mir selbst könnte ich es erklären. Warum ich in den Irak reise, alleine, warum ich Flüge gebucht habe zu Leuten, die ich das letzte Mal gesehen habe, als ich drei Jahre alt war.
Keine Sorge, Onkel Khalef ist Familie, hat mein Vater gesagt. Und was Familie bei uns ist, das will ich Marc auch nicht erklären.
Als Nicht-Muslimin und als Frau, ob ich denn keine Angst hätte, alleine in den Irak?, fragt Marc. Dieses Land sei doch insane.
Fast bereue ich, ihm nicht erzählt zu haben, ich sei Journalistin.
Marc arbeitet für das US-Militär. Das sagt er zumindest. Er will mir nicht verraten, was seine Aufgabe dort ist. Er sagt, er dürfe nicht darüber sprechen, es sei streng geheim.
Und ich denke, vielleicht ist sein Job gar nicht so aufregend, und er will mich nur beeindrucken. Jedenfalls will Marc so schnell wie möglich wieder aus dem Land. Die Arbeit machen und abhauen, sagt er. Und er zeigt mir Fotos auf seinem Handy, von seinen Hunden, Waffen, seinem Auto.
Ich nicke und sehe wieder aus dem Fenster. Die ockerfarbenen Felder, Straßen und Häuser sind jetzt deutlich zu erkennen. Ich sehe den Schatten der Wolken auf der Erde. Ich fotografiere aus dem Fenster. Dann setzt das Flugzeug auf der Landebahn auf, rollt, rollt und rollt, bis es stehen bleibt.
Später schreibe ich: Als ich aus dem Flugzeug steige, die Treppe hinunter zum Bus, schlägt mir heiße Luft entgegen. Ich schreibe auch: zu Hause, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt.
Diese heiße, trockene Luft ist das Erste, was ich wahrnehme, noch bevor ich die ausgedörrte Landschaft bemerke, und sie ist mir vertraut. Es ist dieselbe Luft wie in den Sommern, in denen ich als Kind in das Dorf meiner Großeltern in Syrien fuhr, die mir entgegenschlug, wenn ich aus dem Flugzeug auf die Gangway trat, und die ich atmete, atmete und atmete und atmete.
Passkontrolle. Ich lege meinen deutschen Pass auf die Theke. Der Beamte lächelt, als er meinen kurdischen Namen liest. Er spricht ihn aus, wie er in meiner Familie ausgesprochen wird. Ronya mit weichem R, langem O. Ich nicke.
Der Flughafen in Erbil ist der zweitsicherste Flughafen der Welt, nach Tel Aviv, hat mein Vater gesagt, stolz, als hätte er selbst ihn gebaut. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt und nur durch mehrere Sicherheitskontrollen zu erreichen. Vom Ankunftsterminal nehme ich einen Bus zu der Besucherhalle. Ich durchquere die Besucherhalle.
Onkel Khalef wartet auf dem Parkplatz auf mich. Wir umarmen uns. Onkel Khalef ist nicht der Bruder meines Vaters, trotzdem nenne ich ihn Onkel. Wir fahren aus der Stadt, eine vierspurige Straße. Auf der linken Seite das christliche Viertel Ankawa, auf der rechten das muslimische Erbil. Am Palast von Nêçîrvan Barzanî vorbei. Ein kleines Häuschen, sagt Onkel Khalef und lacht.
Bald nur noch Vororte. Vereinzelte Häuser zerstreuen sich im Umland. Dann Berge. Checkpoint folgt auf Checkpoint. Irgendwann höre ich auf zu zählen. Am Straßenrand die Fotos der Märtyrer, die im Kampf gegen den IS gefallen sind. Ich schreibe: überlebensgroß. Und meine: riesig.
Die grünen und die gelben Wimpel der kurdischen Parteien. Nach jedem Checkpoint beginnt ein eigener Staat, sagt Onkel Khalef und schimpft auf die Korruption. Wir fahren die Straße nach Nordosten, dann über Koya nach Süden. Die kurdischen Flaggen, die in den blauen Himmel wehen, schreibe ich. Obwohl ich weiß, dass die kurdischen Flaggen hier nicht verboten sind, im Gegenteil, vermutlich von der Verwaltung aufgestellt wurden, weil das hier die Autonome Region Kurdistan ist, bin ich erstaunt, sie zu sehen. Ich muss daran denken, wie mein Vater meiner Schwester und mir – wir müssen drei und vier Jahre alt gewesen sein – auf unserer ersten Reise in das Dorf unserer Großeltern einschärfte, niemandem zu sagen, wohin wir unterwegs waren. Nämlich nicht, wie wir selbstverständlich annahmen und wie man es uns gesagt hatte, zu Oma und Opa in Kurdistan. Sondern in die Arabische Republik Syrien.
Kurdistan, da wusste ich längst Bescheid, suchte ich später trotzdem im Schulatlas. Oder die Stelle, wo Kurdistan, wenn es diesen Staat gäbe, eingezeichnet sein müsste. Vom Sykes-Picot-Abkommen hatte mein Vater erzählt, als die Franzosen und Briten 1916, noch vor dem Zerfall des Osmanischen Reichs, den Nahen Osten unter sich aufteilten und die Kurden leer ausgingen. 1920 kam der Vertrag von Sèvres, der den Kurden Autonomie oder gar, laut Artikel 64, einen Staat in Aussicht stellte. Doch mit dem Vertrag von Lausanne 1923 war die Aussicht auf Autonomie und Staat schon wieder verschwunden. Vom Aufwachsen in Syrien erzählte mein Vater und von der Schule, in der die arabische Sprache in die kurdischen Kinder hineingeprügelt wurde. Für jedes kurdische Wort ein Schlag mit dem Stock auf den Handrücken, sagte er und schloss seine Erzählung mit Sätzen wie: Keine Freunde außer die Berge.
Aber hier gibt es, denke ich, als ich aus dem Fenster sehe, das Land, die Berge und, wenn auch keinen Staat, immerhin die Ala Rengîn, die Flagge Kurdistans.
Wir fahren nach Osten. Die Landschaft verändert sich, wird kahl und bergig. Irgendwann halten wir an einem Stausee. Wir steigen aus, trinken Tee und rauchen. Wir stehen am Stausee. Jugendliche rasen in Motorbooten über das Wasser. Onkel Khalef macht ein Foto von mir vor dem Stausee. Ich schicke es meiner Familie und meinen Freunden.
Du siehst glücklich aus, schreibt eine Freundin.
Wieder im Auto denke ich, was ich im Flugzeug schon gedacht habe: Dass ich nicht nur zu Hause bin, sondern auch in dem Land, in dem der Genozid passierte. Ich schreibe: In dem Land, in dem man Êzîden tötete, weil sie Êzîden waren.
Du hast sicher Hunger, sagt Tante Adar.
Es gibt Fladenbrot, Fleisch mit Paprika und Tomaten in Soße und Salat. Dazu Dew mit Minze. Wir essen, Onkel Khalef, Tante Adar, meine Cousinen Lava und Lara und mein siebenjähriger Cousin Lorans. Wir reißen das Brot in Stücke, greifen quer über den Tisch.
Ich schreibe: Ich habe es vermisst, so zu essen. Wieder schreibe ich: zu Hause.
Tee, dann Bonbons, dann Kekse, dann Obst. Gesalzene Sonnenblumenkerne. Kaffee mit Kardamom.
Iss, iss, sagt Tante Adar. Sie ist eine gute Köchin. Einmal habe sie Gäste gehabt, erzählt sie, ein alter Mann. Er sei beim Essen in Tränen ausgebrochen. Und als sie fragte, was los sei, sagte er, es schmecke wie bei seiner Mutter.
Ich fotografiere die Wassermelonen und schicke das Foto meinem Vater. Und ich denke daran, wie er sich all die Jahre über die Melonen in Deutschland beklagt hat, wie fad sie schmeckten im Gegensatz zu den Melonen zu Hause. Ich esse und esse, als könnte ich all die Jahre in Deutschland in nur einem Tag aufholen.
Wir fahren mit dem Auto den Berg hinter der Stadt hinauf. Zwanzig Minuten, dann sind wir oben. Schilder, auf denen steht: Keep Kurdistan Clean.
Die Leute kommen und lassen ihren Müll hier, sagt Onkel Khalef. Die Leute picknicken immer. Selbst während des Krieges, eine halbe Stunde von der Front zum IS entfernt, haben die Familien noch gesessen und gepicknickt.
Wir stehen und machen Fotos. Der Abend dämmert. Das Licht schwindet, und die Stadt zu unseren Füßen ist erhellt von Straßenlaternen, Leuchtreklame und Autos.
Auf dem Rückweg halten wir an einem Kiosk am Straßenrand. Was willst du trinken, fragt Onkel Khalef. Wir haben alles, was du willst. Bier, Wein, Whisky, Wodka und Raki! Das ist nicht Erbil, das ist nicht Duhok oder Bagdad. Das ist Silêmanî. Silêmanî ist frei und sicher, sagt Onkel Khalef. Aus dem ganzen Land kommen Touristen. Aus Bagdad werden sie in Bussen hergebracht.
Später sitzen wir im Wohnzimmer, rauchen, trinken Dosenbier und essen gesalzene Sonnenblumenkerne.
Wir sagen nicht, dass wir Êzîden sind, sagt Tante Adar. Niemand hier weiß, dass wir Êzîden sind.
Und doch denke ich: Es ist wie früher, in den Sommerferien, als wir in das Dorf meiner Großeltern fuhren. Nur dass jetzt ich die Geschenke besorgt habe, und nicht meine Eltern. Die letzten zwei Tage vor meinem Abflug bin ich, wie früher meine Mutter, durch die Kaufhäuser und Geschäfte gelaufen. Ich habe Süßigkeiten und Nescafé gekauft, einen aufblasbaren Fußball für meinen Cousin, ein batteriebetriebenes Spielzeugauto, eine Spielzeugpistole mit Softairkugeln, Nagellack für meine Cousinen, Handcreme, Parfüm und Ohrringe. Spätabends dann alles in Koffer packen. Mein Vater, der versucht, den Koffer zu schließen, meine Mutter, die am Reißverschluss zerrt. Auspacken, umpacken, wiegen, auspacken, wieder wiegen.
All das änderte sich 2011, als die Menschen in Syrien gegen das Assad-Regime auf die Straße gingen. Es änderte sich mit den Schüssen, die wir im Fernsehen sahen, den Demonstrationen, den verwackelten Handykamerabildern von Toten und Verletzten, den Telefonaten mit unserer Familie im Dorf.
Sie sagten: Nein, kommt dieses Jahr besser nicht.
Aber mein Vater lachte nur. Dieses Jahr nicht, sagte er. Aber nächstes Jahr fahren wir in ein freies, demokratisches Syrien. In solch ein Syrien werden wir zurückkehren.
Ein andermal schlug er vor, wir sollten fahren und mit den Leuten auf die Straße gehen. Er wolle den Sturz des Regimes vor Ort miterleben. Dann aber fielen immer mehr Schüsse, und zu den Schüssen kamen die Bomben und zu den Bomben das Chlorgas und das Sarin. Bald waren so viele Menschen verhaftet oder verschwunden, dass man aufhörte zu zählen, und mein Vater sprach nicht mehr davon.
Auch in Nordostsyrien, wo unsere Familie lebte, veränderten sich die Dinge. Irgendwann kamen die Funktionäre der PYD und erzählte den Leuten, sie sollten nicht mehr gegen Assad auf die Straße gehen. Und zu den Assad-Bildern kamen die Öcalan-Bilder. Dann kam Al-Qaida, und Al-Qaida hatte gar keine Bilder.
Nicht schlimm, sagte Onkel Hemo am Telefon, sie werden uns nichts tun. Er kenne den Mann von früher, der mittlerweile bei Al-Qaida für die Provinz Hasaka zuständig war. Er habe ihnen versprochen, solange er für die Provinz zuständig sei, würden sie ihnen nichts tun. Es gebe aber andere. Für die könne er nicht garantieren.
Mein Vater sagte: Du kennst ihn, wir waren einmal bei ihm, als du noch ein Kind warst. Und er ist auf Onkel Hemos Hochzeitsvideo zu sehen, wie er dort in einer Reihe mit den anderen tanzt.
Die Männer, die im Dorf geblieben waren, hoben einen Graben aus. Nacht für Nacht legten sie sich mit ihren Kalaschnikows dort hinein, in die Erde hinter dem Garten meiner Großeltern, hinter dem Zaun und den Granatapfel- und Mandelbäumen, die mein Vater gepflanzt hatte.
Ich lag Tausende Kilometer weiter in meinem Bett und konnte nicht schlafen. Sollten sie kommen, dachte ich, und meinen Onkel, meine Tante, ihre vier Kinder und meine Großmutter töten – ich sah sie vor mir, ihre leblosen Körper, aufgereiht, wie in einer der verwackelten Smartphone-Aufnahmen. Bilder, wie ich sie so oft gesehen hatte, auf YouTube oder weil mein Cousin sie auf Facebook geteilt hatte.
Sollten sie kommen, während ich schlief, dachte ich, würde ich davon nichts merken. Ob ich schlief oder wach war, es machte keinen Unterschied. In dieser deutschen Nacht wird kein Schuss zu hören sein, dachte ich, kein Zittern in der Luft, kein Windstoß.
Wenn wir wieder ein paar Tage nichts von ihnen hörten, weil Stromausfall war oder weil – diesen Satz vervollständigte ich nie. Was, wenn längst jemand gekommen war? Jemand, das waren in meiner Vorstellung Assads tarngemusterte Soldaten, bärtige, schwarz gekleidete Männer oder eine Bande herkömmlicher Krimineller, die das allgemeine Chaos nutzten und raubmordend durch das Land zogen. Wenn ich einkaufen ging, musste ich daran denken, vor dem Kühlregal oder auf dem Weg zum Bus. Ich wurde abergläubisch. Wenn ich auf die Fugen der großen Pflastersteine trete, dann werden sie kommen, sagte ich mir. Aber nachts lag ich in meinem Bett und mein Onkel im Graben. Und über mir war die in den Stuckecken mit Staubfäden verhangene Zimmerdecke. Und hinter meinem Onkel waren die Granatapfel- und Mandelbäume, die mein Vater gepflanzt hatte.
Ich schreibe: Nachdem ich die Geschenke überreicht habe, sitzen wir im Innenhof auf der Hollywoodschaukel und trinken Kaffee. Lorans hat angefangen, uns mit Softairkugeln zu beschießen. Er schleicht sich immer wieder an, von der Mauer zur Straße, von der Treppe hinter der Hollywoodschaukel, die zu den Nachbarn im ersten Stock führt. Er kommt aus dem Hausflur gerannt, hält die Pistole vor sich, greift an, weicht zurück, duckt sich, lauert, schießt. Hat Lorans ein Magazin leergeschossen, sammelt er die gelben Kugeln wieder ein.
Lava und Lara sitzen auf dem Boden und lackieren sich gegenseitig die Nägel.
Ich stülpe meine Tasse um, sodass der Satz auf die Untertasse läuft. Und Onkel Khalef scannt meinen Kaffeesatz mit einer Smartphone-App.
Ich schlafe im Zimmer von Lara und Lava. Bevor wir uns hinlegen, sitzen wir nebeneinander auf meinem Bett und sehen uns Handyvideos an, in denen sich Frauen aufwändige Frisuren machen. Weil wir lange keine Lust haben zu schlafen, lassen wir immer das nächste Video laden und das nächste und das nächste, bis wir irgendwann bei Make-up-Tutorials und Kochvideos gelandet sind.
Komm, sagt Lara irgendwann, ich zupfe dir deine Augenbrauen. Die sind ganz unordentlich.
Ich lege meinen Kopf auf ihre Knie, und Lava holt eine Pinzette aus der Küche. Und es zieht, und mir schießen Tränen in die Augen.
Die Klimaanlage surrt. Es ist kühl im Zimmer. Ich ziehe mir die Decke bis über die Schultern, bevor ich einschlafe.
Tante Adar zeigt mir auf ihrem Handy Fotos von Bekannten, die in IS-Gefangenschaft waren. Sie wischt mit dem Finger von rechts nach links und sagt: Sie hat ihr Gehör verloren in der Gefangenschaft. Dann wischt sie weiter, nächstes Bild, aber ich sehe nicht auf das Bild, ich sehe auf ihre Hand, auf ihre Finger mit der von der Hausarbeit rissigen Haut, ihren Ehering.
Tante Adar sagt: Sie haben ihren Mann und ihre Söhne vor ihren Augen enthauptet. Und wischt weiter. Nächstes Bild. Ich sehe kurz hin, dann sehe ich weg. Sie sagt: Ihm haben sie die Augen ausgestochen, und wischt weiter.
Ich schreibe: Wenn Tante Adar, Onkel Khalef und Lava, Lara und Lorans 2014 nicht in Silêmanî gelebt hätten, sondern vierhundert Kilometer weiter in Shingal – und schreibe den Satz nicht zu Ende.
Was ich schreibe, hat keine Ordnung. Worte, Sätze, die abbrechen, im Nichts verlaufen. Ich nähe, füge zusammen. Dass etwas mit Großbuchstaben anfängt und mit einem Punkt endet. Dazwischen ein Komma, vielleicht ein Halbsatz, der sich auf das eben Gesagte bezieht. Wieder Großbuchstaben und Subjekt, Verb, Objekt bis zum nächsten Punkt. Absatz für Absatz. Ich habe keine Sprache.
Dass wir kaputt sind, ist ein Satz, den ich oft denke. Auch wenn er nichts erklärt. Wir sind kaputt, schreibe ich und meine damit, dass die Dinge sich verschoben haben. Lachen ist ein Ausdruck der Freude, normalerweise. Menschen lachen, wenn sie sich freuen. Kinder lachen, da kann man es beobachten, sie freuen sich. Wenn sich die Dinge verschoben haben – und ich streiche diesen Satz. Die Dinge haben sich nicht verschoben. Alles steht noch an seinem Platz.
Ich habe es an mir selbst beobachtet. Das mit dem Lachen. Es ist mir erst später aufgefallen, beim Schreiben. Ich hatte mich mit zwei Freundinnen im Café getroffen. Ich war noch nicht lange zurück. Wir saßen unter einem Sonnenschirm und tranken Zitronenlimonade. Ich rauchte dünne, lange Zigaretten. Die Freundinnen wollten wissen, wie meine Reise war.
Die Zigaretten waren sehr billig, sage ich. Ich habe viel geraucht. Und weil die Zigaretten so billig waren, habe ich zwölf Schachteln mit nach Deutschland gebracht.
Ich lache und erkundige mich nach der Tochter meiner Freundin.
Der Tochter gehe es gut, sagt meine Freundin und redet, aber ich höre ihr schon nicht mehr zu. Nachdem sie aufgehört hat zu reden, erkundige ich mich nach dem Freund meiner anderen Freundin. Es geht ihm gut, sie redet, und auch hier höre ich nicht zu.
Als mich die Freundinnen fragen, wie die Situation für Êzîden gerade ist – Nur, wenn du darüber reden möchtest, sagen sie –, sage ich: Schlimm, sehr schlimm, und ich lache.
Ich gehe in den Supermarkt. Ich stehe vor dem Kühlregal und suche Milch. Ich habe die Milch gefunden. Leute gehen hinter mir vorbei, öffnen die Kühlregaltür neben mir, nehmen etwas heraus und schließen sie wieder. Können Sie bitte mal zu Seite gehen?
Ich brauche einen Moment, bis ich verstehe, dass ich es bin, die da angesprochen wird. Ja, natürlich, sage ich und nehme die Milch aus dem Regal, gehe zur Kasse und bezahle. Mit der Milch im Rucksack gehe ich langsam über die lange, regennasse Straße nach Hause.
Ich schreibe: Ich stehe im Supermarkt vor dem Kühlregal.
Ich schreibe: In meinem Notizbuch gibt es einen Eintrag zu Rende. Rende, so heißt auch eine Frau in unserer Familie, über die meine Eltern manchmal sprechen, der ich aber kein Gesicht zuordnen kann, obwohl ich sie einmal gesehen haben muss, in Syrien oder in Deutschland. Ich verliere oft den Überblick, weil meine Familie so groß ist und weil so viele nicht mehr dort leben, wo sie noch vor ein paar Jahren gelebt haben. Weil meine geografischen Zuordnungen nicht mehr stimmen.
Aber diese Rende, zu der es einen Eintrag in meinem Notizbuch gibt, ist eine andere. Rende, nur ihr Name, weiter nichts.
Wir sind gerade am Fluss, zum Picknick mit Freunden von Onkel Khalef und Tante Adar. Und als Onkel Khalef ihnen erzählt, dass ich über den Genozid schreiben will, sagt der Freund, dass es, nicht weit von hier, in Dukan, ein Mädchen gebe, das ich besuchen sollte.
Es ist ohnehin schon dunkel, wir packen das restliche Fleisch und Brot ein, klappen die Plastikstühle zusammen und steigen ins Auto. Vor einem alten Schulgebäude halten wir. Rende ist neunzehn Jahre alt. Rendes Mutter bringt Tee. Bevor der IS kam, sagt sie, war Rende ein normales Mädchen. Sie lebten in Khana Sor, einem Dorf unweit der syrischen Grenze. Rende half gerne im Haushalt und spielte mit ihren Geschwistern Fußball. Daran, wie der IS kam, kann sich Rende nicht mehr erinnern und auch nicht daran, wie sie mit ihren Eltern und Geschwistern in die Berge um ihr Leben rannte.
Wenn sie keine Medikamente bekommt, sagt die Mutter, wird Rende wütend und kann nachts nicht schlafen.
Wir trinken Tee. Ich stelle Fragen, die an Rende gerichtet sind, an ihre Mutter. Ist Rende zur Schule gegangen in Khana Sor? Nein, ist sie nicht. Wie viele Geschwister hat Rende? Drei Brüder und eine ältere Schwester. Welche Medizin nimmt Rende?
Kannst du dich erinnern, frage ich. An 2014.
Ich weiß nicht, sagt Rende.
Du bist durch die Berge gelaufen.
Ja, sagt Rende.
Rende, hast du den IS gesehen, fragt Tante Adar.
Rende lacht, als wäre das alles ein Witz, den sie nicht versteht.
Und wie sah er aus, der IS, fragt Tante Adar.
Rende antwortet nicht und zeigt dann auf mich. Schwarz, sagt sie. Wie ihr Kleid.
Tante Adar sagt: Setz dich neben sie. Ich mache ein Foto von euch beiden.
Ich will nicht, warum ein Foto von mir und Rende?
Tante Adar sagt: Nun mach schon.
Im Camp hat sie dasselbe gesagt, ich solle mich neben die alte Frau setzen, mit dem Kieselstein in der Hand. Sie werde ein Foto von uns machen.
Auch neben Eidas Mutter sollte ich mich setzen, deren Augen noch rot waren und verquollen vom Weinen. Die eingeschweißten Fotos ihrer verschleppten Tochter in Händen, so fotografierte uns Tante Adar.
In meinem Notizbuch ist an diesem Tag neben Rende noch ein weiterer Name vermerkt. Khalil. Khalil hatte mit uns am Fluss gesessen. Sein Onkel, einer der Freunde von Tante Adar und Onkel Khalef, hatte ihn mitgebracht. Khalil war etwa in meinem Alter und sehr schweigsam. Ich dachte, vielleicht ist er schüchtern. Ich hatte ihm keine große Beachtung geschenkt. Doch kurz bevor wir aufbrachen, sagte Tante Adar, sein Bruder sei einer der Menschen, die sich 2015 auf den Weg nach Europa gemacht hätten. In Österreich sei er in einem Lastwagen erstickt.
Parndorf, habe ich gesagt, und Tante Adar hatte mich fragend angesehen. Ich sagte, das sei der Name des Ortes, an dem der LKW gefunden wurde. Es war in den Schlagzeilen, sagte ich.
Ich habe Khalil danach gefragt, und er hat genickt. Ja, sagt er, sein Bruder sei in diesem LKW gewesen. Er war erst 22 Jahre alt.
Den Namen seines Bruders habe ich nicht notiert.
Später habe ich einer Freundin davon erzählt. Ich habe gesagt: Ich habe einen Flug gebucht und bin nach Erbil geflogen. Am Flughafen hat man mir das Visum in meinen deutschen Pass gestempelt.
Dass ich mich vor Khalil geschämt hatte, habe ich meiner Freundin nicht erzählt. Nicht, weil ich mich schuldig fühlte am Tod seines Bruders. Sondern, weil ich ein Flugzeug besteigen konnte, während sein Bruder sich in dem Inneren eines LKWs verstecken musste. Und weil ich es so wenig verdient hatte, am Leben zu sein, wie sein Bruder es verdient hatte, zu sterben.
In Duhok treffe ich einen weiteren Freund der Familie. Akram lebt, wie ich, in Deutschland, doch im Gegensatz zu mir ist er hier aufgewachsen. Nach zehn Jahren hat er endlich einen deutschen Pass, kann er das erste Mal seine Familie in Kurdistan besuchen.
Wir gehen zu seiner Cousine und ihrer Familie und essen dort. Eine riesige Plastikplane auf dem Boden und darauf Schüsseln über Schüsseln, als müsse auch Akram die Jahre in Deutschland mit nur einer Mahlzeit aufholen. Danach fahren wir in ein Dorf, dessen Namen ich vergessen habe. Nicht weit von hier gibt es einen Friedhof und inmitten des Friedhofs êzîdische Schreine. Dort treffen wir Sheikh Hassan.
Es ist ein alter Friedhof, manche Gräber sind mehrere hundert Jahre alt, sagt Sheikh Hassan. Auf den Grabsteinen sind kleine Vögel zu erkennen, Schiffe und andere gemeißelte Ornamente. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Im Dorf meiner Großeltern hielt man sein Êzîdentum versteckt. Es gab dort keinen êzîdischen Tempel: von Weitem erkennbar, mit dem typischen kegelförmigen Dach und dem Sonnenemblem auf der Spitze. Auch solche Grabsteine hatte ich dort nie gesehen.
Aber hier, in diesem Land, aus dem man uns vertrieb, wo man uns tötete, unsere Tempelanlagen sprengte. 92 êzîdische Stätten soll der IS zerstört haben – und nicht nur sie, sondern auch die Erinnerung daran, dass es sie je gegeben hat. Das Video, wie sie mit Pressluft- und Vorschlaghammern durch das Mossul-Museum zogen, eine Statue nach der anderen vom Sockel stürzten, zertrümmerten, was mehr als viertausend Jahre gehalten hatte, habe ich mir wieder und wieder angesehen, bis ich es fast auswendig konnte. Ich wusste, wann die Musik einsetzen, wann das Bild ins Stocken geraten würde, wann die Kämpfer ihre Hammer heben, synchron, in Zeitlupe, wann ihre Bewegungen fast einfrieren und sie mit den Hammern auf die umgestürzte Statue zu ihren Füßen einschlagen würden, bis das Video wieder in normalem Tempo weiterliefe.
Umso weniger kann ich glauben, was ich jetzt vor mir sehe. Diese Grabsteine zeugen davon, dass wir schon lange hier sind. Dass schon unsere Vorfahren in dieser Landschaft lebten, ihre Felder bestellten, Schafe züchteten und in ebendieser Erde ihre Toten bestatteten.
Ich schreibe wir, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt.
Ich schreibe: Der Friedhof liegt ein wenig erhöht, fast auf einem Hügel. Und die Gräber liegen in der Sonne, und zwischen den Gräbern wächst dorniges Gestrüpp. Wir gehen weiter.
Neben dem Schrein, sagt Sheikh Hassan, liegt das Grab von sechzig Toten, den Opfern eines anderen Fermans, ein Massengrab. Sein Großvater habe ihm davon erzählt, er war ein junger Mann, als das passierte. Es sei keine Zeit mehr gewesen, habe sein Großvater gesagt, die vielen Toten zu bestatten.
Ich schreibe: Mit Akram fahren wir auf einen Hügel hinter Khanke. Vom Hügel aus kann man auf den Mossul-Damm sehen. Und der Mossul-Damm liegt da – wie schön, sage ich – in der Abenddämmerung. Blaues Wasser, auf der anderen Seite Lichter.
Dort war der IS, sagt Akram. Der Mossul-Damm war die Grenze.
Aber wir sind nicht hier, weil uns Akram den Mossul-Damm zeigen will. Wir parken hinter einem weiteren êzîdischen Schrein, weißer Stein und Sonnenemblem auf der Spitze. Akram geht auf eine Mauer zu. Über die Mauer ragen die Äste eines Olivenbaums. Akram nimmt den Stacheldraht beiseite.
Wegen der Tiere, sagt er. Und dann: Die Gräber meiner Onkel.
Er schaltet die Handytaschenlampe ein und leuchtet auf die Grabsteine.
Es ist nicht das letzte Mal, dass Akram mir Gräber zeigt. Und Akram ist nicht der Einzige. Irgendwann, denke ich, haben wir hier mehr Tote als Lebende, und irgendwann ist fast schon jetzt, und die Gräber sind das Einzige, was wir dann besuchen können.
Ich schreibe: Das Haus meiner Großeltern in Tell Khatun ist abgebrannt. Auch die Bäume im Garten, die mein Vater gepflanzt hat. Das, was einmal zu Hause war, ist heute ein Schützengraben. Leute, die wir kannten, haben meiner Tante Bilder geschickt. Und ein Video, das jemand aufgenommen hat, der durch unseren Garten gegangen ist, von Zaun zu Zaun. Das Bild wackelt, es rauscht. Meine Mutter hat es mir auf ihrem Handy gezeigt und gesagt: Das sind die Bäume, die dein Vater vor vierzig Jahren gepflanzt hat. Und mein Vater hat gesagt: Wie viele Jahre hat es gedauert, bis diese Bäume so groß geworden sind.
Jemand hat uns auch ein Video geschickt von dem Hügel, auf dem sie meine Großmutter begruben. Dass niemand von der Familie dabei sein konnte, dass nicht wir sie begraben konnten, nur Leute, die wir kannten. Mein Cousin war mit dem Sarg, in dem meine Großmutter lag, in die Türkei gefahren, bis zur syrischen Grenze, wo sie ihn entgegennahmen und etwas Geld, damit meine Großmutter auf dem Hügel neben meinem Großvater begraben werden konnte.
Als ich an den Gräbern von Akrams Onkeln stehe und er mit der Taschenlampe die Grabsteine beleuchtet, frage ich mich, ob ich auch einmal so am Grab meiner Großeltern stehen werde. Und, wie Akram jetzt, ihre Grabsteine küssen.
Zwei Tage später fahren wir noch einmal mit dem Auto an den Mossul-Damm. Der Damm ist wie ein See. Wir gehen spazieren in der Abenddämmerung, am Ufer entlang, über schlammigen Boden. Es ist kühl. Menschen steigen in Motorboote und fahren über das Wasser. Fischer, aber auch eine Gruppe von Jugendlichen, mit Bier und lauter Musik. Es ist windig. Auf der Wasseroberfläche kräuseln sich kleine Wellen. Ich versuche, mir eine Zigarette anzuzünden, aber der Wind ist zu stark.
Dass sie 2014 hier herüber geschossen haben, sagt Akram. Und nur der Mossul-Damm zwischen dem Dorf und dem IS, so schmal, dass man das andere Ufer sehen kann.
Ich mache Fotos und schicke sie einer Freundin.
Wie verletzlich die Luft ist, wenn wir schlafen. In Derabûn habe ich das gedacht, als Akrams Cousine sagte: Es waren nur zwölf Kilometer, von hier bis zum IS.
Natürlich ist die Luft nicht verletzlich. Die Luft ist immer gleich. Aber das Haus von Akrams Cousine hat dünne Wände, die nicht dünner sind als andere Wände.
Angesichts der Tatsache, dass der IS nur zwölf Kilometer entfernt war, Wände wie Papier, denke ich. Dass diese Wände gegen den Wind gemacht sind, gegen die Sonne, mit einer Klimaanlage im Fenster. Auch wenn wir nachts den Schlüssel im Schloss umdrehen.
Als ich hinter dem Zaun bei den Ziegen stehe und den Abhang hinuntersehe auf die letzten beiden Häuser des Dorfes bis zur Straße, auf der man LKW hören kann – Warentransport von der Türkei, in die Türkei, an der syrischen Grenze entlang –, muss ich daran denken, wie ich als Kind hinter dem Gartenzaun im Dorf meiner Großeltern gestanden und den LKW nachgesehen habe, die an der türkischen Grenze entlang in den Irak fuhren oder aus dem Irak kamen. Dass sie auf Straßen fuhren, auf denen auch ich gefahren bin, in Städte, in denen auch ich einmal war. Kobanê, Rakka, Palmyra.
Als ich hinter dem Zaun bei den Ziegen stehe, denke ich: Das ist alles, die Straße entlang, einmal abbiegen Richtung Bajid, über den Tigris, der hier ein dünner Arm ist und nicht so breit wie der Mossul-Damm oder der Euphrat, an dem ich als Kind jedes Jahr stand und staunte: Ein Fluss wie ein Meer.
Es hätte so schnell gehen können, denke ich, als ich hinter dem Zaun bei den Ziegen stehe und auf die Straße sehe. Zwölf Kilometer. Wie viel sind zwölf Kilometer. Fünfzehn Minuten vielleicht.
Ich kann mich erinnern an Ausflüge mit der Familie. Schon mein Vater hatte Ausflüge an den Tigris gemacht als Schüler, mit der Kommunistischen Partei. Ich erinnere mich, wie wir, meine Geschwister, meine Cousins, meine Cousine und ich, am Ufer spielten, in einem Restaurant Kebab aßen. An Fotos, die mein Onkel von uns machte.
Ich schreibe: Mein Vater lacht, wenn er vom türkischen Gefängnis erzählt.
Ich schreibe: Er lacht, selbst wenn er über die Folter spricht.
Mein Vater sagt dann nicht Folter, er sagt Schläge. Er sagt: Sie haben meine Arme hinter meinem Rücken zusammengebunden, den Strick oben an der Decke fixiert. So musste ich über Stunden ausharren, und er lacht. Er sagt: Sie haben mich geschlagen.
Er sagt: Einen habe ich gesehen, den mussten sie tragen, er konnte nicht mehr auf seinen Füßen stehen. Er sagt: Ihn haben sie so lange geschlagen und verhört, bis er sagte, er hätte im Stroh Waffen versteckt. Und als sie dann einmarschierten, sagt mein Vater, mit Soldaten und Panzern und die ganzen Strohhaufen im Dorf durchkämmten, haben sie keine einzige Waffe gefunden.
Er lacht.
Einmal, sagt mein Vater und lacht, hat der Oberoffizier mich gefragt, was mein Beruf sei. Ich habe gesagt, ich bin Oberhirte. Nach dieser Antwort sei der Oberoffizier auf ihn losgegangen.
Wir haben viel gelacht im türkischen Gefängnis, sagt mein Vater. Wir haben die ganze Nacht gelacht. Und wenn es Tag wurde, gezittert, wer kommt heute dran?
Versuche ich zu schreiben, ist es, als würde ich einzelne Stücke zusammennähen. Schreibe ich über das Lachen meines Vaters, wenn er vom türkischen Gefängnis erzählt, schreibe ich über mein Lachen, wenn eine Freundin mich fragt, wie die Situation für die Êzîden gerade sei, bringe ich das eine mit dem anderen in Verbindung. Mein Vater aber war 1980 im türkischen Gefängnis, ich war 2018 im Irak, vier Jahre nach dem Genozid. Das türkische Gefängnis und der Genozid. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Ich trenne die Nähte wieder auf und fange von vorne an.
2014 kam meine Großmutter aus Syrien nach Deutschland. Die Hoffnung, die wir in einen baldigen Sturz des Assad-Regimes gelegt hatten, war da längst aufgezehrt. Islamistische Terrorgruppen breiteten sich in Hasaka aus. Al-Qaida, Islamische Front, IS, damal s noch ISIS: Islamischer Staat in Irak und Syrien.
Meine Mutter hatte damals Hunderte, wenn nicht gar tausend E-Mails geschrieben, war von Behörde zu Behörde verwiesen worden, bis sie es schließlich schaffte, dass meine Großmutter auf eine Liste für Kontingentflüchtlinge kam. Die Liste war für Menschen in Deutschland, die direkte Angehörige in Syrien hatten. Direkte Angehörige, das hieß: eine Mutter, einen Vater, einen Sohn, eine Tochter, eine Ehefrau, einen Ehemann.
Als meine Großmutter nach Deutschland kam – ich streiche das durch und schreibe: Als meine Großmutter nach Deutschland floh, denn es war ja eine Flucht, kam sie zu meinen Eltern. Wir wissen nicht, ob auch schon vorher im Dorf oder erst bei meinen Eltern, aber meine Großmutter saß jeden Tag auf dem Boden und sang Klagelieder. Sie sang mit ihrer knitterigen Altfrauenstimme. Sie saß auf dem Boden in der Küche, im Wohnzimmer, im Garten und sang Klagelieder für ihren Vater, den man ermordet hatte, weil er Êzîde war.
Warum hat man ihn getötet, sagte meine Großmutter, er hat doch niemandem was getan. Sie wiederholte, warum hat man ihn getötet? Warum haben sie ihn getötet?
Wenn man ihr etwas zu essen gab, sagte sie: Das Essen ist vergiftet. Man will mich vergiften. Wenn sie die Treppe hinaufstieg, sagte sie: Pass auf, sie haben uns eine Falle gestellt. Sie sagte: Wir sind umzingelt, sie werden uns töten.
Sie wachte nachts aus dem Schlaf auf und schrie. Sie rannte weg, aus dem Haus, die Straße entlang, bis zur Kreuzung. Als meine Mutter sie dort einholte, sagte sie: Ich gehe nach Hause. Es ist nicht weit, dort hinten ist mein Dorf. Ich kann schon die Häuser sehen.
Wir sperrten die Türen ab. Ich blieb bei ihr, damit meine Mutter einkaufen gehen konnte. Meine Großmutter ging von der Haustür zur Hintertür, zur Terrassentür, sie rüttelte an den Klinken, stemmte sich dagegen, und keine konnte sie öffnen. Wir hatten uns angewöhnt abzusperren, weil sie immer davonrannte. Meine Großmutter rüttelte an der Klinke. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Sie schrie.
Ich sitze in meinem Bett, es ist drei Uhr nachts, und sehe mir einen Dokumentarfilm über die Nobelpreisträgerin Nadia Murad an. In dem Dokumentarfilm gibt es eine Szene, in der Nadia Murad in einem Radiostudio in Canada zu Gast ist.
Vor dem IS, sagt sie, habe ich im Shingal in einem êzîdischen Dorf, in Koço, gelebt. Dort bin ich zur Schule gegangen und habe auch im Haushalt mitgearbeitet, ich habe Schafe gehütet. In dem Dorf lebten etwa zweitausend Êzîden. Als sie kamen, sagt Nadia Murad, trugen sie Schwarz. Sie hatten lange Bärte und Waffen in den Händen. Sie haben den Müttern ihre Kinder weggenommen. Mädchen, die älter als neun Jahre waren, haben sie mitgenommen, alte Frauen haben sie getötet. Sie haben etwa siebenhundert Menschen getötet in unserem Dorf. Wir haben gesehen, wie sie unsere Männer umgebracht haben. Wir haben es vom Fenster aus gesehen. Meine Brüder waren an diesem Tag bei unseren Männern.
Die Moderatorin fragt: Können Sie beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man wie ein Objekt behandelt wird?
Die Moderatorin fragt: Wie haben Sie sich gefühlt, als sie Sie so benutzt haben? Wie haben sie euch verteilt, und was haben sie Ihnen angetan? Haben sie Sie geschlagen?
Ja.
Und dann wurden Sie vergewaltigt?
Ja.
Es tut mir leid, dass ich Sie dorthin zurückgehen lasse, in diese furchtbare Zeit, sagt die Moderatorin. Ich frage mich, wie Sie das alles überlebt haben. Wie haben Sie all das ertragen?
Ich habe gesehen, dass es nicht nur mir so ging, sagt Nadia Murad. Ich habe gesehen, dass es kleineren Mädchen so ging, die zehn oder zwölf waren. Meinen Nichten, die fünfzehn sind, haben sie Schlimmeres angetan.
Wenn Sie an die Männer denken, die Sie vergewaltigt haben, haben Sie Rachegedanken? Wie verkraften Sie das bloß? Denken Sie viel an Ihre Familie?
Ich klappe den Laptop zu.
Anderntags sitze ich in der Cafeteria der Bibliothek, mit dem Rücken zum Fenster. Draußen regnet es. Ich schreibe: Es ist, als wären die Tage aus ihrer Verankerung gerissen.
Der aufgeklappte Laptop liegt auf meinen Knien. Ich habe die Seite des Online-Katalogs der Bibliothek geöffnet und schreibe Stichwörter, die mir passend erscheinen, in die Suchmaske. Ich klicke erweiterte Suche. Ich schreibe: Islamismus, Terrorismus, Terror, Völkermord, Genozid. Ich schreibe: Islamischer Staat, ISIL, ISIS, Daesh. Ich schreibe: Êzîden, Jesiden, Yezidi, Yazidi, Jeziden.
Die Bücher bestelle ich über die Fernleihe, ich lade mir PDFs, E-Books und Aufsätze herunter. Ich notiere mir Kennnummern, nehme meinen Laptop, verlasse die Cafeteria und steige die Treppen hinunter ins offene Magazin.
Ich gehe von Regal zu Regal und suche die Reihen ab. Ich vergleiche die Nummern, und wenn die Nummer auf dem Buchrücken mit der von mir notierten übereinstimmt, ziehe ich das Buch aus dem Regal. Ich trage den Stapel in einem Plastikkorb zur Selbst-Ausleihe. Ich ziehe Buch für Buch über den Scanner, dann packe ich sie in meine Tasche und verlasse die Bibliothek.
In Silêmanî hatten wir das Amna-Suraka-Museum besucht. Es ist in einem Gefängniskomplex untergebracht, noch aus Saddam-Zeiten, neben dem Azadî-Park, mitten in der Stadt. Entworfen von Architekten aus der DDR, lese ich in der Broschüre, die man uns am Eingang in die Hand drückt. East-Germany, wo ich jetzt lebe. Dass es also so gewesen sein muss, denke ich. Dass sich 1979 Architekten aus der DDR nach Silêmanî aufmachten, das damals noch nicht in der kurdischen Autonomieregion lag, um für den irakischen Geheimdienst einen Gebäudekomplex zu errichten. In einem robusten Sandbraun, so wie man sich wohl die Wüste vorstellte. Aber um Silêmanî ist keine Wüste.
Sie hatten alles geplant, den Gefangenentrakt, die Verhörzimmer, das Wohnheim für die Sicherheitsbeamten, die Verwaltungsgebäude. Direkt hinter dem Eingang die Ruine eines Hauses, von dem nur noch die Grundmauern und die Fassade übrig sind, mit Einschusslöchern darin. Nicht aus dem Irakkrieg 2004, wie ich erst angenommen hatte, sondern aus dem Jahr 1991, dem kurdischen Aufstand Raperîn, als die Peschmerga Silêmanî und auch dieses Gefängnis befreiten.
Auf dem Platz vor dem Verwaltungsgebäude stehen noch eine Reihe von Panzern und Raketenwerfen, die von der irakischen Armee zurückgelassen worden waren. Im Gebäude gegenüber ein Museum, in dem kurdische Handwerkskunst, vor allem Teppiche und traditionelle Kleidung, ausgestellt wird. In dem ehemaligen Gefängnis kann man Zeichnungen der Häftlinge an den Wänden sehen, Gedichte und Abschiedsbriefe, die sie mit geschmuggeltem Bleistift an die Wände geschrieben hatten.
Heute sind die Wände mit Plexiglasscheiben verkleidet, und weil die Inschriften mit der Zeit verblassen, kaum mehr oder gerade noch zu erkennen sind, hängen daneben kleine Tafeln mitsamt arabischer und englischer Übersetzung.
My name is Muhsin. Jailed in one of the corners of this cell. I was detained at home, I was only 15 years old, they changed my age to 18 to be executed, then I said: mother, father I am about to be executed by Baathism. We will never meet again.
Und: life is pain and pain the beginning of life.
Und: Omar Qaladzaiy 1/11/1989 detained till 1990, I am still here. God is great. Don’t spill tears for my body stained with blood. I am martyred by the oppressor but thanks God I am a Peshmerga.
Die Folter, die sich hier zugetragen hat, wird mit lebensgroßen weißen Gipsfiguren nachgestellt, die mit schmerzverzerrten Gesichtern von der Decke hängen oder, rot angeleuchtet, zum Schlag ausholen.
Die Figuren sind angeschlagen. Hier fehlt ein Finger, dort eine Nase oder ein halber Fuß. Die Verhörzimmer sind mit dünnem Holz ausgekleidet. Damit die Schreie nicht nach draußen dringen, lese ich später und auch, dass es einen Raum gab, in den sie die Frauen holten, um sie zu vergewaltigen. Dass die Soldaten durch die Stadt fuhren, lese ich, und die Frauen, die ihnen gefielen, hierherbrachten.
Eine schmale Mauer, gerade so hoch, dass man nicht darüber sehen kann, trennt das Gebäude von Bürgersteig und Straße. Oben auf der Mauer und über den Innenhof gespannt liegt Stacheldraht. Außer einer Familie, Touristen aus Bagdad, sind wir die einzigen Besucher an diesem Mittwochvormittag. Wir sehen außerdem einen Gang, der mit 182000 zerbrochenen Spiegelscherben ausgekleidet und von 4500 Glühbirnen erhellt ist, die an die Zahl der Opfer und die bei der Anfal-Operation zerstörten Dörfer erinnern soll. Zudem gibt es eine Gedenkhalle, in der man, in Schaukästen rot angeleuchtet, die Kleidung der Opfer ansehen kann.
Eine Texttafel: 9646 is the number of missing children who were subjects to the mass-killing during the last campaign of ANFAL in Badinan. The corpses were never found.
Es sind so viele Texttafeln, dass ich sie mir nicht alle durchlesen kann, sondern abfotografiere für später. Seit 2017 gibt es noch eine weitere Gedenkhalle, in der an die Opfer des IS erinnert werden soll. Die Wände sind voll von Bildern gefallener Soldaten. Peschmerga in Uniform, YPJ vor grünem und YPG vor gelbem Hintergrund. Oben links der rote Stern, das Logo der Truppe, und unten der Name.
Ich stelle mir vor, wie es ist, fotografiert zu werden, bevor man in die Schlacht geschickt wird, zu wissen: Wenn man fällt, wird dieses Bild ein Märtyrerbild sein, an den Straßen stehen, in den Wohnzimmern der Familie hängen, über dem Fernseher an der Wand, wird bei Demonstrationen in die Luft gehalten werden.
Weil in der Halle nicht genug Platz war für all die Märtyrer, wurde die Galerie um einen Gang im ersten Stock erweitert. Es ist ein langer Gang, und rechts und links, Meter für Meter, Namen und Gesichter. Es gibt auch Standbilder aus den Hinrichtungsvideos des IS, die offiziellen Stempel der IS-Verwaltung, lebensgroße Statuen der IS-Kämpfer, der Peschmerga, Fotos zerstörter Städte, persönliche Gegenstände der Kämpferinnen und Kämpfer, Dinge, die sie bei sich trugen, als sie fielen.
Die Êzîden kommen in dieser Halle nicht vor. Ich gehe wieder und wieder die Schaukästen ab, weil ich denke, ich muss etwas übersehen haben. Sicher sind auch sie unter den Märtyrern. Aber es gibt keine gesonderte Tafel, keinen Glaskasten, nicht einmal eine kleine Plakette, die an sie erinnert. Dabei wurde keine Gruppe so systematisch vernichtet wie die Êzîden.
Ist die Wunde noch zu frisch? Oder ist die Geschichte der Êzîden einfach nicht heldenhaft genug, im Gegenteil, ihr Sterben zu erbärmlich, um in diesem Museum davon zu erzählen?
Die Massengräber in Shingal. Die stumme Frau vor dem schäbigen UNHCR-Zelt, die seit vier Jahren nicht spricht, nicht mehr ansprechbar ist, in deren Körper sich die Sprachlosigkeit eingeschrieben hat. Rende, die lacht, als man sie fragt, hast du den IS gesehen, als wäre es ein Witz. Mein siebenjähriger Cousin Lorans, der im Auto sitzt und um sich tritt und brüllt, wir sollen endlich aufhören, von Shingal zu sprechen. Der Freund von Akram, der seit dem Genozid mit muslimischen Frauen schläft, ihnen verschweigt, dass er Êzîde ist, um sie später dafür fertigzumachen, ihnen vorzuhalten, dass sie mit einem Ungläubigen geschlafen haben. Der Mann seiner Cousine, der bei einer Party in der Ecke sitzt und sich auf dem Handy Hinrichtungsvideos des IS ansieht, bis der Sänger Khalo die Saz weglegt und aufhört zu spielen und sie anfangen zu streiten und Khalo fast in Tränen ausbricht. Oder Xatê Shingali, die Generalin, die früher Sängerin war, Xatê, die nach dem Ferman zu ihren Eltern ging und sagte: Ich will keine Saz mehr, ich will jetzt eine Waffe. Oder meine Großmutter, die bis zu ihrem Tod um ihren Vater weinte, den man ermordete, weil er Êzîde war.
Ich schreibe: Wir sind im Auto und auf dem Weg nach Arbat. Meine Cousinen Lava und Lara sind schlecht gelaunt, sie sprechen kaum. Ich frage, was los ist. Lara sagt, sie habe keine Lust, jede Woche ins Camp zu fahren. Es seien doch Schulferien.
Nach vierzig Minuten verlassen wir die Straße, biegen ab und fahren durch eine weite, von Bergen umgebene Landschaft. Inmitten dieser Landschaft ist das Camp. 230 Familien leben hier, sagt Tante Adar, seit sie 2014 vor dem IS geflohen sind. Sie sagt: Sie alle sind Êzîden aus Shingal.
Am Eingang das Kontrollhäuschen. Der Mann im Kontrollhäuschen nickt und winkt uns durch. Das Camp der Êzîden liegt auf der linken Seite und das Camp der Muslime auf der rechten, dazwischen Zäune. Anfangs sei es ein Camp gewesen, sagt Onkel Khalef. Aber du weißt: Nach dem, was passiert ist, können wir mit ihnen nicht mehr zusammenleben.
Hier, sagt Onkel Khalef und hält vor einem der Zelte. Wir steigen aus. Die Familie – Freunde von Onkel Khalef und Tante Adar – begrüßt uns mit Küsschen auf die Wange. Kommt rein, sagen sie, und wir folgen ihnen in eine Art Innenhof, von dem zwei Zelte und eine improvisierte Küche abgehen. Die Küche, in die ich einen kurzen Blick werfe, ist nichts weiter als eine betonierte Fläche. In einer Ecke steht ein Gaskocher und daneben eine kleine Ablage mit Vorräten, Töpfen und Geschirr, dazu ein kleiner Wasserkanister und große Plastikwannen auf dem Boden. Die Toiletten, sagt Tante Adar, teilen sie sich mit anderen Familien.
Bitte, sagen sie. Vor einem der beiden Zelte ziehen wir die Schuhe aus. Sie lassen uns den Vortritt, und wir gehen hinein. Wir nehmen Platz auf den dünnen Matten, die auf dem Boden ausgelegt sind. Die Tochter der Familie trägt ein Tablett mit Teegläsern herein. Ob wir nicht hungrig seien, fragen sie. Onkel Khalef lehnt dankend ab, wir hätten eben gefrühstückt.
Tante Adar, die neben mir sitzt, sagt zu mir: Schau dir das an. Weil sie ein Auto hatten, konnten sie 2014 fliehen, zum Glück. Aber sie haben alles zurückgelassen. Und seitdem sind sie hier, zwei Zelte für eine fünfzehnköpfige Familie.
Hier schlafen sie, sagt sie und deutet auf einen Stapel dünner Matratzen an der hinteren Zeltwand. Im Winter, wenn es regnet, läuft das Wasser rein. Aber sie klagen nie, sagt Tante Adar. Sie sind mit dem Leben davongekommen.
Wir trinken unseren Tee, Onkel Khalef, Tante Adar und die Familie unterhalten sich ein wenig. Dann kommen sie auf den Grund meines Besuchs zu sprechen. Wir trinken einen zweiten Tee. Dann sagt Tante Adar, es gebe wohl ein paar Familien, die mit mir reden würden.
Es ist Vormittag, aber schon heiß. Auf beiden Seiten der Straße die immer gleichen blaugrau ausgeblichenen UNHCR-Zelte. Vernarbtes Gewebe, wieder und wieder geflickt. Wir biegen rechts ab, dann links, dann wieder rechts, und ich habe die Orientierung verloren. Tante Adar und ihre Freundin gehen voran, Lara, Lava und ich folgen ihnen. Irgendwann bleiben wir stehen, treten abermals in eine Art Innenhof, der von vier Zelten und einer ebenso graublauen UNHCR-Plane umschlossen ist. Doch wir treffen nur die Nachbarin an, der junge Mann, der bereit wäre, mit mir zu sprechen, ist nicht da. Seine Mutter, erklärt die Nachbarin, musste zum Arzt.
Fast bin ich erleichtert, dass sie nicht da sind. Mutter und Sohn, sagt Tante Adar, sind die Einzigen, die überlebt haben. Als der IS kam, habe der Sohn mit dem Auto fliehen können. Das Auto, sagt sie, hat er versetzt, um mit dem Geld die Mutter aus der Gefangenschaft freizukaufen.
Ich bin nervös. Wir gehen weiter. Die nächste Familie ist zu Hause. Ich werde erst als Tochter eines Êzîden aus Hasaka vorgestellt, dann als Journalistin, die etwas für eine deutsche Zeitung schreiben will. Ich sehe, dass alle das gleiche dünne rot-weiße Stoffband am Handgelenk tragen, so wie auch ich. Unauffällig ziehe ich den Ärmel meiner Jacke herunter. In diesem Moment will ich lieber eine deutsche Journalistin sein, die ihre Arbeit macht und wieder verschwindet. Mit der das alles nichts zu tun hat.
Es sind nur Frauen und Kinder in dem Zelt. Eine der Frauen, die sich als Fani vorstellt, erzählt von ihrem Vater, der vom IS verschleppt wurde. Wir wissen nicht, wo er ist, sagt sie, und ich beiße mir auf die Lippe, weil ich denke, dass sie ihn getötet haben werden, wie sie alle anderen Männer seines Alters getötet haben.
Fani erzählt von ihrer Tochter, Eida, die fünfundzwanzig Jahre alt war, so alt, wie ich heute, als man sie und ihren einjährigen Sohn verschleppte. In Tell Afar habe man das letzte Mal von ihr gehört. Der Sohn kam bei der «Operation Mossul» wieder frei und konnte kein Wort Kurdisch mehr sprechen. Die IS-Kämpfer hatten ihn von seiner Mutter getrennt. Und von ihr, von Eida, fehlt bis heute jede Spur.
Fani holt Bilder von ihrer Tochter und ihrem Vater hervor, vergrößert und eingeschweißt, und legt sie vor mir auf den Boden. Sie fängt an zu weinen, und ihr Weinen geht in ein lautes Schluchzen über, das ihren ganzen Körper ergreift. Ich beiße mir auf die Lippe. Meine Cousine Lava neben mir schaut sich Videos auf dem Handy ihrer Mutter an. Sie hat den Ton nicht ausgeschaltet.
Nachdem wir aus dem Camp zurück sind, sitzen wir im Wohnzimmer auf dem Sofa.
Kein Badezimmer, die Kälte im Winter, die Hitze im Sommer, kein Zuhause, so fasst Tante Adar zusammen, was wir eben gesehen haben. Sie klopft mit der Hand auf das Sofa, wie um sich zu vergewissern, dass sie das alles noch hat, ein Sofa, ein Haus, ihren Mann und ihre drei Kinder.
Wir trinken Kaffee und hören Ich lebte und sah von Elissa. Tante Adar liebt Elissa. Sie sitzt oft auf dem Sofa, wenn die Hausarbeit erledigt ist, und sieht sich Musikvideos der libanesischen Sängerin an. Sie sagt: Elissa ist wirklich eine schöne Frau.
Tante Adar zündet mir und sich eine Zigarette an. Wir rauchen. Ich will etwas sagen, aber beiße mir auf die Zunge.
Später, nach dem Abendessen, als wir draußen im Hof auf der Hollywoodschaukel sitzen und gesalzene Sonnenblumenkerne essen, sage ich zu Tante Adar: Ich will nach Shingal fahren.
Was willst du in Shingal, Shingal ist tot, sagt sie.
Wir sitzen im Auto und sprechen über Shingal. Seit drei Jahren sei die Stadt vom IS befreit, seit einem Dreivierteljahr auch das Dorf Koço, ganz im Süden, sagt Onkel Khalef. Ganz Shingal sei befreit, doch jetzt regierten die Milizen, sagt Onkel Khalef. Und Lorans wird wütend. Er tritt um sich und fängt an zu schreien, wie er zu schreien anfängt, wenn Lava ihn in die Backe beißt, um ihn zu ärgern, oder er unbedingt Pizza haben will. Er schreit uns an: Hört auf, über Shingal zu sprechen! Immer sprecht ihr über Shingal. Er hört erst auf zu schreien, als wir ihm versprechen: Ja, wir werden nicht mehr über Shingal sprechen.
Weil noch Schulferien sind, ist der Azadî-Park voller Familien. Sie sitzen in der Wiese und picknicken. Sie sitzen auf Bänken und essen Nüsse. Überall vor den Fahrgeschäften sind Schlangen.
Wir kaufen Softeis und spazieren um den großen Teich. Wir fotografieren uns vor blinkenden Brunnen und Löwenstatuen. Onkel Khalef gibt meinen Cousinen und mir Tickets für die Schiffschaukel. Lava will lieber Achterbahn fahren. Aber ich weigere mich, weil der Strom im Park ständig ausfällt, ich will nicht in der Achterbahn sitzen, wenn es Stromausfall gibt. Ich bin auch die Einzige, die bei jedem Stromausfall wieder erschrickt, während alle anderen gelassen ihre Handytaschenlampen anschalten.
Die Schiffschaukel schwingt weit und hoch. Meine Cousinen und ich filmen uns gegenseitig. Wie unsere Haare im Fahrtwind fliegen. Wie wir mit offenem Mund schreien.
Ich wache auf, weil ich friere. Die Klimaanlage surrt. Das Zimmer liegt im Halbdunkel. Neben mir liegt Lara und schläft, das Gesicht auf dem Arm. Wenn sie aufwacht, wird sie einen Abdruck auf ihrer Wange haben.
Ich stehe auf, gehe durch den Hausflur, öffne die Tür zum Hof, und augenblicklich schlägt mir eine große Hitze entgegen. Der Hof liegt in der Sonne. Ich trete hinaus und gleich wieder zurück. Der Boden glüht. Ich ziehe mir Schlappen an und laufe quer über den Hof bis zur Mauer. Und weil die Mauer so hoch ist, muss ich ein paar Stufen hinaufsteigen, um mich über den Mauersims beugen zu können und auf die Straße zu sehen.
Auch die Straße ist von Sonnenlicht geflutet. Auf der anderen Seite liegt ein kleiner Park; dort wachsen Rosensträucher, deren Blüten Tante Adar sammelt für Rosenblütenmarmelade. Manchmal geht Lorans in den Park, um dort Fußball zu spielen, und auch Lava und Lara gehen dorthin. Sie haben mich mitgenommen, und wir haben auf einer kleinen Steinmauer im Schatten gesessen, Gräser zwischen unseren Händen zerrupft und eine Schar Hühner beobachtet, die über die Wiese stakste und in der Erde nach Körnern pickte.
Doch bald ist eine Gruppe von Männern in den Park gekommen, und Lara ist aufgestanden, hat an meinem Ärmel gezupft und gesagt: Lass gehen. Ich habe erst nicht verstanden. Wieso gehen, wir sind doch gerade erst gekommen? Und sie sagte und verdrehte dabei die Augen, als wäre es das Offensichtlichste: Da sind Männer. Lass uns gehen.