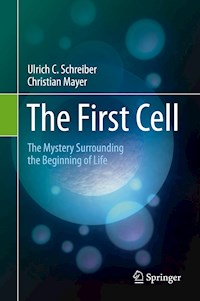9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifelbildverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Science-Fiction-Roman voller Spannung, Mystik und emotionaler Tiefe In dem Roman verwebt Bestsellerautor Prof. Dr. Ulrich C. Schreiber (Die Flucht der Ameisen) meisterhaft Elemente aus Kriminalliteratur, wissenschaftlicher Neugier und archaischer Mystik. Diese faszinierende Geschichte führt die Lesenden von den kühlen, nebelverhangenen Wäldern Nordkareliens bis in die vermeintliche prähistorische Vergangenheit – und zurück. Kaija, eine junge Frau, die in der Abgeschiedenheit eines finnischen Bauernhofs lebt, gerät durch eine schicksalhafte Begegnung in einen Strudel aus Schuld, Geheimnissen und Entdeckungen. Während sie mit den Konsequenzen einer unvorstellbaren Tat kämpft, entdeckt Onni Claasen, ein brillanter norddeutscher Wissenschaftler, ein Artefakt, das die Grenzen der Zeit selbst zu sprengen scheint: eine mysteriöse Vogelknochenflöte. Als Onni unversehens in eine ferne Zeit geschleudert wird, muss er sich in einer brutalen, urtümlichen Welt zurechtfinden, während Kaija versucht, ihre Gegenwart vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Doch das Schicksal verwebt ihre Leben auf unerwartete Weise – in einer Welt, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Spiegel der Zeit miteinander verbunden sind. Eine Geschichte über die Macht der Zeit, die Rätsel der Menschheit und die Frage, wie weit wir gehen würden, um unsere eigene Realität zu schützen. • Atmosphärisch, düster und emotional: Für Fans von Geschichten mit Tiefgang und Spannung • Verbindet Science-Fiction mit archäologischer Mystik und Krimi-Elementen • Ein Roman über Schuld, Liebe und die Zerbrechlichkeit der Zeit Ein packender Roman, der bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DIE SPIEGELUNG DER ZEIT
ULRICH C. SCHREIBER
IMPRESSUM
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Calderan Verlag erschienenen Buchausgabe
Die Spiegelung der Zeit
Ulrich C. Schreiber
1. Auflage 2025
© 2025 Calderan
Ein Imprint der Kraterleuchten GmbH, Gartenstraße 3, 54550 Daun
Verlagsleitung: Sven Nieder
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Andi Bottlinger
Korrektorat: Tim Becker
Umschlag: Björn Pollmeyer
Montage: iStock.com/agsandrew und iStock KI-Generator
Gestaltung und Satz: Kerstin Fiebig
www.ulrich-c-schreiber.de
ISBN E-Book: 978-3-98600-025-7
ISBN Print: 978-3-98600-024-0
www.calderan.de
Meinen Enkelkindern
Greta, Moritz, Nora, Luise, Jonte
INHALT
Kapitel 1
Nordkarelien
Kapitel 2
Universität zu Köln
Kapitel 3
Knochenflöte
Kapitel 4
Magisches Metall
Kapitel 5
Kölsch
Kapitel 6
Höhlenflair
Kapitel 7
Anderssein
Kapitel 8
Orientierungslos
Kapitel 9
Spurensuche
Kapitel 10
Fuß fassen
Kapitel 11
Fassungslosigkeit
Kapitel 12
Standort
Kapitel 13
Ausschlussverfahren
Kapitel 14
Foucault
Kapitel 15
Ursachenrätsel
Kapitel 16
Köhlersein
Kapitel 17
Physikgesetze
Kapitel 18
Kaija
Kapitel 19
Martina
Kapitel 20
Why?
Kapitel 21
Der Cro
Kapitel 22
A Boy!
Kapitel 23
Wasserdruck
Kapitel 24
Salpeter
Kapitel 25
Wortfindung
Kapitel 26
Ofenzeit
Kapitel 27
Umzug
Kapitel 28
Gänsebraten
Kapitel 29
Psychologie
Kapitel 30
Metallurgie
Kapitel 31
Dom-Experiment
Kapitel 32
Schmiedeeisernes
Kapitel 33
Selbstbestimmung
Kapitel 34
Salizylsäure
Kapitel 35
Bittere Wahrheit
Kapitel 36
Waffenschmiede
Kapitel 37
Flötenstunde
Kapitel 38
Kleinkrieg
Kapitel 39
Verschwörungstheorien
Kapitel 40
Verdrehte Welt
Kapitel 41
Kontakt
Kapitel 42
Tausch
Kapitel 43
Austausch
Kapitel 44
Neustart
Kapitel 45
Aufarbeitung
Kapitel 46
Schadensbegrenzung
Kapitel 47
Problemfelder
Kapitel 48
Joensuu
Kapitel 49
Der Ring
Kapitel 50
Der Brief
Kapitel 51
Jülich
Kapitel 52
Schlechte Prognosen
Kapitel 53
Reaktionen
Kapitel 54
Hamburg
Kapitel 55
Aleksi
Kapitel 56
Whisky-Modell
Kapitel 57
Beichte
Kapitel 58
Alternativmodell
Kapitel 59
Tiefpunkt
Kapitel 60
Bleib!
Über den Autor
Bücher von Ulrich C. Schreiber
KAPITEL1
NORDKARELIEN
Als der Tag mit einem kühlen Frühjahrsmorgen im Osten Finnlands begann, ahnte keiner der Bewohner Nordkareliens, dass sich in ihrer Nachbarschaft eines der rätselhaftesten Verbrechen der letzten Jahrzehnte ereignen würde. Auch ahnten sie nicht, dass es das Land monatelang beschäftigen sollte und eine Aufklärung unmöglich war. Vielleicht lag es daran, dass sich das Unaufklärbare direkt an der russischen Grenze abspielte und allein diese Tatsache Tür und Tor für Spekulationen und die wildesten Verschwörungstheorien öffnete.
Die Staatsstraße 9 verlief von Turku über Tampere, Kuopio und Joensuu nach Tohmajärvi. Sie endete am Grenzübergang Vyartsilya, der für den Austausch von Gefangenen während des Kalten Krieges eine gewisse Bedeutung erlangt hatte. Der Grenzverlauf nach Norden folgte von hier über eine kurze Strecke dem kleinen, nach Süden fließenden Fluss Jänisjoki. Nach wenigen Kilometern trennten sie sich wieder. Die geographischen Verhältnisse führten zu einem reizvollen Nebeneffekt, der hauptsächlich Angler interessierte. Das Angeln in diesem Abschnitt direkt im Grenzfluss war untersagt und wegen der Grenzbewachung gar nicht möglich. Weiter nördlich trennte sich der Verlauf der Grenze von dem des Flusses, der nun nur auf finnischem Staatsgebiet floss. Hier war das Angeln bis zu den ersten Grenzmarkierungen zwar nicht direkt verboten, sollte aber unterlassen werden, um keine Konflikte mit den Grenzschützern zu provozieren. Das führte dazu, dass in dem wenig befischten Abschnitt das Fischvorkommen im Vergleich zu anderen frei zugänglichen Standorten deutlich höher war. Aus diesem Grund schlichen immer wieder einzelne Angler aus der Umgebung durch die bewaldeten Randstreifen bis an das Gewässer und versuchten ihr Glück.
Kaija hatte Stress mit der Familie, Stress mit dem Job und Stress mit ihrer Beziehung. Sie war gerade 25 Jahre alt geworden und hatte erneut ihr Studium unterbrochen, um sich um ihre Eltern, Rasmus und Helga Letho, zu kümmern. Oft dachte sie jetzt an Lauri, ihren vier Jahre älteren Bruder.
Sie hatte es nie richtig verarbeitet, dass er von einem Tag auf den nächsten nicht mehr bei ihr war. Gerade jetzt wünschte sie ihn sich mehr als alles andere zurück. Sie brauchte Hilfe, um ihr Ziel nicht aufgeben zu müssen, das Studium in Kuopio. Als eine der wenigen aus ihrem Jahrgang, die sich für naturwissenschaftliche Fächer interessierte, für Chemie oder Physik und sogar für Mathematik, hatte sie keine Probleme gehabt, einen Studienplatz zu bekommen.
Aber während die anderen bereits einen Großteil ihrer Ausbildung oder ihres Studiums abgeschlossen hatten – einige waren sogar schon berufstätig – finanzierte Kaija sich immer noch durch Gelegenheitsjobs. Anfangs war es eine Notwendigkeit, neben dem Studium Geld zu verdienen und jetzt während der Betreuung ihrer Eltern ein Grund, regelmäßig etwas Abstand zu bekommen. Abstand von dem abgelegenen Bauernhof an der russischen Grenze, auf dem sie groß geworden war und den ihre Eltern nicht verlassen wollten. Ihre Unzufriedenheit wirkte sich direkt auf ihre Beziehung zu Florin aus, der mit der Übernahme seines elterlichen Holzunternehmens der Firma Lahtinen vollständig ausgelastet war und wenig mit ihren Vorstellungen zu ihrer Zukunft anfangen konnte. Es würde nicht mehr lange gut gehen. Soviel stand für sie bereits fest. Sie musste die Reißleine ziehen und langsam an sich selbst denken.
Es war wieder einer dieser unendlich gleichen Tage bei den Eltern, zäh wie kalter Schleim, der sich auf sie setzte und jede befreiende Bewegung im Keim erstickte. Irgendetwas staute sich in ihrer Gedankenspirale, ihr Gehirn schien kurz vor dem Siedepunkt zu stehen.
„Raus, ich muss raus!“, dachte sie in einem kurzen Anfall von Panik.
Hastig verstaute sie den Staubsauger in dem Schrank unter der Treppe, in dem er immer ordentlich mit seinem Schlauch aufgehängt werden musste, und rief den Eltern nur noch zu, dass sie den Tag über unterwegs sein werde. Im Schuppen hinter dem rot gestrichenen Elternhaus gab es einen alten Spind, in dem sie ihr Angelzeug aufbewahrte. Hastig verstaute sie die Box mit den Blinkern und ihre neueste Rute im alten Volvo. Eine in die Jahre gekommene Schotterstraße mit einer furchtbaren Waschbrettfahrbahn führte direkt auf die Grenze zu und bog kurz vor dem Fluss nach Süden ab. Von hier aus wählte sie einen verschlammten Seitenweg, der in ein abgelegenes Waldstück führte. Er grenzte direkt an den fischreichen Abschnitt vor der verbotenen Zone.
Gekonnt manövrierte sie den Volvo an den Wasserlöchern vorbei und wendete am Ende des Weges. Im Ernstfall stand er gleich in Fahrtrichtung, sodass sie schnell starten konnte. Obwohl sie nur wenige Kilometer gefahren war, kam ihr die Luft jetzt deutlich frischer vor. Wie befreit streckte sie die Arme aus und atmete tief durch. Die kühle Frühlingsluft erzeugte ein leichtes Kribbeln auf ihrer Gesichtshaut, das sie noch einen Augenblick intensiv genoss. Erst jetzt holte sie ihr Angelzeug aus dem Kofferraum und marschierte in Richtung Fluss. Es war diese Entspannung in der Natur, die sie suchte. Hier bekam sie das Gefühl, etwas weiter weg zu sein von den Sorgen um ihre Eltern und ihre eigene Zukunft. Und sie bekam Abstand vom Beziehungsstress mit Florin.
Der Geruch vom feuchtem Waldboden war überall. Sie kannte ihn seit ihrer jüngsten Kindheit und genoss ihn immer noch so, wie früher. Das war die Welt, in der sie groß geworden war. Sie folgte dem schmalen Waldpfad, der sich um kleinere Tümpel und große, bemooste Felsblöcke schlängelte und ohne Abzweig direkt zum Fluss führte. In der Ferne konnte sie schon das Plätschern des Wassers hören, das sich über eine kleine Stromschnelle über die Steine ergoss. Das war die Geräuschkulisse, die sie suchte und die ihr sofort half, sich zu entspannen und ihre Gedanken zu sortieren.
Kaija nahm sich fest vor, das Betreuungsproblem energischer als bisher anzusprechen und nicht mehr nachzugeben, wenn ihre Mutter sich weigerte, auf das Thema einzugehen. Ihr Vater war durch seine fortgeschrittene Demenz nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Es musste für die Eltern eine Betreuungslösung geben und wenn nicht, blieb nur der Umzug ins Heim.
Wenige Meter vor dem Ufer stoppte sie abrupt und suchte den Streifen nach möglichen Grenzschützern ab, die manchmal in einem größeren Abstand zur Grenze das Gebiet kontrollierten. Oft genug fühlte sie sich vom gegenüberliegenden Ufer aus beobachtet. Jetzt, nachdem sie auch die andere Seite intensiv gemustert hatte, glaubte sie allein zu sein. Wenige Schritte flussaufwärts gab es einen günstigen Standplatz, der durch ein dichtes Gebüsch Sichtschutz vor zufällig auftauchenden Personen bot. Dort breitete sie ihre Angelsachen aus, befestigte einen Blinker an der Angel und schleuderte ihn routiniert bis in die Mitte des Flusses. Langsam kurbelte sie die Schnur zurück auf die Spule.
Es gab kein Zucken an der Leine. Nach einigen aufgewickelten Schnurmetern hielt sie den Blinker erneut in der Hand, diesmal zusätzlich mit einem Haufen Grünzeug am Haken, das sie vorsichtig abzupfte. Der nächste Versuch schien mehr Erfolg zu versprechen. Ein spürbares Ziehen an der Schnur konnte nur bedeuten, dass einer angebissen hatte. Ein kräftiger Ruck mit der Angel und der Fisch sollte nicht mehr vom Haken loskommen.
Kaija konzentrierte sich ganz auf das Hereinziehen des Fangs, dass sie alles um sie herum vergaß. Als ein Ast unüberhörbar laut knackte, drehte sie sich ruckartig um. Ihr Herz schlug augenblicklich schneller.
Vor ihr stand ein Hüne in grüner Tarnkleidung und starrte sie mit einem durchdringenden Blick an. Ein Blick, der nichts Gutes verhieß und ihr sofort Angst machte. Erst verspätet registrierte sie, dass er eine Makarow PM auf sie gerichtet hielt, eine russische Militärpistole, deren Geräusch beim Entsichern sie zu genau kannte.
Kaija war im vorletzten Kriegsjahr geboren und hatte in den Jahren ihrer Kindheit keinen Kontakt zu irgendeiner Art militärischer Ausrüstung gehabt, im Gegensatz zu einigen ihrer Freundinnen und Freunde, die ganze Waldstriche abgesucht und genügend brisantes Material gefunden hatten. Aber die Makarow, die jetzt auf sie gerichtet wurde, kannte sie zu gut. Lauri hatte eines Tages genau diesen Typ mit nach Hause gebracht und sie vor den Eltern versteckt, stolz, sie vor den anderen im Wald gefunden zu haben. Die Erinnerung an seinen Tod durch einen Unfall mit dieser Waffe versuchte sie immer noch zu verdrängen. Und jetzt war der gleiche Typ Pistole auf sie gerichtet, eine Situation, die ihr die Luft abschnürte. Die Gedanken, die ihr unwillkürlich durch den Kopf schossen, brachen unmittelbar ab, als der Mann die Waffe ruckartig nach oben bewegte, ein unmissverständliches Zeichen für das, was er vorhatte.
„Ausziehen!“, raunzte er auf Russisch, das sie verstehen konnte, weil sie diese Sprache neben Schwedisch in der Schule statt Englisch gewählt hatte. Er machte mit wenigen Armbewegungen deutlich, dass er es ernst meinte, und kam langsam auf sie zu, die Waffe bedrohlich auf ihren Oberkörper gerichtet. Kaijas Körper fing an zu zittern. Hilflos suchte sie mit schnellen Blicken die Uferstreifen ab. Es war niemand zu sehen. Wenn sie jetzt schrie, hätte sie verloren. Das spürte sie instinktiv. Der Hüne war inzwischen dicht an sie herangetreten, hielt ihr die Pistole an den Kopf und begann ihren Pullover anzuheben. „Ausziehen, sofort!“
Verzweifelt zog Kaija die ersten Kleidungsstücke aus, besonders langsam, in der Hoffnung, dass doch noch jemand auftauchte, der ihr helfen könnte. Der Mann wurde unruhig, als er den nackten Oberkörper sah, auf den ihr langes blondes Haar herunterfiel. Reflexartig versuchte sie, ihre Brüste mit den Armen zu bedecken. Als er seine klobige Hand ausstreckte und ihre Haut berührte, schrie sie kurz auf. Sofort drückte er die Pistole gegen ihren Unterleib, schob sie langsam nach unten zwischen ihre Beine und grinste. Betont langsam wiederholte er die Anweisung, sich auszuziehen. Es folgte das, was sie immer als schlimmst möglichen Angriff auf sich vorgestellt hatte. Dass es jetzt passieren sollte, daran wollte sie einfach nicht glauben.
Der Mann zwang Kaija, sich auf den Boden zu legen, öffnete seinen Gürtel und stürzte sich auf sie. Sie breitete verzweifelt die Arme aus und fasste in die Heidelbeersträucher, um sich irgendwo festzukrallen. Mit der rechten Hand stieß sie gegen einen Stein aus dem Flussschotter, der gerade so groß war, dass sie ihn zur Hälfte umfassen konnte.
Noch bevor der Vergewaltiger sein Ziel erreichte, spürte er einen scharfen Schmerz über der linken Schläfe, der ihm jäh das Bewusstsein nahm. Im nächsten Moment lag er mit eingeschlagenem Schädel am Ufer des Jänisjoki.
KAPITEL2
UNIVERSITÄT ZU KÖLN
Onni schaute auf die Uhr. „Mist“, entfuhr es ihm. Ein Kollege aus der Chemie hatte ihn unten auf dem Vorplatz des archäologischen Instituts zufällig entdeckt und länger abgehalten, als gedacht. Er beschleunigte seinen Schritt und spurtete die letzten Treppenstufen zum Hintereingang des Hörsaals nach oben. Leise öffnete er die schwere Holztür, schlich hinter die oberste Stuhlreihe und hörte die letzten Sätze der Dozentin.
„… und ich weise noch einmal darauf hin, dass der Cro-Magnon-Mensch, unser jungsteinzeitlicher Vorfahre, nicht als Bindeglied zwischen Neandertaler und modernem Menschen einzuordnen ist. Aber darauf werde ich in der nächsten Vorlesungsstunde genauer eingehen.“ Martina Donners schaute kurz in die Reihen, die für das spezielle Fach mit mehr als 30 Teilnehmern relativ gut gefüllt waren, und verabschiedete sich bis zur nächsten Woche mit einem Dankeschön. Die Studierenden klopften traditionsgemäß auf die alten, ausgeleierten Klapptische, räkelten und streckten sich während sie aufstanden und starteten schließlich gemächlich, um zur Mensa zu gehen.
Onni Claasen hatte schon öfter ein Zeitfenster gesucht, um wenigstens einmal zeitweise an der Vorlesung von Martina teilzunehmen. Es kam bis heute immer etwas dazwischen. Jetzt war es nur der kurze Moment, aber immerhin hatte er einen ersten Eindruck bekommen. Er beobachtete durch die Lücken der durch die Reihen gehenden Studentinnen, wie sie den Laptop vom Kabel trennte, ihn zusammen mit Unterlagen in einen passenden Rucksack verstaute und sich anschließend suchend umschaute. Sekunden später hatte sie ihn entdeckt und winkte kurz.
Seit einigen Wochen war sie seine neue Lebensgefährtin. Onni kannte sich seitdem kaum wieder. Alles machte plötzlich viel mehr Spaß, er joggte wieder, oft zusammen mit Martina, und fühlte sich um Jahre jünger.
Mit schnellen Schritten kam sie im Mittelgang nach oben gestapft, nahm Onni kurz in den Arm und drückte ihm den Rucksack in die Hand.
„Halt mal bitte, ich bin ganz schön fertig.“ Sie fasste auf beiden Seiten in den Stoff ihres roten Pullis und versuchte durch pumpartige Bewegungen etwas Luft unter ihre Achseln zu fächern.
„So eine zweistündige Vorlesung ist echt stressig.“ Mit gespreizten Fingern fuhr sie sich flüchtig durch die langen dunklen Haare und warf den Kopf nach hinten.
„Ich kenne das. Ich habe Kollegen, die halten vier Stunden hintereinander. Das könnte ich nicht.“
„Aber schön, dass du es heute geschafft hast. Gehen wir wieder in die Mensa oder lieber in unser Lokal?“
„Mensa, das geht schneller. Ich habe nachher gleich zwei Termine.“
Kurz bevor sie durch die Tür gingen, drehte sich Onni noch einmal um und sog die Hörsaalluft konzentriert durch die Nase.
„Das ist irgendwie erstaunlich. Bei euch riecht es ganz anders, als bei uns in den Veranstaltungen. Viel parfümierter.“
Martina lachte. „Das ist kein Wunder. Der Studiengang Archäologie ist bei Studentinnen sehr beliebt. Die riechen halt besser!“
„Das wird es sein. In Chemie, Physik oder meinem Fach physikalische Chemie studieren überwiegend die männlichen Vertreter. Leider! Eine gleichmäßige Verteilung zwischen Studenten und Studentinnen wäre nicht nur für die Hörsaalluft besser.“
„Ach ja?“
Auf der Treppe wartete eine Studentin auf Martina, die nach einem Termin für eine Beratung fragte. Während seine Lebensgefährtin schnell in den Kalender schaute, ging Onni langsam vor. Martina war schnell fertig und spurtete hinter ihm her. Als sie gerade noch eine Stufe hinter ihm war, wuselte sie ihm übermütig durch die Haare.
„Nicht doch, wir sind gleich draußen. Wie sieht das denn aus?“
„Gut sieht das aus. Mit der Frisur kannst du in England Karriere machen, als Politiker.“ Sie lachte und amüsierte sich darüber, wie Onni bemüht war, mit beiden Händen die Haare wieder platt zu drücken.
In der Mensa gab es die gewohnten Schlangen, die je nach Essenswahl unterschiedlich lang waren. Onni wählte den Fisch, der länger dauern würde, Martina zog die Salattheke vor. Sie verabredeten sich für einen Fensterplatz auf der rechten Seite. Onni traf zwei Kollegen an der Kasse, die ihn gleich einluden, sich zu ihnen zu setzen. Schnell zeigte er nach rechts und verwies auf Martina. Er wusste, dass sich seine Liaison mit einer Kollegin inzwischen rumgesprochen hatte, wogegen er nichts einzuwenden hatte, im Gegenteil.
Die Tische waren wie immer um diese Zeit voll belegt. Onni entdeckte Martina an einem Vierertisch mit zwei Studenten, wo sie gerade Platz nehmen wollte. Onni kannte die beiden flüchtig. Es waren zwei Mathe Studenten aus höheren Semestern, die bei einem Kollegen für Klausurbetreuungen angestellt waren und ihm schon einmal ausgeholfen hatten. Sie waren bereits fertig und verabschiedeten sich sofort, als ihre neuen Sitznachbarn zu essen begannen.
„Ich habe zwar nicht viel mitbekommen, aber es gefällt mir, wie du vorträgst, Gestik, Blickkontakt, halt die ganze Art. Ich könnte sicher noch einiges von dir lernen“, meinte Onni während sie aßen.
Martina bedankte sich und erzählte sofort von Dozenten, die sie in ihrem Studium in den naturwissenschaftlichen Randfächern erleben durfte. Manche waren so ermüdend, dass sie sich schon damals vornahm, es besser zu machen, sollte sie irgendwann die Gelegenheit dazu bekommen.
Onni sah sie eine Weile an. Es war ihre ganze Art, die ihn vom ersten Moment an faszinierte. Er dachte daran, wie sie plötzlich in seiner Bürotür stand und fragte, ob er kurz Zeit hätte. In der Hand hielt sie einen Steinbrocken, den sie demonstrativ in die Höhe stemmte. Es hatte fast schon etwas Bedrohliches. Sie stellte sich als Martina Donners, eine Kollegin aus der Archäologie vor und hatte eine Frage an einen Kollegen aus der Chemie. Der Stein sei, wie sie gleich erklärte, ein prähistorisches Werkzeug, dessen Isotopenverteilung sie untersuchen lassen wollte. Sie sagte, es handele sich um ein vermeintlich dreißigtausend Jahre alten Faustkeil, trat ohne zu zögern zu ihm an den Schreibtisch und führte vor, wie man ihn in der Steinzeit eingesetzt hatte.
„Wie bist du eigentlich auf mich gekommen, als du nach der Analysenmöglichkeit suchtest?“
Martina lächelte. „Es gab hier in Köln zwei Abteilungen und in den umliegenden Universitäten einige mehr, die solche Analysen machen können. Die eigene Uni kam natürlich zuerst in Betracht, allein wegen der kurzen Wege. Ich habe mir die Abteilungen im Netz angesehen und hatte die Wahl zwischen dir und deinem Kollegen. Er sitzt übrigens dort hinten.“ Sie zeigte in die Mitte der benachbarten Tischreihe. „Und jetzt rate mal, warum ich zuerst zu dir gekommen bin.“
Onni drehte den Kopf und suchte seinen Kollegen. Richtig bewusst hatte er sich noch nie mit ihm verglichen, vielleicht in wissenschaftlicher Hinsicht, aber nicht, wenn es um die eigene Attraktivität für Frauen ging. Jetzt schaute er mit Martinas Augen und nickte ihr zu. Der Kollege war einige Jahre älter, was nicht nur durch fehlende Kopfhaare sichtbar wurde, hatte einen deutlichen Bauchansatz und wirkte etwas gesetzt.
„Hätte ich an deiner Stelle auch so entschieden.“ Onni musste plötzlich grinsen.
„Jetzt weißt du es. Du siehst zudem noch jünger aus, als du eigentlich bist. Und dass daraus mehr werden könnte, hatte ich nicht eingeplant. Hat sich so ergeben.“
„Wenn man dich so ansieht, kann man auch nicht glauben, dass du noch unter vierzig bist und schon die gesamte Hochschulkarriere durchlaufen hast, mit Diplom, Promotion, Habilitation, Bewerbung und Professur.“
„Danke für die Blumen, es war aber auch richtig, richtig viel Arbeit.“ Mit den letzten Worten gab sie das Zeichen für den Aufbruch und stand auf. Gemeinsam reihten sie sich in die Schlange vor der Geschirrannahme ein und warteten, bis sie die Tabletts abgeben konnten.
„Hast dich gut gehalten! Ich bin stolz auf dich.“ Onni holte aus und hätte ihr beinahe einen bestätigenden Klaps auf den Po gegeben, erschrak sich aber bei dem Gedanken, es hier in der Menge zu tun. Wie im Reflex zog er den Arm nach oben und klopfte ihr auf die linke Schulter.
„Gehen wir noch einen Kaffee trinken?“, fragte Martina, während sie kurz den Arm um seine Schultern legte. Onni verneinte. Für seine Terminplan war es schon zu spät. Es würde gerade für einen Becher zum Mitnehmen unten aus der Cafeteria reichen. Als sie jeder mit einem Kaffee bewaffnet die Mensa verließen, blieb Martina kurz stehen und überlegte.
„Ich bin jetzt fast zwei Jahre an dieser Uni und du sagtest, dass du vor vier Jahren von einer Professur in Hamburg nach Köln gekommen bist. Das heißt, wir sind fast zwei Jahre lang parallel hier ein und aus gegangen und haben uns völlig übersehen?“
„Stimmt, das ist schon merkwürdig.“ Martina sah ihn mit einem großen Fragezeichen im Gesicht an. Gemeinsam gingen sie eine kurze Strecke, bis sich ihre Wege zu den Instituten trennten.
„Ich überlege übrigens gerade, heute Abend zu dir zu kommen“, meinte Martina spontan, als sie sich gerade verabschieden wollten. „Ich müsste noch etwas einkaufen, was ich aber nicht mehr schaffe. Wir haben eine dieser zähen Kommissionssitzungen, du weißt, die mit den vielen Selbstdarstellern, und das am Freitag mitten im Karneval.“
Onni freute sich und nickte, weil er ihr dasselbe auch gerade vorschlagen wollte. Er hatte schon vorausahnend ausreichend eingekauft und bot sofort an zu kochen.
* * *
Gegen 17:00 Uhr verließen die beiden letzten Studierenden Onnis Sprechstunde. Bei ihm war die Luft raus und die einem Verlag zugesagte Bewertung einer Veröffentlichung hatte noch Zeit. Also entschloss er sich, etwas früher als sonst Schluss zu machen. Das schien ihm auch sinnvoll, weil er für die Vorbereitungen des Abendessens etwas mehr Zeit benötigte. Er hatte sich überlegt, eine Lasagne zu zaubern, die immer etwas mehr Zeit in der Vorbereitung kostete. Martina hatte sich für 19:00 Uhr angesagt, falls sie rechtzeitig wegkam. Das letzte Mal wurde es durch eine Fakultätsratssitzung so spät, dass sie erst um 22:00 Uhr essen konnten, eigentlich zu spät, wie er fand.
Es war fast schon eine kleine Tradition geworden, dass mindestens zwei Mal in der Woche gekocht wurde. Entweder bei ihm oder bei Martina. Wer gerade die meiste Zeit hatte, war gefragt. Anschließend wurde es regelmäßig ein abwechslungsreicher Abend, mit Wein und Musik, und mit allem, was man sich für die erste Zeit des Kennenlernens vorstellt. Die anderen Tage verbrachten sie getrennt, um abends zu arbeiten oder an Veranstaltungen teilzunehmen. Am Wochenende ging es zur Abwechslung in die Restaurants.
Onni wurde sich erst nach und nach bewusst, dass er in eine neue, intensive Gefühlswelt eingetaucht war, die er lange vermisst und nicht mehr geglaubt hatte, sie noch einmal erleben zu dürfen. Es war nicht selbstverständlich. Zuerst hatte er sich gegen diese neue Vertrautheit unbewusst gewehrt. Zu enttäuschend waren seine bisherigen Beziehungen gewesen, die immer nur von kurzer Dauer waren. Vielleicht kam doch zu viel von seiner Wissenschaft und seinem belehrenden Auftreten durch, wie ihm manchmal vorgeworfen wurde. Aber diesmal war es anders. Sie waren beide in den Gesprächen über ihr Leben soweit in die Tiefe gegangen, dass sie glaubten, sich schon Jahre zu kennen. Ein Phänomen, dass er nicht kannte.
Eine viertel Stunde später als geplant stand Martina vor der Tür und klingelte. Sie hatte den Zweitschlüssel von Onnis Haus bei sich liegengelassen und wirkte sehr unausgeglichen. Onni nahm ihr den dünnen Mantel ab und gab ihr einen Kuss. Sie musste sich plötzlich kräftig schütteln.
„Ist nicht wegen dir, ist wegen der nervigen Sitzung. Es war nicht mehr auszuhalten. Ich bin mit ein paar anderen einfach abgehauen. So, und jetzt brauche ich erst einmal ein Bier.“
Onni fragte erst gar nicht weiter nach und besorgte ihr lieber eine kleine Flasche Kölsch. Als Lasagne, Salat und Rotwein auf dem Tisch standen, hob sich langsam ihre Stimmung. Onni startete eine CD mit klassischer Musik, zündete zwei bereitgestellte Kerzen an und stieß mit ihr an.
„So, jetzt denk an etwas Anderes. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, das wir vielleicht noch andere Verknüpfungspunkte mit unseren beiden Wissenschaften haben, nicht nur die Isotopenbestimmungen.“
„Warum nicht. Wir haben häufig Fundstücke, die andere Analysenmethoden erfordern. Metalllegierungen, Keramiken oder bemalte Gegenstände.“
„Das hätte den nicht uneigennützigen Vorteil, dass ich dich zu deinen Ausgrabungen begleiten könnte. Es muss natürlich zeitlich passen. Was meinst du?“
„Eigentlich keine schlechte Idee. Es könnte aber sein, dass du mich dann von einer ganz anderen Seite kennen lernst. Wenn ich im Gelände arbeite, habe ich keine Augen mehr für rechts und links. Da fühlst du dich vermutlich schnell vernachlässigt.“ Sie sah ihn plötzlich sehr bestimmt an.
„Kein Problem. Es gibt sicher viel zu sehen in den Regionen, in denen du gräbst. Ich beneide dich schon etwas, dass du in den Sommermonaten häufig im Süden bist und frei entscheiden kannst, einen neuen Antrag für deine Grabungen zur Ur- und Frühgeschichte in einer neuen spannenden Region zu stellen. Hast du schon Pläne, neben Spanien und Frankreich neue Gebiete zu bearbeiten?“
„Pläne habe ich noch einige, aber im Moment steht Bulgarien oben an. Der Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist in der Endphase. Wenn die Gutachter zustimmen, werde ich nächstes Jahr im Herbst mit Probegrabungen beginnen.“
„Auch interessant. Worum geht es dabei?“
Martina wurde plötzlich wach. Begeistert gab sie Onni einen Überblick über Urgeschichte, die Wanderung der verschiedenen Hominiden-Arten aus Afrika, ihre Werkzeugkulturen und die Funde, die ihr bisher unter die Schaufel gekommen waren. „Neben dem kleinen Bulgarienprojekt arbeiten wir gerade an einem viel größeren Antrag an die DFG. Es geht um die Wanderung unserer Vorfahren aus Afrika in die ganze Welt. Vielleicht wirst du darüber irgendwann mitentscheiden.“
„Du meinst, weil ich Senator bei der DFG bin?“
„Genau, du wirst dann einer von Wenigen sein, der fachlich richtig gut informiert ist!“ Sie lächelte Onni bedeutungsvoll an und streichelte sachte seine rechte Hand.
Onni überlegte, ob er als Mitglied des Senats bei einer Entscheidung in dieser Sache wegen Befangenheit mit abstimmen durfte. Er war aufgrund seiner außergewöhnlichen Forschungsleistungen bereits als relativ junger Professor in das zentrale wissenschaftliche Gremium der DFG gewählt worden. Es war kurz bevor er Martina kennengelernt hatte, und seitdem hatte er sich noch nicht in alle Richtlinien einarbeiten können.
„Ja, das wäre ein günstiger Zufall“ Seine Antwort kam erst nach einer längeren Überlegung und wirkte sehr gedehnt.
„Wenn ich die Bewilligung bekäme, hätte ich mit den Ergebnissen sicher auch Chancen auf einen der internationalen Preise.“
„Was gibt es bei Euch für Preise? Ich kenne mich gar nicht aus in deinem Fachgebiet.“
„Es könnte die sehr renommierte Goldmedaille sein, die vom amerikanischen Institut für Archäologie vergeben wird. Ist aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem Nobel-Preis für Physik oder Chemie.“ Sie richtete sich bei den letzten Worten auf und lachte Onni an. „Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt. Wenn du in deinem Bereich etwas richtig Bahnbrechendes herausfindest, könntest du zwei Nobelpreise auf einmal bekommen. Das hat es wohl noch nicht gegeben.“
„Ich glaube, das ist nur ein theoretischer Fall und schwer vorstellbar.“
Martina überlegte eine Weile und sah Onni mit einem listigen Blick an.
„Das ist jetzt auch eine rein theoretische Frage: Stell dir vor, du hast Kontakt zu einem verschrobenen Forscher, der allein eine nobelpreiswürdige Entdeckung macht und sie nur dir mitteilt. Und dieser Kollege stirbt überraschend, ohne sein Wissen veröffentlicht zu haben. Würdest du diesen Umstand für dich nutzen?“
Sie beobachtete genau, welche Reaktion Onni mit seinem Minenspiel zeigte. Die Frage war ihm unangenehm. Es war eine Diskussion von ihr, die er nicht mochte. Er überlegte einen Augenblick und wich dann aus: „Der Fall ist mir zu hypothetisch. Ich werde nie in die Verlegenheit kommen, in so einem Fall eine Entscheidung treffen zu müssen. Und wenn der Fall doch eintreten sollte, werde ich dann immer noch darüber nachdenken können.“ Er nickte ihr bestimmt zu und schloss die Diskussion mit einem größeren Schluck Wein ab. „Aber was ich dich immer fragen wollte: Welches war eigentlich der bedeutendste Fund, den du bisher gemacht hast?“
„Oh, das kann ich schnell sagen. Es ist ein Belegstück für eine der ersten menschlichen Kulturen. Eigentlich habe ich den Fund nicht selbst gemacht, ich stand nur direkt daneben, als eine Kölner Studentin, eine bezahlte Grabungshelferin, in den Staub fasste und plötzlich das Bruchstück eines Vogelknochens mit zwei Löchern in der Hand hielt. Ich sah sofort, dass es sich um den Teil einer Flöte handeln musste. Wir siebten den gesamten Sand in diesem Teilstück der Grabungsstelle durch und fanden wirklich weitere Reste. Es ist bis heute eine der am vollständigsten erhaltenen Flöten. Eines der ältesten Musikinstrumente überhaupt.“
„Faszinierend. Wie alt ist sie?“
„Sie stammt aus dem Aurignacien, der ältesten Kultur der Jungsteinzeit. Sie ist immer noch nicht genau datiert, liegt aber zwischen 30.000 und 36.000 Jahren.“
Martina stand auf, verteilte den Rest der Rotweinflasche auf die Gläser und holte eine Flasche Wasser aus der Küche. Als sie zurückkam, sah sie Onni herausfordernd an.
„Und jetzt zu dir. Wie zum Teufel kommt man auf die Idee, Physik oder Chemie zu studieren oder schlimmer noch gleich physikalische Chemie? Was ist daran so spannend?“
Onni lachte vergnügt. „Das fing schon an, als ich noch relativ jung war.“ Er berichtete, dass er als Kind immer versucht hatte, Experimente zu machen. Möglichst solche, wo es auch einmal knallte. Folglich fing er nach der Schule mit dem Chemiestudium an. Physik war sein Zweitfach, das ihn dann richtig zu interessieren begann, als es um die Quantenphysik ging.
„Moment“, unterbrach ihn Martina. „Die verstehen doch noch nicht einmal alle Physiker richtig!“
„Stimmt, es geht dabei um Dinge, die nicht unserer Erfahrungswelt entsprechen. Die Vorstellungen entspringen komplizierten mathematischen Berechnungen und physikalischen Formeln. Ein Feld für theoretische Physiker. Aber dennoch reizvoll, weil sie in eine völlig andere, eigentlich unverständliche Welt führen. Und die scheint um uns herum zu existieren, aber wir erkennen sie nicht. Ich habe dir vor einiger Zeit von unserem philosophischen Kreis mit einigen Kollegen aus den Geisteswissenschaften und der Physik erzählt, in dem ich schon mehrfach zu Phänomenen der Quantenwelt vorgetragen habe. Du solltest einmal mitkommen. Die Diskussionen sind schon sehr speziell.“
Martina schüttelte sich etwas, als laufe ihr gerade ein Schauer über den Rücken. „Vielleicht später, aber was fasziniert dich heute am meisten an der physikalischen Chemie?“
Onni überlegte einen Moment. Dann schenkte er ein zweites Glas Wasser ein und wartete einen Moment, bis es sich beruhigt hatte. „Darf ich?“ Er griff zu ihrem Rotweinglas, nahm einen unbenutzten Teelöffel und tauchte ihn kurz in den Wein. Mit einer Ruckbewegung schleuderte er einen anhängenden Tropfen vom Löffel in das Wasser. „Was du jetzt siehst, ist das Elementarste, was die Welt, das Leben und alles ausmacht.“
Martina starrte ihn etwas ungläubig an. „Es vermischt sich doch nur der Rotweintropfen mit dem Wasser. Was ist daran so elementar?“
„Es zeigt ein Naturgesetz, das Entropie oder besser Entropiezunahme heißt. Man sagt auch, die Unordnung nimmt zu. Letztendlich ist durch die Entropiezunahme die Zeit in unser Universum gekommen. Das ist schwer verständlich. Aber stell dir vor, es würde sich nichts bewegen, keine Atome und keine Sterne oder Planeten. Dann gäbe es auch keine Zeit. Du kennst das Modell vom Urknall, aus dem das Weltall entstanden ist. Nach diesem Urknall hat sich das Weltall ständig ausgedehnt und tut es noch heute. Und das ist das Bestreben von allem. Alles will auseinanderlaufen und somit die Entropie erhöhen. Nur mit Energiezufuhr lässt sich etwas in die andere Richtung bringen, so wie das Leben, das mit dem gezielten Aufbau von Zellen Ordnung gegen die Entropiezunahme schafft. Die Energie hierfür holen wir uns aus der Nahrung, ohne die wir nicht leben können. Und das zeigt dieser Tropfen Wein. Sieh, er ist völlig gleichmäßig im Wasser verteilt. Wir werden niemals erleben, dass sich der Wein wieder von selbst zu einem Tropfen zusammenfindet.“
„So, so. Dann erklär mir bitte, warum meine Einbrenne, die ich in die Soße rühre, so häufig klumpt, anstatt wie dein Rotweintropfen auseinander zu laufen.“
„Okay, ich glaube, das ist ein guter Grund, einmal in meine Vorlesung zu kommen. Ich werde dir den passenden Tag mitteilen.“ Er lachte und schlug vor, ins Bett zu gehen. Sie baute sich vor ihm auf, wuschelte durch seine dichten blonden Haare und gab ihm einen Kuss.
* * *
Gerade als sie erschöpft und zufrieden nebeneinanderlagen und sich die ersten Zeichen einer Traumwelt abzeichneten, setzte sich Onni plötzlich auf und machte die kleine Nachttischlampe an.
„Was ist denn?“, murmelte Martina im Halbschlaf. Onni antwortete nicht, sprang auf und fing an, nackt wie er war, in einem alten Wandschrank etwas zu suchen. Kurze Zeit später kam er mit einer kleinen Kiste wieder und setzte sich zu Martina aufs Bett.
„Schau doch, das sind Utensilien, die meinem Großvater mütterlicherseits gehörten. Ich habe ihn nicht mehr kennen gelernt. Es sind Bilder und Sachen, die er aus dem Krieg mitgebracht hat. Er war in Frankreich stationiert.“
Gemeinsam sortierten sie die Fotos, die alte Aufnahmen von Soldaten und Kriegsgerät zeigten. Auch einige Landschaftsfotos waren dabei, die sie nicht genau zuordnen konnten. Neben einem schwarz angelaufenen Zigarettenetui, einem Benzinfeuerzeug und einem Taschenmesser lag unter den Fotos eine längliche Hülle, in die eine Zigarre gepasst hätte. Vorsichtig zog Onni die Kappe ab und sah hinein. Es war noch da, das leicht gekrümmte weiße Röhrchen mit mehreren Löchern.
„Mir ist beim Einschlafen noch einmal dein Bericht über den Flötenfund eingefallen. Ich wusste, ich habe so etwas schon einmal gesehen. Jetzt weiß ich auch wo.“
Vorsichtig zog er einen Vogelknochen aus der Umhüllung und hielt ihn Martina triumphierend hin.
„Das ist jetzt nicht dein Ernst?“ Ungläubig starrte sie auf Onnis linke Hand, in der der Knochen lag. Behutsam fasste sie zu und musterte das Teil eingehend. Es schien relativ unversehrt, geklebte Bruchstellen konnte sie auf Anhieb nicht erkennen.
„Wenn es das ist, was ich vermute, müssen wir der Sache unbedingt nachgehen. Wo war dein Opa stationiert, woher konnte er das Stück bekommen haben, hat er es selbst gefunden oder hat es ihm jemand geschenkt, gibt es Hinweise in Briefen, welches Alter hat es? Oh, ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen.“
Dass sich die letzte Befürchtung in erschreckender Weise bestätigen würde, ahnte Martina nicht. Onni nahm die vermutet urzeitliche Flöte wieder vorsichtig zurück und teste den Abstand der Löcher.
„Früher musste ich Blockflöte lernen. Eine schreckliche Zeit. Aber ich frage mich, ob die hier noch funktioniert.“
„Wage es nicht, das auszuprobieren!“, rief Martina. „Das ist ein wertvolles archäologisches Fundstück! Weißt du nicht, was für eine zersetzende Wirkung auch nur ein Tropfen Speichel auf etwas so Altes haben kann?“
„Okay okay.“ Onni fand, dass sie ein bisschen übertrieb. Einmal einen Ton hervorzubringen würde sicher nicht schaden. „Aber ich gehe sie mal saubermachen. Ich glaube, da hängt ein bisschen Dreck drin.“
Er stand auf und ging ins Bad. Martina rief ihm noch nach, er solle wirklich vorsichtig sein.
Nach dem Plätschern des Wassers hörte sie noch genau zwei Geräusche, bevor sich alles in ihrer Welt änderte. Das erste war das eines schwach laufenden Föns, mit dem Onni versuchte, die Flöte wieder trocken zu legen. Es folgte der zweite, ein etwas krächzender Fiepton aus einem Instrument, das vielleicht mehr als 30.000 Jahre alt war.
KAPITEL3
KNOCHENFLÖTE
Martina zog sich die Bettdecke halb über den nackten Körper und bat Onni, doch langsam wieder ins Bett zu kommen. Sie hatte minutenlang nichts von ihm gehört und wollte langsam schlafen. Durch die offene Schlafzimmertür sah sie, wie die Badezimmertür brüsk aufgestoßen wurde und laut krachend mit dem Türgriff gegen die Wand schlug. Fast gleichzeitig kam jemand aus dem Bad, der sofort wie erstarrt im Halbdunkel des Flurs verharrte. Ihr erster Schreck wich augenblicklich der Überlegung, wie Onni sich in der kurzen Zeit so hatte verkleiden können. Die männliche Gestalt war nackt und reichlich behaart. Es fing an mit dem langen schwarzen Haupthaar und einem zauseligen Bart, der sich nahtlos über große Teile des Körpers fortzusetzen schien. Dazu passte die dunkle, ins Rötliche gehende Farbe seines Gesichts, das durch eine ausgeprägte Nase noch einmal eine besondere Note bekam. Reflexartig fiel ihr Blick auf sein Geschlechtsteil, das sich gerade zu verändern schien. Jetzt schoss ihr der Schreck erst richtig in die Glieder. Sie setzte sich ruckartig auf und zog die Decke bis über die Schultern. Das konnte nicht Onni sein.
„Wer sind Sie? Was wollen Sie und was soll das? Wo ist mein Freund?“, schrie sie den ungebetenen Gast an, während sie gleichzeitig die Decke nutzte, um die Sicht auf die Schublade des Nachtschranks zu verhindern. Mit der linken Hand fingerte sie darin nach etwas, das sie als Waffe gebrauchen könnte. Die Gestalt schien sich langsam aus ihrer Starre zu lösen. Mit einem fast lächerlich wirkenden Minenspiel betrat der behaarte Mann langsam das Schlafzimmer, die weit aufgerissenen Augen immer auf Martina gerichtet. Sie hoffte, dass die ertastete kleine Flasche wirklich Pfefferspray war, wie die Vertiefung am Sprühknopf versprach, und nicht etwa Intimspray.
Er kam bis zum Bettrand. In diesem Moment leuchtete das Display von Martinas Handy auf. Sie hatte vergessen, es leise zu stellen. Eine Zehntelsekunde später setzte der Klingelton ein, ein bekannter Ausschnitt eines elektronischen Gitarrenstücks einer australischen Rockband erklang mit voller Wucht. Und jetzt passierte es. In dem Moment, da Martina die Spraydose hervorzog und auf den Unhold richtete, drehte dieser sich ruckartig voller Schrecken zum Handy, sodass er den gerade abgedrückten Strahl nur seitlich an der linken Kopfhälfte abbekam. Mit einem großen Satz rannte er über den Flur in Onnis Arbeitszimmer, wo ihn Martina poltern hörte, als wollte er die gesamte Einrichtung auseinandernehmen. Sie hatte sich gerade das Handy geschnappt und mit der Decke hinter dem Schrank versteckt, als der Einbrecher zurückkam, aber diesmal zum Treppenhaus abbog. Laut polternd erreichte er das Erdgeschoss. Dort tobte er durch die Räume wie eine Wildsau, wie Martina es später der Polizei versuchte zu beschreiben. Schließlich schnappte er sich den Flokatiteppich, der vor dem Kamin lag, legte ihn um seinen behaarten Körper und rannte mit Anlauf durch die Glasscheibe der Terrassentür.
* * *
Die Polizei kam mit einem großen Aufgebot. Eduard Brenner stellte sich als der zuständige Kommissar von der Kriminalpolizei vor. Er verschaffte sich schnell einen provisorischen Überblick, während seine Kollegen den Garten mit Taschenlampen und gezogenen Pistolen absuchten. Es war das Karnevalwochenende in Köln. Martina roch es, als Brenner ihr die ersten Fragen stellte. Sie hatte sich inzwischen angezogen und den ersten Schock überwunden.
„Wollen Sie auch noch einen Ouzo? Ich kann jetzt einen gebrauchen.“ Sie trat zum Kühlschrank und ging in der untersten Schublade die Flaschen durch, goss sich einen Schwung in das nächst stehende Wasserglas ein und prostete dem Kommissar kurz zu.
Brenner überhörte die Frage und wartete, bis sie einen Schluck genommen hatte. Er wollte jetzt endlich wissen, was passiert war. Martina bat ihn, sich mit an den Tisch zu setzen. Während sie mit wenigen Worten versuchte, den Ablauf einigermaßen genau zusammenzufassen, musterte sie den Mann von der Kripo. Mit dieser Berufsgruppe hatte sie noch nie zu tun gehabt. Sie fragte sich instinktiv, was der Reiz an diesem Job war. Brenner war größer als sie, vielleicht 45, hager mit dunklem vollem Haar. Durch ausgeprägte Augenringe und seinem modisch unrasierten Outfit wirkte er vermutlich älter, als er war.
„Frau Donners, jetzt helfen Sie mir mal. Ihr Lebensgefährte ging als Physik-Professor auf die Toilette, um etwas mit einer alten Flöte auszuprobieren…“
„Physikochemie-Professor!“
„Dann eben auch das. Er ging also als Professor auf die Toilette und kam als Neandertaler wieder heraus.“
„Nein, das war ein anderer Mann. Und dann schon eher ein Cro-Magnon-Mensch und kein Neandertaler.“
Brenners Gesichtsfarbe wechselte langsam zu einem zarten Rotton. „Woher hatte er das Kostüm, und wie konnte er sich so schnell umziehen und wieso verwüstete er die Wohnung und sprang nackt, nur mit einem Flokati bekleidet durch die geschlossene Terrassentür? Hat er, oder haben Sie beide irgendetwas geraucht, Amphetamine oder Koks zu sich genommen?“ Brenner sah Martina energisch und gleichzeitig leicht verärgert an.
„Unsinn, erstens rauchen wir beide nicht und berauschen tun wir uns an der Wissenschaft. Ich gebe Ihnen gern eine Blutprobe. Und zweitens sollte eine Frau den Unterschied zwischen zwei nackten Männern erkennen.“
„Geht das auch genauer?“
„Ich habe Körperteile von ihm gesehen, die eindeutig nicht zu meinem Lebensgefährten gehören konnten.“
„Sie meinen, weil er nackt war?“
„Das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber die Schneidezähne waren nur noch Stümpfe, die Füße viel zu breit und verdreckt, mit schrecklichen Fußnägeln. Außerdem wirkte er viel muskulöser als Onni. Seine Hände hätten in einem Edgar-Wallace-Film Karriere machen können.“
„Gut, nehmen wir einmal an, es war so. Wo ist dann ihr Lebensgefährte, wie heißt er? Onni?“
„Claasen, Prof. Dr. Onni Claasen. Aber das ist das, was Sie mir beantworten sollen. Onni ist ein hochintellektueller, zivilisierter Mensch, der mir nie so etwas antun würde.“
„Was meinen Sie?“
„Na, sich einen Trick einfallen lassen, um abzuhauen. Jetzt, da wir noch mitten in der siebten Wolkenphase sind. Und dann dieser Cro-Magnon. Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe.“
„Und von mir verlangen Sie es? Was ist das denn zum Teufel noch mal mit dem Cro-Magnon? Reden Sie mal Klartext.“
Martina beschrieb mit wenigen Sätzen die Cro-Magnon-Menschen, die die Neandertaler in Europa ablösten, aber noch eine Weile parallel mit ihnen vorkamen. Sie hatten eine andere Kultur und schienen auch durch anatomische Unterschiede, besonders im Schädelbereich, den Neandertalern überlegen gewesen zu sein. Sie öffnete eine Bilddatei auf ihrem Handy und suchte Beispiele von Gesichtsrekonstruktionen heraus, die sie in Zusammenarbeit mit Kollegen von Schädelfunden angefertigt hatte.
„Sehen Sie den hier? Das ist das Bild, das ich vor Augen hatte, als er vor meinem Bett stand.“
„Moment, können Sie mir das schicken? Daraus lässt sich doch ein Fahndungsfoto machen.“
„Wie? Das Bild zeigt einen Vorfahren von uns, der vor mehr als 30.000 Jahren gelebt hat. Und den wollen Sie jetzt zur Fahndung ausschreiben?“
„Quatsch, den natürlich nicht. Aber das ist doch besser als eine Zeichnung, die unser Spezialist nach Ihren Angaben anfertigen würde. Die ist hiermit quasi schon fertig und gibt einen Anhaltspunkt.“
In diesem Moment kam ein Beamter in einem weißen Schutzanzug auf Brenner zu und reichte ihm eine durchsichtige Probentüte mit einem kleinen Glasröhrchen zu Brenner hielt es gegen das Licht der Lampe und meinte, es müsse ein Haar sein. Der Mann von der Spurensicherung bestätigte. Es war ein recht dickes schwarzes Haar.
„Welche Haarfarbe hat Herr Claasen?“, fragte Brenners Kollege. „Die aus der Bürste im Bad sind blond und Ihre schwarz gefärbt.“
„Ach ja, woher wissen Sie das?“ Die Frage schien Martina plötzlich dumm. Die Herren waren ja schon etwas weiter in ihren Untersuchungen und hatten sicher auch ihre Haare gefunden. Schnell bestätigte sie, dass Onni blond sei.
„Okay, dann haben wir zumindest einen Hinweis auf eine zweite Person. Wir werden über die DNA mehr erfahren.“
KAPITEL4
MAGISCHES METALL
Etwas Feuchtwarmes wischte über seine Taille und schickte sich an, in Richtung der Pobacke zu wandern. Onni wachte langsam aus einem eigenartigen Dämmerzustand auf und konnte es überhaupt nicht zuordnen. War er in einer Klinik und wurde gewaschen oder war es Martina, die ein feuchtes Handtuch nach dem Duschen an seine Hüfte drückte? Aber was war das für ein Gestank? Etwas Undefinierbares kroch in seine Nase, befiel seine Riechnerven und reizte die Schleimhäute bis fast zum Niesen. Es roch irgendwie nach ranzigem Fett, Hundekot und altem Schweiß. Der feuchte Lappen entwickelte eine Schlabberbewegung. Reflexartig schlug Onni um sich und traf die Schnauze eines größeren Hundes. Ein kurzes Aufjaulen erschallte, dann rannte etwas panikartig weg. Um ihn herum entwickelte sich im Halbdunklen schlagartig eine Unruhe. Berge von Fellkörpern erhoben sich und bildeten einen Halbkreis um ihn herum. Ruckartig sprang Onni auf. Da stand er, splitternackt in einer Kalksteinhöhle, umstellt von Gestalten, die er nirgends zuordnen konnte. Erst jetzt merkte er, wie kalt es war und dass er langsam anfing, am ganzen Körper zu zittern.
„Verfluchte Scheiße, was ist das denn?“, fauchte er den Typ an, der ihm direkt gegenüberstand. „Kann mir mal einer erklären, was das hier soll?“
Ein Murmeln setzte unter den Gestalten ein. Einige hoben langsam einen Arm, in der Hand etwas Klobiges, Undefinierbares. Die Kälte wurde unangenehm. Schnell sah sich Onni um und entdeckte einen Schritt neben sich einen kleinen Fellhaufen. Während er den Schritt wagte, wichen die Gestalten etwas zurück. Sein Fuß ertastete nichts Festes. Vorsichtig bückte er sich, immer die Gestalten im Blick, und hob das Bündel Fell auf. Es reichte für einen knappen Umhang.
Langsam wurde es heller in dem Raum, den Onni jetzt als eine Art Eingang einer Höhle identifizieren konnte. Vom hinteren Teil her hörte er das Geräusch von tropfendem Wasser. Die Sonne schien gerade aufzugehen. Sie tauchte die Wände aus massivem Kalkstein in ein rosafarbenes Licht. Erst jetzt, als die Umrisse und das Aussehen des fast nackten Mannes vor ihnen deutlicher wurden, schienen die Bewohner zu begreifen, dass etwas anders war als sonst.
* * *
Die Situation wurde langsam bedrohlich. Während Onni unentwegt nach einer Erklärung suchte, ob er entführt oder einem Scherz zum Opfer gefallen war, wieso er nichts von seinem Transfer mitbekommen hatte und vor allem, ob die Leute vor ihm eine Rolle spielten oder echte Wilde waren, die gleich erste Körperteile von ihm abschneiden würden, um sie in die glimmende Glut am Eingang der Höhle zu werfen, stieg das Gemurmel der Gruppe zu immer lauter werdendem Gezische und Gegrunze an. Ihr Aussehen ließ nicht auf eine Aussteigergruppe schließen, die die alternative Lebensweise von Vormenschen nachlebten. Der Menschenschlag kam ihm überhaupt nicht bekannt vor. Sie erinnerten eher an Vitrinenbewohner naturhistorischer Museen. Vom Eingang gesellten sich weitere Personen dazu, große und kleine, vermutlich Frauen und Kinder, die eine ähnliche Kleidung aus Fellen trugen. Onni war ein friedliebender Mensch. Er verabscheute Gewalt und hatte sich noch nie in seinem Leben richtig geprügelt. Vielleicht war er auch nur etwas zu feige dazu. Jetzt stand er mit dem Rücken zur Wand vor einem Halbkreis von anscheinend wilden Exemplaren der Gattung Mensch und sah, wie die ersten eine Art Steinaxt hoben und einen kleinen Schritt auf ihn zu machten.
Was für eine Szene. Über den von der Höhlenöffnung sichtbaren Horizont erhob sich in diesem Moment der Rand der aufgehenden Sonne, die ihre ersten Strahlen in die Höhle direkt auf das Gesicht von Onni schickte. Der schloss die Augen, legte den Kopf nach hinten und brüllte mit weit geöffnetem Mund so laut er konnte ein verzweifeltes „AAAHHH!“ heraus.
Das Gemurmel verstummte schlagartig. Würde er gleich den ersten Schlag spüren, wenn er jetzt die Augen öffnete? Vorsichtig blinzelte er gegen die Sonne in die Runde. Im Gegenlicht sah er vor allem die Umrisse der Höhlenbewohner, konnte ihre Gesichtszüge nur grob erahnen. Allerdings erkannte er, dass auch die ihre Münder geöffnet hatten. War es sein langanhaltender Brüllton, der sie so erschreckte? Oder versuchten sie sich in einer Kopie seiner Mimik, wie bei einem Chor, der dem Chorleiter mit den Mundbewegungen folgte? Onni schloss den Mund wieder und sah in die Augen seiner Gegenüber, deren Blicke er nicht deuten konnte. War es Angst, war es Bewunderung oder Staunen?
Es dauerte nur eine Sekunde, dann fiel es ihm schlagartig ein. Die Goldzähne. Zwei seiner Molaren auf der linken Seite im Ober- und im Unterkiefer waren vor einigen Jahren neu aufgebaut und mit einer Goldkrone versehen worden. Die Sonnenstrahlen mussten direkt darauf gefallen sein. Jetzt würde es sich zeigen, ob Schauspieler vor ihm standen, oder es sich wirklich um Wilde handelte, die noch nie einen Goldzahn gesehen hatten.
KAPITEL5
KÖLSCH
Der behaarte Mann war über den Gartenzaun gesprungen und schlich die Straße entlang in die Richtung, aus der er ein entferntes Trommeln wahrnahm. Je näher er dem Gebäude kam, aus dem die Schläge drangen, desto mehr mischten sich Töne darunter, die er als schmerzhaft empfand. Es war eine unangenehm feuchtkalte Nacht, wie er schnell feststellen musste. Der Teppich reichte nicht weit unter die Hüften, seine Beine spürten die Kälte deutlich. Aber das war nichts Ungewöhnliches für ihn. Er war noch wenige Meter vom Eingang entfernt, da flog die Tür auf und mehrere merkwürdig bekleidete Paare stolperten auf die Straße.
„Na, was ist das für ein geiles Kostüm“, kreischte die erste der Damen, die sich direkt vor dem Fremden aufbaute, nachdem der Teppich zum wiederholten Male über seiner Brust auseinander rutschte. „Seht mal, ein Teppich, viel Naturfasern und sonst nichts“, gackerte sie los.
Ein als Clown verkleideter Herr starrte hinter seiner roten Pappnase auf die kurzzeitig freigelegte Hüftregion seines Gegenübers. „Da kann man doch was machen“, lallte er und drehte sich zu den nachströmenden Jecken um. „Gebt dem Mann mal ein Kölsch, der scheint völlig ausgetrocknet!“
Es war eine schlechte Idee. Einer der Mit-Jecken hatte noch einen fast vollen Pappbecher in der Hand und reichte ihn dem Fremden. Ohne zu verstehen, was er in der Hand hielt, roch er an dem Becher und schüttelte sich unwillkürlich.
„Ich bin zwar aus Düsseldoof aber so schlecht is dat Kölsch doch och nich“, raunzte ihn ein Dritter an, der ebenfalls einen Becher in der Hand hielt. Er ging einen Schritt nach vorn und versuchte an das andere anzustoßen. Ruckartig zog sein Gegenüber die Hand zurück. „Dann nich!“, nörgelte der Düsseldorfer und trank das Kölsch in einem Zug leer. Anschließend rülpste er lauthals aus sich heraus. Das schien den Fremden zu beeindrucken. In gleicher Weise leerte er seinen Becher, stand einen Augenblick still wie angewurzelt und rülpste filmreif über die Köpfe der anderen hinweg.