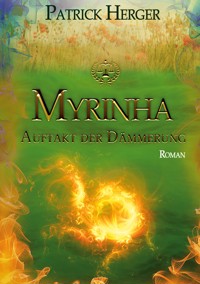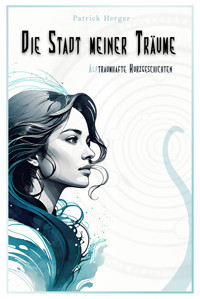
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Stadt Sankt Gallen gehen die Schatten nachts auf die Jagd. Ein Theaterstück treibt seine Zuschauer in den Wahnsinn und was sich bei den drei Weihern eingenistet hat, sollte lieber verborgen bleiben. An der Universität offenbaren die Alpträume eines Studenten einen Schrecken, der älter ist als die Menschheit. Doch sind es nur schlechte Träume und an ihrem Ende wartet ein hoffnungsvoller Morgen auf uns... oder etwa nicht? Sechs unheimliche Kurzgeschichten, nach denen Sie Sankt Gallen und seine Bewohner mit etwas anderen Augen sehen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Patrick Herger
Die Stadt meiner Träume
Sechs Kurzgeschichten nach Art von H. P. Lovecraft
Impressum
© 2024 Patrick Herger
1. Auflage 2024
Patrick Herger, Etzelbüntstrasse 5a, CH-9011 St. Gallen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 9783759267016
Illustrationen: Pixabay, TheDigitalArtist
Einbandgestaltung: Patrick Herger mit DREAMS by Wombo
Korrektorat und Lektorat: Rahel Grüter
Mehr von Patrick Herger
@p.herger_autor
@hintermeinerstirn
@hintermeinerstirn
Vorwort
Im Jahr 2016 lief ich in Sankt Gallen an einer Gasse vorbei, die mir zuvor nie aufgefallen war. Gerade breit genug, als dass ich meine Arme nach links und rechts ausbreiten konnte, hatten zahlreiche Sprayer an den Wänden ihre Spuren hinterlassen.
Aus irgendeinem Grund ging mir diese Gasse später nicht mehr aus dem Kopf. Welche Geschichte erzählte sie?
Als ich bei der Recherche nichts Zufriedenstellendes finden konnte, beschloss ich, sie zum Teil einer meiner Geschichten zu machen. Später verwob ich diese mit dem kosmischen Horror eines gewissen Howard Phillips Lovecraft, dessen Leben ich in den vergangenen Jahren studierte und dem ich mich in gewisser Weise verbunden fühle.
Nicht mit seinem Weltbild, wie ich hier in aller Deutlichkeit betonen möchte. Wir wissen heute, dass Lovecraft vieles, was ihm fremdartig erschien, verachtete. Er pflegte eine selbst für seine Zeit sehr konservative, rassistische und überaus pessimistische Weltanschauung, von welcher ich mich an dieser Stelle distanziere.
Lovecrafts fremdenfeindliche Denkweise begegnet uns in vielen seiner Geschichten wieder. Wenn ich The Shadow over Innsmouth für eine seiner gelungensten Werke halte, dann allerdings aus dem Grund, weil sie mich mit ihrer unheimlichen, maritimen Atmosphäre und ihren skurrilen Figuren vortrefflich unterhalten hat. Sie inspirierte mich auch zu meiner Kurzgeschichte Der Schrecken aus dem Weiher, die Sie in diesem Band finden werden.
Denke ich an H. P. Lovecraft, empfinde ich Mitgefühl. Er scheint ein Aussenseiter gewesen zu sein, ein kreativer Geist und eine alte Seele. Sein Werk prägte unsere Welt erst nach seinem Tod und erfreut uns heute in mannigfaltiger Form in Büchern, Comics, Rollenspiel-Abenteuern, Videospielen oder dergleichen mehr.
Als Autor und Freund sowohl des Fantastischen wie auch des Unheimlichen verneige ich mich in Demut und hoffe, dass Sie in den folgenden Geschichten ein wenig vom Geist eines H. P. Lovecrafts wiederfinden mögen.
Patrick Herger, Juli 2024
Im Haus der Nadeln
Ich weiss, wie verrückt das alles klingt, aber… ich habe das Gefühl, Sie sind die Einzige, die mir glaubt.«
»Machen Sie sich selbst nicht so fertig. Was denn glauben? Es sind nur Alpträume«, erwidert meine Professorin leichtfertig.
Nur Alpträume? Gedankenverloren starre ich durch die Glaswand. Die unteren Etagen auf der anderen Seite verschwimmen vor meinen Augen. Normalerweise beruhigt mich die Bibliothek mit ihrer geometrischen Bauweise, ihrem Vorrat an Fachliteratur und den eckigen Sitzgelegenheiten.
Heute schafft sie es nicht. Wage kann ich mein Spiegelbild auf der Scheibe erkennen und stutze für einen Moment. Der Mann, der mir aus übernächtigten Augen entgegenstarrt, ist keine vierundzwanzig Jahre alt. Wie ein Politikstudent gegen Ende des ersten Semesters sehe ich nicht aus. Die Augenringe graben sich tief in mein Gesicht. Die zwei Mal tägliche Dosis Koffein in Form von Energydrinks wirkt bei mir längst nicht mehr. »Sie sagten, Sie könnten mir vielleicht helfen?« Ich wende mich von dem lebenden Leichnam in der Glaswand ab und mustere Frau Seeweicher.
Der Ausdruck in meinen Augen muss etwas Flehendes an sich haben, denn sie schaut mitleidig zurück. »Wegen Ihrer Insomnia sollten Sie Ihren Hausarzt konsultieren, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie meinten, Sie wollten von mir etwas über Ägypten erfahren? Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen?«
»Bei unserer Einführung vor ein paar Wochen haben Sie uns etwas über Ihren Werdegang erzählt, wissen Sie noch? Sie sagten, Sie hätten damals in den achtziger Jahren mit dem Studium der Ägyptologie angefangen, bevor Sie Literaturprofessorin wurden.«
»Das stimmt. Für Ältere Geschichte und Archäologie konnte ich mich damals schon begeistern.« Frau Seeweichers Stimme nimmt einen schwärmerischen Ton an. »In meiner Jugend habe ich das Land einige Male bereist. Es ist faszinierend, die Pyramiden, die Wüste und-«
»Haben Sie auf Ihren Reisen je eine weiße Wüste gesehen, Frau Seeweicher? So weiss, als wäre der Sand aus…« Das Bild von gemahlenen Knochen taucht vor meinem inneren Auge auf.
Pikiert rückt Frau Seeweicher ihre Brille zurecht. »Es existiert ein Ort, den die Einheimischen el sahara el beida nennen, die weiße Wüste. Sie ist eigentlich ein Teil der lybischen Wüste und liegt etwas westlich von Kairo. Wollen Sie die Studienrichtung wechseln, Herr Bianchi, oder planen Sie eine Urlaubsreise oder was ist los?«
Ich bekomme Schweißausbrüche, wenn ich an diesen Ort denke. Die Hitze aus meinem Traum ist so real, dass ich das Gefühl habe, als wäre ich wirklich dort gewesen. Ich spüre den Pulversand unter meinen Füßen, der mich unter jedem Schritt bis zu den Knöcheln einsinken lässt. Die Sonne brennt vom Himmel herunter und trocknet meine Kehle aus. Ich irre gefühlt stunden-, tagelang durch ein Meer aus weißem Wüstensand. Felsen und Ruinen von bleicher Farbe kreuzen meinen Weg. Sie scheinen mich zu beobachten und über mich zu lachen. Im Fieberwahn nehmen sie die Gestalten von Monstern und Bestien an, die auf mich lauern: Wasserspeier, wie ich sie an der Fassade von Notre-Dame hängend und in die Tiefe glotzend gesehen habe; Schrecken aus den Tiefen des Weltalls, wie sie sich nur ein HR Giger ausdenken konnte. Ich verfolge sie mit den Augen und sie starren zurück, während ich meinen Weg fortsetze. Im nächsten Moment zieht ein Sturm auf.
Ich blinzele ein paar Mal, um die Erinnerung aus meinem Kopf zu vertreiben. Doch gelingen will es mir nicht. »Waren Sie schon einmal da?«, frage ich die Professorin, um mich von dem Gefühl der Hitze abzulenken. Woher kommt dieser Geschmack auf meiner Zunge, der mich das Gesicht verziehen lässt? Ist das Erde?
»Bei Farafra? Ja. Das ist eine Oase nahe dem Nationalpark, in dem sich die weiße Wüste befindet. Es gibt dort auch ein Museum mit reich verzierter Fassade: In den Stein gehauene Bilder von Beduinen mit Maultieren, Kamelen und so weiter. Ein Künstler – ich glaube, sein Name war Badr – stellt dort seine Werke aus. Ist Ihnen nicht wohl, Herr Bianchi? Sie sind plötzlich so blass.«
Nein, kein Sandsturm. Das ist nicht der Wind, der in meinen Ohren säuselt. Es ist das Geräusch Hunderter und Aberhunderter kleiner Flügelpaare. Als ich den Blick hebe, sehe ich den Schwarm, der zuerst einen hohen Bogen beschreibt und dann direkt auf mich zuhält. Wanderheuschrecken, dämmert es mir. Ich meine, sie von einer Dokumentation wiederzuerkennen, die ich erst vor Kurzem gesehen habe. Darin war auch von fleischfressenden Exemplaren die Rede, die ihr eigenes übelriechendes Blut verspritzen, um Feinde auf Distanz zu halten. Nur, dass ich in diesem Fall weniger Feind als mehr Beute zu sein scheine. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken.
In diesem Augenblick wirft der Schwarm wie die Plage aus dem Alten Testament seinen Schatten über mich.
Ich kehre der Wolke aus gelben, surrenden Leibern den Rücken zu und renne, so schnell es der Sand mir erlaubt. Ein Flügelpaar streift meine Schläfe und ich spüre etwas Vielbeiniges über meinen Nacken huschen. Im Lauf schlage ich um mich. Schweiß rinnt mir aus allen Poren und mein Pulsschlag klingt mir wie ein Trommel-Staccato in den Ohren. Links und rechts neben mir fallen Insekten in den Sand, um meine Verfolgung über den Landweg aufzunehmen. Nur einen Moment lang drehe ich um – und bereue es sofort.
Einige der Wanderheuschrecken sind mir so nahegekommen, dass ich die langen, gebogenen Hinterbeine erkennen kann. Das vielstimmige Surren ihrer Flügel klingt zornig. Hungrig.
Ich verliere fast das Gleichgewicht, als der längliche Hinterleib der Tiere mit einem widerlichen Knacken aufzubrechen beginnt. Aus der wundartigen Öffnung dringt etwas nach außen, das wie die gierigen Tentakel eines Qualle nach mir tastet. Ich unterdrücke einen Aufschrei und versuche, schneller zu laufen.
Etwas Glitschiges streift meinen Hals und hinterlässt ein Brennen, bevor ich es panisch fortwische.
Nicht weit in der Ferne schält sich ein Bauwerk aus dem Wüstensand. Seine Gestalt erinnert mich an einen Turm. Es mag an der Lichtspiegelung liegen, doch er kommt mir verdreht und grotesk vor. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet, doch in diesem Augenblick scheint es die einzig sichere Zuflucht vor den hungrigen Heuschrecken-Wesen zu sein. Ich halte darauf zu, als das Surren mit einem Mal deutlich anschwillt und ich drohe, in einer Wolke aus Insekten unterzugehen.
Im nächsten Moment bin ich wieder in der Bibliothek. Ich schnappe entsetzt nach Luft und fühle mich wie ein Taucher, der nach zu vielen Minuten gerade noch rechtzeitig die Wasseroberfläche durchbricht. »Farafra… Die Wüsten-Oase…«, keuche ich, als die letzten Fetzen meines Gesprächs mit Frau Seeweicher in mir hochdämmern. Ich schlucke trocken. Dario, die Wände der Fachhochschule sind dick, versuche ich mir einzutrichtern. Wir sind in der Schweiz, Tausende Kilometer von Ägypten entfernt. Hier gibt es keine Heuschreckenschwärme. »Gibt es dort in der Nähe zufällig einen Turm? Einen Leuchtturm in der Wüste, der die Wanderer leiten soll, die sich in der Wüste verirrt haben?«
Frau Seeweicher überlegt einen Augenblick. Dabei lässt sie ihre Augen an mir vorbei durch das Studierzimmer wandern. Ich bete stumm, dass sie das Schweigen bricht, damit das Surren in meinem Kopf endlich verstummt. »So etwas wie Pharos von Alexandria meinen Sie? An einen Turm erinnere ich mich nicht. Meine letzte Ägypten-Reise ist schon einige Jahre her und meine Studienzeit noch länger. Allerdings…«, sie hält kurz inne und kaut auf ihrer Unterlippe herum. »Es gibt da eine alte Geschichte, die mir ein Mann im Rahmen meines Studiums erzählt hat.« Sie scheint mit sich selbst zu ringen, als würde sie die Erinnerung daran lieber verdrängen. »Für mich stand die archäologische Forschung im Vordergrund und ich konzentrierte mich dabei auf die Zeit von Amenophis III. In meinem vierten Studienjahr wurde eine dreitausend Jahre alte Stadt in der Nähe von Luxor entdeckt. Haben Sie davon gehört?« Als ich nichts darauf erwidere, fährt sie fort: »Die Geschichte, die ich meine, ist noch etwas älter, mehr als eintausend Jahre vor Amenophis‘ Zeit. Ich unterhielt mich mit den Einheimischen und traf dabei auf den Nachfahren einer langen Reihe von Sem-Priestern. Die Sem galten als die Hohepriester von Osiris, dem Herrn des Jenseits aus der ägyptischen Mythologie.«
Eine leichte Übelkeit befällt mich bei dem Gedanken, was diese Geschichte und ihr Ausgang für mich bedeuten könnten. Der ägyptische Herr des Jenseits. Ich denke an die Darstellungen alter Götter, an Menschen mit Tierschädeln, den Reißzähnen eines Reptils, den scharfen Schnabel eines Raubvogels und die Hörner einer Bestie.
»Dieser Mann… Er war damals schon sechsundachtzig und ist mittlerweile verstorben. Als ich ihn traf war er fast blind, aber ich glaube, dass seine Augen Schrecken gesehen haben, die sich ein Sehender kaum vorstellen kann.« Frau Seeweicher senkt verschwörerisch die Stimme. »Sein Name war Tanamun ibn Amin. Er berichtete mir von einer Legende, die in seiner Familie weitergereicht wird. Vor über dreitausend Jahren, in der 3. Dynastie des Alten Reiches, regierte Pharao Djeser. In seinem Dienst stand eine Frau namens Iibra. Sie sei ein mageres Mädchen ohne besondere Reize gewesen. Doch der Pharao musste etwas in ihr gesehen haben. Vielleicht hatte er auch Mitleid mit ihr, weil sie eine Waise war und niemand genau wusste, woher sie stammte. Wie sich schnell herausstellte, besaß sie außergewöhnliches Geschick und eine gewisse Fingerfertigkeit, weshalb sie der Baumeister und Leibarzt des Pharaos, Imhotep, persönlich zu seiner Assistentin ausbildete. Ihm haben wir die berühmten Stufen-Pyramiden zu verdanken.« Offenbar hofft die Professorin immer noch, mich für ein Studium der Ägyptologie oder Archäologie erwärmen zu können. Als ich auch hierauf nichts erwidere, fährt sie fort: »Gerüchten zufolge soll Iibra jedoch eine böse Zauberin gewesen sein. Sie ließ sich mit einer Gruppe Nomaden ein, vermutlich Vorläufer der Yoruba, einer westafrikanischen Religions-gemeinschaft, die Afrika von Ägypten aus zu durchqueren versuchte. Unter ihnen befand sich ein Voodoo-Priester, der sich auf schwarze Magie spezialisiert hatte. Ein so genannter Bocor.« Sie schluckt, als riefe die Bezeichnung etwas in ihr hervor, an das sie lieber nicht denken will. »Fasziniert von seinen Künsten ging Iibra bei dem Voodoo-Priester in die Lehre und kam dabei mit einem Kult in Berührung, der einen anderen König als Djeser verehrte. Darüber wollte mir Tanamun nicht mehr erzählen. Allein davon zu sprechen, schien ihm wahnsinnige Angst einzujagen. Alles, was ich später dazu finden konnte, war ein Begriff, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Es handelt sich bei diesem König wohl um-«
»Den schwarzen Pharao… Nephren-Ka…«, murmele ich und der Name grollt in meinen Gedanken wie ein Donnerschlag. Die Übelkeit in mir wird stärker und ein unangenehmer Schauer schüttelt mich. Es fühlt sich an, als würde ich fiebern. Ich wende meinen Blick von der Professorin ab und schlurfe zurück zur Glaswand.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Herr Bianchi? Haben Sie etwas gesagt?«
Ich blicke hoch und erwarte, die Spiegelung von Frau Seeweicher auf dem Glas zu sehen. Doch ihre Züge, die Brille und der Lockenkopf sind seltsam verzerrt. Ich erkenne einen schwarzen Flecken Tinte in Form eines Hexagons auf ihrer Kleidung. Unter anderen Umständen wäre er mir nicht aufgefallen. Eine unnatürliche Schwärze scheint von ihm auszugehen. Ein Flimmern wie von einer Lichtspiegelung liegt darüber.
Als hätte ich Kraft meiner Gedanken einen molekularen Mechanismus in Gang gesetzt, beginnt der Fleck rasch, sich auszubreiten. Wie ein sich stetig verformender Rorschach-Test fließt er über die Bluse von Frau Seeweicher, die davon nichts zu bemerken scheint, wächst und wächst immer weiter.
Ein Schrei gellt in meinem Inneren wieder – nicht mein eigener, sondern schrill und hoch und grauenerregend unmenschlich – als eine Flüssigkeit aus dem Flecken heraus zu triefen beginnt wie Blut. Im nächsten Moment schiebt sich eine Hand aus der Schwärze empor. Auch sie trieft vor dieser ölartigen Nässe und ist von einer Dunkelheit, die weder die Nacht noch sonst etwas auf dieser Welt hervorbringen könnte. Sie erwächst zu einem Arm, der sich an der Professorin festkrallt und etwas aus dem schwarzen Loch zutage fördert. Von Schmerzensschreien wie von einem infernalischen Chor begleitet, entsteigt ihm eine Kreatur, eine humanoide Gestalt, deren Gesicht jegliche menschliche Physiognomie vermissen lässt. Ein scheußliches Knacken ertönt, als sich das Rückgrat der Professorin biegt, um dem Unwesen Platz zu schaffen. Mit einem letzten Ruck befreit es sich aus dem Schattenportal und lässt Frau Seeweicher dabei wie eine abgeworfene Schlangenhaut zu Boden gleiten.
Nun steht das Etwas im hinteren Teil des Raumes und blickt zu mir herüber. Seine Augen starren mit einer bedrückenden Intensität aus der Schwärze seines Gesichts hervor. Ich erkenne die Konturen eines Mannes, haarlos und mit viel zu langen Gliedmaßen. Nephren-Ka, hallt es in mir.
»Nephren-Ka«, wiederholt der schwarze Mann, oder war es nur das Echo meiner Gedanken? Seine Stimme ist ein heiseres Gurgeln, als versuche jemand mit durchschnittener Kehle Worte in einer Sprache zu bilden, die er nie zuvor gebrauchte. Die Glühlampe an der Decke beginnt zu flackern und das Rauschen in meinem Kopf nimmt unerträgliche Ausmaße an.
»Was haben Sie gesagt, Herr Bianchi?«
Ich keuche auf. Frau Seeweicher steht wieder an Ort und Stelle. Von einem schwarzen Fleck ist weit und breit nichts zu sehen. Mir war kalt – eine Kälte, die aus meinem Inneren zu kommen scheint und mich an Ort und Stelle frösteln lässt.
Ich… verliere den Verstand, stelle ich erschrocken fest.
»Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Bianchi. Was haben Sie gesagt?«
»Wie… Wie geht die Geschichte weiter?«, wende ich mich wieder an die Professorin und klammere mich dabei an das letzte bisschen Vernunft, das mir noch geblieben ist.
Sie sieht ernsthaft besorgt aus und zögert zunächst, bis sie mit der Erzählung fortfährt. »Nun… Als Pharao Djeser dahinterkam, verbannte er die Hexe in die weiße Wüste. Ausgedörrt, entkräftet und vor ihrem König in Ungnade gefallen, starb Iibra scheinbar an diesem Ort. Doch ihr Ka, also ein Teil ihrer Seele, fand keine Ruhe. Sie bediente sich weiterhin schwarzmagischer Praktiken und schaffte es, in den Träumen der Menschen lebendig zu bleiben. Glauben Sie… Herr Bianchi, glauben Sie, Ihre Alpträume stammen von einer Hexe aus dem Alten Ägypten?« Sie runzelt die Stirn.
In mir erwächst der jähe Drang, sie anzuschreien. Wie kann sie diese Frage derart leichtfertig stellen? Ist die Antwort nicht offensichtlich? Nein, eher irrsinnig, widerspricht die Stimme in meinem Kopf. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Nacht für Nacht ist es derselbe Traum, der mich am Morgen schweißgebadet hochfahren lässt.
***
Sobald ich in die Nähe des halb von Sand verschütteten Turmes gelange, scheinen die Bestien von mir abzulassen. Ihr Sirren klingt mir noch immer in den Ohren, während ich mich hastig abklopfe. Das Phantomgefühl von krabbelnden Insektenbeinen auf der Haut verschwindet nur langsam.
Nachdem ich ein wenig zu Atem gekommen bin, schaue ich mir das Bauwerk genauer an. Es ist geschätzt nicht mehr als einhundert Meter hoch und scheint aus einem glatt polierten Material zu bestehen, ähnlich wie Perlmutt. Nach oben hin verjüngt sich der Turm zu einer Spitze, die mehrfach in sich gedreht ist, sodass man das Gefühl hat, vor einem gigantischen, maritimen Schneckenhaus zu stehen. Ein Fremdkörper in der Wüste, dessen Oberfläche das Licht der Sonne reflektiert und damit seltsame, hypnotische Muster auf den Sand malt.
Der säuerliche Geruch von Fäulnis und Schimmel schlägt mir aus dem Inneren entgegen. Mein Verstand schreit mich an, umzukehren, während mich eine dunkle Neugier dazu bewegt, wenigstens einen vorsichtigen Blick zu riskieren. Ich nehme meinen Mut zusammen und wage mich durch den pfortenlosen Eingang hinein.
Ich gelange in eine Art Vorraum. Von der Decke hängen dichte Spinnweben. Die Wände sind mit sonderbaren Mustern überzogen, die sie organisch wirken lassen. Als würde man an einem Sommertag die Augen schließen und die Innenseite seiner Augenlider betrachten: Übereinanderliegende, feine Hautschichten, die mit Adern, Härchen und anderen Unregelmäßigkeiten durchzogen sind. Das Licht der Sonne scheint halb durch sie hindurch und ich denke an tanzende Nachbilder, hypnotisch und unwirklich.
Zentimeterdick haftet der Staub an allem. Auch auf den Treppenstufen ins Obergeschoss, die ich nach meinem ersten zögerlichen Rundgang entdecke. Von oben ertönt ein regelmäßiges Knarzen, das wie Fingernägel auf einer Schiefertafel allmählich damit anfängt, an meinen Nerven zu zerren.
»Hallo?«, krächze ich. Meine Stimme klingt heiser. Die tote Stille des Turms scheint sie ungehört zu verschlucken.
Statt einer Antwort erklingt das unheimliche Summen einer Frau. Anhand der Stimme ist es mir nicht möglich, ihr Alter zu schätzen. Sie könnte nicht viel älter sein als meine Mutter oder schon seit Äonen an diesem gottverlassenen Ort am Rand der Vernunft festsitzen.
Ich rufe noch einmal, glaube aber nicht, dass meine Worte bis ins nächste Stockwerk vordringen. Ich sehne mich nach Wasser – etwas, um meine Kehle zu befeuchten. Doch wo sollte es hier, mitten in der Wüste, Wasser geben?
Ein plötzliches Krabbeln auf der Haut lässt mein Herz einen Moment lang aussetzen. Panik schiesst durch meinen Körper, als ich die Hand instinktiv zurückreisse. Sofort glaube ich, die Wanderheuschrecken könnten bis ins Innere des verwaisten Bauwerks vorgedrungen sein. Doch es ist nur ein dunkler Käfer, dessen dickliche Erscheinung mir sonderbar bekannt vorkommt. Ein Skarabäus?
Das Summen verebbt in einem heiseren Kichern. Im nächsten Moment dringen Laute über die Treppe zu mir herab – Worte, die ich noch nie zuvor gehört habe. Ein arabischer Dialekt, vermute ich zunächst. Dann fällt mir auf, dass obwohl ich die Sätze nicht verstehe, sie mir einen Schauer über den Rücken jagen.
»I-… Lao-…Dol-…Hi-…Bo-… Dro-… Me!«
Etwas schwappt aus den Tiefen meines Bewusstseins zu mir hoch. Schwarze Hände, groß und schrundig und mit viel zu langen Fingern, wühlen sich aus dem Sand am Grunde des Meeres und steigen aus der Dunkelheit empor. Sie ziehen tintenartige Schlieren hinter sich her. Aus den Fluten heraus greifen sie nach mir, versuchen meine Gedanken zu packen und meinen Verstand mit sich in die Tiefe zu reißen. Scharf wie Krallen, wie zu Menschenhänden verformte Krebsscheren schnappen sie nach mir. Ich versuche die Worte, die wie ein schauerliches Gebet an eine verbotene Gottheit in meinem Kopf widerhallen, abzuschütteln. Je mehr ich mich dagegen sträube, desto lauter scheinen sie zu werden:
I-Lao-Dol-Hi-Bo-Dro-Me!
I-Lao-Dol-Hi-Bo-Drome!
Ilaodolhibodrome!
Ilaodolhibodrome!
Um nicht stehenzubleiben – um diesem Wahnsinn nicht weiter zu erlauben, sich in mir auszubreiten – renne ich die Treppenstufen hinauf. Eine weitere Kammer mit Wänden wie aus einer organischen Membran erwartet mich.
Das Gebet ist jetzt nicht mehr nur in meinem Bewusstsein. Mit den Augen verfolge ich seinen Klang durch den Raum bis zu seinem Ursprung. Mein Blick streift einige Regale, in denen Gläser, zerlesene, in Leder gebundene Bücher und medizinische Instrumente von vorsintflutlicher Machart zu finden sind. In der Mitte der Kammer befindet sich eine Bahre, die aus einem Holzgestell und etwas Ledernem gefertigt ist, wobei es sich hier um die Haut eines Tieres handelt. Zumindest hoffe ich, dass es ein Tier war…
Alles wirkt unsagbar alt und wie aus einer anderen Zeit. Staub bedeckt die Regale, die Bahre und den Boden, der Geruch von Schimmel und Fäulnis, von Salz und Erde ist auch hier allgegenwärtig.
Im hinteren Teil des Raumes kauert eine Gestalt. Sie erscheint mir seltsam unförmig und das widerliche Knarzen scheint von ihrem Körper auszugehen, so wie er sich zuckend vor und zurück wiegt. »Ilaodolhibodrome«, murmelt die Frau.
Als sie meine Anwesenheit bemerkt, erhebt sie sich und jetzt erkenne ich, dass das Geräusch von einem Lehnstuhl kommt, den ich im Dämmerlicht nicht erkannt hatte. Sie dreht sich zu mir um und mir stockt der Atem.
Ihr Körper, nur in einige dürftige Stoffstreifen gehüllt, ist ausgezerrt – jeder Knochen zeichnet sich durch die fahle Haut nach außen ab. Ihre Augen sind rund, gelbstichig und zeugen von einem Wahnsinn, der zahlreiche Jahrhunderte Zeit hatte, um auszureifen. Mir scheint, als würde eine lebendige Mumie vor mir stehen. Während sie mich mit einem undurchsichtigen Blick taxiert, wandern ihre zuckenden Finger hinauf zu ihrem Kopf.
Die Frau ist kahlgeschoren, das registriere ich jetzt, und dort, wo sich normalerweise ihr Haar befunden hätte, sind…
»Herr Bianchi, hören Sie mich?«
Meine Augenlider flattern, als das Dämmerlicht des unheilvollen Turmgebildes in das elektrische Licht einer Glühlampe überspringt. Ich kauere auf dem Teppichboden, an meinem Rücken spüre ich die glatte, unnachgiebige Kühle der Glaswand.
»Fühlen Sie sich nicht wohl? Soll ich Ihren Hausarzt anrufen, Herr Bianchi?« Das Gesicht von Frau Seeweicher erscheint über mir.
»I-… I-… Lao-…«
»Wie bitte?«
»Nein…«, murmele ich und stelle verwundert fest, dass meine Kehle sich nicht mehr rau und trocken anfühlt. »Nein, ich brauche keinen Arzt...«
»Sie haben mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt! Sie haben plötzlich die Augen verdreht und sind weggekippt.«
Wieder spüre ich ein Kribbeln, als befände sich ein vielbeiniges Etwas unter meiner Kleidung. Ich zucke heftig zusammen und Frau Seeweicher erschrickt so sehr, dass sie es mir nachtut.
Dann bemerke ich, dass es nur der Vibrationsalarm meines Smartphones ist. Ich schaue auf das Display, meine Augen streifen die Datumsanzeige – Freitag, der zweiundzwanzigste Oktober, zwei Tage vor meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag. Ich verziehe die Mundwinkel zu einem müden Lächeln. Dann erblicke ich den Namen meines guten Freundes und Studienkollegen Jonas Kürsteiner und wische mit dem Daumen nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
»Hey Dario, hier ist Jonas!«
»Hey Jonas…«
»Ist alles in Ordnung? Du hörst dich ziemlich kaputt an. Hast du immer noch diese Schlafstörungen?«
»Ich bin gerade im Gespräch«, erwidere ich mit Blick auf meine Professorin. Sie macht eine beruhigende Geste. Trotzdem habe ich jetzt keine Lust, länger als nötig mit Jonas zu sprechen.
»Ich will auch nicht lange stören. Erinnerst du dich an den Zeitungsartikel, den du mir neulich gezeigt hast? Den mit den Muscheln?«
Ich erinnere mich. Während meiner Recherchen zu dem grotesken Turmgebilde aus meinen Träumen stiess ich auf ein interessantes Thema, das zuerst vor einem Jahr im März 2020 und dann noch einmal ein Jahr später, im April 2021 die Runde auf verschiedenen Online-Plattformen machte. Offenbar hatten einige Muschelarten, die sonst hauptsächlich im Schwarzen Meer heimisch waren, ihren Weg in den Bodensee gefunden, wo sie sich dann rasch vermehrten. Man vermutete, dass Wasservögel, Boote und Taucher sie vor etwa vier Jahren versehentlich einschleppten. Nun drohten die Muscheln zu einem ernstzunehmenden Umweltproblem zu werden.
Auf den Fotos zu den Artikeln erkannte ich eine Muschel, die dem Turm aus meinen Träumen zum Verwechseln ähnlich sah. Es handelte sich um das Gehäuse einer Meeresschnecke, deren wissenschaftliche Bezeichnung Tibia Ilaodolhibodrome lautete. Als ich davon erfuhr, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken.
Ich sprach mit Jonas über den Vorfall und er erzählte mir, dass sein Onkel ein begeisterter Mineralien- und Fossilienforscher sei. Offenbar hat er bereits mehrere Bücher auf diesem Gebiet verfasst und Ausstellungen im Naturmuseum betreut, die letzte im Oktober 2018 über Fossilien im Alpstein. Ich bat Jonas, mehr über die Sache herauszufinden und er versprach mir, mit seinem Onkel darüber zu sprechen.
»Diese Seeschneckenmuschel, von der du erzählt hast. Mein Onkel meinte, die Forscher, mit denen er zusammenarbeitet, stünden diesbezüglich noch vor einem Rätsel. Deshalb kann ich dir nicht viel darüber erzählen. Im Alpstein wurden versteinerte Schnecken aus der Kreidezeit gefunden, die Fossilien sind also über einhundert Millionen Jahre alt. In der einschlägigen Literatur war darüber nichts zu finden, offenbar weiß also niemand Genaueres. Dann bin ich in diesem Buch namens Unaussprechliche Kulte auf etwas gestoßen. Diese Schneckenart – wenn es denn eine Schneckenart ist – wird schon lange vor den Ägyptern als… als eine Art Sprachrohr zu irgendwelchen Gottheiten angesehen. Die Okkultisten glaubten, dass sie mit ihrer Hilfe ins Reich Hulm gelangen könnten, eine Art Paradies oder Traumwelt, die wie eine Oase beschrieben wird. Dort würden sie große Macht und Unsterblichkeit erlangen. Sagt dir das irgendetwas?«
Ich halte einen Moment inne, um das Gesagte in meinem Kopf zu sortieren. »Jonas, halt mich bitte nicht für verrückt, aber… Hältst du es für möglich, dass jemand aus dem Abbild dieser Kreaturen eine Art Tempel bauen würde? Sagen wir, als Heimstätte eines Kultes, der darin zu irgendwelchen Göttern betet, wie du sagst?«
Am anderen Ende bleibt es eine Zeit lang still. Dann endlich sagt Jonas: »Was meinst du, was ich glaube? Nein, um ehrlich zu sein… Ich weiß es selbst nicht. Ich meine, unsere Planeten sind nach römisch-griechischen Gottheiten benannt. Aber das hier… scheint mir alles noch deutlich älter zu sein und… Ach, es ist einfach zu irrsinnig! Ich meine… das ergibt doch keinen Sinn! Dario? Dario, bist du noch dran?«
Er hat recht, denke ich in dem Augenblick, als ich das Smartphone langsam sinken lasse, ohne mich von Jonas zu verabschieden. Das ergibt alles wirklich keinen Sinn. Der Turm aus meinem Traum ist nicht etwa ein Gebilde, das sich mein Unterbewusstsein herbeifantasiert, um ein Erlebnis aus längst vergangenen Tagen zu verarbeiten. Er ist ein Tempel, ein uralter Sakralbau, und der Kult, der ihn errichtet hat, betet zu Göttern, die um ein Vielfaches älter sind als die Menschheit. In diesem Moment bin ich absolut davon überzeigt.
Ich schließe die Augen, um der bedrückenden Wirklichkeit zu entkommen und blinzle die Tränen fort. Das Licht schwindet und ich befinde mich wieder im dämmrigen Obergeschoss jenes Tempels, inmitten der weißen Wüste.
Die Hexe steht vor mir.
Meine Augen haben sich schnell an die Dunkelheit gewöhnt oder vielleicht ist es im Raum auch etwas heller als zuvor. Jetzt erkenne ich die unzähligen Stecknadeln, die den Kopf des Scheusals zieren wie die alptraumhafte Version der griechischen Medusa. Sie lächelt über meine Bestürzung und entblößt dabei zwei Reihen verrotteter Zähne. Ich möchte sie ihr ausschlagen, ihr dieses scheußliche Grinsen vom Gesicht wischen. Doch ich bin unfähig, mich zu rühren.
»Ilaodolhibodrome«, zischt die Hexe und ihre Augen weiten sich, während in meinem Kopf die Trommeln ihren fürchterlichen Rhythmus wieder aufnehmen.