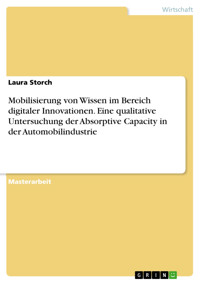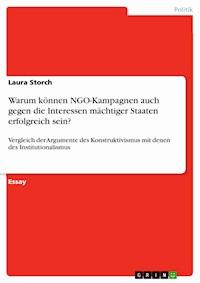18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 1,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Wiederherstellung einer demokratischen Identitätsgemeinschaft durch kollektive Erinnerung? Im Zuge der Demokratisierung in Südafrika, einem Land, welches jüngst von massiven Formen politischer Gewalt heimgesucht wurde, bestand das Bedürfnis nach der Bewältigung einer grausamen Vergangenheit. Kompromiss und Konsens sollten die jahrhundertelange Spaltung der Gesellschaft überwinden. Dies sollte mit Hilfe einer Wahrheitskommission geschehen, welche dazu dient, schwere Menschenrechtsverletzungen, die in einem bestimmten Zeitraum verübt wurden, zu erfassen, um dann Empfehlungen für zukünftige Reformen auszusprechen, um erneute Gewaltausbrüche zu verhindern. Mit Hilfe der südafrikanischen Wahrheitskommission hoffte man, einen politischen Wandel herbeizuführen und sich öffentlich mit den historischen Spannungen auseinanderzusetzen. Die Problematik beginnt sich damit zu entfalten, wer überhaupt angeklagt werden soll und wer nicht bzw. wer die Entscheidungen darüber trifft und wie sich bestimmte ,,Täter" einem Verfahren entziehen können. Würde eine Festlegung, wer anzuklagen ist und wer nicht, den Gedanken der im Rechtsstaatsprinzip verankerten Gleichheit bei der Strafverfolgung nicht konteragieren? Wie geht man mit ehemaligen Staatsführen um? Wie kann man über das Unrecht der Vergangenheit richten und trotzdem zum Dialog einladen? Kann das Leid durch Geld ersetzt bzw. dem Leid ein „monetärer Wert“ gegeben werden? Inwiefern könnte man Opfer, die gefoltert, enteignet, oder deren Angehörige ermordet wurden angemessene Entschädigungen zukommen lassen? Wo liegen institutionelle Stärken und Schwächen der Kommission, welche juristischen/ethischen Probleme sind entstanden? War die TRC lediglich ein Mittel zum Zweck einer politischen Kompromissbildung oder diente sie durchaus der Herstellung von nationaler Einheit? Ist es generell möglich, eine Identitätsgemeinschaft wiederherzustellen und die historische Wahrheit in kollektive Erinnerung münden zu lassen? Wie kann man das Ziel „der Gerechtigkeit, der Verantwortung, der Stabilität, dem Frieden und der Versöhnung gleichermaßen gerecht zu werden“ umsetzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Historischer Hintergrund für die Entstehung der TRC
3.Erläuterung zentraler Begriffe
3.1 Vergebung, Versöhnung und Wahrheit
3.2 Traumata
3.3 Opfer/Täterbegriff
4. Allgemeine Klärung des Terminus Wahrheits- und Versöhnungskommission
5. Ziele/ Konzepte der TRC und Forderungen an die TRC
5.1 Friedenskonsolidierung und transnational justice
5.2 Ubuntu als Hintergrund für die Zielsetzung der TRC
5.3 Konfliktlinien des ANC in Anbetracht des „gerechten Krieges“
6. Individueller Charakter und Besonderheiten der TRC
7.Autonomie der Kommission
8.Rolle der Medien
9. Struktur der Kommission
9.1 Personal der TRC
9.2. .Komitee zu Menschenrechtsverletzungen( „Human Rights Violatins Committee):
9.3 Der Ausschuss für Reparation und Rehabilitation („ Reparation and Rehabiliation Committe“):
9.4 Der Amnestierungsausschuss
9.5 Die Forschungsabteilung ( Research Unit ):
9.6 Die Ermittlungsabteilung (Investigation Unit):
10. Ergebnisse der Kommission
10.1 Abschlussbericht der Kommission
11. Evaluierung der südafrikanischen Wahrheitskommission
11.1 Positive Aspekte
11.2 Kritik an der TRC
11.2.1 Keine Förderung der individuellen Versöhnung und insuffiziente Wahrheiten für die Individuen auf Opferseite
11.2.2 Fehlendes Gerechtigkeitsempfinden auf Opferseite
11.2.3 „Retraumatisierung“ der Opfer
11.2.4. Nichtbeachtung struktureller Defizite der Apartheid
11.2.5 Keine kollektive Identitätsstiftung
11.2.6 Ineffizienz der Kommission
11.2.7 Schwache Autonomie des Reparationsausschusses
11.2.8 Erbärmliches Schuldbewusstsein von Seiten der Weißen Bevölkerung und fehlende Einsichten aus Täterperspektive
11.2.9 Ungerechtigkeit durch den Amnestieprozess
11.2.10 Mangelnde Anteilnahme des ANC
12. Fazit und Ausblick
13. Literaturverzeichnis
1.Einleitung
Gesellschaften, die sich in politischen Übergangssituationen befinden, sind oftmals mit der Problematik der Entmachtung alter Institutionen und Ordnungen konfrontiert, welche auf eine Art und Weise durchgesetzt werden müssen, um ehemalige Eliten nicht dazu zu verleiten, ihre restliche Macht gegen den sich neu entwickelnden Demokratisierungsprozess zu verwenden. Es kann durchaus passieren, dass eine Gesellschaft, die ihrer schrecklichen Vergangenheit gegenübergestellt wird, derart schockiert von der aufgedeckten Wahrheit ist, dass die neuen Herrschaftsverhältnisse gefährdet sind.
Im Zuge der Demokratisierung in Südafrika, einem Land, welches jüngst von massiven Formen politischer Gewalt heimgesucht wurde, bestand das Bedürfnis nach der Bewältigung einer grausamen Vergangenheit. Kompromiss und Konsens sollten die jahrhundertelange Spaltung der Gesellschaft überwinden. Dies sollte mit Hilfe einer Wahrheitskommission geschehen, welche dazu dient, schwere Menschenrechtsverletzungen, die in einem bestimmten Zeitraum verübt wurden, zu erfassen, um dann Empfehlungen für zukünftige Reformen auszusprechen, um erneute Gewaltausbrüche zu verhindern. Mit Hilfe der südafrikanischen Wahrheitskommission hoffte man, einen politischen Wandel herbeizuführen und sich öffentlich mit den historischen Spannungen auseinanderzusetzen.
Statt den Prozessen nach Nürnberger Vorbild sollte den Tätern der Anreiz nach Amnestie in Aussicht gestellt werden, um sie dazu zu bewegen, die Wahrheit vor der Kommission zu bekennen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit durch das Aufzeigen von Motiven, Perspektiven und Folgen von Menschenrechtsverletzungen, wurde als Kriterium für ein friedvolles und zukunftsorientiertes Zusammenleben, in welchem Rache- und Hassgedanken in den Hintergrund rücken, angeführt. Die südafrikanische Truth and Reconciliation Commission sah es vor, die Opfer wieder zu sich selbst finden zu lassen, um die Kontrolle über ihre individuelle Erinnerung zu erlangen.
Eine wichtige Grundlage für die Entstehung der TRC war die Forderung der Interim Constitution, in welcher die Notwendigkeit nationaler Versöhnung und der Regelung von Amnestien angeführt wird.
„Diese Verfassung bemüht sich um eine historische Brücke zwischen der Vergangenheit einer zutiefst zerrissenen Gesellschaft ,die charakterisiert war durch Streit, Konflikte, ungezähltes Leiden und Ungerechtigkeit- und einer Zukunft, die basiert auf Menschenrechten, Demokratie und friedlicher Koexistez und der Entwicklung von Chancen für alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Rasse, Klasse, ihrem Glauben oder Geschlecht. Das Streben nach nationaler Einheit, das Wohlergehen aller südafrikanischen Bürgerinnen und Bürger sowie der Frieden erfordern Versöhnung zwischen den Menschen Südafrikas und einen Umbau der Gesellschaft“.[1]
Dieses Zitat beschreibt den Kerngedanken der neuen Rechtsform, welche darauf bedacht war, die Menschenrechte zu achten und durch die öffentliche Auseinandersetzung mit den historischen Spannungen, einen politischen Wandel herbeizuführen. Diese neue Rechtsform stand einer riesigen Menge unaufgeklärter Verbrechen unter dem Apartheidregime gegenüber. In Südafrika teilte sich das Land in ehemalige Leidtragende der Apartheid und im Gegenzug dazu Profiteuren bzw. Befürwortern des alten Regimes.
Nun stellt sich die berechtigte Frage, wie eine gespaltene Gesellschaft, wie jene in Südafrika wieder in Frieden zusammenleben und die moralische politische Ordnung wiederhergestellt werden kann.
Die Problematik beginnt sich damit zu entfalten, wer überhaupt angeklagt werden soll und wer nicht bzw. wer die Entscheidungen darüber trifft und wie sich bestimmte ,,Täter" einem Verfahren entziehen können. Würde eine Festlegung, wer anzuklagen ist und wer nicht, den Gedanken der im Rechtsstaatsprinzip verankerten Gleichheit bei der Strafverfolgung nicht konteragieren? Wie geht man mit ehemaligen Staatsführen um? Wie kann man über das Unrecht der Vergangenheit richten und trotzdem zum Dialog einladen? Kann das Leid durch Geld ersetzt bzw. dem Leid ein „monetärer Wert“[2] gegeben werden? Inwiefern könnte man Opfer, die gefoltert, enteignet, oder deren Angehörige ermordet wurden angemessene Entschädigungen zukommen lassen?
Wo liegen institutionelle Stärken und Schwächen der Kommission, welche juristischen/ethischen Probleme sind entstanden? War die TRC lediglich ein Mittel zum Zweck einer politischen Kompromissbildung oder diente sie durchaus der Herstellung von nationaler Einheit? Ist es generell möglich, eine Identitätsgemeinschaft wiederherzustellen und die historische Wahrheit in kollektive Erinnerung münden zu lassen? Wie kann man das Ziel „der Gerechtigkeit, der Verantwortung, der Stabilität, dem Frieden und der Versöhnung gleichermaßen gerecht zu werden“[3] umsetzen?
Das Lesen und das direkte Mitgefühl für die Geschichten in den durchaus einfühlsamen TRC- Hearings des Buches von Chubb/van Dijk ließen mich lange über die TRC und ihre Wirksamkeit nachdenken, weshalb ich mich zum Verfassen dieser Arbeit entschloss.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit dem Konzept und der Struktur der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission beschäftigen und mich der Frage widmen, inwiefern und ob die südafrikanische Wahrheitskommission generell zur Friedenskonsolidierung und Wiederherstellung einer demokratischen Identitätsgemeinschaft durch kollektive Erinnerung und Aufarbeitung beitragen konnte.
Die Fragestellung besitzt insofern Relevanz, als dass sie den konkreten Versuch einer Bewertung der anfänglichen Euphorie zur Arbeit der Kommission kritisch reflektiert und zu ermitteln versucht, inwiefern und ob die südafrikanische Wahrheitskommission tatsächlich Ursachen aufklären und soziale Gerechtigkeit im Land herbeiführen konnte. Damit die Forschungsfrage präzise beantwortet werden kann, wird eine vielfältige Bandbreite an Literatur untersucht, um die Kommission aus unterschiedlichen Perspektiven systematisch beleuchten und zu soliden Schlussfolgerungen gelangen zu können.
Ein gewisses Maß an Basiswissen über die Zeit der Apartheid wird in dieser Hausarbeit vorausgesetzt, da ich nur kurz auf die Historie des Apartheidregimes eingehen kann.
Strukturell verlangt die Arbeit zunächst ein theoretisches Konstrukt, bestehend aus der Historie, die zum Beginn der TRC beigetragen hat, der Klärung von wesentlichen Termini, wie Versöhnung, Vergebung, Wahrheit, Trauma, Opfer, Täter und einer Erläuterung der Aufgaben und Ziele einer Wahrheitskommission. Außerdem bedarf es eine Klärung der institutionellen Rahmenbedingungen, welche das Vorhaben der Kommission theoretisch eingliedern, um letztendlich eine Antwort auf die vorangestellte Forschungsfrage finde zu können.
Anhand der Ergebnisse des Abschlussberichts wird die Rolle der TRC unter Anbetracht des Aspekts der Friedenskonsolidierung und des Ubuntubegriffs im gesamtstaatlichen Kontext reflektiert. Ergänzend wird auf die Besonderheiten und Unterschiede der südafrikanischen im Gegensatz zu anderen Wahrheitskommissionen eingegangen, um die spezifischen Merkmale der TRC deutlich zu machen.
Schlussendlich werden unter Anwendung genannter Fakten die Pro- und Contra Aspekte der TRC herausgefiltert und die Ergebnisse in Form eines Fazits resümiert, um ein Fundament für die Implementierung von Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschriften bilden zu können.
2. Historischer Hintergrund für die Entstehung der TRC
Seit den Parlamentswahlen im Jahre 1948 herrschten in Südafrika Unruhen und ein Klima politischer Gewalt ohne jegliche Beachtung der Menschenrechte. In diesem Jahr gewann die „Nasionale Party“ (NP) die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Das neue Konzept der „Apartheid“, welches die schwarze Bevölkerung bewusst ausgrenzte, bildete den neuen Umgang der Weißen mit der restlichen Bevölkerung, sowie gleichzeitig das Wahlprogramm der NP. Das ganze Volk wurde gnadenlos gesetzlich nach Rassen getrennt in Schwarze, Coloureds, Asiaten und letztendlich den Weißen, welche als einzige Rasse das Wahlrecht besaßen. Ebendiese ethnischen Gruppen sollten fortan nach Rassen kategorisiert werden.
Insgesamt wurden ca. 3,5 Millionen Menschen in sogenannte „homelands“ umgesiedelt. Das Ziel dieser „homelands“ war die schrittweise Ausbürgerung der schwarzen Bevölkerung, welche keinerlei Rechte besaß, sondern vielmehr unter staatlichen Repressalien und eklatanter wirtschaftlicher Ausbeutung litt. Im Laufe der Apartheid waren „Nicht-Weiße“ einem brutalen staatlichen Terror ausgesetzt, der selbst vor groben Menschenrechtsverletzungen, wie Mord und Folter nicht zurückschreckte.