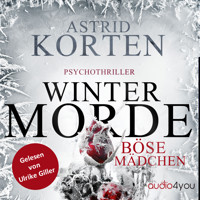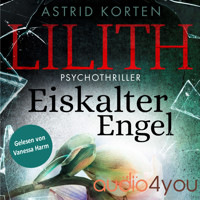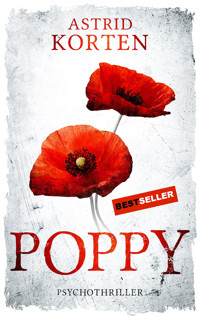4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
NEUERSCHEINUNG!!! Gläserne Schatten. Ein gebrochenes Lächeln. Ein falscher Winter. In der Magie ist alles möglich, selbst der Tod ... Victor Adams, dem unter dem Künstlernamen Horus der internationale Durchbruch als Illusionist gelungen ist, steigt nach einer Zahnwurzelbehandlung in die falsche Straßenbahn. In darauffolgenden Nächten wird Victor von Albträumen heimgesucht und sein Leben mimmt eine dramatische Wendung. Seine Assistentin Julia verschwindet auf mysteriöse Weise während einer Illusion und er wird des Mordes verdächtigt. Victor bleibt ungerührt, ihm beschäftigt nur eine einzige Frage: Wie konnte Julia verschwinden und seine Illusion überlisten? Eines Tages taucht Inspektor Percy Banks von der Kripo Canterbury bei ihm auf und bittet Victor, eine grausam zugerichtete Frauenleiche zu identifizieren … Ein fesselnder Thriller, mitreißend und verstörend mit psychologischem Tiefgang und einer Auflösung, die selbst den geübten Thriller-Leser überraschen wird. Erste Stimmen: Ein spannender Thriller voller Illusionen - Helgas Bücherparadies Meister der Illusionen - Martin Schult Ein fesselnder Thriller mit Tiefgang - Dreamlady Ganz grosse Klasse! - Wencke Richter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Prolog
Teil 1
Die Täuschung
Die schwarze Schlampe
Entlarvt
Ein Freund
Lebensweisheiten
Der Albtraum
Der Besucher
Gewinnen und Nicht-Gewinnen
Der tote Nerv
Die Halluzination
Eine echte Assistentin
Feigheit
Zwillinge
Der Schal
Update
Die List
Die Lüge
Gewissheit
Identität
Alles
Panik
Wahre Freiheit
Der Vertrag
Wer bist du?
Teufelstraum
Mit dem Strom
Der Jogger
Vergessen
Die Skizze
Trotzdem
Verhaltener Zorn
Keine Linien
TEIL 2
Gegenwind
Die Beerdigung
Das Päckchen
Falsche Tatsachen
Hall of Shame
Das Rätsel
Tanz, Mini, tanz
Die Wahrheit
Dunkelheit
Irritationen
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Impressum
ASTRID KORTEN
Lügen und andere kleine Monster
Psychothriller
Tom Heuser
ein wunderbarer Schauspieler
und
Uwe Donner
donnerTV / MEDIA TV- & Filmproduktion
Zwei wunderbare Menschen, die ich sehr schätze.
Über das Buch
Zu glauben, dass du die Kontrolle über dein Leben hast, ist eine Utopie.
Victor Adams, dem unter dem Künstlernamen Horus der internationale Durchbruch als Illusionist gelungen ist, steigt nach einer Zahnwurzelbehandlung in die falsche Straßenbahn. An der nächsten Haltestelle entdeckt er seltsame Treppenhäuser, die ihn magisch anziehen. Er steigt aus.
In darauffolgenden Nächten wird Victor von Albträumen heimgesucht. Als er wissen will, was es mit den Treppenhäusern auf sich hat, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Seine Assistentin Julia verschwindet auf mysteriöse Weise während einer Illusion. Die Polizei verdächtigt Victor, Julia getötet zu haben, da er sich von ihr trennen wollte. Victor bleibt ungerührt, ihm beschäftigt nur eine einzige Frage: Wie konnte Julia verschwinden und seine Illusion überlisten?
Eines Tages taucht Inspektor Percy Banks von der Kripo Canterbury bei ihm auf und bittet Victor, eine grausam zugerichtete Frauenleiche zu identifizieren …
Ein fesselnder Thriller, mitreißend und verstörend mit psychologischem Tiefgang und einer Auflösung, die selbst den geübten Thriller-Leser überraschen wird.
Prolog
Rochester, Süd-England
Anfang Oktober 2020
Nach meiner Zahnwurzelbehandlung stieg ich in die falsche Straßenbahn und gab damit meinem Leben eine völlig andere Richtung, obwohl ich das erst Monate später realisieren sollte.
„Fahren Sie bitte nicht selbst, Mr. Adams“, warnte mich die Zahnarzthelferin. „Sie werden womöglich noch ein wenig benommen sein von der Betäubungsspritze.“
Zum Glück gab es in der Straßenbahn einen Sitzplatz. Ich schloss sofort die Augen. Fünf Minuten später öffnete ich sie wieder, weil ich befürchtete, meine Haltestelle zu verpassen. War ich schon zu weit gefahren? Aber nein, der Park und die Bäume waren mir vertraut. Und da war auch der Spielplatz. Mit meiner linken Hand am pochenden Kiefer stieg ich aus.
Vorsicht!, warnte mich eine innere Stimme. An der Bordsteinkante innehalten! Nicht zu schnell gehen, Mini! Schau nach links, nach rechts!
Mein Finger dirigierte mich. Ich überquerte die Straße und ging auf die Häuser mit den Treppenstufen zu. Die Zweige eines am Straßenrand stehenden Baumes waren so niedrig, dass ich mich bücken musste. Meine Haut war jetzt hell und glänzte wie weißes Folienpapier, meine Nägel sahen aus wie Krallen, sie waren zu grotesker Länge gewachsen und drehten sich ein, wie die Nägel der Toten, die angeblich in der Abgeschiedenheit des Grabes wuchsen.
Aus einem offenen Fenster drang der Geruch von Essen in meine Nase. Curry, widerlich.
Der Geruch brachte mich dazu, schneller laufen zu wollen, aber meine Beine kooperierten nicht. Die Treppe war eng und steil, die Stufen schienen geschrumpft. Die Füße hoben sich jedes Mal um einige Zentimeter zu viel.
Eine einzige Glühbirne beleuchtete die Eingangstür, schmucklos wie die Sonne und ebenso schmerzhaft für die Augen. Auch die Tür schien kleiner zu sein. Ich musste mich bücken, um an der Schnur im Briefkasten zu ziehen. Da war aber keine Schnur. Mich erwartete sicher eine Ohrfeige, weil ich zu lange fortgeblieben war.
Mein Kiefer schmerzte schon, als die Tür von einer Frau geöffnet wurde, die überrascht schien, dass jemand vor ihr stand, dann ein schöner Blick voll gequälter Erwartung.
„Tut mir leid.“ Ich kicherte. „Hab mich wohl in der Hausnummer geirrt.“
Ich machte zwei Schritte rückwärts. Gerade noch rechtzeitig drehte ich mich um. Meine Beine schlotterten, dennoch nahm ich die Treppe mit jeweils zwei Stufen. Die Frau rief mir etwas zu, aber ich konnte nicht hören, was sie sagte, denn da hatte ich schon die Straße überquert, weiter über die Gleise, zurück zur Haltestelle, zur Bank. Das Einzige, was in dem wogenden Meer aus Asphalt und Pflastersteinen Bewegungslosigkeit zeigte.
Minutenlang blieb ich dort völlig irritiert sitzen. Eine Straßenbahn hielt an, mit Lärm und Fenstern, in denen sich die Sonne grell spiegelte. Ich starrte auf den Boden. Die Leute stiegen aus, drängten sich zu meinen Füßen und gingen weiter. Die Türen der Bahn zogen sich wieder zu. Langsam glitt sie an mir vorbei. Hinter dem letzten Wagen wurden die Häuser mit den Treppen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder sichtbar. Häuser, die ich kennen sollte, in einer Straße, deren Namen ich aber nicht kannte.
Erst jetzt sah ich in den Fenstern die riesigen Posaunen. Ihr Klang wurde über die Straßenbahnschienen hinweg getragen und ließ meinen Bauch erzittern, bis er sich hohl anfühlte. Ich war fast froh über den Schmerz in meinem Kiefer. Eine halbe Stunde, hatte der Zahnarzt gesagt, dann sollte die Wirkung des Betäubungsmittels abgeklungen sein. Ich ließ eine weitere Straßenbahn vorbeifahren, hörte die Trompetenstöße, ihr schriller Ruf im Einklang mit einem Signal, das die Abfahrt einer weiteren Straßenbahn ankündigte. Als diese weiterfuhr, sahen die Giebel auf der anderen Straßenseite nicht mehr wie alte Bekannte aus. Ich war einfach den falschen Weg gegangen, war an der falschen Haltestelle ausgestiegen. Inzwischen hatte ich auch meinen Zug am Bahnhof verpasst, aber es gab viele, die nach Canterbury fuhren. Ich könnte den nächsten nehmen.
Jetzt, wo ich mich entschieden hatte, schien es länger zu dauern, bis die nächste Straßenbahn kam. Ich starrte auf die Giebel der „Treppenhäuser“ auf der anderen Straßenseite, plötzlich bekamen sie finstere Augen. Ein Vorhang bewegte sich hinter einem der Fenster und wurde geöffnet.
Da … zwei Körper. Ich spürte die Unaufrichtigkeit sofort, die Schreie, die in mein Gehirn drangen, die mit einer gänzlich anderen Bedeutung befrachtet waren, in diesem Fall das finstere Gegenteil. Ich konnte es nicht leugnen, obwohl ich verstand, dass es von größter Wichtigkeit gewesen wäre, die Anziehungskraft eines Aktes zu leugnen und sich abzuwenden. Doch ich konnte mich dem nicht entziehen, weil der bloße Blick auf die Körper den schrecklichen Aufruhr verstehen ließ und der mich bis in die Haarwurzeln elektrisierte.
Ich sah zum ersten Mal einen verstörenden Geschlechtsakt, ein sexueller Raubzug in übelster Vollkommenheit, eine fremdartige, wechselnde Gemeinschaft des Fleisches, die mich von einem Augenblick auf den anderen veränderte, die mich zwang, mich auf diesen Akt und die fiebernde Gefahr zu fixieren. Ich hatte das neue Feuer entdeckt, das alle anderen aufzehrte und nichts als Asche in seiner Spur zurückließ.
Gekreische …
Die Stimmen von Kindern. „Ich war zuerst da!“
Ein Motorroller raste an mir vorbei. Im Sog der Benzindämpfe verblasste der Geruch von Zwiebeln, Knoblauch und Curry. Ich blickte noch einmal zum Fenster. Der Vorhang war zugezogen. Die Posaunen waren verschwunden. Ich wusste mit einem Mal, dass das Böse all die Jahre auf der Lauer gelegen, dass das Feuer in der hintersten Hirnwindung gelodert hatte. Ich hatte es nicht selbst gewählt, sondern ich wurde auserwählt.
Wieder einmal verbarg eine Straßenbahn die Sicht auf die Straße. Quietschende Bremsen vertrieben die Stimmen von herunterzählenden Kindern, die ein Versteckspiel ankündigten.
„Zehn ... Neun ... Acht ...“
Ich stieg ein und blickte nicht zurück.
Teil 1
Wie alles begann
Trenne dich nicht von deinen Illusionen! Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.
(Mark Twain)
Das Unmögliche wollen, das Undenkbare denken und das Unsägliche sagen, haben stets gleiche Früchte getragen.
(Franz Grillparzer)
Die Täuschung
Canterbury - Oktober 2020
Vor einem Jahr beschloss ich in Cannes, mich von Julia zu verabschieden, der Frau, die fünfundzwanzig Jahre lang meine Assistentin gewesen war. Wir saßen im Le Grand Café, warteten auf das Taxi, das uns zum Flughafen bringen sollte, und schauten auf den menschenleeren Strand hinaus. Vor mir stand ein Espresso, Julia hatte einen Café au lait mit extra Milch und viel Zucker. Zwei Kellner aus dem benachbarten Etablissement schrubbten unbeeindruckt die Terrasse, der Bäcker las vor der Boulangerie seine Zeitung, ein Jogger schlenderte vorbei und der Manager des Le Grand Café polierte an der Bar Weingläser. Der Morgen brachte eine Ruhe, die nicht vorhanden war, so wie ich meinem Publikum seit Jahren eine Realität präsentierte, die es nicht gab. Ich nippte an meinem Espresso, schaute Julia an und wusste ganz genau: Der Abschied stand unmittelbar bevor.
Als ob Julia meinen Gedanken eingefangen hätte, hob sie den Kopf und starrte mich mit zusammengekniffenen Augen an, die ihre Augenfältchen verstärkten. Für eine Frau von fünfzig Jahren sah Julia Willow großartig aus. Ich war weder blind noch unsensibel. Sie hatte immer noch den Bauch einer Frau in den Zwanzigern, eine volle Oberweite, kurvige Hüften und eine wunderbar gebräunte Haut, sie trug immer noch die Stretchkleider, die eine Näherin vor fünfzehn Jahren für eine Show angefertigt hatte. Ihr dunkelblondes Haar glänzte immer noch seiden, und wenn sie im Sommer zwischen den Proben durch die Stadt spazierte, bemerkte ich oft, dass viel zu junge Männer einen Blick auf ihre sehnigen Unterschenkel warfen, die wie Geschenke unter ihrem Rock hervorlugten. Doch die sich vertiefenden Krähenfüße machten allmählich deutlich, dass auch Julia den Naturgewalten nicht entkommen konnte.
Mit einer anmutigen Bewegung steckte sie sich eine Haarsträhne hinter ihr linkes Ohr und lehnte sich zurück.
„Worüber denkst du nach, Victor?“, fragte sie.
Ich stellte die Kaffeetasse auf den Tisch, nahm eine Serviette vom Ständer, tupfte mir langsam die Lippen ab und atmete tief ein. Bedeutungsvolles braucht Zeit, hatte mir einst Noah Adams, mein Onkel, gelehrt, und alles, was er mir beigebracht hatte, würde ich niemals vergessen.
Ich entfaltete die Serviette, legte sie auf meinen Schoß, als würde ich eine Mahlzeit beginnen und warf Julia einen flüchtigen Blick zu.
„Dass es vorbei ist“, antwortete ich und sah zur Seite, knäuelte unter dem Tisch die Serviette zusammen und glättete sie wieder. Meine Finger klebten vor Schweiß.
Julia nickte. „Es ist tatsächlich vorbei. Es war so eine schöne Woche, aber es ist okay, Victor. In fünf Stunden sind wir wieder in England. Ist das nicht schön? Nach sieben Tage habe ich die Nase voll von Cannes, um ehrlich zu sein.“ Sie beugte sich wieder über ihren Milchkaffee und rührte ihn zum x-ten Mal um.
Natürlich hätte ich in diesem Moment sagen müssen: Du missverstehst mich, Julia. Es geht nicht um die vergangene Woche, es geht um uns. All das, die Art und Weise, wie wir uns gemeinsam von Theater zu Theater bewegen, du und ich. Es tut mir leid, aber ich suche mir eine neue Assistentin und du wirst das tun, was du schon immer tun wolltest. Unsere Zeit, oder besser gesagt deine Zeit ist vorbei, der Vorhang ist gefallen.
Vielleicht hätte ich ihr zum Dank für fünfundzwanzig Jahre Mitarbeit einen Händedruck geben sollen, aufstehen, um sie auf der leeren Terrasse des Le Grand Café zu verlassen. Aber ich blieb ruhig und trank einen bitteren Espresso.
Im Flugzeug, das uns von Cannes zurück nach London brachte, hatte ich ein zweites Mal die Gelegenheit, Julia mitzuteilen, dass die Zusammenarbeit zu Ende sei. Das Flugzeug hatte seine Höhe erreicht, das Signal zum Lösen der Gurte war gerade erloschen, und die Flugbegleiterinnen rollten die Trolleys durch die Gänge und verteilten englische Tageszeitungen.
Ich nahm die Tageszeitung in die Hand und schlug aus Gewohnheit sofort die Kulturseite auf. Wir wurden darin mit keinem Wort erwähnt. Wie auch. Die Zeiten, in denen unser Privatleben und unsere Shows Flüsternachrichten waren, waren längst vorbei. Seit wir die glitzernden Dekors gegen eine nüchterne und minimalistischere Bühnendekoration ausgetauscht hatten, wurde unser Kommen und Gehen auf den Kulturseiten der seriöseren Zeitungen besprochen, und obwohl dies ein Kompliment für den künstlerischen Gehalt unserer Show sein sollte, störte mich diese Tatsache. Wir verschwanden langsam aus dem Blickfeld des wahren Publikums.
Nach fünfzehn Minuten fragte Julia aus heiterem Himmel und ohne mich anzusehen, ob mich auch manchmal die Erkenntnis traf, dass alles endlich war.
Ich war ziemlich schockiert über ihre direkte Frage. Wollte sie mir zu verstehen geben, dass sie ahnte, was ich ihr auf der Terrasse zu sagen versucht hatte?
„Dass man plötzlich die Einsicht bekommt, dass es völlig egal ist, was man mit seinem Leben macht“, fuhr sie fort. „Ob du nun hart arbeitest oder gerade mal nichts tust, wir alle werden irgendwann sterben, der Tod bedeutet das Ende und nach dem Tod spielt nichts mehr eine Rolle“,
Julia blickte kurz auf, schien aber keine Reaktion von mir zu erwarten. Sie nahm ihren Timer aus der Handtasche, schlug ihn am Monatsanfang auf und tippte mit dem Finger auf die aufgeschlagene Seite.
„Was sollte uns noch Sorgen bereiten? Die Vorbereitungen für eine neue Show, die Termine, Fotoshootings, Interviews, all die verschwitzten Umkleidekabinen mit den konfrontierenden Spiegeln, die Autogrammstunden im Foyer, und das Abend für Abend?“
Julia schloss den Timer, lehnte den Kopf leicht nach vorne gegen das Fenster und machte einen betrübten Eindruck.
„Versteh mich bitte nicht falsch, Victor, ich liebe unsere Arbeit, sie ist fantastisch, aber manchmal denke ich… Schau dir das an.“ Sie tippte mit dem Zeigefinger auf die Alpenlandschaft. „Diese Berggipfel da unten, sie sind die Ewigkeit, sie werden bestenfalls nach dem Winter durch den Regen und das Schmelzwasser etwas glatter, aber wir Menschen werden alle sterben. Wir gehen und alles, was wir zurücklassen, sind die Erinnerungen, die genauso vergänglich sind wie wir selbst. Alles ist endlich und sinnlos. Verstehst du, was ich damit sagen will?“
Das hätte mein Stichwort sein sollen, um die Vergänglichkeit ihrer Rolle als meine Assistentin zu kommentieren, aber ich war so überwältigt von der Wahrheit ihrer Worte, dass ich erst zehn Minuten später erkannte, welche Chance Julia mir geboten hatte. Und dann war der Moment auch schon wieder vorbei.
Zurückblickend war es ein Wortspiel. Ich mochte keine Wortspiele. Was ihren Unterhaltungswert anging, würde ich sie irgendwo zwischen einer tiefen Schnittwunde und einem Essen im Familienkreis einordnen.
Julia schlief ein. Auch ich schloss meine Augen, aber ihre Worte gingen mir immer wieder durch den Kopf. Als ich zehn Minuten später die Augen wieder öffnete, stand ein etwa zwölfjähriger Junge neben meinem Sitz.
„Mein Dad sagt, dass Sie Horus, der große Zauberer sind“, sagte der Junge schüchtern und drehte sich kurz zu dem Mann um, der offenbar sein Vater war.
„Was hast du gesagt?“ Ich versuchte, höflich zu lächeln.
Natürlich hatte ich den Knirps verstanden. Ich hatte jedes Wort gehört, besonders Zauberer. Das Wort rief eine spontane Müdigkeit in mir hervor. Meine Augenlider wurden schwer, mein Kopf schmerzte, als hätte mich jemand in einen Schraubstock gelegt. In meinen Ohren rauschte der Blutfluss, die Muskeln um meinen Mund zuckten.
Ich schloss die Augen, atmete tief ein und aus, ein und aus, und noch einmal, und als ich die Augen wieder öffnete, stand ich neben meinem Vater in der Tür des Gemeindezentrums in Rochester …
Herbst 1987
„Wir können uns immer noch registrieren, nehme ich an?“, fragt mein Vater und legt die schwarze Ledertasche mit den Trickutensilien auf den Tisch. „Mein Sohn möchte bei der Talentshow mitmachen.“
Der Mann am Anmeldeschalter wirft uns einen kurzen, nicht besonders freundlichen Blick zu, nimmt aber einen Kugelschreiber in die Hand.
„Name des Jungen?“ Die Stimme klingt barsch.
„Victor Adams“, antwortet mein Vater.
„Alter?“
„Dreizehn.“
„Akt?“
„Mein Sohn ist ein Zauberer.“
„Stimmt das?“ Der Mann sieht mich an.
Ich schüttele den Kopf.
„Was bist du denn dann?“
„Ein Illusionist“, antworte ich und schenke meinem Vater einen vernichtenden Blick, während ich das Wort artikuliere.
Der Mann nickt, beugt sich über die Teilnehmerliste und schreibt hinter meinen Namen Zauberer.
Ich koche vor Wut.
Als wir die Halle betreten, packe ich meinen Vater am Ärmel seiner Jacke. „Sag das nie wieder, Dad!“
„Was soll ich nicht sagen, Victor?“
„Du darfst nie wieder sagen, ich sei Zauberer.“
„Aber du zeigst doch Zaubertricks?“
„Es geht nicht darum, was ich mache, sondern darum, wie ich es nenne, Dad!“
„Ich verstehe den Unterschied nicht, Junge.“
„Das ist das eigentliche Problem, Dad“, zische ich unverblümt und lasse meinen Vater einfach stehen…
„Mr. Horus?“
Der Junge bewegte sich unruhig hin und her, blickte schnell zu seinem Vater und zuckte mit den Schultern.
Ich hatte ihn vermutlich ein paar Minuten lang apathisch angestarrt und es dauerte eine Weile, bis ich mich daran erinnerte, was mich der Junge gefragt hatte.
Ich schaute direkt in die Augen des Jungen und sah mich in dem klaren Blau reflektiert. Ist das ein glücklicher Mann, der dich da anschaut, Mini?, fragte mich die innere Stimme.
Ich legte meine Hand auf den Kopf des Jungen, streichelte sein Haar und zog eine Zwei-Euro-Münze hinter seinem rechten Ohr hervor. „Ich bin in der Tat der Zauberer“, sagte ich traurig.
Ein Jahr später hatte ich Julia immer noch nicht gesagt, dass die Ära von Victor Horus und seiner reizenden Hekate, wie die New York Times Julia einmal genannt hatte, nach der laufenden Saison zu Ende gehen würde. Es gab immer etwas, das mich davon abhielt, es ihr zu sagen: Buchungen für Fernsehshows und Galaabende in europäischen Hauptstädten, ich erhielt den International Magic Society Award, und wir bekamen eine bescheidene Rolle in einer BBC-Fernsehproduktion: Eine Familiengeschichte, die sich um die Weihnachtszeit als echter Kassenschlager entpuppte und uns auch jede Menge Publicity bescherte.
Natürlich gab es Zeiten, in denen ich es Julia hätte sagen können, zum Beispiel während einer der langen Autofahrten zu den Theatern auf dem Land. Aber diese täglichen Momente waren so leer, dass kein noch so großes Gespräch die Stille füllen konnte. Im Laufe der Jahre waren unsere enthusiastischen Unterhaltungen während der Fahrten zur stillen Routine geworden. Ich folgte den Rücklichtern des Lastwagens, in dem meine Tricks und Illusionen verstaut waren, Julia hörte ihrem mp3-Player zu, las eines ihrer Lieblingsbücher, schrieb manchmal Briefe oder Einträge in ihr Tagebuch. Sie unterbrach ihre Aktivitäten nur, um mir ein Sandwich, einen Kaugummi oder ein Red Bull zu reichen. Und selbst dann waren Worte überflüssig. Ein dankbares Nicken, ein Lächeln, ein Augenzwinkern konnten nach all den Jahren der Zusammenarbeit ganze Gespräche ersetzen.
Nur am letzten Tag der Theatersaison war der Moment unweigerlich da. Ein Aufschieben war nicht mehr möglich. Nach der Vorstellung würde ich mich von Julia verabschieden, in ehrlicher und offener Aussprache: Sie war fünfundzwanzig Jahre lang eine vorbildliche Assistentin gewesen, die Beste, die sich ein Illusionist wünschen konnte, aber sie wurde sichtlich älter und damit auch das Publikum. Und ein alterndes Publikum war eine aussterbende Rasse.
Julia wusste, dass die Assistentin des Illusionisten das Aussehen einer ungebundenen Dreißigjährigen haben musste. Darauf basierte das Gesetz der Verführung: Die Assistentin lockte die Männer mit ihren geschwungenen Wimpern, falschen Nägeln, glitzernden Lippen, knackigem Po und festen Brüsten; der Illusionist betörte die Frauen, indem er ihnen vorgaukelte, er hätte Macht über die Kräfte des Alltags.
„Ein Illusionist ist ein Marketender, der Mogelpackungen verkauft. Die Assistentin ist seine Hure, die die Opfer in dem Moment ablenkt, in dem der Betrug stattfindet“, hatte Noah einmal gesagt. Genau darin lag das Problem: Julia war ein Schatz, aber ihr charmantes und reifes Auftreten bedeutete, dass sie als Assistentin nicht mehr glaubwürdig sein konnte.
Das nötige Handwerkszeug, die Geheimnisse hinter der Illusion und die perfekte Assistentin garantierten meinen Erfolg. Alles wurde durchdacht, jede Sekunde geplant. Das war harte Arbeit. Genau das hatte ich an der neuen Generation von Illusionisten auszusetzen. Sie waren nicht gewillt, wirklich zu arbeiten, sich ihrer Kunst vollständig zu verschreiben. Sie schäkerten mit ihrem Personal und verbanden privates mit geschäftlichem. Und das wiederum bedeutete, sie würden nie mehr als Dilettanten sein. Ich opferte meiner Karriere und meiner Kunst alles. Ich hatte neuerdings den Eindruck, dass Julia nicht mehr ganz bei der Sache war. Sie zeigte eindeutig Ermüdungserscheinungen vom Business.
Als ich gegen vier Uhr nachmittags mit Julia für einen Durchlauf der Show auf die Bühne ging, kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich sie am besten in einem Brief über meinen Entschluss informieren sollte, den ich per Einschreiben verschicken würde. Ein feiger, aber effektiver Weg: Ich vermied die Chance auf ungeschickte Formulierungen und Julia konnte mich nicht unterbrechen.
An diesem Nachmittag führte Julia die Tricks wie auf Autopilot aus, während ich versuchte, den Inhalt des Briefes in Gedanken zu formulieren.
„Geht es dir gut?“, fragte ich Julia später. „Du warst so abwesend während der Probe.“
„Alles gut“, antwortete sie knapp.
Ich verließ das Marlowe-Theatre, kaufte in einem Laden einen Stift und Papier und ging ins Restaurant The Veg Box Cafe. An einem Tisch am Fenster schrieb ich den Brief an Julia. Ich verfasste mehrere Versionen, bevor ich mit dem Inhalt zufrieden war. Danach lief ich ein Stück am Great Stour entlang. Im Greyfriars Garden pickten Elstern am Gras. Als ich an ihnen vorbeikam, schoss einer der Vögel kreischend hoch, andere Elstern flatterten ebenfalls einen halben Meter nach oben, als wollten sie mir eine Ehre zukommen lassen: Victor Horus, auch im Tierreich weltberühmt.
Um sieben Uhr betrat ich wieder die Umkleidekabine.
„Du bist spät dran“, sagte Julia und warf irritiert einen Blick auf ihre Uhr.
„Ich musste mich um etwas kümmern“, erwiderte ich knapp und tastete nach dem Brief in meiner Jackentasche.
Julia betrachtete sich im Spiegel. Das weiße Licht der Neonröhren machte die dunkle Haut unter ihren Augen gnadenlos sichtbar, trotz des Make-ups. Umkleidekabinen waren brutal, sie erzählten einem, wie das Leben war: wie einsam das Reisen von Stadt zu Stadt, wie trist die Routine des Umherziehens nach ein paar Wochen sein konnte, wie unglamourös sich der Glamour letztendlich erwies.
Sie sah mich an und ihre Fassade der Unverletzbarkeit bröckelte. Ich wusste es, weil ich auf ihre Hände schaute. Ich schaute immer auf die Hände, denn sie verrieten viel mehr als das Gesicht. Julia hielt sie unter ihrem süßen runden Hintern, ein instinktiver Versuch, sie ruhig zu halten, das wachsende Verlangen zu stillen, ihre Arme, ihren Körper zu umklammern, vielleicht sogar mich wegen der Verspätung zu packen.
„Sieht dir gar nicht ähnlich, so spät zu kommen.“ Julia öffnete ihre Puderdose.
Wortlos setzte ich mich an den Schminktisch.
Der Vorhang öffnete sich, die Musik erklang. Julia kam mit fünf Sekunden Verspätung auf die Bühne, so dass ich, als Matador gekleidet und mein rotes Tuch anmutig schwenkend, eine zusätzliche Drehung um die eigene Achse machen musste, um unsere Schritte in Einklang zu bringen und die Choreografie wieder dem Paso doble anzupassen.
Sie lief verführerisch um mich herum, bettelte mit den Armen um Körperkontakt, ließ mit den Hüften den dunkelroten Flamenco-Rock aufreizend aufwallen.
Zu hart kam Julia gegen mich zum Stehen und stellte ungeschickt ihren Fuß auf meinen. Sofort schoss der Ärger durch meinen Körper.
Während wir uns progressiv trotzig im Kreis drehten, jeder mit dem linken Arm um die Taille des Anderen und den anderen in die Luft erhoben, sah ich sie durchdringend an. Hunderte Seifenblasen entsprangen mit jeder Drehung aus dem Nichts und umfingen uns. Sie nickte mir schuldbewusst und etwas unterwürfig zu und mimte perfekt den roten Schatten des Toreros.
Julia wusste, dass sie die verlorene Zeit irgendwo während der Schritte zum Käfig aufholen musste, damit die Illusion des Verschwindens zur Musik passte. Jede Bewegung, die Anzahl der Sekunden, die man das Publikum ansah, die Tanzschritte, die Geschwindigkeit, mit der ein Käfig geöffnet und geschlossen und die Art und Weise, wie der Vorhang über einen Käfig drapiert wurde, alles war sekundengenau durchdacht, die Choreografie und die Musik darauf abgestimmt. Die Tatsache, dass Julia schlampig wurde, bestärkte mich in meinem Entschluss, mich von ihr zu verabschieden.
Der Rest der Show verlief wie gewohnt. Ich war so vertieft in die Vorstellung, dass ich den Brief vergaß. Erst als Carmina Burana über das Publikum hallte und der letzte Akt – The Vanishing, das Verschwinden – begann, erinnerte ich mich an den Brief. Ich hatte ihn in Julias Handtasche versteckt und es war nur eine Frage der Zeit, bis Julia ihn finden würde. Auf der Autofahrt nach Canterbury hätten wir dann Zeit, über den Inhalt zu sprechen. Dann würde ich Julia vor ihrer Wohnung absetzen und das war‘s dann.
Ich rollte den Stahlkäfig in die Mitte der Bühne und öffnete die vergitterte Tür. Julia betrat die Bühne und trug einen riesigen Umhang. Sie ging einmal um den Käfig herum, warf den Umhang ab, nahm die Hand, die ich ihr hinhielt, und kroch mit einer anmutigen Bewegung in den Stahlkäfig. Ich verriegelte die Tür mit einem Vorhängeschloss, kletterte auf die Stahlkonstruktion und drapierte zum Klang der Musik das schwarze Tuch über den Käfig. In diesem Moment winkte sie mir kurz und kühl zu, eine kleine Handbewegung in der Luft, mit einer weichen zuversichtlichen, leicht ironischen Hand, die besagte: bis gleich. Dann öffnete sie die Heckklappe, rollte in Richtung Freiheit und verschwand. Allerdings zwei Sekunden zu spät.
Ich sprang vom Käfig, zog den Vorhang zurück und nahm meinen Applaus mit gemischten Gefühlen entgegen. Plötzlich tat der bevorstehende Abschied ein wenig weh. Ich riss mich zusammen und ging zurück zum Käfig, drapierte das Tuch wieder darüber und lief um den Käfig herum, bereit, Julia zurückzunehmen. Dies war nicht das Ende dieser Serie, sondern das einer Ära. Ich schaute in den Saal und lächelte kurz. Dann fuhr ich langsam mit der linken Hand über die glänzende Seide und wartete die vereinbarten Sekunden, bevor ich Julia wieder aus dem Käfig ziehen konnte.
Mit einem festen Ruck zog ich den Vorhang vom Käfig und ging an den Rand der Bühne, um den Applaus entgegenzunehmen. Der Applaus setzte ein, verebbte aber sofort wieder und plötzlich gab es Gelächter aus dem Publikum, der Applaus schwoll wieder an, jetzt aber klang er verhalten.
Ich hatte immer Angst, dass mir irgendwann etwas Schreckliches zustoßen könnte, denn während so viele Menschen in ihrem Leben mit allen möglichen Rückschlägen zu kämpfen haben, war mein Leben bisher fast perfekt verlaufen.
Früher oder später läuft aber etwas Entscheidendes aus dem Ruder. Und dieses eine schreckliche Ereignis würde alles ins Gleichgewicht bringen, denn schließlich erreichte kein Mensch unbeschadet die Ziellinie.
Am Ende geschah es dann auch. Zu einem Zeitpunkt, als ich am wenigsten darauf vorbereitet war: in diesem Moment.
Ich drehte mich entsetzt um. Der Käfig war leer.
Die schwarze Schlampe
Rochester, England - 1987
An meinem dreizehnten Geburtstag schenkte mir mein Vater eine schwarze Arzttasche aus Rindsleder. Sie hatte ursprünglich meinem Großvater gehört, aber die Tasche sah nach all den Jahren immer noch unbenutzt aus.
„Um darin all deine Trickutensilien unterzubringen“, erklärte er, als er den enttäuschten Blick in meinen Augen sah. „Die Ringe, die Tücher und die Karten, alles ordentlich sortiert.“ Er nickte kurz, als würde er seinen eigenen Worten in meinem Namen zustimmen.
Ich stand ein wenig verloren in der Mitte des Wohnzimmers und dachte an die Achtmillimeter-Kamera, die ich mir zum Geburtstag gewünscht hatte. Damit wollte ich meine Tricks filmen und die Fotos minutiös studieren, meine Finger beim Tanzen mit den Münzen beobachten, mich bei allzu offensichtlichen „double lifts“ während eines Kartentricks ertappen und raffinierte Schiebetechniken auf ihre Unsichtbarkeit hin beurteilen. Ich hatte meinen Eltern sogar angeboten, meine Ersparnisse zu investieren. Sie haben es nicht einmal erwogen.
Mein Vater hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Geschenk einzupacken, aber immerhin glänzte die Außenseite und es roch eindeutig nach Schuhcreme. Ich legte die Tasche auf den Couchtisch, klappte sie auf und starrte hinein. Das Innenleder hatte einen gräulichen Farbton, der Boden war mit einer weißen Kunststoffplatte ausgelegt, die Initialen meines Großvaters mit schwarzer Tinte auf das Leder geschrieben.
Eine eisige Stille fiel ein. Nur das Atmen meines Vaters durchbrach sie.
„Und?“ Seine Stimme klang leicht verärgert.
Ich schaute ihn kurz an, dann meine Mutter, die sich die Hände an der Schürze abwischte. Sie hatte bereits die Kartoffeln für das Abendessen geschält, obwohl es erst halb acht Uhr frühmorgens war.
„Gefällt sie dir, Victor?“ Offenbar reagierte ich wieder nicht schnell genug, denn sie fuhr blitzschnell fort: „Die Tasche ist ein Erbstück. Sie gehörte deinem Großvater, dann deinem Dad und jetzt dir. Ein guter Magier braucht doch eine besondere Tasche, nicht wahr?“
„Zumindest sind wir davon ausgegangen“, ergänzte mein Vater und nickte ostentativ.
Ich fuhr mit dem Zeigefinger über das schwarze Leder und zog dabei versehentlich eine stumpfe Linie. Ein Fehler. Meine Mutter drehte sich enttäuscht um.
„Hättest du die Tasche nicht vorher leeren müssen, Mum?“, fragte ich schnell. Sie blieb stehen und drehte sich wieder um. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln schlich sich auf ihre Lippen.
Ich steckte die rechte Hand in die Tasche. „Schau mal, was da drin ist.“ Mit einer schnellen Bewegung zog ich einen Fächer mit Spielkarten heraus, griff dann mit der linken Hand in die Tasche, und während ich den ersten Fächer mit einem anmutigen Schwung zu Boden fallen ließ, zauberte ich einen zweiten Halbkreis Spielkarten hervor, warf auch sie hin und grub einen dritten Fächer aus. Dabei zwinkerte ich meiner Mum zu.
Mein Vater klatschte fröhlich in die Hände, kam auf mich zu und fuhr mir mit der Hand durchs Haar. „Jetzt sind wir alle glücklich, so glücklich. So mag es Daddy.“
Er ging grußlos an uns vorbei und verließ das Haus, um in die Firma zu gehen, eine Fabrik für Autozubehör. Erst als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, ging meine Mutter wieder in die Küche. Im Türrahmen drehte sie sich noch einmal um. Sie wollte mir etwas sagen, aber dann zuckte sie nur mit den Schultern und ließ mich im Wohnzimmer allein zurück.
Ich beugte mich über die Tasche, steckte mein Gesicht in die Öffnung, holte tief Luft und rümpfte die Nase. Mief.
Noah blickte entsetzt auf die schwarze Tasche. „Hat er dir tatsächlich die alte Schlampe geschenkt?“
Ich antwortete nicht, zuckte nur schüchtern mit den Schultern.
„Junge …“ Mein Onkel beugte sich herunter und tat so, als würde er mich mit einer Kamera fotografieren. Ich hatte ihm eine Woche zuvor von meinem Wunsch nach einer Kamera erzählt. Er bot mir begeistert an, Fotos von mir zu machen.
Wieder antwortete ich nicht, sondern schaute in Richtung Küche, um zu sehen, ob meine Mutter in der Tür stand und uns hören konnte.
„Gütiger Himmel. Wirklich?“, fragte Noah im Flüsterton.
Ich schüttelte den Kopf und schubste verärgert gegen das Erbstück, so dass die Tasche über den Couchtisch glitt.
„Was machst du denn jetzt mit der Tasche von dem alten Quacksalber?“ Noah legte seine Hand auf meine Schulter und drückte mich einen Moment lang.
Ich schaute zu ihm auf und zum ersten Mal fiel mir die Ähnlichkeit zwischen ihm und meinem Vater auf. Sie hatten beide volle, dunkle Augenbrauen, die fast aneinanderstießen, und einen Blick, der etwas Autoritäres oder zumindest eine offensichtliche Präsenz ausstrahlte. Dennoch wirkte Noah entspannter und selbstsicherer. Mein Vater war wie mein Großvater, der einst seine Arbeit als Arzt so ernst genommen hatte, dass er sich auf seinem Sterbebett gefragt hatte, wie die Menschen im Dorf ohne ihn überleben würden.
„Zeig Noah, was dein Vater dir geschenkt hat, Victor“, sagte meine Mutter, als sie lächelnd das Wohnzimmer betrat. In den Händen trug sie ein Tablett mit Kaffee und Apfelkuchen. Der Rand des Tabletts war mit einer Girlande verziert.
„Was macht so ein Junge mit dieser alten Kuh?“ Noah nahm die Tasche vom Tisch und hielt sie ihr vor die Nase. Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht meiner Mum.
Sie stellte das Tablett auf den Tisch und nahm meinem Onkel die Tasche aus der Hand. „Victor hat inzwischen eine Menge Trickutensilien gesammelt. Diese Arzttasche ist sehr praktisch, wenn man das alles mitnehmen muss.“ Sie klopfte mit der flachen Hand auf das Leder. „Außerdem hat der Junge sich sehr über das Geschenk gefreut. Nur darauf kommt es an.“
„Ein Pappkarton wäre genauso praktisch gewesen“, antwortete Noah, drehte sich um und schenkte mir ein hilfloses Lächeln. Ich erwiderte es nicht, weil ich den Blick meiner Mum spürte.
„Ende der Diskussion“, erwiderte sie schroff. Sie sah mich flüchtig an und stellte die Tasche wieder auf den Tisch. Die Kaffeetassen zitterten und störten die beklemmende Stille.
Kurz nach dem Mittagessen kam mein Onkel zum zweiten Mal zu uns. Er radelte mit voller Geschwindigkeit den Gartenweg herauf, die rechte Hand am Lenker, mit dem linken Arm hielt er ein Paket umklammert. Er stieg vom Fahrrad, stellte es gegen den Schuppen und winkte meiner Mum am Küchenfenster zu.
„Mensch Noah, was hast du da nur getan?“, sagte sie, als er die Küche betrat.
„Habt ihr überhaupt eine Ahnung davon, wie viel Talent Victor hat? Dieses Ding wird ihm helfen, den nächsten Schritt zu machen“, antwortete mein Onkel.
„Und welchen Schritt machst du?“, flüsterte sie.
Ich konnte ihre Worte dennoch hören.
Noah schwieg einen Moment. „Es geht hier nicht um mich, es geht nicht um meinen Bruder und es geht nicht um dich. Es geht nur um Victor.“
Ich erschien im Türrahmen. Meine Mutter stand an der Spüle, die Arme ineinander verschränkt, und starrte nach draußen. Noah drehte sich zu mir um und lächelte mich an. „Ich schulde dir noch ein Geschenk. Komm her!“
Mein Herz klopfte vor Aufregung. Am Küchentisch riss ich das Geschenkpapier vom Karton. Noah legte mir die Hand auf die Schulter. „Ein echter Illusionist muss wissen, was die Leute sehen, die in seine Vorstellung kommen und ihn sehen wollen.“
Ich sah zu ihm auf. „Illusionist?“
Noah nickte. „Ein Zauberer lässt sofort an Väter oder Großväter denken, die auf Geburtstagsfeiern die Kleinen mit aus dem Ärmel gezogenen Blumensträußen unterhalten. Illusionisten sind die Profis unter den Zauberern.“ Er zwinkert mir zu.
Ich spürte seine Wärme in meinem Körper durch die Hand, die auf meiner Schulter ruhte und dachte: Warum kann Papa nicht wie Noah sein?
Die Achtmillimeter-Kamera surrte wie eine Nähmaschine in Zeitlupe. Ich schaute in die Linse, lächelte, drehte mich um und nahm den Spazierstock vom Tisch. Mitten im Wohnzimmer stellte ich mich in meine Ausgangsposition und streckte die Arme vor mir aus, wobei ich den Stock in einer vertikalen Position hielt. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich beugte meine Knie leicht, drückte meine Fersen fest auf den Boden und spannte die Muskeln in Armen und Beinen an. Mein Magen kribbelte bei der Aussicht, mich in ein paar Tagen auf einem Film zu sehen. Endlich würde ich sehen, wer ich bin, wenn ich als Illusionist ins Leben trete.
Langsam öffnete ich meine Hände. Der Stock schwebte dreißig Zentimeter von mir entfernt, hing in der Luft und folgte den anmutigen Bewegungen, die ich mit meinen Händen machte.
Ich bewegte mich nach links und rechts, nach oben und unten und drehte mich um die eigene Achse, der Spazierstock tanzte mit mir, schwebte durch die Luft und folgte meinen Bewegungen wie der Schwanz einem Fuchs.
Ich schloss die Augen und hörte in meinem Kopf die Klänge von Georgia, dem Lied, auf das ich die Kadenz des gesamten Tricks aufgebaut hatte.
Ich musste meine Augen nicht öffnen, um die Bewegungen zu machen und zu sehen, wie der Rohrstock mir gehorchte. Ich führte den Trick willig aus, als ob ich mich vom Boden gelöst hätte und der Stock meine Bewegungen lenkte, statt umgekehrt.
„Mach deine Schritte nicht zu groß“, sagte meine Mutter. „Ich verliere dich sonst, die Kamera kann dich dann nicht erfassen.“ Der Ton ihrer Stimme verriet ihre Freude. Zuerst hatte sie sich geweigert, die Kamera zu halten, aber als sie die Begeisterung sah, mit der ich die Tricks vorführte, während Noah mich filmte, stimmte sie zu. „Okay, was soll’s. Ich bin eure Kamerafrau.“
Ich setzte meinen Auftritt unbeirrt fort.
„Es geht hauptsächlich um seine Hände, Ann“, erklärte Noah ihr. „Achte darauf, dass die Kamera auf seine Hände gerichtet ist und alles einfängt.“
Ich öffnete die Augen und ließ den Stock ein wenig auf und ab tanzen und herumwirbeln, fing ihn dann auf, schaute in die Kamera und lächelte selbstbewusst in die Mitte des Objektivs, als ob irgendwo hinter dieser Glasscheibe tatsächlich ein Publikum wäre, das mich beobachtete, und ich ihnen zeigen müsste, wie sehr ich an das Unmögliche glaubte. Mit der rechten Hand rutschte ich dicht an den Stock heran, von unten nach oben, so dass er durch meine linke Hand langsam nach oben glitt, bis er schließlich wieder frei in der Luft hing.
Genau in dem Moment, als ich mich wieder um die eigene Achse drehen wollte, fing ich den Stock aus der Luft und schaute überrascht an der Kamera vorbei, direkt in die Augen meines Vaters. Er stand auf der Schwelle und beobachtete uns. Meine Mutter drehte sich entsetzt um und vergaß, die Kamera auszuschalten. In der Stille, die eintrat, klang das Surren wie ein Trommelwirbel, der einen Höhepunkt ankündigte.
„Wo ist die Tasche?“, fragte mein Vater ruhig. „Ich will meine Tasche zurück.“
Es war meine Mutter, die zwei Tage später die Stille brach.
„Ich habe heute Morgen mit unserer Nachbarin gesprochen“, sagte sie und stellte eine Schüssel mit dampfenden Kartoffeln auf den Tisch.
Mein Vater antwortete nicht, er schaufelte Kartoffeln auf seinen Teller. Die Stille kehrte sofort zurück. Mum drehte sich wortlos um und verschwand in der Küche.
Ich sah meinen Vater an, aber er wich mir aus, so wie er Mum seit dem Vorfall mit der Kamera aus dem Weg ging. Das Schweigen zwischen ihnen war aufgeladen wie ein drohendes Gewitter. Zwei Tage lang kreisten sie umeinander, und wenn sie zufällig zur gleichen Zeit im selben Raum waren, gingen sie aneinander vorbei, als wäre der Andere Luft. Sie feuerten leise Vorwürfe aufeinander ab wie die Kanonen zweier Kriegsschiffe in einer Seeschlacht.
Ich hatte mich in den vergangenen zwei Tagen in mein Zimmer zurückgezogen und stundenlang grundlegende Kartentricktechniken geübt. Es war mühselig, mich quälte die lähmende Stille im Haus. Die Karten glitten mir beim Mischen aus den Händen, die Fächer, die ich normalerweise mit einer geschmeidigen Handbewegung präsentierte, bildeten keinen perfekten Halbmond und die Schiebetechnik gelang mir auch nicht.
Mum kam mit einem Teller mit gut gewürzten Steaks aus der Küche zurück. „Sie hat einen Job.“
„Einen Job?“, fragte Dad entgeistert.
„Ein Bürojob. Telefonate entgegennehmen, Briefe tippen, Termine für den Direktor vereinbaren. So was in der Art.“
Dad zuckte mit den Schultern. „Warum will sie einen Job?“
„Heutzutage ist es völlig normal, dass eine Frau arbeitet. Wir leben in den achtziger Jahren“, antwortete Mum und verteilte die Steaks auf die Teller, ohne ihn anzusehen. „Sie hat sich fünfzehn Jahre lang um die Kinder gekümmert, jetzt ist sie an der Reihe.“
Dad legte das Besteck zur Seite und verschränkte die Arme. „Und wer kümmert sich um die Kinder? Sollen sie sich ihr Essen demnächst selbst kochen?“
„Sie fängt morgens um neun Uhr an, wenn die Kinder zur Schule gegangen sind. Mittags kommt sie nach Hause, um mit den Kindern zu essen, und wenn alle wieder in der Schule sind, geht sie noch einmal für zwei Stunden ins Büro.“
Ich nickte zustimmend, obwohl ich keine Ahnung hatte, was meine Mutter in Wahrheit sagen wollte.
Ich war nur froh, dass meine Eltern wieder miteinander sprachen. Aber es gefiel mir nicht. Ein Gespräch über eine dritte Person bedeutete einen heftigen Streit. Der Haussegen hing eindeutig schief.
„Brauchen sie denn das zusätzliche Einkommen?“
Mum seufzte einen Moment lang. „Die Nachbarin braucht ein Leben außerhalb der Familie.“
Dad nahm das Besteck wieder in die Hand, schnitt ein Stück Fleisch ab, schob es sich in den Mund und zeigte dann mit der Gabel auf Mum. „Aber der Familienbetrieb läuft einfach weiter. Sie kann alles Mögliche wollen, aber sie hat einst die Entscheidung getroffen, Kinder zu bekommen. Wer wird dann die Hausarbeit erledigen?“
Mum beugte sich über ihren Teller und schnitt die Kartoffeln in zwei Hälften. Der Dampf kräuselte sich entlang ihres Gesichts. „Ihr Ehemann wird einen Teil der Aufgaben übernehmen. Sie haben es durchdacht.“
„Ich frage mich, warum die Menschen immer das Bedürfnis haben, alles auf den Kopf stellen zu müssen.