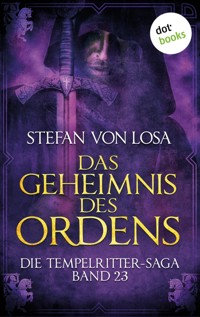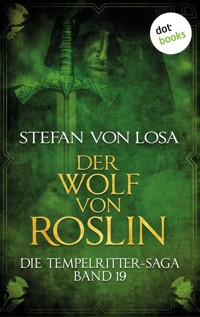
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"Wölfe sind intelligente Raubtiere. Sie lassen nicht locker, bis entweder du tot bist – oder sie": "Die Tempelritter-Saga" jetzt als eBook bei dotbooks. Der Tempelritter Henri de Roslin befindet sich auf der Flucht. Seine Häscher sind ihm dicht auf den Fersen und haben ihn fast eingeholt – Henri scheint ihnen nicht entkommen zu können. Als letzten Ausweg bemüht er sich um einen Freibrief, der ihn unter den persönlichen Schutz des schottischen Königs stellt. Doch sein Gesuch wird abgelehnt. Henri ist verzweifelt: Inmitten von politischen Intrigen und Ränkespielen weiß er nicht mehr, wem er noch trauen kann – und sieht sich bald mit einem verfeindeten Orden konfrontiert, der die Tempelritter als Ketzer verleumdet … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Tempelritter Henri de Roslin befindet sich auf der Flucht. Seine Häscher sind ihm dicht auf den Fersen und haben ihn fast eingeholt – Henri scheint ihnen nicht entkommen zu können. Als letzten Ausweg bemüht er sich um einen Freibrief, der ihn unter den persönlichen Schutz des schottischen Königs stellt. Doch sein Gesuch wird abgelehnt. Henri ist verzweifelt: Inmitten von politischen Intrigen und Ränkespielen weiß er nicht mehr, wem er noch trauen kann – und sieht sich bald mit einem verfeindeten Orden konfrontiert, der die Tempelritter als Ketzer verleumdet …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Der Autor Stefan von Losa entstammt einem alten Familiengeschlecht, dessen Wurzeln bis in die Zeit der Süpplingenburg im Braunschweiger Land zurückreichen. Während seines Geschichtsstudiums erforschte er das spannungsreiche Verhältnis des Erzbistums von Magdeburg zum deutschen Zweig der Tempelritter eingehend.
Stefan von Losa lebt mit seiner Familie im heimatlichen Süpplingenburg.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Stefan von Losa auch den folgenden Band:
»Die Tempelritter-Saga – Band 23: Das Geheimnis des Ordens«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2016
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2015 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/LjubodragG und shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich
ISBN 978-3-95520-830-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Wolf von Roslin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stefan von Losa
Der Wolf von Roslin
Die Tempelritter-Saga
Band 19
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Anfang November 1320. Im Hafen von Edinburgh
Der Winter war früh gekommen. Die Bucht des Firth of Forth durchzog dichter Nebel, der alles mit einer eisigen Kälte überzog – die Ufer zu beiden Seiten der Bucht ebenso wie die Häuser der kleinen Ortschaft Tantallon mit ihrer mächtigen Feste und Kirkcaldy an der felsigen, nördlichen Küste gegenüber.
Auch auf den Aufbauten des Schiffes, das jetzt lautlos wie von Geisterhand in die Bucht hineinglitt, lag der neblige Hauch des eisigen Winters. Die Takelage und die schwellenden Segel waren ebenso weiß wie das Deck. Die blau-weiß-rote schottische Fahne, die man gehisst hatte, glich einem weißen, steifen Tuch.
Und auch die beiden Gestalten, die an der Reling standen und zum Ufer blickten, wo sich im Dunst die ersten flackernden Feuer der Stadt abzeichneten, waren von einem feinen Reif überzogen, der aus nichts als Feuchtigkeit und Kälte bestand. Ihre dunkle Kleidung schimmerte in einem ebenso eisigen Weiß wie ihr Gepäck, das hinter ihnen aufgestapelt lag.
Die beiden konnten es kaum erwarten, den Hafen zu erreichen und an Land zu gehen. Ihre Reise von Zypern aus hatte sie mehr als ein halbes Jahr gekostet. Durch Stürme und Piratenangriffe war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. In einem Sturm hinter Konstantinopel war einmal der Hauptmast gebrochen, woraufhin der Segler sieben Tage lang richtungslos im Meer herumgetrieben war. Einem möglichen Angriff wären sie hilflos ausgeliefert gewesen, und die kostbare Fracht aus Seide, Pelzen und Edelmetallen wäre ein Raub der Piraten geworden. Im Hafen von Palermo hatten sie schließlich auf ein Schiff warten müssen, das sie nach Bordeaux bringen konnte.
Dort, in dem französischen Atlantikhafen, der unter dem Protektorat englischer Behörden stand, waren sie im allerletzten Moment Häschern des Königs entkommen. Als englische Soldaten aufmarschierten, hatte der Kapitän des Seglers, auf dem sie angeheuert hatten, kurzerhand abgelegt, denn er war als Schotte auf die Engländer nicht gerade gut zu sprechen, ja, er hasste sie sogar noch mehr als die Franzosen.
So hatten die beiden Reisenden alle Gefahren auf ihrem Weg heil überstanden. Die mächtige Lothian glitt in den Hafen von Edinburgh, wo sie von einer geruderten Schaluppe in Empfang genommen wurde, deren Besatzung sie mit einem starken Tau verband und zu ihrem Landeplatz lotste, wo sie wiederum von Schauerleuten in einen Kanal navigiert und festgezurrt wurde. Mit einem Zittern kam der mächtige Rumpf des Schiffes zur Ruhe; es gab noch einen letzten Ruck, dann lag der Segler still, und die Bordglocke ertönte.
Henri de Roslin und Sean of Ardchatten ließen ihr Gepäck an Land bringen. Sie selbst griffen jeder nur einen Beutel, der Dinge barg, die sie nicht aus der Hand geben wollten. Während sie von Bord gingen, winkten sie dem mutigen Kapitän, Jack Elnorck, noch einmal zu, um anschließend im Menschengewirr der Hafenanlage unterzutauchen.
»Ich bin so aufgeregt, endlich deine Heimat sehen zu dürfen, Meister!«, sagte Sean.
«Es hat lange gedauert«, erwiderte Henri.«Ich bin selbst ziemlich aufgeregt, da ich nicht weiß, was mich nach so langer Zeit erwartet.«
»Wie lange warst du nicht mehr hier?«
Henri überlegte. »Es sind jetzt dreizehn Jahre«, sagte er dann. »Es war das Jahr, in dem man unseren Orden verfolgte, und ich kam nach Schottland, um meine Geschäfte zu regeln. Damals hielt ich mich in London und in St. Albans auf, um einen Mord zu untersuchen. Das war zu einer Zeit, als wir Templer noch ein hohes Ansehen genossen und unser Bezirk das Zentrum der Hauptstadt war. Jetzt sind wir auch in England verboten. Wie es in Schottland ist, weiß ich nicht, man hört Unterschiedliches.«
»Wird man uns auf Roslin überhaupt empfangen? Ich weiß, es ist deine Burg, aber angesichts der derzeitigen Situation …«
»Nun, auch ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich hörte, es gibt dort jetzt einen Verwalter. Die Burg gehört mittlerweile der Gemeinde. Wie man uns aufnehmen wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es schwierig. Aber einige der alten Bediensteten sind mir noch immer treu ergeben, dessen bin ich mir sicher.«
»Die Menschen handeln oft unvorhersagbar wie wilde Tiere«, sagte Sean. »Du musst vorsichtig sein.«
»Das werde ich, Sean. Aber dies ist meine Heimat. Vieles von dem, was ich bin, nahm hier seinen Anfang, ich musste einfach herkommen.«
Mit ihren Beuteln in der Hand suchten Henri und sein Knappe, der seine ersten Kämpfe bereits ausgetragen hatte und kurz davorstand, den Rittergürtel zu erhalten, einen Gasthof für die Nacht. Erst am nächsten Tag wollten sie nach Roslin weiterreisen.
Das Viertel am Hafen war dicht besiedelt. In Leith quoll Rauch aus den Kaminen der kleinen, geduckten Häuser, die sich um die halbrund angelegten, ungepflasterten Straßenzüge gruppierten. Kälte, Nebel und Qualm verbanden sich zu einer stickigen Masse, die sich schwer auf die Brust legte. Henri und Sean froren. Sie spürten noch die Wärme der vergangenen Monate im Süden in sich und hüllten sich fester in ihre Umhänge.
Die Kathedrale St. Giles ragte über den Dächern empor, und über allem thronte die mächtige Burg. Am Bergkamm entlang streckte sich eine lange, graue Phalanx von Bürgerhäusern, und zu deren Füßen fanden die Reisenden schließlich eine ruhige, saubere Herberge. Sie verstauten ihr Gepäck und machten sich anschließend wieder auf, um irgendwo ein stärkendes Abendessen einzunehmen.
Während sie durch die Straßen gingen, stieß Henri ein Stoßgebet aus. Es galt seinen Freunden Joshua ben Shimon, der jetzt vielleicht schon in London war, wenn seine Reise zügiger vonstatten gegangen war als die ihre, und Uthman ibn Umar. Der Sarazene hatte sich von Zypern aus nach Syrien begeben, um seine Familie wiederzusehen. Henri hoffte, dass es ihm gut ging. Aber das war ungewiss. So vieles konnte geschehen. Oft wusste man nicht einmal, ob man den nächsten Tag noch erleben würde.
»Edinburgh ist verräuchert wie eh und je«, sagte Henri missmutig. »Die Einwohner nennen die Stadt deshalb auch Auld Reekie, die Alte Verräucherte. Nicht ganz unpassend, was meinst du?«
Sean hustete. »Gewiss nicht, Herr Henri!«
Sie gingen die düsteren Straßen hinab und blickten hin und wieder neugierig in enge Hinterhöfe. Als sie am Burkes Inn vorbeikamen, erinnerte sich Henri, dass der frühere Besitzer dieser Herberge einst Durchreisende mit Kissen erstickt und die Leichen an den städtischen Henker am Grassmarket verkauft hatte, der sie an einen obskuren Mediziner weiterverhökerte, der tagsüber heilte und in der Nacht sezierte, was streng verboten war. Und hatte es nicht den Fall eines Ratsherrn gegeben, der eine ganze Reihe junger Frauen umbrachte? Edinburgh war eine dunkle Stadt voller Geheimnisse, in der sich Doppelnaturen und Schatten breitmachten, die sich vor allem in der dunklen Jahreszeit wohlfühlten.
Henri unterließ es, Sean davon zu erzählen, ebenso wie vom Grassmarket, den sie soeben passierten. Der Grassmarket war Marktplatz und Hinrichtungsstätte zugleich, Henri vermied es, einen Blick auf die Galgen zu werfen, die dort standen. Trotz der feuchten Kälte hielten sich am Rand des Platzes einige Bettler auf. In ihrer zerlumpten Kleidung saßen sie in der Nähe der Kneipen, die Namen wie The Luckpenny und The Last Drop Tavern trugen. Henri machte einen großen Bogen um diese Etablissements, die nur von Trinkern, Arbeitsunwilligen und Halsabschneidern bevölkert wurden. Für sich und Sean wollte er eine heimeligere Atmosphäre finden.
So gingen die beiden Männer nach Westen, durch die Candlemaker Row, wo sich die Kerzenzieher angesiedelt hatten, vorbei am alten Friedhof, hinter dessen schmiedeeisernen Toren die Grabsteine an den angrenzenden Häusern angebaut worden waren. Rücken an Rücken mit den Toten, dachte Henri, vielleicht ist dies die Eigenart der Einwohner wie der Schotten überhaupt – sie grenzen nichts aus ihrem Alltag aus. Henri fand, dass dies eine durchaus ehrenwerte Eigenschaft war.
Kurz darauf erblickten er und Sean einen Gasthof, in dem es angeblich gutes französisches Essen geben sollte. Da sie großen Hunger hatten, betraten sie die Gaststube. In dem gut geheizten Raum wischten sie sich den Kälteschleier aus Gesicht und Haaren. Henris Haupthaar war tiefschwarz, nur seinen Bart durchzogen erste graue Fäden; trotz seiner achtundvierzig Jahre stand er jedoch aufrecht und trat energisch auf. Sean schüttelte seine blonden Locken.
In einem großen Topf am Rande der Gaststube köchelte Zwiebelsuppe, in einem zweiten Hühnchen in Rotwein nach Burgunder Art. Der Wirt erklärte, man müsse die Franzosen bei guter Laune halten, denn sie beschützten im Moment die Schotten gegen die Engländer. Henri dachte an Kapitän Jack Elnorck, der Ähnliches erzählt hatte.
Doch an diesem Abend wollte Henri von Politik nichts wissen. Er und Sean sprachen tüchtig dem Essen zu, das tatsächlich sehr gut war und sie an bessere Zeiten in Frankreich erinnerte. Während sie aßen, verfolgten sie die Gespräche der anderen Gäste.
»Der Wind pfeift heute wieder durch die Stadt wie über ein offenes Feld«, sagte einer.
Und ein anderer ergänzte: »Und wenn du die ganze Nacht wach liegst, dann hörst du ihn über dir heulen wie einen einsamen Wolf im Moor, und er tobt mit einem Getöse wie von Schiffbrüchen und einstürzenden Häusern.«
»Es ist nasskalt im Winter, rau im Sommer und chaotisch im Frühjahr. Was hat die Stadtgründer nur dazu getrieben, hier zu siedeln, auf einem jedem Wind und Wetter ausgesetzten Bergrücken?«
»Die Schwachen sterben früh, und zwischen den kalten Winden und dem klatschenden Regen beneiden wir sie manchmal um ihr Schicksal. – Dennoch, ich möchte nirgendwo anders leben!«
»Keiner von uns will das!«
»Wirt! Schenk nach!«
»So haben sie immer geredet«, flüsterte Henri Sean zu. »Zu keiner Zeit hörte ich es anders. Die Edinburgher lieben ihre Stadt und reden ständig schlecht von ihr. Das scheint eine schottische Eigenart zu sein. Denn überall hier schimpfen die Menschen auf ihr Land, doch sie würden es niemals verlassen, es sei denn, bittere Not zwänge sie dazu.«
»So, wie sie dich gezwungen hat, nicht wahr? Ich meine, hättest du Roslin je verlassen, Meister, wenn die Templer nicht verfolgt worden wären?«
»Ich glaube nicht. Aber ich konnte es mir nicht aussuchen.«
Henri wollte eigentlich noch etwas hinzufügen, wurde aber von einem anderen Gast abgelenkt, der so laut sprach, dass Henri und Sean unwillkürlich zuhören mussten.
»In den schaurigen Gassen zu beiden Seiten der High Street«, sagte der Alte mit dem zerzausten, schlohweißen Schopf, »geht nachts manchmal ein herrenloser Spazierstock um. Und erst vor zwei Nächten habe ich gesehen, wie vor mir über dem Weg eine flackernde Laterne tanzte, ohne dass sie jemand hielt. Eine Nacht später sah ich dann in der West Bow, kurz vor dem Grassmarket, ein kopfloses schwarzes Pferd galoppieren, das sich danach in Flammen auflöste.«
»Was machst du nachts auf den Straßen, Flanagan? Erträgt dich dein Weib nicht und sperrt dich aus?«
»Oder bist du der Geist des Predigers Thomas, der Unzucht mit seiner eigenen Schwester trieb und sich mit dem Teufel einließ, sodass du jetzt ohne Rast und Ruh herumlaufen musst?«
»Nichts dergleichen, meine Freunde. Aber sind wir hier in Edinburgh nicht allesamt Blüten einer leidenschaftlichen Religion, die Aberglauben heißt? Glauben wir nicht alles, was wir sehen, genauso wie das, was wir nicht sehen, was nicht sein kann und sein darf?«
»Mensch, Flanagan, du bist ja ein Poet! Das wusste ich noch gar nicht!«
»Vor allem bin ich einer, der ständig Durst hat. Wirt, noch einen Branntwein!«
Henri und Sean hatten ihr Mahl beendet. Sie fühlten sich wohl in der Gesellschaft dieser Menschen. Darin drückte sich etwas aus, das Henri lange vermisst hatte – Ehrlichkeit. Selbst wenn es Aberglaube war, man konnte es hier äußern, ohne eine Anklage wegen Ketzerei fürchten zu müssen oder in Gefahr zu geraten, wegen seiner Gesinnung verhaftet zu werden.
Als sie gezahlt und die dampfende Gaststube verlassen hatten, empfing sie draußen wieder der eisige Nebel. Erneut hüllten sich Henri und Sean in ihre dicken Umhänge. In den Gassen war es jetzt still. Plötzlich jedoch ertönte von irgendwoher ein einzelner klagender Laut, der an entferntes Wolfsgeheul erinnerte. Spätestens da wurde Henri wieder bewusst, dass er sich hier in der Heimat der Wölfe befand. Denn so nannte der Volksmund Midlothian, die Region um Edinburgh und um Roslin. Und so mancher, der gut reden konnte, erzählte des Nachts am prasselnden Kaminfeuer Legenden von riesigen Werwölfen, die bei Vollmond erschienen und sich von menschlichem Blut ernährten.
Auch davon wollte Henri Sean nichts erzählen. Solche Geschichten würden den empfindsamen Jungen nur unnötig erschrecken. Seine Augen hatten in letzter Zeit schon genügend wirkliche Tragik, echtes Grauen und menschliche Untaten gesehen.
*
Am nächsten Morgen brachen sie früh auf. Der Nebel hatte sich gelichtet, und es war nicht mehr so kalt wie am Abend zuvor. Als dann plötzlich noch die Sonne hervorbrach, tauchte sie das weite Land in ein strahlendes Licht, in dem die reifbedeckte Landschaft herrlich funkelte. So liebte Henri seine Heimat.
Gewaltige Blöcke aus Buntsandstein, die den Weg der beiden Reiter ebenso säumten wie ausgedehnte Heideflächen, die von keiner Erhebung unterbrochen wurden, leuchteten plötzlich auf. Henri kannte die Moore in der Umgebung, und so vermied er es, den schmalen Pfad zu verlassen, der sich durch die Landschaft zwischen Edinburgh und Roslin schlängelte. Unzählige Menschen waren auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Als der Wind unversehens zunahm und die Luft schneidend wurde, machten sie Rast in einer Höhle. Sean erzählte von Feen, Zwergen und Elfen, die hier hausten. Henri fragte sich, woher sein Knappe solche Geschichten kannte, schließlich war er seit seiner frühen Kindheit nicht mehr in Schottland gewesen. Sean wusste es selbst nicht, er behauptete aber, jedes schottische Kind kenne solche Sagen und Legenden.
Sie stärkten sich und ritten bald weiter.
Eigentlich hatte Henri bis zum Einbruch der Dunkelheit seine Lehnschaft Roslin erreichen wollen. Aber im Laufe des Tages begann es heftig zu schneien, und die Wege waren nur noch schwer passierbar. Da sie Roslin noch nicht erreicht hatten und es zu dieser Jahreszeit bereits früh dunkel wurde, blieben sie in dem kleinen Ort Dalkeith. Das Dorf war an einem Hügel gebaut, und die Abwässer flossen über die ausgetretenen Wege in einen Bach hinab, sodass es überall tüchtig stank. In der Gegend um ihr Gasthaus hatte man die Abflussrinnen allerdings mit Holzlatten zugedeckt, was den Geruch erträglicher machte. Außerdem blieben Henri und Sean in Dalkeith unbehelligt. Dennoch fragte sich Henri, was ihn in seinem Heimatdorf Roslin erwarten würde, und er konnte nicht einschlafen.
Am nächsten Morgen passierten er und Sean einige uralte Rundfestungen. Henri hatte vom Wirt gehört, dass sich sechs Jahre zuvor die Freiheitskämpfer um William Wallace darin verschanzt und den Engländern schwere Verluste beigebracht hatten. Seitdem gärte es im ganzen Land. Die meisten Schotten sehnten die Unabhängigkeit von England herbei. Doch das englische Königshaus sah in ihnen nur Outlaws, Verbrecher, die für vogelfrei erklärt und rücksichtslos bekämpft wurden. Immerhin akzeptierte man inzwischen die schottische Krone, die Robert the Bruce derzeit trug. Doch der Weg in die schottische Unabhängigkeit war von Gewalt und Elend gesäumt, und Henri betete für einen starken König Robert.
Noch immer schneite es. Da erblickte Henri vor sich plötzlich Spuren, die nur ein Rudel Wölfe hinterlassen haben konnte. Da der frisch fallende Schnee sie nicht verdeckte, konnte das Rudel noch nicht lange fort sein.
Henri zügelte sein Pferd und bedeutete Sean, sich still zu verhalten. Er lauschte. Doch außer dem leise fallenden Schnee und vereinzelten kleinen Schneelawinen von zugeschneiten Baumkronen war nichts zu hören. Selbst die Raben, die wie geheimnisvolle schwarze Punkte in der weißen Landschaft wirkten, blieben stumm.
»Reiten wir weiter«, sagte Henri. »Zum Glück sind wir tagsüber unterwegs. In der Nacht möchte ich hier keinem Wolfsrudel begegnen.«
»Aber das sind doch keine Gegner, wir haben, wie du weißt, schon ganz andere Feinde besiegt«, wunderte sich Sean.
»Du irrst dich, Knappe«, erwiderte Henri. »Ein Rudel hungriger Wölfe ist ungemein gefährlich. Wölfe sind überaus intelligente Raubtiere, sie wissen im Vorhinein, was du tun wirst, und sie lassen nicht locker, bis entweder du tot bist – oder sie.«
»Das kann ich nicht glauben, Herr Henri«, meinte Sean. »Das würde ja bedeuten, dass Wölfe denken können.«
»Bete dafür, dass wir den Beweis für meine Behauptung nie geliefert bekommen«, sagte Henri. »Reiten wir weiter.«
Die Stille war körperlich spürbar. Henri und Sean durchquerten einen Wald, in dem sich ihr Pfad an Felsbrocken und wild wucherndem Gestrüpp vorbeischlängelte. Henri hielt die Augen offen und sah, dass auch Sean die Umgebung mit wachen Blicken beobachtete. Sie atmeten auf, als das Waldstück hinter ihnen lag.
Der Rest des Weges ging über offenes Gelände. Doch einfacher wurde er dadurch nicht, jedenfalls nicht für Henri, denn je weiter er sich Roslin näherte, umso widerstreitender wurden seine Gefühle.
Er erinnerte sich an seine Herkunft, seinen Eintritt in den Tempel und den Großkomtur, der ihn aufgenommen hatte. Und er erinnerte sich an die Aufnahmeprozedur. Der Generalvisitator des schottischen Ordens hatte dies besorgt. Darüber hinaus war ein Komtur mit weißen Haaren anwesend gewesen, im Hintergrund hatten die Ordensbrüder gestanden. Der junge Henri hatte ein Gelübde abgelegt, mit dem er Gehorsam und die Einhaltung der Ordensregel gelobte, dann hatte man ihm ein Bronzekreuz zum Kuss hingehalten. Anschließend hatte ihm der Komtur den weißen Mantel um die Schultern gelegt. Henri sah all dies deutlich vor sich. Aber er hatte keine Erinnerungen an seine Eltern, die ihn vom Tempel hatten erziehen lassen. Was hatte sie dazu bewogen? Er hatte es nie erfahren.
Vater und Mutter waren in Roslin gestorben und nahe der Burg beigesetzt worden. In ein paar Stunden würde Henri an ihren Gräbern stehen. Andere Familienmitglieder gab es nicht, nicht einmal entfernte Verwandte.
Jetzt, dachte Henri, werden wir sehen, ob der Kreis sich schließt. Und was darin bleibt, das es wert ist, festgehalten zu werden.
Kurz darauf teilten sich die dunklen Schneewolken, und mit einem einzigen gebündelten Strahl warf die Sonne ihr Licht auf die Burg von Roslin, den Stammsitz von Henris Vorfahren. Fast grob verhielt Henri sein Pferd, das aufwieherte, so sehr berührte ihn der Anblick.
Genau hier, an diesem Ort, hatte sein Leben vor achtundvierzig Jahren begonnen. Es hatte ihn in die ganze Welt geführt. Und nun, da er fast ein halbes Jahrhundert gelebt hatte, kam er an den Ort seiner Kindheit zurück, und es konnte sein, dass es für immer war.
Henri ließ sein Pferd unruhig tänzeln. Sean blickte ihn von der Seite her aufmerksam an. Er schien sich zu fragen, was sein Herr empfand.
Henri hätte darauf keine Antwort geben können. Seine Gefühle schwirrten durcheinander, ebenso seine Gedanken. Er seufzte. Dann ließ er sein Pferd antraben und legte die letzte Meile im leichten Galopp zurück.
Kurz bevor sie den Ort erreichten, erhob sich vor ihnen ein Schwarm Krähen. Er flog über ihre Köpfe hinweg und verschwand lautlos in der Weite der Moore und den angrenzenden Wäldern.
Henri kam es plötzlich so vor, als hätten die schwarzen Vögel den Ort bisher besetzt gehalten. Und nun, da der Lehnsherr zurückgekommen war, flüchteten sie, so als wäre kein Platz mehr für sie in dieser Gegend und als würde eine neue Zeit anbrechen.
Henri schüttelte den Gedanken ab. Aber etwas davon blieb in seiner Vorstellung haften. Vielleicht begann jetzt wirklich etwas Neues. Er würde seine Verhältnisse ordnen können, und damit ging auf jeden Fall etwas Altes zu Ende.
Seine Flucht würde endlich vorüber sein.
»Beeilen wir uns!«, sagte Henri zu Sean. »Ich kann es nicht mehr erwarten, in den Ort zu kommen. Es ist mir, als wäre ich nicht lange fort gewesen und die Räume in der Burg seien noch warm vom Feuer, das ich selbst entzündet habe. Und als sei es höchste Zeit, dass ich zurückkomme.«
»Auch ich kann es kaum erwarten, die Burg zu sehen!«, bekannte Sean. »So oft habe ich mir vorgestellt, wie es hier aussehen mag. Und doch ist es ganz anders, als ich es mir ausgemalt habe.«
»Es ist so geblieben, wie es immer war«, rief Henri seinem Knappen über die Schulter zu. »Nur ich habe mich, wir haben uns verändert.«
Und sie spornten ihre Reittiere mit Rufen an und gaben ihnen die Hacken.
2
Anfang November 1320. Die Angst und die Kälte
In der alten, verräucherten Wirtsstube von Roslin saßen die Menschen dicht an dicht. In der Mitte des niedrigen Raums brannte ein offenes Feuer. Der Winter hatte in diesem Jahr besonders früh eingesetzt, und das Eis und die Kälte erschwerten das Leben der Menschen. Was den Menschen in Roslin und Umgebung allerdings noch mehr zusetzte, war die Angst. Sie zitterten nicht nur wegen der Kälte, sie schauderten vor dem, was man sich in diesen Tagen erzählte.
Aber konnte man den Berichten trauen? Ein riesiger Wolf solle die Wälder unsicher machen, sagte man. Er habe zahlreiche Tiere gerissen und vier Bauern seien ihm schon zum Opfer gefallen.
»Vielleicht gehört das Untier den Räuberbanden, die hier seit dem Krieg überall herumziehen«, sagte der Wirt. »Die Banditen richten Wölfe ab, die ihnen den Weg freimachen. Denn eins ist sicher: Die meisten ergreifen die Flucht, sobald sie einen Wolf auch nur erblicken, und lassen Hab und Gut zurück, sodass die Halunken nur noch zuzugreifen brauchen.«
»Kein Mensch kann einen Wolf zähmen!«, rief der Koch. »Schon gar nicht einen so blutrünstigen wie diesen. Meinten nicht alle, die ihn gesehen haben, dass er größer sei als jeder Hund, fast so groß wie ein Ochse, aber auf jeden Fall so groß wie ein Kalb?«
»Das ist übertrieben«, sagte der Ortsschreiber. »Einen so großen Wolf gibt es nicht.«
»Es muss ein Werwolf sein«, sagte der Gehilfe des Vogts. »Die werden äußerst groß, das weiß jeder, denn sie sind nicht von dieser Welt und fallen nicht unter die Gesetze der Natur. Sagt man nicht auch, das Ungeheuer habe von innen geleuchtet?«
»Werwölfe gibt es nicht, das solltest gerade du wissen, Amtmann«, warf der Koch ein. »Aber drüben in Glennkiln gab es einmal einen Wolf, der sogar in Häuser einbrach. Er war so schlau, dass man ihn nicht zur Strecke bringen konnte. Schließlich verschwand er und tauchte in Stanret wieder auf. Er schien übersinnliche Fähigkeiten zu. besitzen. Letztlich stellte sich dann aber heraus, dass es ein gewöhnlicher Wolf war, der allerdings schon viele Jahre auf dem Buckel hatte und daher einige Tricks kannte.«
»Wenn sie Hunger haben, hält keiner sie auf«, sagte die Frau des Ortsschreibers schaudernd. »Es sind grauenhafte Kreaturen.«
»Fressen will jeder«, sagte der Koch.
»Das stimmt!«, entgegnete der Wirt. »Stellt euch vor, ihr kriegt tagelang nichts zwischen die Zähne. Wenn es nur lange genug dauert, wird jeder zum Wolf.«
»Ja, aber hast du dich schon mal in den Arm oder das Bein deines Nachbarn verbissen, nur weil die Rationen kleiner wurden? Wir sind durchaus keine Menschenfresser, mein Guter.«
Mit einem Mal war von draußen Geheul zu hören. Alle erstarrten und lauschten. Aber es war nur der sich aufbäumende Wind, der gegen das Haus drückte und durch die Ritzen der Außenmauern zog, die der Wirt nicht ausreichend mit Geflecht und Lehm abgedichtet hatte.
»Solche großen Wölfe tauchen immer dann auf, wenn eine Veränderung bevorsteht«, sagte plötzlich der Ortsschreiber in die Stille der Wirtsstube hinein. »Schon bald wird etwas geschehen, da könnt ihr sicher sein, meine Lieben. Ein Fremder wird kommen und große Unruhe stiften.«
Einige der Anwesenden zogen hörbar den Atem ein.
»Was redest du denn da?«, fuhr die Frau des Ortsschreibers ihren Mann an. »Mach uns doch keine Angst. Es ist Winter, und es ist kalt, und draußen gibt es ein hungriges Rudel Wölfe, das ein paar Tiere gerissen hat. Das ist nicht schön, aber es ist auch alles. Der Jäger wird die Viecher erlegen. Und dann ist der ganze Spuk vorbei.«
Doch der Ortsschreiber ließ sich nicht beirren. »Einer wird kommen!«, wiederholte er beharrlich. »Ich habe es in den alten Chroniken gelesen. Alle zwanzig Jahre taucht im Winter ein Mann mit den Wölfen auf, der alles durcheinanderbringt. Die Frage ist nur, ob uns dieses Durcheinander nützen oder schaden wird.«
Draußen waren plötzlich Hufschläge zu hören, die vor der Tür des Wirtshauses innehielten. Die Gäste im Inneren verstummten. Sie starrten zur Eingangstür. Jemand kam näher. Etwas fiel zu Boden, dann ertönten abermals Schritte. Vor dem Eingang erstarben sie.
Dann wurde die Tür aufgerissen. Ein Windstoß fuhr durch die Stube, und hinter den dichten Schneeflocken, die der Wind mit sich brachte, erkannten die Gäste zunächst nicht, wer es war, der dort im Türrahmen stand. Sie sahen nur eine kantige, dunkle Gestalt, die sich schüttelte wie ein durchnässter Hund.
Als die Gestalt die Tür geschlossen hatte und alle Schneeflocken zu Boden gefallen waren, erkannten die Leute im Schankraum sie schließlich doch. Und insgeheim atmeten sie auf. Es war der Verwalter von Roslin, der laut fluchend in die Stube trat. Mit einem energischen Ruck riss sich der hochgewachsene, rothaarige Mann, dessen rechte Schläfe eine bleiche Narbe verunstaltete, den Umhang von der Schulter, dann stapfte er zu einem der Tische und ließ sich auf eine Bank fallen.
»Was für ein Sauwetter«, zeterte er. »Ein elendes, verfluchtes Mistwetter! Bei solch einer Eiseskälte jagt man keinen Hund vor die Tür.«
»Was führt Euch dann ins Freie und zu mir, Verwalter Dunoon?«, wollte der Wirt wissen.
»Ich habe ganz gemeinen, schnöden Hunger, Wirt«, erwiderte der Verwalter und schüttelte sich erneut. »Mein Koch ist krank. Er hat irgendeine rätselhafte Krankheit, die der Medicus nicht heilen kann. Tischt mir nur schnell etwas Warmes, Dampfendes auf!«
»Kommt sofort«, sagte die Wirtsfrau und scheuchte den Koch in die Küche. »Es gibt frisches Stew vom Hammel.«
»Soll mir recht sein, wenn es nur die Kälte vertreibt!«, sagte der Verwalter. Er strich sich über die borstigen, roten Haare und sah sich in der Gaststube um. »Hier sind noch mehr Hungrige, wie ich sehe.«
Die Wirtsfrau brachte sogleich den verrußten Eisentopf, der über dem Feuer gehangen hatte, und einen Holzteller. Alle sahen zu, wie sie dem Verwalter auftrug. Nachdem dieser gierig einige Löffel verschlungen hatte, fragte ein Gast neugierig: »Gibt es was Neues von den Wölfen, Verwalter? Ihr müsst es doch wissen.«
»Nichts Neues«, entgegnete Dunoon kauend. »Aber das macht mir sowieso keine Sorgen. Mit Wölfen muss man umgehen können. Die kommen und gehen.« Er schob einen weiteren Löffel Stew in den Mund, kaute, hob den Zeigefinger und sagte: »Etwas anderes bereitet mir weit größeren Kummer. Darum war mir der Ritt hierher auch sehr willkommen. Ich musste nachdenken, und das kann ich nicht, wenn ich in meiner Stube sitze.«
»Was ist es denn?«, fragte der Ortsschreiber und kratzte sich den verfilzten Bart.
»Habt ihr die Stelen gesehen?«
»Was sollen wir gesehen haben?«
»Die Stelen. Die mit den Gestalten, den Gesichtern. Sie stehen seit Tagen am Friedhof. Jemand hat sie dort abgestellt. Und ich frage mich nun, wer das war und was das zu bedeuten hat.«
»Ihr habt Recht«, sagte der Büttel. »Jetzt, wo Ihr es erwähnt, erinnere ich mich. Ich sah diese Stelen, wie Ihr sie nennt, auch. Aber ich habe nicht weiter darauf geachtet. Es sind Steine, nicht wahr, sie begehen keine strafbaren Handlungen. Also bin ich dran vorbeigeritten.«
»Hmm,« brummte der Verwalter kauend, »da sind wir offenbar gegenteiliger Meinung. Denn ich glaube durchaus, dass sie strafbare Handlungen begehen.«
»Wer?«
»Die Stelen. Ich glaube, sie werden Verbrechen begehen. Sie sind von dieser Art, das zu tun.«
»Aber Herr Verwalter«, entfuhr es dem Wirt, »was um Himmels willen meint Ihr damit?«
»Eben das, was ich sage«, entgegnete Dunoon. »Diese Stelen werden ein Verbrechen begehen. Sie haben sogar bereits eines begangen, oder besser gesagt, sie zeigen eines. Eine zumindest zeigt es ganz deutlich.«
»Was zeigt sie? So redet doch!«, flehte der Wirt. Und die restlichen Gäste nickten ihm eifrig zu.
Doch der Verwalter ließ sich mit seiner Antwort Zeit. »Das Stew ist gut, hol’s der Teufel«, sagte er, und erst nach einer kurzen Pause, in der er sich genüsslich über den Bauch strich, fuhr er fort: »Nun, diese Stele. Tja, meine Lieben, die wird uns noch Sorgen bereiten. Sie zeigt Priester Wigtown, der ja, wie ihr wohl alle wisst, vor vier Monaten unter mysteriösen Umständen von uns gegangen ist. Sein Tod hat nicht nur in Roslin für viel Wirbel gesorgt. Und nun prangt sein Gesicht auf einem dieser Steine, die am Friedhof stehen.«
»Unmöglich!«
»Aber wahr!«, sagte der Verwalter.
»Priester Wigtowns Gesicht prangt auf einem dieser Steine, Ihr meint, es wächst daraus hervor?«, fragte der Wirt.
»Nun …«
»Das müssen wir uns ansehen!«, rief der Büttel. »Wenn das stimmt, sind wir einer höchst seltsamen Sache auf der Spur!«
»Das will ich meinen«, sagte Dunoon. »Aber lasst mich euch erst mehr darüber berichten. Solchen Dingen tritt man am besten nicht unvorbereitet gegenüber.«
»Was sieht man genau auf diesem Stein?«, wollte der Gehilfe des Vogts wissen.
»Nun – Wigtown.«
»Sonst nichts?«
»Doch, an seinem Hals sieht man zudem einen Hund. Es kann auch ein Wolf sein. Er hat eine spitze Schnauze. Der Steinmetz hat ihn weniger gut ausgearbeitet als Wigtown.«
Die Wirtin machte große Augen und hielt sich vor Schreck die Hand vor den Mund. »Der Priester starb durch den Biss eines Hundes oder Wolfes!«, rief sie.
»Eben«, meinte der Verwalter. »Ist das nicht merkwürdig? Wer stellt nach einem solch tragischen Vorfall einen derartigen Stein her? Welcher Steinmetz kommt dafür in Frage? Es muss einer sein, der sein Handwerk versteht, davon zumindest konnte ich mich überzeugen. Er hat schnell und dennoch akkurat gearbeitet.«
»Und was zeigen die anderen Stelen?«, fragte der Büttel.
»Das will ich euch sagen – soweit ich mich daran erinnern kann jedenfalls. Es sind immerhin ganze zwölf Stück.«
»Was? So viele?«
»So viele, in der Tat.«
»Noch Stew?«, fragte die Wirtsfrau.
»Wie? Nein danke.« Dunoon schüttelte verwirrt den Kopf. »Wo war ich stehengeblieben? Ach so, ja, die Stelen. Also, sie zeigen seltsame Gestalten und Gesichter. Das erste zeigt einen Mann mit einem Tatzenkreuz vor der Brust.«
»Ein Kreuzritter!«, rief jemand aus der Menge.
»Das kann ich nicht entscheiden. Es könnte auch ein Templer sein, wie der frühere Burgherr, Henri de Roslin, einer war.«
»Was aus dem wohl geworden ist?«, überlegte der Ortsschreiber. »Man munkelt, dass er die Zerschlagung des Ordens überstanden hat und anschließend in wilder Flucht durch die ganze Welt gereist ist! Ich sage euch, wenn …«
»So lasst doch den Verwalter sprechen!«, murrte der Wirt.
Als es wieder still war im Schankraum, fuhr Dunoon fort: »Also, die zweite Stele. Meine Lieben, ich sage euch, sie zeigt tatsächlich einen Kreuzfahrer. Er sitzt auf seinem Pferd, und an seiner Seite reiten zwei Knappen.«
»Und die dritte Stele?«, wollte der Büttel wissen. »Lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen!«
Der Verwalter kratzte die Reste aus seinem Teller, schob ihn von sich und rülpste dezent. »Die dritte Stele, ja, die dritte Stele, ihr Lieben! Sie zeigt einen Mann, der ein pochendes Herz vor sich herträgt.«
»Ein pochendes Herz? Ich denke, es ist aus Stein geschlagen! Wie kann es dann pochen?«
»Das ist symbolisch gemeint, Büttel! Es scheint zu leben, verstehst du?«
»Nein, eigentlich nicht. Aber ich werde noch ein wenig darüber nachdenken. Erzählt uns inzwischen von dem vierten Bild. Was ist darauf zu sehen?«
»Das vierte Bild zeigt Luzifer, wie er als Engel in die Hölle hinabstürzt. Sein Mund ist weit aufgerissen, so als schreie er verzweifelt gegen sein trauriges Schicksal an.«
»Wie schaurig!«, sagte die Wirtsfrau und bekreuzigte sich. »Wo kommen diese Stelen bloß her?«
»Wenn ich das nur wüsste«, sagte der Verwalter. »Sie stehen jedenfalls genau dort, wo Priester Wigtown die neue Kirche bauen wollte.«
»Das wird ja immer mysteriöser!«, sagte der Ortsschreiber. Doch statt zu zittern wie die meisten anderen in der Stube, trat ein leichter Glanz in seine Augen, ganz so, als würde er sich über die schaurigen Neuigkeiten freuen.
»Da fällt mir gerade etwas ein«, meinte der Verwalter nachdenklich. »Kurz bevor Wigtown starb, nach der Messe in Bonnyrigg, erzählte er mir, dass er einen ehemaligen Kreuzfahrer kennengelernt habe und mit dessen Geld die Kirche in Roslin bauen wolle, damit wir nicht immer in die Nachbargemeinde laufen müssen. Außerdem meinte er, dass er Steine besäße, auf denen wie in einer Chronik die Geschichte von Roslin abgebildet sei sie erzählten, was geschehen sei und was geschehen würde. Die Steine sollten den Grundstock für den Schmuck der neuen Kirche bilden.«
»Unsinn! Das kann doch gar nicht sein! Wie kann man etwas abbilden, das noch gar nicht geschehen ist!«
»Ich weiß es nicht. Wigtown sagte es so. Ich erinnere mich ganz genau daran.«
»Munkelte man vor einiger Zeit nicht etwas über Priester Wigtown?«, sinnierte der Ortsschreiber. »Irgendwas über seine Vergangenheit? Soll er nicht Kinder gehabt haben?«
»Priester Wigtown und Kinder?« Die Wirtsfrau machte große Augen. »Mit wem soll der denn Kinder gehabt haben?«
»Mit einer Frau!«, antwortete der Wirt.
»Ach ja, was du nicht sagst. Aber mit welcher? Aus unserem Ort kam sie jedenfalls nicht.«
»Ich sage ja, irgendetwas war mit seiner Vergangenheit!«
»Ach was! Priester haben keine Vergangenheit! Zumindest nicht so eine verwerfliche. Sie leben in der Gegenwart und verkünden uns das Jüngste Gericht in der Zukunft!«
»Mit Wigtown war was! Wenn ich mich nur erinnern könnte!« Der Ortsschreiber runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach.
»Ging es nicht um einen Schatz?«, sagte der Büttel. »Brachte Wigtown nicht großen Reichtum mit, als er vor zwei Jahren hier zu uns nach Roslin kam? Oder kündigte diesen zumindest an?«
»Der Schatz der Templer!«, entfuhr es dem Ortsschreiber. »Ihr könntet Recht haben, Büttel! Wigtown war keinesfalls mittellos, als er zu uns kam. Und das ist unüblich für einen Priester.«
»Das ist überhaupt nicht unüblich! Viele Priester kommen aus adligen Familien, und die haben reichlich Vermögen.«
»Dieser nicht!«, konterte der Ortsschreiber. »Wigtown war kein Adliger. Wo er herkam, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er kein Adliger.«
»Schon gut, schon gut! Sein plötzlicher Tod zerschlug jedenfalls die Pläne für eine eigene Kirche für Roslin!«
»Die Umstände von Wigtowns Tod konnten bisher nicht geklärt werden«, sinnierte der Schreiber. »Zwar hat es Nachforschungen gegeben, doch die führten zu nichts. Was geblieben ist, sind Gerüchte und abergläubische Hirngespinste.«
»Jammerschade! Diese Kirche sollte so prächtig werden! Mit einer so kolossalen Westfassade, wie man sie selbst in Edinburgh nicht kennt – so jedenfalls drückte sich der Priester aus!«
»Ihr erinnert Euch mittlerweile ja an eine ganze Menge, Verwalter«, sagte der Wirt. »Wer könnte, Eurer geschätzten Meinung nach, denn Interesse daran gehabt haben, den Bau der Kirche zu unterbinden?«
»Woher soll ich das wissen?«
»In Roslin jedenfalls niemand!«, sagte der Wirt. »Die Kirche hätte dem Ort höchstes Ansehen gebracht und vielleicht sogar unsere Märkte und Zünfte gefördert.«
»Dann wären Neider denkbar, die uns kleinhalten wollen!«
»Aus Gorebridge? Aus Glennkiln? Oder aus Sweetheart Castle?«
»Oder jemand aus dem Moor!«, sagte der Ortsschreiber.
»Ach was!«, sagte der Wirt. »Dort wohnt doch niemand! Zumindest kein Lebender!«
»Das stimmt nicht ganz. Das Moor ist zwar spärlich besiedelt, das gebe ich zu, aber durchaus nicht menschenleer. Dort leben mindestens fünf Moorbauerfamilien.«
»Und Räuber«, ergänzte die Wirtsfrau. »Wir wissen doch alle, dass sie sich von dort aus auf ihre Raubzüge begeben und sich anschließend wieder ins Moor zurückziehen, wohin ihnen niemand folgen mag.«
»Vielleicht bedient sich jemand dieser Räuber und dieser Hunde«, spekulierte der Ortsschreiber, »um den unheimlichen Ruf Roslins zu erhalten und zu behaupten, ein schreckliches, immerwährendes Unheil läge über unserem Ort. Und der Tempelritter sei daran schuld.«
»Oder der Priester und seine Vergangenheit!«
»Wigtown fragte mich manchmal, ob ich an Spuk glaube«, sagte der Ortsschreiber. »Ob ich nicht jenes sonderbare Wesen gesehen, oder das Bellen eines Hundes ganz in der Nähe gehört hätte, obwohl es keinen Hund gab.«
»Das fragte der Priester Euch tatsächlich?«
»Immer wieder! Besonders während der dunklen Jahreszeiten! Wir saßen oft zusammen und unterhielten uns über die Geschichte von Roslin und verschiedene Glaubensfragen. Einmal empfing er mich am späten Abend in seinem Haus am Ortsrand, wo das Moor beginnt. Als er die Tür öffnete, blickten seine Augen plötzlich starr an mir vorbei, so als sähe er etwas Entsetzliches hinter mir. Ich drehte mich um und konnte gerade noch einen schemenhaften Umriss erkennen, der mir wie ein großes, schwarzes Kalb vorkam. Die Gestalt eilte vorbei und war im nächsten Moment verschwunden. Wigtown deutete nur mit der Hand darauf, er zitterte vor Erregung. Wir gingen dann ins Haus, und ich verbrachte die halbe Nacht bei ihm. Er wollte nicht allein bleiben. Ich hielt ihn für überreizt. Er steigerte sich in seine Ängste hinein und ließ sich durch nichts beruhigen.«
»Aber Ihr habt das seltsame Tier mit eigenen Augen gesehen?«
»Nun ja, es war eher ein Schatten. Es kann eine Täuschung gewesen sein. Im Moor sieht man vieles, das in Wahrheit gar nicht da ist.«
»Aber die entsetzliche Katastrophe ist dann ja tatsächlich eingetreten. Wigtown wurde getötet, wahrscheinlich von einem Hund! Man fand seine Leiche im Moor. Sein Gesicht war angstverzerrt, die Hände zu Krallen versteift, und am Hals klafften große hässliche Wunden! Also waren seine Ängste durchaus keine Hirngespinste!«
»Mein Gott, warum müssen ausgerechnet wir das alles durchmachen?«, entfuhr es der Frau des Ortsschreibers. »Warum wir und nicht die Leute von Bonnyrigg oder Glennkiln?«
»Ein Fluch liegt auf Roslin, das habe ich immer gesagt!«, meinte der Ortsschreiber. »Und am schlimmsten hat unser Lehnsherr ihn zu spüren bekommen!«
»Der arme Herr Henri!«, seufzte die Wirtin. »Ich würde ihm mein bestes Stew kochen, wenn er nur zurückkäme.«
»Er wird schon Schuld auf sich geladen haben!«, sagte der Verwalter, »sonst hätte man ihn nicht verfolgt.«
»Die Templer hatten alle Dreck am Stecken!«, sagte der Büttel.
»Eben nicht«, sagte der Wirt. »Man verfolgte sie, weil man sie loswerden wollte, aus welchem Grund auch immer. In Frankreich sowieso, aber auch in England. Sie sind Opfer der Willkür eines verrückt gewordenen französischen Königs!«
»Sei’s drum!«, sagte der Verwalter. »Die fünfte Stele zeigt eine Mutter mit ihrem Kind. Und daneben den leibhaftigen Teufel.«
»Was soll das alles bedeuten? Das ergibt doch keinen Sinn. Und diese Stelen sollen unserem Wigtown gehört haben? Hat er sie anfertigen lassen, um sie später in der Kirche anzubringen?«
»Das ist zu vermuten, er deutete es jedenfalls an«, sagte der Verwalter. »Vielleicht erwarb er sie aber von jemandem, der uns unbekannt ist. Oder man stellte sie bei ihm ab. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Die sechste Stele zeigt jedenfalls einen Ritter, der ein hölzernes Kruzifix vor sich trägt.«
»Ist das unser Herr Henri? Mit dem Kreuz, das er zu tragen hat?«
»Ich kenne ihn nicht von Angesicht«, bekannte der Verwalter. »Daher kann ich es nicht sagen. Ich kam ja erst nach Roslin, als man ihn schon vertrieben hatte. Und in der Burg gibt es keine Abbildungen von ihm.«
»Große Gestalt, halblange, schwarze Haare, gestutzter Bart, große Augen, energisches Kinn, wohlgeformte Gesichtszüge, so hat er ausgesehen«, erinnerte sich die Wirtsfrau; ihre Stimme hatte einen schwärmerischen Ton angenommen.
Der Verwalter zuckte die Schultern.
»Seine Burg bekommt er jedenfalls nicht zurück«, sagte der Büttel. »Die bleibt im Besitz der Ortsverwaltung. Henri de Roslin gehört hier gar nichts mehr, und er müsste schon sehr viel Wohltätiges tun, um hier wieder Fuß zu fassen.«
»Die siebte Stele«, unterbrach der Verwalter den Büttel, »zeigt einen Musikanten, der einen Dudelsack spielt. Die achte Stele eine Dämonenfratze, halb Tier, halb Mensch, sie ist grünlich angemalt. Die neunte zeigt seltsame Wesen in geduckter Stellung, wieder halb Mensch, halb Dämon. Die zehnte einen Engel, der auf einer Art Flöte spielt.«
»Und das sollte Schmuck für unsere Kirche sein? Es klingt eher nach einem Gruselkabinett.«
»Was zeigt die elfte Stele?«, wollte jemand wissen.
»Sie zeigt einen Grabstein vor einer Säule. Die Inschrift ist unleserlich. Jedenfalls konnte ich sie auf den ersten Blick nicht entziffern.«
»Die zwölfte Stele zeigt dann wohl den unglücklichen Priester Wigtown und die Bestie, die ihn tötet?«, fragte der Gehilfe des Vogts.
»Sehr richtig! Ihr seid ein schlaues Bürschchen.«
»Und alle diese Steine stehen am Rand des Friedhofs? Und niemand weiß, woher sie kommen?«
»Vielleicht sind sie vom Himmel gefallen«, mutmaßte ein Stallknecht. »Viele Dinge fallen in kalten Nächten vom Himmel!«
»Sei still, John!«, fuhr ihn der Büttel an. »Du weißt gar nichts!«
»Eins ist jedenfalls sonnenklar«, sagte Dunoon. »Diese Steine haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Und dass sie gerade jetzt auftauchen, ist ebenso bedeutsam. Wir gehen Zeiten entgegen, in denen wir sehr wachsam sein müssen, meine Lieben! Seid vorsichtig bei allem, was ihr tut! Jeder unbesonnene Schritt kann verhängnisvolle Folgen haben!«