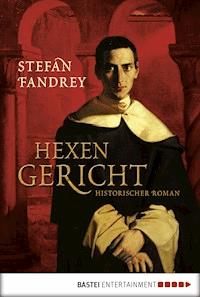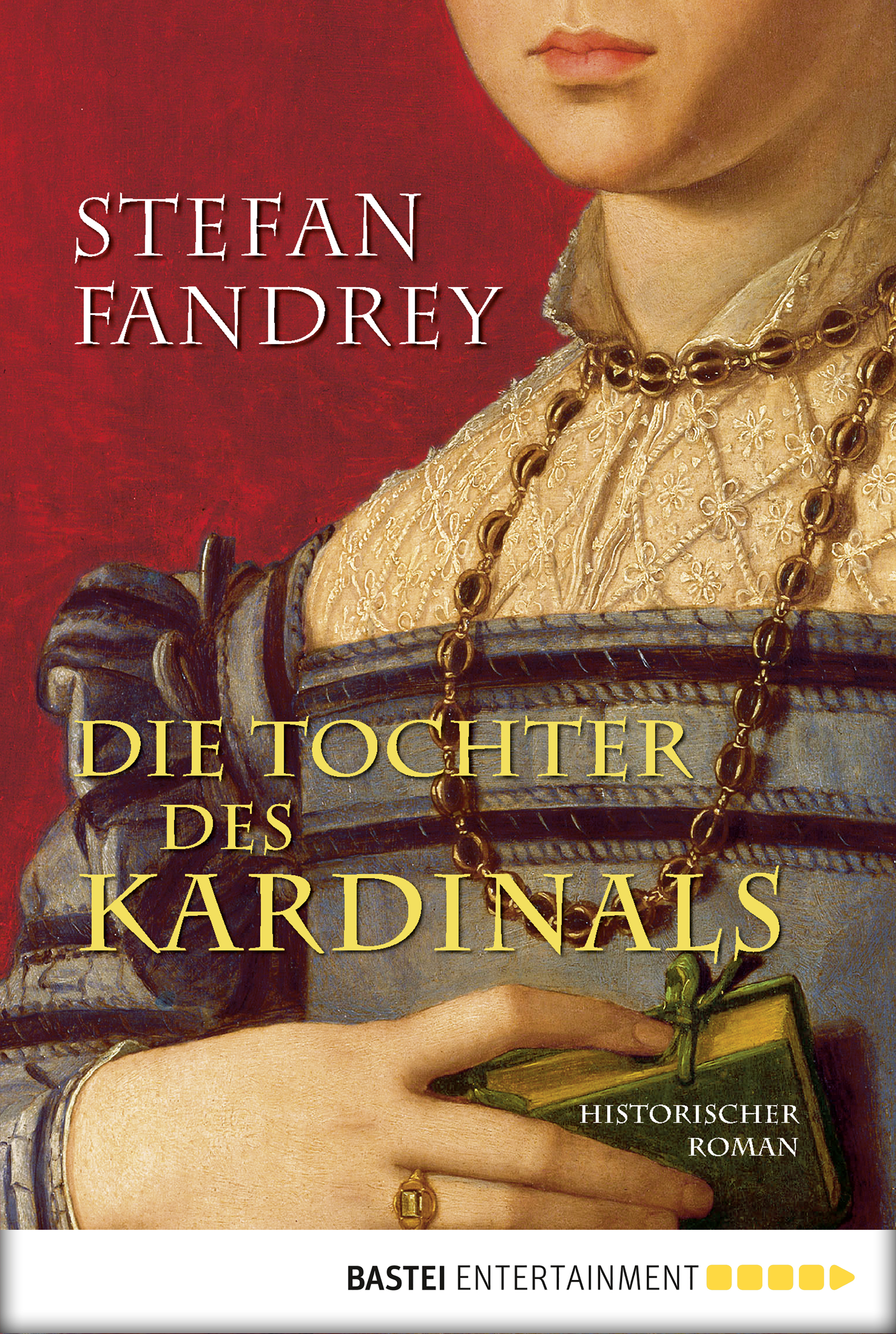
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Italien, 1589. Rom wankt unter der Macht der um sich greifenden Reformation. Immer mehr Fürsten bekennen sich zu dem neuen christlichen Glauben. Die Gegner des Papstes wittern eine einmalige Chance, allen voran sein größter Feind, Kardinal Callisto Carafa. Doch seine Mittel sind begrenzt, ein erster Mordanschlag schlägt fehl. Carafa benötigt Informationen aus dem engsten Umfeld Sixtus' V. Unter einem Vorwand lässt er die junge Benediktinernonne Giulia nach Rom holen. Diese ahnt nichts von Carafas niederträchtigem Plan ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stefan Fandrey
DIE TOCHTERDES KARDINALS
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Lutz Steinhoff
Titelillustration: akg-images/Rabatti-Domingie
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2126-2
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
FÜRMEINE GROSSELTERNCHRISTELUND WALTER DANISCH
GOTTISTÜBERALL,AUSSERWOERSEINEN STELLVERTRETERHAT.
(Italienisches Sprichwort)
PROLOG
IRGENDWOIN ITALIEN, IM JAHREDES HERRN 1570
Seit Tagen hatten sie die Sonne nicht mehr gesehen.
Kein Sonnenstrahl drang durch die dunklen Wolken. Es regnete wie seit Monaten nicht mehr. Die Kühe lagen müde und teilnahmslos auf den Weiden, die Schweine verspürten nicht die geringste Lust, sich im Schlamm zu suhlen. Kein Vogel, der fröhlich in den Baumwipfeln sang, kein Kind, das in den Gassen herumtollte, kein Bauer, der das Feld bestellte. Nur Regen, Blitz und Donner.
Die beiden Reiter, die an diesem Abend durch Dörfer und Wälder, über Wiesen und Äcker preschten, als wäre der Teufel hinter ihnen her, nahmen die Trostlosigkeit um sie herum kaum wahr. Ihre Blicke waren starr nach vorn gerichtet. Die Hufe der Tiere gruben sich tief in den aufgeweichten Boden und peitschten ihn auf. Die vereinzelten Rufe, mit denen sie ihre Pferde antrieben, waren die einzigen Laute, die aus ihrer Kehle drangen.
Dann plötzlich ein erstickter Schrei. »Halte ein!«, rief eine Frauenstimme.
Der zweite Reiter hielt sein Pferd an und machte kehrt. Neben der Frau angekommen, schob er die Kapuze seines Mantels in den Nacken. Zum Vorschein kam das hagere Gesicht eines Mannes von etwa dreißig Jahren. Das dichte schwarze Haar hing ihm im Nu in nassen Strähnen ins Gesicht. Aus gehetzten dunklen Augen starrte er seine Begleiterin an. »Was ist geschehen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, herrschte er sie an: »Wir müssen weiter. Eil dich!«
Sie schüttelte den Kopf und schob ebenfalls ihre Kapuze nach hinten. Lange dunkle Locken umrahmten ein zierliches blasses Gesicht. »Ich kann nicht mehr!«, stieß sie hervor.
»Was soll das heißen?«, fragte er. »Wir haben keine Zeit, zu rasten.«
»Ich glaube, es ist so weit«, keuchte sie.
»Was ist so weit?«
Trotz der Anstrengungen brachte sie ein Lächeln zustande. Und in diesem Augenblick verstand er. Er sah auf die Wölbung unter ihrem Mantel. »Du meinst …?«
Sie nickte mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Hastig sah er sich um. Dann zeigte er hinunter ins Tal. »Dort ist ein Dorf. Hältst du bis dorthin durch?«
Wieder nickte sie. Und während sie sich aufstöhnend nach vorn beugte und beide Hände auf ihren Bauch legte, griff er nach ihren Zügeln. So trabten sie dem Dorf entgegen.
Das Dorf bestand aus ärmlichen Häusern, die an einer breiten Straße und mehreren kleinen Gassen aneinandergereiht standen, die, Adern gleich, von der Hauptstraße wegführten. Aus wenigen Fenstern glomm Kerzenlicht zu den beiden nächtlichen Besuchern heraus. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen.
Der Regen wurde stärker. Die Tropfen prasselten auf ihre Köpfe wie Kieselsteine. Auf der Straße hatten sich große Rinnsale gebildet, durch die die Pferde jedoch mühelos hindurchstapften.
»Da ist eine Kirche!«, rief der Mann plötzlich und hielt auf das Gotteshaus zu, das sich über einem kleinen Platz in der Dorfmitte erhob. »Gott sei es gedankt.«
Vor der Kirche sprang er in den Schlamm und half seiner Begleiterin aus dem Sattel. Gemeinsam stiegen sie die drei Stufen zum Portal hinauf und stießen es auf. Im Innern der Kirche herrschte Dunkelheit. Nur auf dem Altar brannte eine Kerze. Er führte sie durch das Kirchenschiff bis vor den Altar. Dann nahm er die brennende Kerze und entzündete damit alle Kerzen, die er finden konnte. Währenddessen bereitete sie vor dem Altar unter den wachenden Augen einer Madonnenfigur ein Lager aus ihrem nassen Mantel und einer ebenso nassen Decke und legte sich ächzend darauf nieder.
Hastig kehrte er zu ihr zurück und knöpfte seinen Mantel auf. Darunter kam die schwarze Soutane eines Priesters zum Vorschein. Er nahm den Mantel und legte ihn unter ihren Kopf. »Was soll ich nun tun?«, fragte er.
»Wasser …«, presste sie hervor.
Suchend sah er sich um, eilte zum Taufbecken und nahm die bronzene Schale heraus. Dann lief er hinaus ins Freie. Vor der Tür stellte er die Schale in den strömenden Regen. Innerhalb weniger Augenblicke war sie bis zum Rand vollgelaufen. Beinahe zärtlich hob er die Schale auf und trug sie zurück zum Altar. Er stellte die Schale ab und kniete sich unschlüssig vor seine Begleiterin, die in regelmäßigen Abständen aufstöhnte. Ihr Gesicht war rot und glänzend wie im Fieberwahn.
Wieder schrie sie auf, und ein Schwall klaren Wassers ergoss sich aus ihrem Schoß auf die Decke. Er schob das blutrote Kleid aus Brokat über ihre angewinkelten Beine bis zur Hüfte hoch. Anschließend zog er ihr vorsichtig ihre Beinkleider aus. Hilflos blickte er auf ihre geöffnete Scham. Die Schreie der Frau wurden lauter, fordernder, verzweifelter. Zwischendurch presste sie hechelnd.
Er schaute hinauf zur Madonnenfigur im Tabernakel und betete leise.
Da packte sie ihn am Ärmel. »Deine Gebete helfen jetzt nicht weiter!«, stieß sie hervor.
»Dann sag mir, was ich tun muss«, erwiderte er. »Ich habe so etwas noch nie gemacht.«
»Ich auch nicht!«, brüllte sie. »Versuch, ob du den Kopf fühlen kannst.«
Mit zitternden Händen tastete er sich in ihre Scham. »Ich kann ihn nicht fühlen. Vielleicht liegt das Kind falsch.«
»Verdammt!«, stöhnte sie und schrie sogleich wieder auf. »Nun kann allein ein Wunder helfen.«
Und das Wunder trat ein. Plötzlich öffnete sich das Kirchenportal, und eine Nonne, wohl durch die Schreie aufmerksam geworden, erschien in der Tür. Ein Windstoß blies durch das Gemäuer und ließ die Kerzen flackern.
Der Priester sprang auf und eilte ihr entgegen. »Euch schickt der Himmel!«
»Reverendo«, sagte die Nonne und starrte an ihm vorbei zu der stöhnenden Frau vor dem Altar. »Was geschieht hier?«
Er griff sie am Arm und zog sie mit sich. Die Nonne verstand sofort und kniete sich nieder. »Ist ihr Wasser bereits abgegangen?«, fragte sie.
»Ja, vor wenigen Augenblicken«, antwortete er. »Aber der Kopf … Irgendetwas ist nicht so, wie es zu sein hat.«
Mit sorgenvoller Miene befühlte die Nonne die Lage des Kindes. »In der Tat«, murmelte sie. »Ich muss es wenden, dass es mit dem Kopf voran den Schoß der Mutter verlässt.« Sie bewegte ihre Finger sachte vorwärts und führte kleine ruckartige Bewegungen aus.
Der Priester sah zu seiner Begleiterin auf. »Sie atmet kaum noch!«
Der Kopf der Nonne schnellte hoch. »Wir verlieren sie«, keuchte sie, und ihre Hände arbeiteten noch flinker.
Angstvoll ging der Priester auf und ab. Immer wieder hockte er sich neben die werdende Mutter und benetzte ihre Stirn. Ihre Brust hob und senkte sich langsam, ihr Atem ging stetig flacher.
Die Zeit verstrich. Der Priester ließ die Nonne wortlos ihre Arbeit verrichten. Rastlos streifte er durch die Kirche, kniete betend vor der Madonna, ging vor die Tür und kam wieder zurück. Seine Begleiterin, bleich und apathisch, stöhnte wie im Delirium.
Und dann: Ein Schrei! Die Nonne hielt das neugeborene Leben in beiden Händen. Sie biss die Nabelschnur durch und band beide Enden mit Streifen ab, die sie sich aus ihrem Gewand gerissen hatte. »Ein Mädchen.« Sie lächelte. Anschließend wusch sie es mit dem Wasser aus der Schale.
Der Priester hatte keine Augen für das Kind. Er hielt die Hände der Mutter. Nur schwach erwiderte sie den Druck. Plötzlich schlug sie die Augen auf. Sie löste ihre Hände aus den seinen und streckte sie der Nonne entgegen. Die reichte ihr den Säugling.
Während die junge Frau ihr Kind voller Glück an ihre Brust hielt, bemerkte der Priester das blutige Rinnsal, das unter ihrem Kleid hervor über die Stufen des Altars sickerte. Er schaute die Nonne an. Sie erwiderte seinen Blick und schüttelte unmerklich den Kopf.
Dann starb die junge Frau. Es schien, als würde sie einfach einschlafen. Sie lächelte noch einmal, schloss die Augen, und ihr Kopf fiel sanft zur Seite.
Die Nonne bekreuzigte sich und nahm das Kind vom Leib seiner toten Mutter.
Der Priester streichelte über die Stirn seiner Begleiterin, faltete die Hände und betete. Schließlich stand er auf, und sein Blick wurde kalt und starr. »Aus welchem Kloster seid Ihr?«, fragte er die Nonne, ohne sie anzusehen.
»Aus dem Kloster Santa Annunziata«, gab die Nonne zurück. »Es liegt gleich in der Nähe.«
»Gut«, sagte er. »Versprecht mir, das Kind in Euren Konvent aufzunehmen und es zu einer guten Christin zu erziehen.«
Sie riss die Augen auf. »Wo ist der Vater des Kindes? Es sollte in seine Obhut, Reverendo.«
»Es gibt keinen Vater«, sagte er. »Versprecht Ihr mir das?«
Die Nonne nickte.
»Gut«, sagte er wieder, hob seinen Mantel auf und beugte sich über die tote Frau. Ein letztes Mal strich er über ihr Gesicht. Dann wandte er sich schnell ab und strebte dem Portal entgegen.
Als er es öffnete, rief die Nonne ihm hinterher: »Welchen Namen soll ich dem Kind geben, Reverendo?«
Er drehte sich um und starrte sie ratlos an. »Wie heißt dieser Ort hier?«
»Giulianova«, rief sie zurück.
»Dann nennt sie Giulia.« Ohne ein weiteres Wort verschwand er im tosenden Orkan.
Die Nonne sah ihm noch lange nach. Dabei wiegte sie die kleine Giulia zärtlich in ihren Armen.
1
ROM, 19 JAHRESPÄTER
»Schläfst du?«, fragte eine dunkle Frauenstimme.
Der Mann, der neben ihr auf dem Bett lag, schlug die Augen auf. »Mitnichten«, sagte er und drehte sich auf den Rücken. Er streckte eine Hand aus, streichelte über ihre Wange und strich die lockigen schwarzen Strähnen aus ihrem jungen Gesicht.
Sie nahm die Hand und küsste jeden einzelnen Finger. »Woran denkst du?«
Lächelnd entzog er ihr seine Hand und legte sie unter seinen Kopf. »Allegra«, sagte er, »meinen Körper weihe ich deiner Jugend und Schönheit, meine Gedanken jedoch verbleiben dort, wo sie sind.« Er tippte an seine Schläfe.
Allegra warf lachend den Kopf in den Nacken. »Das war früher einmal anders, Callisto.«
»Früher?«, echote Callisto. »Seit wann teilen wir das Bett? Seit einem Jahr?«
»Oh …« Allegra streichelte ihm über den Bauch und schürzte die Lippen. »Sind wir heute ein wenig griesgrämig?«
»Nein«, gab er zurück. »Allein dein Begriff von Zeit ist mir fremd.« Mit gerunzelter Stirn betrachtete er den Baldachin über dem Bett.
Wieder lachte sie. »Zeit ist nichts als ein leeres Wort. Ein Jahr vergeht für mich ebenso zügig oder langsam wie für dich.«
»Das«, sagte er und sah sie an, »ist bloßer Unfug. Dein müßiges Kurtisanenleben vermag schnell oder langsam zu vergehen, doch hängt es von den Umständen ab. Hier in meinem Bett eilt die Zeit gewiss, aber lasse ich dich in den Kerker von Torre di Nona werfen, glaube mir, mein Kind, werden Stunden zu Tagen und Tage zu Monaten.«
Schmollend warf sie sich auf den Rücken und zog das Laken bis unter das Kinn. »Es ist nicht nötig, mir zu drohen.«
»Drohen?«, fragte er. »Warum sollte ich dir drohen?«
»Das frage ich dich!«
Wieder lächelte er. Es war ein kaltes, versteinertes Lächeln.
»Er ist es, nicht wahr?«, fragte sie.
Blitzschnell legte er seine Hand auf ihre Lippen. »Nenne seinen Namen nicht!«
Allegra riss die Augen auf und schob seine Hand weg. »Wusste ich es doch. Seinetwegen bist du seit Wochen gereizt wie ein toller Hund.«
»Du weißt gar nichts«, entgegnete Callisto.
»Wann gedenkst du, endlich etwas gegen ihn zu unternehmen?«
»Sei still«, sagte er und schloss die Augen.
Sie richtete sich auf und sah ihn herausfordernd an. »Pah!«, machte sie. »Letztendlich bist du nicht besser als die anderen großmäuligen Schwächlinge. Ihr schwatzt von Veränderungen, von Dingen, die in die Hand genommen werden müssen. Aber am Ende seid ihr alle nur kleine, feige Maden.«
Allegra sah den Hieb nicht kommen. Callistos Hand traf sie am Kinn, und mit einem Schrei stürzte sie aus dem Bett auf den kalten Boden. Er beugte sich zu ihr hinunter. »Hüte deine Zunge, Hure! Oder ich lasse sie dir mit heißem Eisen herausschneiden. Das Privileg, in meinem Bett zu sein, lässt dich deine Stellung vergessen.«
Sie saß eingeschüchtert da und starrte ihn wortlos an. Ein dünner Blutfaden rann aus ihrem Mundwinkel.
Callisto klatschte dreimal laut in die Hände. Sogleich trat ein Diener ein. »Der Ankleider soll kommen!«
Der Diener verneigte sich und verschwand. Kurz darauf klopfte es, und der Ankleider betrat das Gemach. Die Gewänder, die er auf den Armen trug, legte er neben einem Paravent auf einen mit Goldfäden bestickten Stuhl. An der Wand darüber hing ein farbenprächtiger Gobelin.
Ohne Allegra zu beachten, stand Callisto auf. Nackt wie er war, ging er durch den großen Raum und stellte sich hinter den Paravent. Der Ankleider begann unverzüglich mit seiner Arbeit. Als Letztes setzte er Callisto den Purpurhut auf das Haupt.
Callisto kam hinter dem Paravent hervor, besah sich in einem mannshohen goldgefassten Spiegel und richtete hier und da noch eine Kleinigkeit.
»Habt Ihr weitere Wünsche, Eminenz?«, fragte der Diener.
»Nein«, antwortete Callisto, ohne den Blick von seinem Ebenbild zu wenden. »Du kannst gehen.«
»Sehr wohl, Eminenz«, sagte der Diener und verschwand.
Allegra war zurück in das Bett gekrochen. »Wann wirst du zurück sein?«, fragte sie, als wäre nichts geschehen.
»Ich weiß es nicht«, sagte Callisto. »Ich sorge dafür, dass es dir während meiner Abwesenheit an nichts mangelt.«
»Mir hat es in deinem Haus noch nie an etwas gemangelt«, sagte sie mit einem schnippischen Unterton. Dann fügte sie liebevoll hinzu: »Komm wohlbehalten zurück.«
»Warum sollte ich nicht?«, fragte Callisto und zog eine Augenbraue hoch. »Seit wann ist dir mein Wohlbefinden derart wichtig?«
»Dass es dir gut geht, ist mein alleiniges Bestreben, Callisto«, hauchte Allegra mit einem betörenden Augenaufschlag.
An der Tür drehte sich Callisto noch einmal um. »Dein alleiniges Bestreben ist es, die Kurtisane des Papstes zu sein«, sagte er und verließ das Zimmer.
»Die Kurtisane des Papstes«, flüsterte Allegra, nachdem die Tür zugefallen war. »Das klingt bezaubernd.«
Vor dem mächtigen Portal des Palazzo warteten vier Träger mit einer Sänfte, an deren Seiten das Wappen von Kardinal Callisto Carafa prangte: ein silbernes Kreuz und ein Schwert gekreuzt auf rotem Grund. Darüber der purpurne Kardinalshut mit jeweils fünfzehn Quasten an den Seiten, darunter in verschnörkelten goldenen Lettern der Wappenspruch des Kardinals: Vox Temporis – Vox Dei. Die Stimme der Zeit ist die Stimme Gottes.
Carafa stieg in die Sänfte. Kaum hatte er Platz genommen, hoben die Träger die Sänfte an. »Zum Quirinalspalast!«, rief der Kardinal und zog die Vorhänge aus rotem Samt zu. Sogleich setzten sich die Träger in Bewegung.
Die Sommerresidenz des Papstes lag etwa eine Stunde von Carafas Palazzo entfernt, im Norden der Stadt, auf dem baumbestandenen Quirinalshügel. Dort hatten sich reiche Römer Villen bauen lassen. Es hieß, die Luft hier oben wäre besser als unten in der Stadt. Gebaut wurde noch immer. Selbst der Palast des Papstes war nach fünfundzwanzigjähriger Bauzeit bei Weitem nicht fertiggestellt. Papst Sixtus V. hielt Unsummen bereit, um die Residenz nach seinen Wünschen erweitern zu lassen. Man sprach von über einer Million Scudi, die er bereits verbaut haben sollte. Ein Ende der Bauwut war nicht abzusehen. Zurzeit wurden die Arbeiten an dem zur Piazza del Quirinale gelegenen Westflügel abgeschlossen.
Vor den Toren des Palastes ließen Carafas Träger die Sänfte zu Boden. Wortlos stieg er aus. Den Soldaten der Schweizergarde war er bekannt, sodass er ungehindert passieren durfte. Im Innenhof ging er um den Springbrunnen herum, in dessen Mitte ein Delphin aus Marmor Wasser versprühte, und vorbei an Ölbäumen, die den gesamten Hof umrahmten. Dann betrat er den Palast. Drinnen umgab ihn angenehme Kühle. Seine Schritte auf dem weißen Carrara-Marmor hallten von den hohen Wänden wider, als er zügig an den Statuen längst verstorbener Päpste vorbeieilte.
Vor einem großen Portal standen zwei weitere Soldaten der Schweizergarde. Als sie den Kardinal kommen sahen, öffneten sie die Türen.
Eine dunkle Stimme, die maßlose Verärgerung ausdrückte, drängte ihm entgegen: »Wir erwarten Euch bereits.«
Carafa atmete tief durch und trat ein.
Erst Stunden später, es war inzwischen später Nachmittag, öffneten sich die Tore wieder. Das Konsistorium war beendet. Vierzig Kardinäle strömten teils schweigend, teils leise miteinander redend aus dem Saal. Gemeinsam mit den Kardinälen Primo Pozzi und Giambattista Castagna verließ Carafa das Konsistorium als einer der Letzten. Schweigend gingen sie durch den Palast, bis Carafa die Kardinäle in eine Nische in einem menschenleeren Nebenflügel führte. Vor einer Büste Papst Alexanders VI. blieben sie stehen.
Pozzi, ein kleiner, feister Mann mit buschigen Augenbrauen und spärlichem Haarkranz, sah Carafa erwartungsvoll an.
»Das Maß ist voll«, sagte dieser.
Castagna, einige Jahre älter und größer als Pozzi und Carafa und von kräftigem Körperbau, richtete seine wachen dunklen Augen auf Carafa. »So ist es schon seit Langem, wie wir wissen«, sagte er.
»Schreiten wir nicht umgehend ein, treibt das Gespenst der Reformation uns alle aus Rom hinaus«, fuhr Carafa fort.
Castagna hob beschwichtigend die Hände. »Sein beharrlicher Kampf gegen die Hugenotten hat längst ein deutliches Zeichen der einzig wahren Kirche gegen die ketzerischen Lutherböcke gesetzt.«
»Aber durch sein Geplänkel mit König Philipp wird die heilige Mauer wieder brüchig«, erwiderte Carafa.
»Carafa hat recht«, warf Pozzi ein. »Solange das Reich mit der Pest des Protestantismus befallen und Frankreich mit den Hugenotten beschäftigt ist, bleibt Spanien der wichtigste Verbündete in unserem geheiligten Kampf. Die ständigen Auseinandersetzungen mit Philipp richten nur Schaden an.«
»Zudem«, ergänzte Carafa, »lässt er den Jesuiten, den Einzigen, die das reformatorische Gespenst aus den Köpfen der Menschen mit Gottes Wort und nicht mit dem Schwert zu vertreiben vermögen, keinerlei Unterstützung angedeihen.«
Pozzi nickte heftig.
Carafa spie auf den glänzenden Marmorboden. »Schon als er seinen vierzehnjährigen Großneffen zum Kardinal bestimmte, brach er alle Absprachen mit den Kardinälen. Wir hätten ihn niemals wählen dürfen!«
Noch immer nickend, sagte Pozzi: »Ganz meine Meinung. Und was macht der dekadente Adoleszent seitdem? Er vergrößert seinen Reichtum in gleichem Maße wie seinen Bestand an Huren.«
»Gottes Werk dienten seine Taten bisher nicht«, stimmte Carafa zu.
»Vergessen wir nicht, dass er die Zahl der Mitglieder des Kardinalskollegiums auf siebzig erhöht hat«, ergänzte Pozzi. »Mir scheint, diese Entscheidung hat ihre Wurzeln allein in dem Wunsch, seine Nepoten zu protegieren.«
»Folglich müssen wir etwas unternehmen«, sagte Carafa. »Wir dürfen nicht länger zaudern, sondern müssen entschlossen handeln. Es kann nicht der Wille des Herrn sein, dass ein schwacher, eitler Papst das Bollwerk der katholischen Kirche gegen die Häresie der Protestanten bildet.«
Da lächelte Castagna. »Ich kenne Euch schon lange, Callisto«, sagte er. »Lange genug, um Euch den Kämpfer für den einzig wahren Glauben nicht ganz abnehmen zu können.«
Carafa verengte die Augen zu Schlitzen. »Wie darf ich Euch verstehen?«
Das Lächeln auf Castagnas Lippen erstarb nicht, sondern wurde sogar noch breiter. »Euch geht es allein um Macht.« Sogleich hob er die Hände. »Nein, bitte, missversteht mich nicht. Ich schätze Männer, die ein klar umrissenes Ziel verfolgen. Als Vizekanzler der Kirche bekleidet Ihr das zweithöchste Amt im Vatikan – aber eben nur das zweithöchste. Ihr habt nie einen Hehl daraus gemacht, wozu Ihr Euch eigentlich berufen fühlt. Und Ihr, Primo.«
Pozzi starrte Castagna an, als könne dieser ihn auf der Stelle zerreißen wie der Wolf das Lamm.
»Euch«, sagte Castagna, »geht es nur um eines: Gold, Silber und Juwelen. Verzeiht, das waren gleich drei Dinge.«
Pozzi stand sprachlos da. Fast schien es, als wolle er Castagna an die Gurgel springen. »Was …«, brachte er schließlich hervor, »was fällt Euch ein?«
»Während es Callisto nach dem apostolischen Stuhl dürstet«, sagte Castagna ungerührt, »verlangt Euer florentinisches Kaufmannsherz allein nach weltlichen Dingen. Die Vergrößerung des Kardinalskollegiums trifft Euch nicht in Eurem Gewissen, sondern in Eurem Geldbeutel. Jeder Kardinal mehr bedeutet weniger Einnahmen bei den anderen Kardinälen. Und der Segen des Nepotismus dürfte Euch auch nicht fremd sein.«
Pozzi wollte schon etwas entgegnen, doch Carafa kam ihm zuvor. »Genug geschwatzt!«, polterte er. »Bei unserem letzten Treffen standet Ihr in unserer gemeinsamen Sache noch wie ein Fels. Nun beleidigt Ihr Pozzi und mich, als wären wir dreckige Straßenräuber.«
»Oh!«, rief Castagna und hob entschuldigend die Hände. »Beleidigt hätte ich Euch, hätte ich die Unwahrheit gesagt. Schwört beim Kreuze des Herrn, dass ich gelogen habe, und unverzüglich bitte ich Euch um Verzeihung. Nun?« Er sah die Kardinäle fragend an.
Während Pozzi mit dem Schuh einen imaginären Fleck auf dem Boden fortzuwischen versuchte, hielt Carafa dem Blick Castagnas stand. »Ich schulde Euch keinen Schwur«, sagte er. Seine Nasenflügel bebten vor Zorn. »Doch von Euch will ich hier und jetzt wissen, ob wir auf derselben Seite stehen oder ob Ihr Eure Gesinnung gewechselt habt wie die Huren in Eurem Bett?«
»Vergesst nicht«, sagte Castagna, »dass protestantische Teufel meinen Bruder und meine Neffen gemeuchelt haben. In unserem Kreis bin ich wohl der Einzige, dem aus tiefstem Herzen daran gelegen ist, die Reformation zu ersticken wie ein wild brennendes Feuer. Item bin ich der Ansicht, dass Sixtus in keinster Weise der richtige Mann auf dem Heiligen Stuhl ist, dem die Kraft und Entschlossenheit zuzutrauen wäre, dieses Ziel zu erreichen.«
»Was soll dann dies ganze Gewäsch?«, wollte Carafa wissen.
Castagna blieb die Ruhe selbst. »Ich möchte nur betonen«, sagte er, »dass, obgleich wir dasselbe erreichen wollen, unsere Motive nicht dieselben sind.«
Carafa atmete tief durch. Die Zornesröte wich allmählich aus seinem Gesicht. »Ich denke«, sagte er, wobei er Pozzi ansah, »dass Eurem Verlangen nach Offenheit hiermit Genüge getan wurde.«
»Gewiss«, sagte Castagna.
»Wohlan«, sagte Carafa. »Wir sind uns folglich einig, dass die Zeit reif ist, unseren Plan zum Wohle der Christenheit auszuführen.«
Castagna und Pozzi nickten.
»Wie steht es um die anderen Kardinäle?«, wollte Castagna wissen. »Ohne sie ist es unmöglich, unser Vorhaben zu einem glücklichen Ende zu führen und Euch auf den Heiligen Stuhl zu setzen.«
»Ich habe hier und da unverfängliche Gespräche mit einigen von ihnen geführt«, antwortete Carafa. »Toscani, Delgado, Mambelli und Lombi sind eindeutig gegen den Papst, auch wenn sie dies nicht offen darlegen. Ihre Äußerungen sprechen eine deutliche Sprache. Rinaldi, Valdemarin, Ortlano und Petit schreibe ich eher der anderen Seite zu. Ihnen hat Sixtus ohnehin große Summen für seine Wahl gezahlt. Hautepierre und Grazioli ist es völlig gleich, wer auf dem Heiligen Stuhl sitzt, solange ihre Einnahmen nicht beschnitten werden.«
Nachdenklich rieb sich Castagna am Kinn. »Hinter Delgado stehen die gesamten Spagnoli. Das ist gut. Hinter Petit allerdings versammeln sich die französischen Kardinäle. Das ist schlecht.«
»Mit den Stimmen der Italiener und Spanier ist meine Wahl gesichert«, erwiderte Carafa.
»Allein … nicht alle Italiener würden Euch wählen, Callisto«, gab Castagna zu bedenken. »Und dann besteht die Gefahr, dass wir als Papstmörder mit abgezogener Haut auf dem Scheiterhaufen landen.«
»Jeder Kardinal ist käuflich«, warf Pozzi ein. »Hier ein Bistum, dort eine Grafschaft. Das hat noch jeden umgestimmt.«
Spöttisch blickte Castagna auf Pozzi hinunter. »Verzeiht, aber Euer Denken ist simpel.«
»Ich darf ja wohl bitten!«, polterte Pozzi.
Carafas scharfe Stimme unterbrach die beiden. »Genug! Pozzi hat recht. Noch kein Papst hat seine Wahl ohne den großzügigen Einsatz von Gold und Pfründen gewonnen. Die Zeiten haben sich nicht geändert.«
»Nun«, sagte Castagna gedehnt. »Ich nehme an, Ihr habt längst einen Plan ausgearbeitet, der Sixtus’ Ende einläutet. Erzählt uns davon.«
Carafa lächelte kalt. »Gewiss«, sagte er.
2
Nachdem Carafa geendet hatte, trennten sich die drei und verließen den Quirinalspalast in verschiedenen Richtungen.
Carafa stieg in die wartende Sänfte und ließ sich heimtragen.
In seinem Palazzo angekommen, begab er sich sogleich in das erste Geschoss. Allegra lag noch immer in seinem Bett. »Du bist schon zurück?«, fragte sie schläfrig, rieb sich die Augen und schob die seidene Decke fort, sodass ihr nackter Leib zum Vorschein kam.
»Wie du siehst«, gab er zurück, ohne ihr Beachtung zu schenken. Er warf seinen purpurnen Umhang auf einen Stuhl, legte seinen Hut darauf und klatschte dreimal in die Hände.
Ein Diener trat ein. Er verneigte sich tief und wartete auf die Befehle seines Herrn.
»Der Ankleider soll mir meine Straßenkleider bringen«, sagte Carafa. »Du weißt, wovon ich spreche?«
»Gewiss, Euer Eminenz«, sagte der Diener und verschwand.
»Was hast du vor?«, wollte Allegra wissen. Sie hatte die Decke wieder über ihren Körper gezogen.
»Du stellst zu viele Fragen«, sagte Carafa, während er zu einem Schrank ging. Er öffnete ihn, entnahm ihm einen Dolch, eine Pistole und ein verziertes Silberkästchen und legte alles auf den Kirschholztisch in der Mitte des Gemachs.
Es klopfte. Der Ankleider trat ein, in den Händen die gewünschten Kleider. Stumm legte er sie hinter den Paravent, wo er auf Carafa wartete.
Nachdem er angekleidet war, schickte Carafa den Ankleider hinaus. Dann trat er hinter dem Paravent hervor. Seine Beine steckten in dreckigen, zerschlissenen Hosen. Darüber trug er ein löchriges braunes Hemd und eine alte schwarze Jacke. Die schwarzen Stiefel waren nicht weniger alt und ausgetreten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!