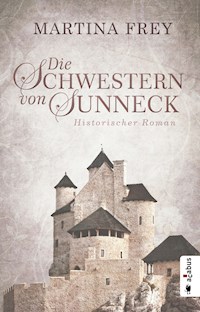Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr der badischen Revolution, 1848, als sich die wohlbehütete Arzttochter Eugenia in den Bauernsohn Matthias verliebt. Doch die gesellschaftlichen Unterschiede lassen ihre Liebe unmöglich erscheinen. Matthias verzweifelter Versuch, seine Familie durch Wilderei vor dem Verhungern zu bewahren, führt zur Katastrophe. Als kurz darauf die Revolution losbricht, wird Eugenias Leben von Grund auf erschüttert und neu bestimmt - kann sie ihr Glück doch noch finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die Tochter eines Arztes
von Martina Frey
Prolog
Wiesbaden, im Jahr 1839
Der Abend war hereingebrochen, sodass kaum noch Licht durch die hohen Fenster fiel. In dem Raum brannte keine Lampe. Die Dunkelheit ließ nur schemenhaft die zweite Gestalt erahnen, die Anton Hentschel an einem kleinen Tisch gegenübersaß. Beide schwiegen, als hätten sie sich geeinigt, im Finsteren zu sitzen und nichts zu sagen.
Eine bedrückende Stimmung herrschte zwischen ihnen.
Plötzlich erhob sich Sebastian Kreutzer und zündete auf dem Tisch eine Kerze an. Sie erhellte die direkte Umgebung. Anton Hentschel empfand selbst dieses Licht als schmerzhaft und bedeckte sein Gesicht mit einer Hand. Er konnte es nicht ertragen zu sehen, wie Sebastian Kreutzer wieder ihm gegenüber Platz nahm und ihn nur schweigend anstarrte. Als könnte der ihn einfach damit trösten, ihn anzustarren. Sebastian, war er denn nicht mehr als sein Kollege, war er nicht ein guter Freund? Anton spürte, wie Wasser in seine Augen schoss. Er schluckte. Als es ihm gelungen war, die Tränen niederzukämpfen, seufzte er und ließ seine Hand sinken. Dabei fuhren seine Finger über die Bartstoppeln an seinem Kinn. Ein ungewohntes, ungutes Gefühl. Nach all den schlaflosen Nächten lastete eine bleierne Müdigkeit auf ihm.
„Du kannst dich nicht ewig verkriechen, Anton“, sagte da Sebastian Kreutzer in die unerträgliche Stille. „Du musst deine Arbeit wieder aufnehmen.“
„Ich kann mir selbst nicht mehr ins Gesicht sehen, wie soll ich da anderen Menschen gegenübertreten?“, erwiderte Anton Hentschel gequält.
„Du kannst nicht rückgängig machen, was geschehen ist.“
Anton wollte das nicht hören. Er ließ die Hände auf den Tisch sinken, wendete die Handflächen nach oben und starrte sie an: „Damit wollte ich heilen, Menschen helfen. Aber das, was nun geschehen ist, habe ich nicht gewollt. Er ballte die Hände und ließ den Kopf sinken.
„Im Leben eines Arztes kann es vorkommen, dass er nicht das Leben retten kann, das ihm anvertraut wurde.“
Doktor Hentschel fuhr auf. „Ich habe es beendet!“
„Es war ein Fehler, es ist passiert. Trotzdem bist du ein guter Arzt. Ich bin dein Freund, Anton, hör mir zu. Das Wohl und die Gesundheit der anderen liegen dir am Herzen. Du kannst wegen dieses Fehlers nicht aufgeben.“
„Ich habe diesen Menschen getötet, weil ich seine Krankheit nicht erkannte.“ Wieder starrte Anton Hentschel auf seine Hände. „Was für ein Arzt bin ich? Was für ein Mensch bin ich, dass ich über das Leben eines anderen richte? Ich kann das nicht mehr.“ Doktor Hentschel hob die Hände und begrub sein Gesicht darin. „Ich bin ruiniert. Wenn jemand davon erfährt, werde ich meine Konzession verlieren, meine Praxis.“
Sebastian Kreutzer beugte sich über den Tisch. Die Flamme der Kerze flackerte aufgeregt bei dem Luftzug, den seine Bewegung auslöste. „Du wolltest helfen. Du hast diesem Mann seine Leiden nehmen wollen.“
„Aber nicht, indem ich ihn töte. Ich habe ihn aufgrund eines Fehlers getötet, mein Gott, es ist mein Fehler.“ Anton Hentschel holte aufgeregt Luft. „Ich hätte merken müssen, an was er tatsächlich litt. Aber die Anzeichen passten so gar nicht zu seinem Krankheitsbild. Ich kann es mir nicht erklären.“
„Mach dir nicht so viele Gedanken. Es war ein Diagnosefehler. Du hättest ihm wahrscheinlich nicht helfen können, selbst wenn du die richtige Diagnose gestellt hättest.“
„Das ist doch gleich, ich habe ihn falsch behandelt! Und ich werde mir mein Leben lang Vorwürfe machen!“
Sebastian schien kurz nachzudenken, als ob er Worte des Trostes suchte. „Wie viele Menschen hast du mit deinem Wissen schon geheilt? Wie viele kamen in diese Stadt, krank und schwach? Du hast die meisten von ihnen heilen können. Dieser eine Fehler macht aus dir keinen Unmenschen.“
Anton Hentschel fuhr sich mit einer Hand über sein Gesicht.
„Ich bin ruiniert, meine Familie … wir sind am Ende. Mein Sohn Moritz und Eugenia, meine Tochter, sind noch so jung. Was wird aus ihnen, wenn herauskommt, welches Unglück mir als Arzt widerfahren ist? Was soll ich nur tun, Sebastian?“
Der jüngere Kollege klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Ein Hauch von Sorglosigkeit lag in seinem Gesicht. „Tu das, was du mit deiner Berufung tun kannst: Anderen Menschen helfen. Ich werde über diesen Vorfall schweigen. Ich verspreche dir, es wird nie jemand davon erfahren.“
„Ich werde mit diesem Wissen leben müssen und eines Tages …“
Sebastians Gesicht wirkte sehr ernst, als er sprach: „Die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen, das schwöre ich dir.“
Kapitel 1
Holzhausen auf der Heide, Anfang April 1847
Während Moritz Hentschel mit gleichmäßigen Schritten den Weg weiterging, atmete er tief die frische Luft ein. Er fühlte sich wohl, als er über die Wiesen hinweg den großen Wald betrachtete. Dieser Blick brachte ihn ins Schwärmen. Tannenwald und Hügel wechselten sich ab. Sonne und Wolken tauchten die Landschaft in ein reges Spiel von Licht und Schatten. Hier, inmitten des Taunus, lag in einer quellenreichen Senke ein Dorf, gut geschützt von Stürmen, die oft vom Rhein heraufkamen und nicht selten Unwetter mitbrachten. Das hatte Moritz bereits einmal erlebt. Er blieb stehen und sah die Straße entlang. Wie hieß dieser Ort noch gleich? Holzhausen auf der Heide. Im Herzogtum Nassau gehörte es eindeutig zu den beschaulichsten Dörfern des Taunus, fand Moritz und ging weiter.
In den ersten Tagen des Aprils hatte sich der Wind gedreht und kam mit eisiger Kälte vom Osten her. Er fegte über die Dächer der Fachwerkhäuser und Holzhütten, strich über die Lehmgassen, an Zäunen und Ställen entlang, einen kleinen Hang hinauf zur Kirche. Am höchsten Punkt kreuzten sich zwei wichtige Fernstraßen. Diese waren, das wusste Moritz, schon von Römern genutzt worden. Vor knapp vierzig Jahren waren Napoleons Armeen darüber marschiert.
Moritz schlenderte die Straße entlang, bis er bei einem zweigeschossigen Haus mit weißem Putz stehen blieb. Vor Kurzem hatte sein Vater, ein freipraktizierender Arzt aus Wiesbaden, mit herzoglicher Erlaubnis, dieses Gebäude in Holzhausen erbauen lassen. Das Walmdach war mit Schiefer gedeckt. Ein hohes Eingangsportal mit einem kleinen Giebel und hellen Steinpfeilern an den Seiten zierte die Vorderseite des Hauses. Die Fenster hatten blaue Holzläden, die am Abend geschlossen wurden. Das Haus wirkte einfach in seiner Gestaltung und passte doch nicht in das Bild dieses ländlichen Ortes, fand Moritz und vernahm durch die offen stehenden Fenster das Spiel eines Pianofortes.
Das musste seine Schwester Eugenia sein, die täglich an diesem Instrument saß, um ihre Fingerfertigkeit zu verbessern. Moritz betrat das Haus und ging in die Wohnstube, in der er, wie vermutet, seine Schwester vorfand.
Eugenia Hentschel saß aufrecht vor dem Instrument und spielte einige kurze Stücke, ohne Leidenschaft und besondere Freude zu zeigen. Sie trug ein dunkelrotes Tageskleid, das an den engen Ärmelenden mit weißer Spitze versehen war, genau wie am hochgeschnittenen Halsausschnitt. Das übliche Korsett betonte die schmale Taille. Es musste ziemlich unbequem sein, so eingeschnürt auf dem Bänkchen zu sitzen, vermutete Moritz. Eugenias Haar war zu einem Nackenknoten zusammengebunden. Während die Finger über die Tasten flogen, wippten Korkenzieherlocken an ihren Schläfen und umrahmten ein volles, makelloses Gesicht. Die gesenkten Augen waren unter dichten Wimpern verborgen, da sich Eugenia auf das Musikstück konzentrierte.
Plötzlich verstummte das intensive Spiel.
„Ich hasse es!“, sagte sie ruhig mit einem unterdrückten Ton von Überdruss.
Moritz trat näher. „Mir hat das Stück gut gefallen.“
„Das meine ich nicht!“ Eugenia starrte unzufrieden auf die Tasten.
Um zu überprüfen, ob sein Spaziergang Spuren hinterlassen hatte, sah er an seinen hellen Pantalons hinab, die an der Taille in Falten lagen, bis zum Boden reichten und sogar die schwarzen Schuhe bedeckten. Doch es war alles in Ordnung. Mit sich zufrieden setzte er sich neben seine Schwester auf die Bank und betrachtete von der Seite ihren mürrischen Gesichtsausdruck. „Du übertreibst“, sagte er.
Die Korkenzieherlocken wirbelten herum, als Eugenia den Kopf schüttelte. „Tu ich nicht. Hast du dir dieses Dorf angesehen? Halb zerfallene Hütten, Menschen in Fetzen, die noch dünner sind als streunende Hunde bei uns in Wiesbaden.“ Sie drehte sich zu ihrem Bruder. Die blassen Strahlen der Frühlingssonne fielen durch die hohen Fenster und verfingen sich in ihrem Haar, das in diesem Augenblick golden schimmerte.
Moritz lachte, nachsichtig mit der schlechten Laune seiner Schwester. „Selbst Goethe schwärmte vom Taunus. Es ist malerisch. Du überblickst Wiesen und Wälder und kannst dir romantische Geschichten auf dem Lande ausdenken.“
„Pah. Geschichten über Mädchen, die auf dem Land versauern.“
Er stieß sie sanft in die Seite. „Du bist ungerecht. Du weißt, warum wir auf das Land gezogen sind. Mutter geht es bereits besser.“
Eugenia blickte reumütig zur Seite. Die Worte ihres Bruders flößten ihr sichtlich Schuldgefühle ein. Die Veränderung ihrer Mutter war augenfällig. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Wochen wesentlich gebessert, fand Moritz. Farbe war in das sonst blasse Gesicht zurückgekehrt und die Mutter wirkte lebhafter, so als täte ihr die Ruhe gut, die Eugenia so einschläfernd fand.
„Ja, das ist wahr.“ Sie seufzte. „Ich bin ungerecht. Selbst die wenigen Wochen hier haben Mutter gutgetan. Sie lacht wieder und das sollte mich froh machen. Ach, es ist nur … hier ist es eben … öde.“
Moritz legte einen Arm um ihre Schultern und drückte sie tröstend an sich. Er kannte den Unternehmungsdrang seiner Schwester sehr gut und versuchte ihre Unzufriedenheit zu verstehen. „Vater wird dich bestimmt bald für einige Tage nach Wiesbaden schicken.“
„Ich werde grau sein und Falten haben, ehe das passiert.“
Moritz lachte auf. „Du bist gerade siebzehn Jahre alt geworden, Schwesterlein, und es dauert noch sehr lange, bis du grau wirst.“ Er musterte sie. „Aber du solltest aufhören, ein solches Gesicht zu ziehen, davon könntest du durchaus Falten bekommen.“
Eugenia zog einen Schmollmund und begann gedankenverloren auf den Tasten zu spielen. „Ich sitze jeden Tag in diesem Haus und weiß nichts mit mir anzufangen. Das ist geistlos. Ich ertrage das nicht länger. Mir fehlt meine Freundin Dorothea und all das Vergnügen.“
„Hab etwas Geduld“, tröstete Moritz seine Schwester. „Vater wird bald einen angemessenen Gatten für dich finden und du wirst das gesellige Leben wieder aufnehmen können.“
Eugenia legte nachdenklich den Zeigefinger an ihr Kinn. „Bist du nicht erstaunt darüber, dass wir so plötzlich auf das Land gezogen sind?“ Wieder wippten die Schläfenlocken.
Nein, er hatte bisher nicht darüber nachgedacht, gestand er sich ein. Natürlich war er etwas überrascht gewesen, doch sein Vater hatte keine Erklärung über seine Pläne abgegeben. Aber der Vater pflegte seine Entscheidungen ohnehin nicht zu rechtfertigen. „Mutters Gesundheit geht vor.“
Eugenia ließ den Zeigefinger wieder sinken. Ihr flehentlicher Blick traf Moritz und er versuchte ihm auszuweichen, doch da hörte er ihre bittende Stimme, der er selten zu widerstehen vermochte: „Könntest du Papa bitten, mich nach Wiesbaden zurückzubringen?“
„Wir sollten ihm lieber nicht vorschreiben, was er zu tun hat, das gehört sich nicht“, warnte Moritz sie, erhob sich von dem Bänkchen am Pianoforte und ging zu einem der Fenster, um nachdenklich hinauszublicken. Mochte es hier keine gesellschaftlichen Verpflichtungen geben, denen Eugenia so gern nachging, ihm gefiel die Abgeschiedenheit. Es war so gänzlich anders als an der Universität, an der er studierte. „Ich würde mich hier sehr wohlfühlen. Es ist behaglich“, sagte er schließlich.
„Du musst nicht versuchen, mich aufzuheitern. Es ist nicht behaglich, sondern öde. Ach, ich wiederhole mich. Du hast gut reden. Du kannst tun, was dir beliebt.“
Ein unguter Gedanke zog durch seinen Kopf. „So ist es nicht. Vater schickt mich nach Gießen, obwohl ich nicht studieren will.“ Er sprach selten darüber, nun packte ihn Verdrossenheit. „Doch wann hat er mich gefragt, was ich möchte? Meine Meinung zählt nicht. Ich will nicht Arzt werden!“
Sie sah ihn mitleidig an. „Hast du mit Vater darüber gesprochen?“
Moritz schnaubte unwillig. „Pah, wenn ich das täte, ich wüsste, was er mir antworten würde …“ Er neigte seinen Kopf, setzte eine tadelnde Miene auf, um den Vater zu imitieren, und sprach mit tieferer Stimme: „Sohn, du hast deine Familie zu ehren und musst an deine Zukunft denken. Mach uns keine Schande. Du tust, was ich für richtig halte!“
„Aber an deiner Universität in Gießen bist du nicht unter seiner Aufsicht“, gab Eugenia zu bedenken, als müsste sie einen Grund nennen, ihn aufzuheitern. „Du hast dort Freunde gefunden.“
Moritz blickte wieder versonnen aus dem Fenster. „Glaube mir, ich wäre lieber in Holzhausen, als Frösche aufzuschneiden und mir ihre Innereien anzusehen. Ich will mein Leben und meine Zukunft selbst bestimmen, aber Vater lässt das nicht zu. Ich kann nicht einmal Blut sehen, wie soll ich jemals Menschen verarzten?“
„Das hat mich auch gewundert. Das letzte Mal, als ich mir in den Finger geschnitten habe, bist du schreiend davongelaufen.“
Moritz erinnerte sich und lachte. „Da waren wir Kinder.“
Eugenia erhob sich von dem Bänkchen und räumte die Noten zusammen. „Ich mache dir einen Vorschlag. Du bleibst in dieser Einöde und ich studiere.“
Moritz drehte sich lachend zu ihr um. „Du und studieren?“
„Ich würde gern Medizin studieren.“
Moritz nahm den sehnsüchtigen Ton in ihrer Stimme wahr. Er schmunzelte belustigt. „Eine Frau als Ärztin? Sei nicht albern.“
„Ich möchte anderen Menschen helfen, so wie Vater. Ich könnte das“, versicherte Eugenia mit Nachdruck. Aber auch ihr, so dachte er, war sicher bewusst, dass dieser Traum nicht in Erfüllung gehen würde. Und obwohl er ihre Äußerung abgetan hatte, war er sich sicher: Wenn Frauen Ärzte werden könnten, dann wäre Eugenia eine der Besten. Auch wenn sie verhätschelt wurde – sie war eindeutig Vaters Liebling –, so besaß Eugenia dennoch ein gütiges Herz. Eine Eigenschaft, die ihr bisher Tadel beschert hatte. Moritz erinnerte sich an einige Vorfälle in Wiesbaden, die seiner Schwester nichts als den mütterlichen Tadel eingebracht hatten. Eugenia half jedem Menschen, dessen Not sie erkannte, sei es ein Junge, der sich auf dem Markt verlaufen hatte, oder ihr Bruder, der sich bei einem heimlichen Pferderennen einige Schürfwunden zugefügt hatte.
Moritz wandte sich wieder zum Fenster. Es war schade, dass sich in dieser Zeit ein Mädchen wie Eugenia nicht frei von gesellschaftlichen Zwängen entwickeln durfte.
„Komm“, sagte er nach einer Weile. „Die Gäste werden bald eintreffen.“ Er durchquerte den Raum, doch Eugenia hielt ihn zurück. „Kannst du nicht mit Papa über mein Anliegen sprechen?“
„Er wird nicht auf mich hören. Nicht die Kinder treffen die Entscheidungen.“
„Aber du kannst ihm sagen, dass mein Benehmen an diesem Ort leiden wird.“
Moritz kniff ihr in die spitze Nase. „Mal sehen, ob sich eine Gelegenheit ergibt.“
Eugenia küsste ihren Bruder auf die Wange. „Du hast etwas gut bei mir.“
„Ich werde dich eines Tages daran erinnern“, murmelte er leise.
Eugenia und ihre Geschwister wurden vom Vater mit einem kritischen Blick begutachtet. Er war sehr darauf bedacht, einen guten Eindruck auf die Gäste zu machen, die das erste Mal dieses Haus betraten.
Doktor Hentschel selbst sah tadellos aus. Er war von schlanker Statur, mit aufrechtem Gang. Der hohe Kragen des weißen Hemdes war von einem ordentlich gebundenen Halstuch umwickelt. Weste und Gehrock pflegte der Arzt erst zum Abendessen abzulegen. Sein dunkelblondes Haar war ordentlich gekämmt, das Gesicht glattrasiert, während sich an den Seiten lange Koteletten entlangzogen, die zurzeit in Mode waren. Auf seiner Nase lag eine Brille mit dünnem Drahtgestell. All die Zeit über Büchern und Notizen hatte sein Augenlicht getrübt, sodass er diese moderne Hilfe benötigte.
Die Gäste wurden im Eingangsbereich von der Familie Hentschel begrüßt. Es waren Pfarrer Wilhelm Brachel mit seiner Frau und der Lehrer von Holzhausen, Herr Hardt, sowie seine Gattin mit ihrer Nichte Luise. Eugenia machte einen höflichen Knicks, während sich Moritz vor den Gästen verbeugte, als sie vorgestellt wurden.
„Der Tee wird bald serviert“, verkündete die Mutter höflich, die heute in ihrer Rolle als Gastgeberin sichtlich aufblühte.
Nach den drei Wochen, die sie nun in Holzhausen lebten, hatte die Mutter erklärt, es sei genug Zeit vergangen, man müsse nun Einladungen aussprechen. Der Schultheiß Ernst Gerlach war vor einigen Tagen zu Besuch gekommen, mit seiner Frau und drei kleinen Kindern, von denen Eugenia nicht sagen konnte, wer sich unmöglicher benommen hatte.
Sie hoffte, dass sich diese Gäste angemessener verhalten würden, und so lächelte sie der Nichte des Lehrers zu und ging mit ihr durch den Flur zum Esszimmer. Wortkarg und zurückhaltend zeigte sich Luise, zwei Eigenschaften, die Eugenia sofort auffielen. Luise trug ein schlichtes Kleid, das bis zu ihrem Hals geschlossen war. Ihr Gesicht war von Sommersprossen übersät, das Haar hellblond. Blassblaue Augen schauten Eugenia mit freundlichem Ausdruck an. Eugenia warf Luise ein Lächeln zu und erhielt ein zaghaftes zurück.
Das war ein Anfang, dachte Eugenia. Vielleicht würde sie eine Freundin finden, um sich über die Langeweile hinwegzutrösten, die ihre Tage füllte.
Die Gäste nahmen an der Tafel Platz, dann setzte sich Doktor Hentschel an das Kopfende. Das Hausmädchen brachte Tee und Kuchen, während die Gespräche sich um oberflächliche Themen drehten. Es wurde sich kennengelernt, wie Mutter zu sagen pflegte, dachte Eugenia und beobachtete die Gäste. Die Nichte des Lehrers hielt den Kopf gesenkt und antwortete beflissen, wenn sie gefragt wurde.
„Sie haben ein sehr schönes Haus, Frau Doktor“, sagte Frau Hardt zu Charlotte Hentschel.
„Vielen Dank. Mein Gatte wollte es ähnlich gestalten wie unser Haus in Wiesbaden, damit wir uns heimisch fühlen.“
„Ich hoffe, Sie haben sich gut eingelebt“, meldete sich der Pfarrer zu Wort. „Ich würde Sie gern am nächsten Sonntag in der Kirche begrüßen.“
Eugenias Mutter sagte einen nächsten Besuch des Gottesdienstes zu. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, wies sie darauf hin, dass sie sehr auf regelmäßigen Kirchgang achteten.
„Sagen Sie, Herr Hardt, wie viele Schüler gibt es an der Schule in Holzhausen?“, wollte Doktor Hentschel wissen, während das Hausmädchen einen Knicks machte und das Esszimmer verließ.
„Im Augenblick haben wir ungefähr 125 Schüler. Das ist recht unterschiedlich und richtet sich nach der Jahreszeit. Im Winter haben die Töchter und Söhne der Bauern mehr Zeit.“
Eugenias Blick fiel auf ihren Bruder, der etwas steif da saß. Sein Hemd hatte einen hohen Stehkragen, in dessen Öffnung ein weißes Tuch gebunden war. Unter der schwarzen Jacke lugte eine karierte Weste hervor, die dem sonst biederen Äußeren etwas Farbe verlieh. Die langen Koteletten an den Seiten seiner Wangen waren noch nicht ausgeprägt. Ansonsten wirkte er fast so vornehm wie Vater.
Lehrer Hardt wandte sich zu Moritz. „Ich hörte, Sie haben ein Studium begonnen? Darf ich fragen, welches Ziel Sie haben?“
Moritz nickte ihm höflich zu. Das sonst spitzbübische Lächeln auf seinen Lippen verblasste. „Medizin, wie mein Vater. Ich besuche die Ludoviciana-Universität in Gießen.“ Seine Stimme hatte einen seltsamen Klang angenommen, den nur Eugenia deuten konnte, genauso wie den finsteren Blick, den Moritz seinem Vater zuwarf.
Doktor Hentschel achtete nicht darauf oder er bemerkte es nicht. „Mein Sohn gehört zu den Besten. Wir sind sehr stolz auf ihn.“
„Medizinischer Rat ist immer gefragt. Ich vermute, gerade in Wiesbaden, wo viele Kurgäste zu Besuch kommen, gibt es genug Arbeit für einen Arzt.“
„Wir können uns nicht beklagen“, entgegnete Doktor Hentschel.
Pfarrer Wilhelm Brachel meldete sich zu Wort: „Wir sind sehr froh, dass ein freipraktizierender Arzt nach Holzhausen gekommen ist. Auch wenn Sie Ihre Praxis in Wiesbaden nicht aufgegeben haben, Herr Doktor, so ist es gut zu wissen, dass Sie hier sind. Der bei uns eingesetzte Medizinalarzt kann sich nicht immer um alle Kranken kümmern und die Bader sind mir ein Gräuel.“
„Es gibt viele Quacksalber, auch in Wiesbaden. Und es kann gefährlich werden, wenn man an solche gerät“, warnte Doktor Hentschel. „Wenn ich helfen kann, tue ich es gern, auch den Ärmeren im Dorf.“ Er sprach direkt zum Pfarrer gewandt, als wollte er etwas andeuten.
Dieser schien zu verstehen und nickte. „Vielen Dank, Herr Doktor. Es gibt genug Menschen in diesem Dorf, die dringend ärztliche Hilfe benötigen, jedoch aus verschiedenen Gründen nicht den Arzt aufsuchen. Unsere Hinkelhanna zum Beispiel lehnt es strikt ab, zu einem Arzt zu gehen, dabei hat sie einige Gebrechen.“
„Ich werde sie in den nächsten Tagen besuchen, vielleicht kann ich helfen“, bot sich Doktor Hentschel an.
Es war ein Gespräch, in das sich die Frauen nicht einzumischen hatten, das wusste Eugenia, und so verfolgte sie es nur schweigend. Sie wagte einen Blick zu ihrer Rechten, wo die schweigsame Nichte des Lehrers saß.
„Was tust du am liebsten?“, wollte Eugenia wissen.
„Ich widme mich der Musik“, antwortete Luise zurückhaltend.
„Luise ist sehr talentiert“, sprach Frau Hardt zu Eugenias Mutter. „Sie müssen wissen, dass ihre Eltern vor einigen Jahren bei einem Unfall verstarben. Seitdem kümmern wir uns um Luise. Ihre Mutter, meine Schwester, hat sehr viel Wert auf gute Erziehung gelegt.“
„Vielleicht bieten Fräulein Luise und Eugenia später einige Lieder dar?“
Die beiden jungen Frauen nickten gehorsam.
Eugenia unterdrückte ein Gähnen und wurde von ihrem Bruder durch ein Hüsteln ermahnt. Sie kicherte leise, nahm ihre Teetasse und schlürfte lautlos die heiße Flüssigkeit, während sie sich wieder dem Gespräch der Männer widmete. Diese Art von Teegesellschaften war ihr vertraut. In der Stadt hatte Mutter regelmäßig solche gesellschaftlichen Verpflichtungen abgehalten. Dann hieß es, still und aufrecht am Tisch sitzen, freundlich dreinblicken, höflich Antwort geben, wenn man gefragt wurde, und ansonsten unauffällig bleiben. Eugenia unterdrückte wieder ein Gähnen.
„Es sind die Gelehrten, die ihren Freigeist verbreiten. Ich glaube nicht, dass sich das einfache Volk von dieser Stimmung mitreißen lässt“, sagte gerade der Lehrer.
Pfarrer Wilhelm Brachel schürzte nachdenklich seine Lippen. „Wir sollten die Sorgen des einfachen Volkes nicht unterschätzen: die Schulden, auch wenn kein Zehnt mehr zu leisten ist, die schlechte Ernte. So mancher Schultheiß in den Dörfern ist nicht so gerecht wie unserer. Wir haben Glück, den Gerlach Ernst bekommen zu haben. Er kümmert sich um die Belange der Dorfbewohner. Ich kenne einen Schultheiß, der widmet sich nur seinem Branntwein und führt sich wie ein König auf. Wenn dann die unterdrückten Menschen von der Befreiung ihrer Lasten hören, von Meinungsfreiheit, mehr Rechten – ich glaube sogar, das einfache Volk wird sich eines Tages erheben.“
„Das klingt aus Ihrem Mund so, als sei es eine Prophezeiung“, sagte der Doktor mit einem Schmunzeln. Die Männer lachten höflich.
„Herr Brachel hat das Talent, meistens recht zu haben“, versicherte der Lehrer und ließ sich von Charlotte Hentschel ein weiteres Stück Kuchen auf den Teller legen.
„Unser Herzog Adolph hat ein gutes Händchen, was seine Untertanen angeht. Niemand wird sich gegen ihn erheben. Wir haben es gut im Nassauer Land, wir sollten uns nicht beschweren“, sagte Anton Hentschel nun. Die Männer nickten im einträchtigen Einvernehmen, doch da erklang eine weitere Stimme:
„Wenn wir vergessen, dass wir nicht unsere Meinung in aller Öffentlichkeit sagen dürfen und wir uns dem Walten eines Herzogs unterwerfen müssen, keine Versammlungen abhalten können, keine freie politische Presse haben, das Wild im Wald nicht schießen dürfen.“ Moritz sah in die Runde. Auch das Gespräch der Frauen war verstummt. „Wenn wir all das vergessen, brauchen wir natürlich keine Freiheit. Aber die Macht eines Parlamentes, das vom Volk gewählt wird, ist größer und eindrucksvoller als das Erbe der Adeligen.“
Eugenia ließ langsam die Gabel mit dem Kuchenstück sinken und starrte ihren Bruder an. Solche Worte hatte sie von ihm noch nie gehört, und vielleicht waren es nicht einmal die Worte, die sie so beeindruckten, sondern der Nachdruck, mit dem er gesprochen hatte.
Anton Hentschel schien es ähnlich zu gehen, da er seinen Sohn mit einem überraschten Blick bedachte. „Ich wusste nicht, dass du so denkst“, sprach er. „Das klingt allerdings sehr nach aufrührerischen Gedanken. So etwas sollte nicht laut ausgesprochen werden. Man könnte meinen, du befürwortest diese neue Stimmung, die unsere Welt erfasst.“
Moritz schien erst darauf antworten zu wollen. Eugenia spürte den Unwillen in ihm, das Aufgebehren. Es war in diesem Augenblick allerdings fehl am Platz, und so stieß Eugenia unter dem Tisch mit einem Fuß gegen sein Bein, um ihren Bruder an einer Antwort zu hindern. Moritz zuckte zusammen und schwieg tatsächlich.
„Wir sollten nach dem Tee in das Musikzimmer gehen“, schlug Charlotte Hentschel vor, um von der angespannten Stimmung abzulenken.
Moritz trank seine Tasse leer. Eugenia rührte sich nicht und sah zu, wie die Gäste von der Tafel aufstanden und den Salon verließen, an der Spitze der Hausherr, der seinem Sohn zuletzt einen mahnenden Blick zuwarf.
„Was ist nur in dich gefahren?“, wollte Eugenia wissen, nachdem sie allein zurückgeblieben waren.
Moritz starrte auf die leere Tasse, die noch vor ihm stand, während er sprach: „Wie kann Vater behaupten, dass alles gut ist, wie es ist? Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Die Geburt entscheidet über unser Schicksal. Ist jemand gut betuchter Adeliger oder ein reicher Bürger, dann ist das Leben in Ordnung. Wirst du aber in die Familie eines Tagelöhners hineingeboren, bist du bis zu deinem Lebensende daran gebunden und wirst verachtet. Soll unsere Geburt tatsächlich bestimmen, wie wir unser Leben führen? Jeder Mensch sollte frei sein, in seinem Denken, in seinem Glauben und in dem, was er tun will.“
„Aber so ist das schon immer gewesen.“
„Ja, und deshalb ändert sich nichts. Wir werden geformt, wie es die Gesellschaft von uns erwartet. Sieh dich an, Eugenia. Du tust nichts anderes, als Vater zu gehorchen, dich in Handarbeit, in Hausarbeit und Musik zu bilden. Und wozu? Weil es dein Schicksal ist, einem anderen Mann zu gefallen, der von deinem Vater ausgesucht wird. Doch was willst du wirklich? Hat dich das irgendwann jemand gefragt?“
Eugenia war verblüfft über diese Worte, die so fremd und aufsässig klangen, dass sie sich zunächst fragte, ob sie überhaupt darüber nachdenken sollte. „Aber ich wurde so erzogen, Moritz. Und du ebenso. Warum sollten wir uns dagegenstellen?“
Sie war es gewohnt, mit ihrem älteren Bruder über alles reden zu können, über ihre Gedanken, ihre Sehnsüchte, aber bisher nie über Verbotenes oder gar Abwegiges. Sie hatte nicht gewusst, dass er so dachte, seine aufbegehrenden Worte waren neu für sie. Ob es etwas mit seinem Widerwillen dem Studium gegenüber zu tun hatte?
Seine Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
„Dein Wort wird niemals einem Mann gegenüber zählen. Ist dir gleichgültig, dass du irgendeinem alten Langeweiler übergeben wirst, der dir wiederum sagt, was du zu tun hast? Ist es das, was du willst?“
Sie war über seine Frage überrascht. Eugenia erhob sich von ihrem Platz und schob den Stuhl an den Tisch. „Ich habe darüber nie nachgedacht, lieber Bruder, und es hat auch keinen Sinn, es zu tun. Mein Leben gehört nicht mir, also kann ich nicht darüber verfügen.“
Moritz stand auf. „Vorhin sagtest du zu mir, du würdest gern anderen Menschen helfen, du würdest gern Medizin studieren. Also denkst du doch darüber nach!“
„Und du hast mich vorhin ausgelacht.“
Moritz nestelte an der Tischdecke herum, als wäre er bedrückt. „Ich lache dich nicht aus, Schwester. Ich habe vor einiger Zeit begriffen, dass uns etwas aufgezwängt wird, und das ist nicht richtig.“ Er wirkte plötzlich so ernst wie schon lange nicht mehr, fand Eugenia. Sie konnte sich von seinem Anblick nicht losreißen. „Du darfst deine Träume nicht aufgeben, Eugenia. Du solltest über deine Zukunft nachdenken. Und du solltest wissen, was du willst!“
Ihr schien es, als hätte er sich auf die Zunge gebissen, da er nicht mehr weitersprach.
Sie ging zur Tür des Esszimmers, während das Hausmädchen den Tisch abräumte. „Du hast nicht einmal den Mut, Papa zu sagen, dass du keine Medizin studieren willst, aber ich soll mir Gedanken machen, was ich wirklich will? Ich kann mein Leben nicht ändern und mein Schicksal auch nicht.“ Sie hielt inne. „Natürlich habe ich Träume. Und ja, ich würde gern Ärztin werden, Menschen helfen, so wie Vater. Und ich möchte einen Mann finden, den ich liebe und der mich liebt, so wie ich bin. Ich will mit ihm gemeinsam etwas aufbauen, dafür arbeiten und ein erfülltes Leben führen, mit Heim und Kindern.“
Moritz nickte zufrieden, als hätte er genau diese Antwort von seiner Schwester erwartet. „Vielleicht wird eine Revolution etwas ändern und Frauen dürfen eine eigene Meinung haben und ihr Leben selbst bestimmen“, überlegte er laut. „Und vielleicht wird es dann auch Frauen als Ärzte geben.“
„Ein Bürgeraufstand wird nicht das Denken der Menschen ändern“, widersprach Eugenia mit einem Unterton von Trostlosigkeit. „Menschen wie Vater werden niemals solche freizügigen Wünsche akzeptieren. Meinungsfreiheit, Gleichstellung, das sind Fremdwörter für ihn. Nein, selbst wenn alle Menschen plötzlich anfingen, nach diesen neuen Prinzipien zu leben, Papa würde das niemals tun.“
„Dann muss jeder an sich arbeiten, damit die neuen Ideen durchgesetzt werden können.“ Moritz wirkte plötzlich entschlossen, so als wäre er zu einer Entscheidung gelangt, über die er bisher nur nachgedacht hatte.
Sie war über sein Verhalten weiterhin erstaunt und sagte: „Ein Bürgerkrieg bringt Tod und Elend. Ich kenne die Geschichten, als in Frankreich das Volk auf die Straße ging. Kurze Zeit später führte Napoleon Krieg gegen alle. Viele Menschen mussten damals sterben. Unschuldige wurden dahingerafft, für was? Für Freiheit und Brüderlichkeit. Das war keine gute Zeit und ich will sie nicht erleben. Es reicht mir, darüber gelesen zu haben.“ Sie hatte die Tür erreicht, die offen stand.
„Du liest über Kriege, über andere Länder und ihre Sitten. Du bist nicht wie die anderen Mädchen. Du bist viel zu klug und wissbegierig. Welcher Mann will eine gebildete Frau, Eugenia?“, hörte sie ihren Bruder sagen.
Sie streckte das Kinn vor, eine eingeübte Trotzhaltung. „Bildung kann man verstecken.“
„Aber nicht die Sehnsucht danach.“
Kapitel 2
Wiesbaden
Doktor Hentschel beugte sich vor, um einen Blick aus dem Fenster der Kutsche zu werfen. Umgeben von zahlreichen Hügeln und Wäldern, eingebettet zwischen dem Taunus und dem breiten Strom des Rheins, lag nun Wiesbaden vor ihm. Es war ein schöner Ort, fand Anton, nicht grundlos der Mittelpunkt des Herzogtums. In dieser Stadt residierte der Landesherr, Herzog Adolph von Nassau. Das milde Klima, die Wälder, so weit das Auge reichte, und die Mineralquellen machten die Stadt zu einem beliebten Ziel von Reisenden und Kranken. Anton Hentschel profitierte davon. In Zeiten von Missernten und Unmut wurde aus Wiesbaden ein Anziehungspunkt für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die hofften, Arbeit in der Stadt zu finden. Anton spürte den Umschwung selbst in seiner Praxis, wenn seine Patienten von nichts anderem sprachen als von Revolution und Regierungswechsel.
Er wies seinen Kutscher an, einen kleinen Umweg zu machen, direkt durch die Stadt. So fuhr er an dem Schloss vorbei, das der Herzog von Nassau vor wenigen Jahren inmitten der Stadt hatte erbauen lassen. Umringt von prachtvollen Häusern, bäuerlichen Höfen und Kirchen konnte Herzog Adolph seinem Volk nah sein. Es war ein prächtiges Gebäude, mit Säulen und einem kleinen Balkon, auf dem sich manchmal der Herzog seinem Volk zeigte.
Anton beobachtete die Passanten, die über den großen Platz vor dem Schloss spazierten. Die Stadt war nicht nur für die Vielzahl der Thermalquellen und deren Heileigenschaften bekannt, sondern auch für den Frohsinn und die Großmut der Bewohner. Selbst Goethe war im März 1818 über Wiesbaden eingefallen, „dass das Leben dort zu leicht, zu heiter sei, als dass man nicht verwöhnt würde fürs übrige Leben“.
An den Straßen reihten sich Bäume, dahinter prunkvolle Villen. Kutschen fuhren daran vorbei, Fußgänger spazierten am Rand der Straßen, von denen die wichtigsten gepflastert waren. Zwischen Eichen und Kastanien lag das Kurhaus, das vor einigen Jahren gebaut worden und dessen Entstehung dem Glücksspiel zu verdanken war. Auf der Wilhelmstraße flanierten bei schönem Wetter Kurgäste und Bürger. Doch heute senkten sich die Wolken düster über die Stadt.
Anton Hentschel hielt den Einspänner vor dem großen Haus. Es war Vorbild gewesen für das in Holzhausen errichtete Gebäude: Zwei runde Säulen trugen ein vorgezogenes Dach über dem Eingangsportal. Hier hatten sie viele Jahre verbracht. Der weiße Putz strahlte trotz des verhangenen Himmels. Ein Bursche eilte herbei und führte das Pferd mit der Kutsche um das Haus. Der Verwalter, der sich während der Abwesenheit der Hentschels um das Haus kümmerte, begrüßte Anton Hentschel freudig. „Herzlich willkommen, Herr Doktor.“
„Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist, Henning? Ich habe einige Termine wahrzunehmen und werde heute den ganzen Tag in der Praxis sein.“
„Möchten Herr Doktor am Abend ein Essen serviert bekommen?“
„Ja, um sieben Uhr.“
„Sehr wohl, Herr Doktor.“ Der Verwalter verbeugte sich und verschwand in der Eingangshalle, während sich Anton Hentschel in die Wohnstube zurückzog. Die Wände waren in einem hellen Grün gestrichen. Auf einem eckigen Teppich standen drei Stühle, ein Tisch und ein Sofa. Ihre Bezüge waren aus rotem und grünem Wolldamast. Um im Sommer die Sonne abzuhalten, waren Spannvorhänge an den Fenstern angebracht. In dieser vertrauten Umgebung angekommen, steckte sich Anton Hentschel eine Pfeife an. Es kam ihm alles leer vor, ohne Familie. Er war es gewohnt, dass dort auf dem Sofa seine Frau saß und stickte oder die klare Stimme seiner Tochter durch das Haus klang oder sie am Pianoforte spielte.
Jetzt herrschte Stille im Haus.
Anton zog nachdenklich an der Pfeife und ein süßer Duft verbreitete sich um seinen Kopf. Sein Blick fiel auf ein Gemälde, das an der Wand hing. Er, inmitten seiner Familie.
Das seltsam beengende Gefühl seiner Schuld war wieder präsent, während er das Bild anstarrte. Plötzlich fühlte er sich wie schon so oft um einige Jahre zurückversetzt. Den Tod eines Menschen zu verantworten, war eine große Last. Die Schuld lag ihm noch immer schwer auf der Seele, doch er hatte gelernt, damit zu leben. Es war nicht so, dass er noch nie einen Patienten verloren hatte oder ihn nicht hatte heilen können. Jedoch war es ihm noch nie passiert, dass er sich so sehr in seiner Einschätzung geirrt hatte, dass ein Mensch mit seinem Leben bezahlen musste. All die Jahre waren diese Selbstvorwürfe seine ständigen Begleiter gewesen. Sebastian hatte er es zu verdanken, dass er als Arzt weiterpraktizierte und für seine Familie ein guter Ehemann und Vater geblieben war. Ausgerechnet dieser Freund bereitete ihm nun Sorgen.
Der Rauch, den Anton aus seinem Mund blies, umhüllte das Gemälde, auf dem seine Familie zu sehen war. Charlotte Hentschel zeigte ein schüchternes Lächeln. Obwohl das Bild vor einigen Jahren gemalt worden war, wirkte Moritz bereits erwachsen. Stolz erfüllte den Arzt, als er an seinen ältesten Sohn dachte. Der Blick fiel auf den goldenen Schopf seiner Tochter. Ein liebevoller Zug lag um Eugenias Lippen, ihre Wangen rosig, ein Strahlen in ihren Augen. Anton Hentschel zog an seiner Pfeife und die Aussicht auf das Gemälde verschwand leicht im Tabakrauch. Sein Herz zog sich zusammen, als er die Anmut seiner Tochter betrachtete, trotz des Schleiers vor seinen Augen.
Da klopfte es an die Tür und der Verwalter trat ein. Er räusperte sich, bevor er sprach: „Verzeihen Sie die Störung, Herr Doktor. Sie haben Besuch.“ Der Mann trat zur Seite und ein Herr im Frack mit Zylinder auf dem Kopf stürmte in den Raum und sagte ohne Begrüßung:
„Sieh an, mein guter Freund lässt sich auch wieder in der Stadt blicken.“ Anton Hentschel ließ die Pfeife sinken und starrte den Mann entgeistert an. „Sebastian? Was machst du hier?“
„Ich freue mich auch, dich zu sehen“, witzelte der Herr. Seine schlanke Gestalt und das gebräunte Gesicht ließen ihn jung wirken. Unter seiner Jacke trug Sebastian eine geblümte Weste, das weiße Hemd und der Stehkragen verliehen ihm ein stattliches Aussehen. Um die Augen zogen sich zwar kleine Falten, die sich vertieften, wenn Sebastian lachte, ansonsten war ihm sein Alter kaum anzusehen. Immer vergnügt, immer ein Scherz auf der Zunge, dachte Anton und wurde übelgelaunt.
„Du bist nach unserem Gespräch vor einigen Monaten einfach verschwunden. Ich wollte dir Zeit zum Nachdenken lassen“, sagte Sebastian, als wollte er sich dafür entschuldigen, sich nicht gemeldet zu haben.
Doktor Hentschels Gesicht verfinsterte sich. Er hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Er betrachtete ein letztes Mal den liebreizenden Anblick auf dem Gemälde und wandte sich seinem Freund zu. „Charlotte ging es nicht gut. Sie verträgt die Hektik in der Stadt nicht mehr, deshalb sind wir auf das Land gezogen.“
Sebastian trat an den Kamin, vor dem auch Anton Hentschel stand, und warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. „Natürlich, Charlotte. Ich hoffe, sie fühlt sich wohl auf dem Land.“ Die Ironie in seiner Stimme war nicht zu überhören.
„Es geht ihr deutlich besser.“
„Ich dachte schon, du willst dich vor mir verstecken.“ Da war ein Funkeln in seinen Augen.
Doktor Hentschel schien die Beherrschung zu verlieren. Er nahm die Pfeife aus dem Mund und legte sie zur Seite. „Was willst du, Sebastian?“
„Ich habe nicht viel zu tun, seitdem du mir den Zugang zu unserer Praxis untersagt hast.“
„Du sagst das so vorwurfsvoll, als sei ich schuld daran.“
„Natürlich bist du schuld. Du hast mich rausgeworfen.“
„Weil du mit dieser Medizin, die ich gar nicht Medizin nennen will, herumexperimentierst. Du schadest unserem Ruf und dem aller Ärzte, wenn du solche Quacksalbermethoden anwendest.“
Sebastian winkte ab, als wollte er sich nicht mit dem Mann über seine Methoden unterhalten. „Woher weißt du, dass ich in der Stadt bin?“, fragte Anton Hentschel plötzlich. „Du beobachtest mich?“
„Ach, das hört sich an, als sei ich krank im Kopf“, erwiderte Sebastian erheitert. „Nein, ich weiß nur, was du so tust.“
Doktor Kreutzer lehnte sich an den Kaminsims. Das Feuer prasselte in dem offenen Schacht. Anton Hentschel betrachtete Sebastian mit gemischten Gefühlen. Sie waren gute Freunde gewesen, lange Zeit. So lange schon, dass Anton gar nicht mehr wusste, auf welche Weise sie sich kennengelernt hatten. Beide fanden ihre Leidenschaft in der Heilung von Kranken. Sie hatten einen gemeinsamen Weg beschritten und eine vom Herzog genehmigte Praxis in Wiesbaden aufgebaut, die zahlreiche Patienten und kranke Kurgäste anzog. Und das in einer Zeit, in der die meisten Ärzte in Wiesbaden Beamte waren und im Dienst der Regierung standen. Doch Anton und Sebastian hatten die freie Ausübung ihres Berufes gewählt. Es war eine gute Zeit gewesen, erinnerte sich Anton Hentschel. Jedoch nur, bis er entdeckt hatte, dass sein Freund die Gesundheit der Patienten aufs Spiel setzte, um Profit zu machen.
„Hast du über unser Gespräch nachgedacht?“, wollte Sebastian wissen. „Aber natürlich hast du das, sonst wärst du nicht Hals über Kopf nach … wohin gezogen? Holzhausen? Ein nettes Dorf, nehme ich an. Träumerisch ruhig.“
Anton Hentschel knirschte mit den Zähnen. „Hör auf damit! Lassen wir diese Tirade über Freundschaft. Ich weiß, warum du hier bist, und ich sage das Gleiche wie das letzte Mal.“
Sebastian winkte lässig ab. „Aber, aber, Anton, wir wollen uns doch nicht mehr streiten.“
„Du bist in meinen Augen kein Arzt mehr. Du benutzt unsere Patienten für deine Bereicherung, das ist erbärmlich und gegen unser Bestreben, Leben zu retten. Ich will dich nicht mehr als Geschäftspartner oder als Freund.“
„Leben retten? Darüber musst ausgerechnet du reden.“ Die Stimme hatte einen abfälligen Klang angenommen.
Stille.
Das Gesicht von Anton Hentschel wurde dunkelrot, als ihm sein Vergehen ins Gedächtnis gerufen wurde. „Als würde ich nicht oft genug daran denken.“ Er sagte es leidenschaftlich. Ausgerechnet Sebastian musste ihn daran erinnern. Er, der einst sein Freund gewesen war, der all den Kummer miterlebt hatte. „Unsere Zusammenarbeit endete, weil ich gegen deine Methoden bin und gegen deinen neuen Lebenswandel“, sagte Anton Hentschel nun mit Nachdruck. „Mir ist damals ein Fehler unterlaufen, den ich bitter bereue, heute noch. Du aber bist rücksichtslos und gierig geworden.“
Sebastian schien erheitert über die Reaktion des Mannes. „Du bist blind der modernen Medizin gegenüber. Und ich bin nicht rücksichtslos. Es gibt in der Zwischenzeit fortschrittlichere Erkenntnisse, mein Freund. Die willst du nicht annehmen. Du bist ignorant. Vielleicht hätten wir damals den Mann retten können, der unter deinen Händen gestorben ist.“
„Ich habe eine falsche Diagnose gestellt, aber er wäre an seiner Krankheit sowieso gestorben. Das hast du selbst damals gesagt.“
Sebastian zuckte mit den Schultern. „Ach, das habe ich nur zu dir gesagt, um dich zu beruhigen. Du warst ein nervliches Wrack.“
Anton Hentschel trat bestürzt zurück. „Und du hast dich verändert, Sebastian. Interessiert dich nur noch das Geld, das du von deinen Patienten bekommst? Hast du noch ein Gewissen?“
„Ansehen und Vermögen kommen einem nicht entgegengeflogen. Aber das verstehst du nicht. Du warst schon immer gut situiert, hast alles bekommen, was du wolltest. Dein Studium, deine Praxis, dieses Haus, die Frau …“
„Jetzt fang nicht wieder damit an. Charlottes Vater hat meinem Antrag damals zugestimmt, ehe ich ahnen konnte, dass du sie wolltest.“
Sebastian schien seine Heiterkeit zu verlieren. Er ballte die Hände und machte einen Schritt auf den Mann zu. „Ich will auch endlich etwas, und zwar ohne dafür kämpfen oder bezahlen zu müssen!“
Anton Hentschel war klar, dass sie nun zu dem Punkt kamen, der vor einigen Monaten den endgültigen Bruch ihrer Freundschaft herbeigeführt hatte. „Ich gebe sie dir nicht.“ Anton Hentschel klang eigenwillig, hoffte auf keine Widerworte.
Sebastian versuchte sich zu beruhigen und setzte seine erheiterte Miene wieder auf. „Ich habe seit unserem Streit nachgedacht, und je mehr Zeit vergangen ist, desto sicherer bin ich mir, eine Entschädigung von dir verlangen zu können. Du hast mir meine Arbeit genommen. Unsere Praxis war sehr beliebt.“
„Du hättest dabei bleiben sollen, die Patienten anständig zu behandeln, stattdessen gehst du deinen dubiosen Geschäften nach und erpresst mich.“
„Ich habe niemanden damit umgebracht.“
Wieder der Hinweis auf sein Vergehen. Anton Hentschel hätte den Mann am liebsten aus seinem Haus geworfen, doch er wusste, dieses Gespräch war noch nicht zu Ende.
Sebastian stieß sich von dem Kaminsims ab und schlenderte zum Sofa, um sich dort in seiner saloppen Art niederzulassen. Er schlug ein Bein über das andere und schien zu frohlocken. „Für dich bedarf es keiner großen Überwindung, meiner Bitte nachzukommen. Gib mir, was ich verlange, und ich lasse dich in Ruhe. Ich werde nach Frankfurt gehen, um dort die Erlaubnis für eine freie Praxis zu erbitten. Dort sind die Ärzte sowieso besser angesehen.“
Anton Hentschel drehte sich von dem Kamin fort. Fast widerwillig stellte er die folgende Frage: „Und wenn ich nicht einwillige? Was willst du dann tun?“
Es dauerte eine Weile, bis Sebastian sprach. Dabei klang er, als wollte er zu einem Teenachmittag einladen. „Ich werde deinen Namen in den Schmutz ziehen und deinen Ruf ruinieren.“
Antons schlimmste Befürchtung würde wahr werden. „Was ist aus dir geworden, Sebastian?“
„Ein Mann, der nicht jünger wird. Also, wie lautet deine Antwort?“
Anton Hentschel überkam ein unbehagliches Gefühl. Er hatte dieses Gespräch mit Sebastian schon einmal geführt. Er hatte geglaubt, sie seien Freunde, die sich alles anvertrauen können. Doch er hatte sich geirrt. Auch wenn er über den letzten Streit nachgedacht und tatsächlich erwogen hatte nachzugeben, so war ihm nun die Erkenntnis ganz deutlich geworden. Er würde auf Sebastians Forderung nicht eingehen. Seine Stimme klang entschlossen, so entschlossen, wie man sein konnte, wenn man alle Konsequenzen in Kauf nahm. „Du bekommst Eugenia nicht, ganz gleich was du tust. Ich werde meine Tochter nicht einem nachlässigen Menschen wie dir überlassen.“ Anton holte Luft, als müsste er Kraft sammeln. „Und jetzt verlasse mein Haus!“
Sebastian ließ das übergeschlagene Bein von dem anderen rutschen und erhob sich langsam, als sei er ein alter Mann mit Gebrechen. Er schien durch die Worte nicht entmutigt zu sein. Mit wenigen Schritten war er bei Anton Hentschel und baute sich vor ihm auf. In seinem Gesicht zuckte es leicht, die Augen blitzten gefährlich auf. Seine Stimme klang tief und grollend. „Ich lasse dir noch einmal Zeit nachzudenken. Du weißt genau, dass ich dich zugrunde richten kann.“ Seine Stimmte hatte zum Schluss schneidend geklungen.
Anton Hentschel zweifelte nicht an der Drohung. Voller Sorge blickte er dem Mann nach, der mit festen Schritten zur Tür ging und ohne ein Wort des Abschieds die Wohnstube verließ.
Anton seufzte. Er war tatsächlich nach Holzhausen gezogen, um seine Tochter aus dem gesellschaftlichen Leben zu ziehen und damit aus dem Kreis gewisser Personen. So hatte er gehofft, sein ehemaliger Freund würde von der Idee ablassen, Eugenia heiraten zu wollen. Das war wohl ein Irrtum. Auch wenn das humorvolle Gemüt Sebastians und Eugenias Offenheit zusammenpassten, eine Heirat kam nicht in Frage. Sebastians Lotterleben war allgemein bekannt. Seine erste Gattin sollte angeblich an ihrem Gram gestorben sein, da sich Sebastian stets den Vergnügungen gewidmet hatte, statt Verantwortung zu übernehmen. In den letzten Monaten war Sebastian zudem zu einem jähzornigen, raffgierigen Menschen geworden. Solange Eugenia in Holzhausen verweilte, hatte Anton genug Zeit nachzudenken, was er tun konnte, um Sebastian zur Vernunft zu bringen. Er bereute es nicht, seiner Tochter die ländliche Einsamkeit anzutun. Dadurch ersparte er ihr ein durchaus schlimmeres Schicksal. Anton wollte diesen Kummer von ihr fernhalten. Das war ein Problem, das nur ihn allein betraf. Sie durfte davon nichts erfahren.
Kapitel 3
Holzhausen, einige Tage später
Eugenia saß an dem Sekretär in ihrem Zimmer über einen Brief gebeugt. Seitdem Moritz Holzhausen verlassen hatte, war es noch einsamer geworden. Sie hatte mit ihrem Bruder über alles reden können. Sie hatten Ausritte unternommen und waren über die grünende Ebene zum Wald galoppiert, um dort Rehe zu beobachten. Nun war ihr Bruder abgereist, um sein Studium fortzusetzen. Eugenia verfasste einen Brief an ihre Freundin Dorothea in Wiesbaden und unterließ es nicht, ausschweifende Bemerkungen über das langweilige Leben niederzuschreiben. Vor einigen Tagen war ihr Vater nach Wiesbaden gefahren. Enttäuscht hatte sie ihm nachgeschaut. Damit war die Eintönigkeit zurückgekehrt, die Eugenia so einschläfernd fand. Mit ihr kam auch die Verbitterung.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!