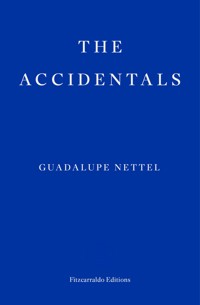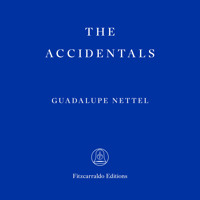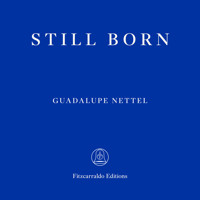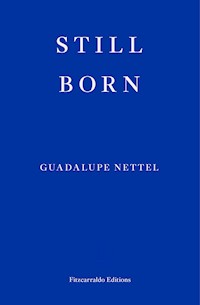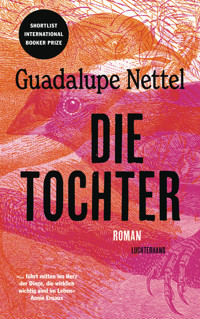
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unvergessliche Geschichte über die Ambivalenz des Mutterseins und Nicht-Mutterseins, über Freundschaft und die Solidarität von Frauen. »Diese Geschichte führt mitten ins Herz der Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben.« Annie Ernaux Der internationale Erfolgstitel - in 23 Länder verkauft, Shortlist International Booker Prize, ausgewählt vom »New Yorker« als eines der »Best Books 2023«.
Die beiden Freundinnen hatten sich geschworen, niemals Mutter zu werden. Unvorstellbar, ihre Freiheit für ein Kind aufzugeben. Und doch ist eines Tages alles anders. Alina wird schwanger. Laura, die sich die Eileiter durchtrennen ließ, empfindet dies als Verrat. Weshalb die Fehler der eigenen Mütter wiederholen und sich in Abhängigkeit begeben? Dann aber stellen die Ärzte fest, dass etwas mit Alinas Baby nicht stimmt. Ihr Leben nimmt einen ganz anderen Lauf, als sie es sich gedacht hatte. Zu selben Zeit freundet sich Laura mit einem kleinen Jungen in der Nachbarschaft an, dessen Mutter ihn vernachlässigt. Die neuen Erfahrungen wecken Ungeahntes im Inneren der beiden Freundinnen. Auf zwei sehr unterschiedlichen Arten lernen sie kennen, was es auch heißen kann, Frau zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
»Diese Geschichte führt mitten ins Herz der Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben.« Annie Ernaux
Die beiden Freundinnen hatten sich geschworen, niemals Mutter zu werden. Unvorstellbar, ihre Freiheit für ein Kind aufzugeben. Und doch ist eines Tages alles anders. Alina wird schwanger. Laura, die sich die Eileiter durchtrennen ließ, empfindet dies als Verrat. Weshalb die Fehler der eigenen Mütter wiederholen und sich in Abhängigkeit begeben? Dann aber stellen die Ärzte fest, dass etwas mit Alinas Baby nicht stimmt. Ihr Leben nimmt einen ganz anderen Lauf, als sie es sich gedacht hatte. Zur selben Zeit freundet sich Laura mit einem kleinen Jungen in der Nachbarschaft an, dessen Mutter ihn vernachlässigt. Die neuen Erfahrungen wecken Ungeahntes im Inneren der beiden Freundinnen. Auf zwei sehr unterschiedliche Arten lernen sie kennen, was es auch heißen kann, Frau zu sein.
Zur Autorin
Guadalupe Nettel, 1973 in Mexico City geboren, zählt zu den wichtigsten Stimmen der lateinamerikanischen Literatur. Sie wuchs in Frankreich, Montreal und Barcelona auf und promovierte an der École des Hautes Études in Paris. Ihre Romane erhielten internationale Anerkennung und wurden mit bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet. Ihr Erfolgsroman Die Tochter erscheint in 23 Sprachen und war für den International Booker Prize nominiert. Guadalupe Nettel lebt in Mexico City und in Paris.
Zur Übersetzerin
Michaela Meßner übersetzt Literatur aus dem Spanischen, Französischen und Englischen, u. a. von César Aira, Cristina Campos und Arantza Portabales.
GUADALUPE NETTEL
DIE TOCHTER
Roman
Aus dem mexikanischen Spanischvon Michaela Meßner
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »La hija única« bei Editorial Anagrama, Barcelona.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 Guadalupe Nettel c/o Indent Literary Agency
www.indentagency.com
Copyright der deutschen Ausgabe © 2025 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: buxdesign | München unter Verwendung eines Designs von © Katya Mezhibovskaya
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31365-4V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für meine Freundin Amelia Hinojosa, die mir großzügig erlaubte, ihre Geschichte in allen Details zu erzählen, und mir die Freiheit ließ, notfalls etwas dazuzudichten.
If you’ve never wept and want to, have a child.
David Foster Wallace, Incarnations of Burned Children
Scendono dai nostri fianchi I lombi di tanti figli segreti
Alda Merini, Reato di vita
Der Mensch, der sich einem anderen gegenüber für überlegen, unterlegen oder auch gleichwertig hält, begreift die Wirklichkeit nicht.
Buddha, das Diamantsutra
Einem Baby beim Schlafen zuzusehen, ist, als betrachte man die Zerbrechlichkeit allen Menschenlebens. Seinem sanften und gleichförmigen Atem zu lauschen, bewirkt eine Mischung aus Ruhe und Andacht. Ich betrachte das Baby vor mir, sein Gesicht ist entspannt, ein wenig gedunsen, Milch rinnt ihm aus dem Mundwinkel, die Lider sind vollkommen, und mir kommt der Gedanke, dass jeden Tag eines der Kinder, die schlafend in all den Wiegen dieser Welt liegen, nicht weiterlebt. Es erlischt, lautlos wie ein Stern, der durchs Universum irrt, einer unter Tausenden, die weiterhin die Dunkelheit der Nacht erhellen, doch sein Tod beunruhigt niemanden, nur die engsten Verwandten. Die Mutter wird ihr Leben lang untröstlich sein, hin und wieder auch der Vater. Alle anderen nehmen die Tatsache mit erstaunlicher Resignation hin. Der Tod eines Neugeborenen ist so alltäglich, dass er niemanden überrascht, und doch – wie können wir ihn hinnehmen, nachdem die Schönheit dieses unversehrten Wesens uns gerührt hat? Ich sehe das Baby schlafen, in seinem grünen Strampler liegt es da, der Körper ist ganz entspannt, der Kopf ruht zur Seite geneigt auf dem kleinen weißen Kissen, und ich wünsche mir, dass es am Leben bleibt, dass sein Schlaf wie auch sein Leben durch nichts gestört wird, dass alle Gefahren der Welt von ihm abgewendet werden und der zerstörerische Sturm der Katastrophen an ihm vorüberzieht, ohne es zu bemerken. »Solange ich bei dir bin, wird dir nichts passieren«, verspreche ich, obwohl ich weiß, dass das gelogen ist, denn tief im Inneren bin ich genauso hilflos und verletzlich wie dieses Baby.
ERSTER TEIL
1
Vor wenigen Wochen sind in die Wohnung nebenan neue Leute eingezogen. Eine Frau mit einem kleinen Jungen, der offenbar, um es vorsichtig auszudrücken, mit seinem Leben nicht zufrieden ist. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber so viel kann ich allein vom Zuhören behaupten. Gegen zwei Uhr, wenn der Essensgeruch aus der Wohnung durch die Flure und das Treppenhaus unseres Mietshauses weht, kommt er aus der Schule. Jeder weiß, dass er jetzt da ist, denn er klingelt immer Sturm. Kaum hat er die Tür hinter sich zugezogen, gehen die Dezibel hoch, denn er schreit los, dass ihm nicht passt, was es zu Mittag gibt. Dem Geruch nach zu urteilen, ist das Essen weder gesund noch appetitlich, aber die Reaktion des Jungen ist wirklich überzogen. Er flucht und schimpft, irgendwie befremdlich bei einem Kind seines Alters. Außerdem knallt er die Türen und wirft alles Mögliche an die Wand. Und das hört nicht so bald auf. Seit sie eingezogen sind, habe ich drei Ausbrüche miterlebt, aber bis zum Schluss habe ich nie durchgehalten, sodass ich gar nicht sagen könnte, wie es endet. Er schreit so laut und verzweifelt, dass ich nur die Flucht ergreifen kann.
Ich muss gestehen, mit Kindern bin ich noch nie gut zurechtgekommen. Wenn sie mir zu sehr auf die Pelle rücken, gehe ich ihnen aus dem Weg, und wenn sich der Umgang mit ihnen nicht vermeiden lässt, weiß ich nicht recht, wie ich es anstellen soll. Ich gehöre zu den Menschen, die sich völlig verkrampfen, wenn sie im Flugzeug oder im Wartezimmer eines Arztes ein Baby weinen hören und das keine zehn Minuten aushalten. Aber ich lehne Kinder auch nicht grundsätzlich ab. Wenn ich ihnen im Park beim Spielen zusehe oder beobachte, wie sie sich im Sandkasten um ein Spielzeug prügeln, amüsiert mich das durchaus. Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, wie wir Menschen uns benehmen würden, gäbe es keine Anstands- und Höflichkeitsregeln. Jahrelang habe ich meine Freundinnen zu überzeugen versucht, dass es ein nicht wiedergutzumachender Fehler ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ich habe ihnen erklärt, dass Kinder, so nett und süß sie in ihren guten Momenten auch sein mögen, immer eine Beschränkung der Freiheit und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, von den körperlichen und seelischen Herausforderungen ganz zu schweigen: neun Monate Schwangerschaft, weitere sechs oder noch mehr Monate Stillzeit, viele schlaflose Nächte, solange sie klein sind, und später dann, wenn sie in die Pubertät kommen, die ständige Sorge um sie. »Außerdem ist die Gesellschaft so eingerichtet, dass wir, und nicht die Männer, uns um die Kinder kümmern, und das bedeutet oft den Verzicht auf eine Karriere, auf Sachen, die man allein unternimmt, auf Erotik und manchmal sogar auf den Partner«, erklärte ich ihnen mit Nachdruck. »Ist es das wirklich wert?«
2
Damals war mir Reisen sehr wichtig. Ferne Länder entdecken, über die ich wenig wusste, sie auf dem Landweg, zu Fuß oder in klapprigen Bussen, durchstreifen, ihre Kultur und ihre Küche kennenlernen, all das gehörte zu den Vergnügungen dieser Welt, auf die ich niemals hätte verzichten wollen. Ich habe einen Teil meines Studiums außerhalb Mexikos absolviert. Trotz meiner damals prekären Lebensverhältnisse betrachte ich diese Zeit immer noch als die sorgloseste Phase meines Lebens. Ein wenig Alkohol und ein paar Freunde, mehr brauchten wir nicht, um jede Nacht zum Fest werden zu lassen. Wir waren jung, und im Gegensatz zu heute steckten wir schlaflose Nächte problemlos weg. Da ich in Frankreich lebte, konnte ich selbst mit wenig Geld fremde Welten erkunden. In Paris verbrachte ich viele Lesestunden in Bibliotheken, ging ins Theater, besuchte Bars oder Nachtclubs. Nichts davon ist mit einer Mutterschaft vereinbar. Frauen mit Kindern können so nicht leben. Zumindest nicht in den ersten Jahren. Wollen sie einfach mal nachmittags ins Kino oder abends auswärts essen gehen, müssen sie vorausschauend planen, einen Babysitter kommen lassen oder den Ehemann überreden, auf die Kinder aufzupassen. Wann immer es also mit einem Mann ernst wurde, erklärte ich ihm, dass er mit mir niemals Kinder haben würde. Fing er eine Diskussion mit mir an oder gab nur die leiseste Traurigkeit oder das geringste Unbehagen zu erkennen, führte ich sofort die Überbevölkerung der Erde an, das war ein triftiger Grund, humanitär genug, um nicht als verbittert oder, im schlimmsten Fall, egoistisch abgestempelt zu werden, wie es Frauen, die beschlossen haben, sich der traditionellen Geschlechterrolle zu entziehen, oft widerfährt.
Anders als in der Generation meiner Mutter, für die es undenkbar war, keine Kinder bekommen zu wollen, entschieden sich in meiner Generation viele dagegen. Meine Freundinnen zum Beispiel ließen sich in zwei gleich große Gruppen aufteilen: Die einen wollten ihre Freiheit aufgeben und sich für den Erhalt der Spezies opfern, die anderen waren bereit, in den Augen von Gesellschaft und Familie in Ungnade zu fallen, um ihre Autonomie zu bewahren. Beide Seiten vertraten ihre Haltung mit starken Argumenten. Natürlich verstand ich mich besser mit der zweiten Gruppe. Alina zählte auch dazu.
Wir lernten uns kennen, als wir Mitte zwanzig waren, was in vielen Gesellschaften immer noch als das beste Alter fürs Kinderkriegen gilt, doch wir hegten beide eine ähnliche Abneigung gegen das, was wir mit einem verschwörerischen Augenzwinkern »die menschliche Fußfessel« nannten. Ich promovierte in Literaturwissenschaft, und weder mein Stipendium noch meine freiberufliche Tätigkeit bot mir irgendeine finanzielle Sicherheit. Alina hatte einen anspruchsvollen, aber gut bezahlten Job an einem Kunstinstitut und gab ihr Bestes, sich nebenbei zur Kulturmanagerin ausbilden zu lassen. Sie verdiente zwar doppelt so viel wie ich, schickte aber einen Großteil ihres Geldes nach Hause, um ihre Familie zu unterstützen: Der Vater war seit vielen Jahren krank und lebte allein in einem Dorf in Veracruz, während ihre Mutter nach einem Schlaganfall wieder auf die Beine zu kommen versuchte. Alina hatte früh jene Lebensphase erreicht, in der die Eltern auf uns angewiesen sind. Wie hätte sie sich da noch um ein Kind kümmern sollen?
Damals begeisterte ich mich für Wahrsagerei, vor allem Handlesen und Tarot hatten es mir angetan. Ich erinnere mich, wie ich eines Abends nach einer langen Feier, an deren Ende unter anderem zwei Gläser kaputt waren und der Balkon ein Flaschenfriedhof, mit Alina allein in meiner Wohnung saß. Die Schritte des letzten Gastes verhallten in der Rue Vieille du Temple, in der um diese Zeit keine Menschenseele mehr unterwegs war. Ich fragte Alina, ob ich ihr die Karten legen dürfe. Sie tat es nur mir zuliebe, denn sie war eine pragmatische Frau, der die Vorstellung, Botschaften von unsichtbaren Mächten zu erhalten, völlig abstrus erschien. Tarot war für sie offenbar ein Spiel wie jedes andere. Ich benutzte an jenem Abend ein komplexes Legesystem, das ihr ganzes Leben einbezog. Alina mischte die Karten mehrmals und legte sie dann an den Stellen, auf die ich deutete, vor sich auf den Tisch. Als alle Karten an ihrem Platz waren, drehte ich sie, da ich schon recht angezwitschert war und es so theatralischer wirkte, sehr langsam um. Wie beim Entwickeln eines Fotos, das man in Silbernitrat taucht, kam allmählich die Geschichte zum Vorschein. In der Mitte der Heldenreise erschienen die Herrscherin, die Sechs der Schwerter, der Tod und der Gehängte. Die Karte mit dem Tod – die dreizehnte Arkana, die in vielen Tarotspielen gar keinen Namen trägt – bedeutet nicht immer, dass jemand stirbt, verweist aber auf eine radikale und tiefgreifende Veränderung. Alles deutete darauf hin, dass eine Tragödie ihrem Leben eine andere Richtung geben, es vielleicht sogar brutal beenden würde. Sosehr ich mich auch bemühte, ich konnte meine Überraschung nur schwer verhehlen. Alina musste meine entsetzte Miene bemerkt haben, denn sie fragte besorgt, was ich in den Karten las.
»Hier steht, dass du ein Kind bekommen und ein Leben im Kloster führen wirst«, sagte ich mit einem verschmitzten Lächeln.
Alina schüttelte energisch den Kopf und lachte, wahrscheinlich dachte sie, es sei ein Scherz. Trotzdem sahen ihre großen schwarzen Augen mich fragend an, und ich nahm unterschwellig wahr, wie sehr das Gehörte sie beunruhigte. Wir tranken weiter, und nachdem wir ein paar Stunden später die letzte Flasche geleert hatten, verabschiedete ich sie vor der Haustür. Ich stieg wieder in meine Wohnung hinauf und legte mich, erschrocken über das, was ich gesehen hatte, ins Bett.
Monate später beschloss Alina, nach Mexiko zurückzukehren, wo sie eine gute Stelle in einer Galerie gefunden hatte. Ich dagegen blieb noch ein Jahr in Frankreich, und nach Abschluss meines Masterstudiums bereiste ich Südasien. Dort wanderte ich durch Berg und Tal, besuchte Tempel und buddhistische Pilgerstätten. Die Nonnen mit ihren braunen Gewändern und kahlgeschorenen Köpfen faszinierten mich. Sie hatten dem Familienleben abgeschworen, um sich dem Studium der Schriften und der Meditation zu widmen. Ich saß nur wenige Meter von ihnen entfernt und hörte sie singen; ihre Lieder unterschieden sich stark vom gutturalen Singsang der Lamas, sie rezitierten auch Sutras, die von Befreiung und dem Ende allen Leidens sprachen. Die Distanz stellte unsere Freundschaft unweigerlich auf die Probe. Manchmal bedeutet Distanz das Ende einer Freundschaft, so wie ein Frosteinbruch eine gute Ernte vernichten kann, aber auf Alina und mich traf das nicht zu. Wir schrieben uns weiter und riefen einander oft an, sprachen über die wichtigsten Dinge – Aurelios Auftritt in ihrem Leben, den Gesundheitszustand ihres Vaters, die Wahl meines Dissertationsthemas –, und so wuchs die Zuneigung, die wir ohnehin füreinander hegten, nur immer weiter.
3
In jungen Jahren ist es leicht, Ideale zu haben und nach ihnen zu leben. Dauerhaft konsequent zu bleiben, trotz der Herausforderungen, vor die das Leben uns stellt, ist schon schwieriger. Kurz nach meinem dreiunddreißigsten Geburtstag nahm ich die Anwesenheit von Kindern plötzlich stärker wahr und fand sie reizend. Seit zwei Jahren lebte ich mit einem asturischen Künstler zusammen, der stundenlang zu Hause arbeitete und unsere gemeinsame Wohnung mit dem süchtig machenden Geruch von Ölfarbe füllte. Er hieß Juan. Im Gegensatz zu mir wusste er mit Kindern umzugehen und verbrachte gern Zeit mit ihnen. Begegnete er draußen im Park oder bei Freunden einem Kind, ging er zu ihm hin und sprach mit ihm, ganz gleich, womit er gerade beschäftigt war. Ich weiß nicht, ob es sein Einfluss auf mich war oder ob es aus mir selbst kam, aber wenn wir zusammen waren, war ich nicht mehr so auf der Hut. Ich ging zwar immer noch nicht aktiv auf Kinder zu, doch sie machten mich irgendwie neugierig. Ich sah ihnen gern zu, wie sie mit ihren Ranzen auf dem Rücken aus der Schule kamen oder die Straße hinunter zur U-Bahn liefen. Ich betrachtete sie, wie man eine reife Frucht betrachtet, wenn man Hunger hat. Ohne mir dessen bewusst zu sein, fielen mir plötzlich auch schwangere Frauen auf. Ich entdeckte überall welche, als hätten sie sich plötzlich vervielfacht, und wenn ich auf einer Party oder in der Schlange vor dem Kino Schwangeren begegnete, sprach ich sie manchmal sogar an, so neugierig war ich. Ich musste sie verstehen, musste herausfinden, ob sie sich wirklich für dieses Schicksal entschieden hatten oder im Gegenteil resigniert einer familiären oder gesellschaftlichen Erwartung entsprachen. Wie sehr hatten ihre Mütter, Partner, Freundinnen diese Entscheidung beeinflusst?
An einem winterkalten Samstagmorgen, wir lagen noch faul im Bett, kamen John und ich auf das Thema Nachwuchs zu sprechen. Er meinte, er wolle unbedingt ein Kind und warte nur darauf, dass ich ihm grünes Licht gäbe. Er war – das muss ich zugeben – ein sehr liebevoller Mann und wäre bestimmt auch ein ebenso liebevoller Vater. Plötzlich stellte ich mir vor, wie wir uns gemeinsam um ein Baby kümmerten, wie wir beim Einlassen des Badewassers die Temperatur prüften oder einen Kinderwagen die Straße hinunterschoben. Dieses Familienleben lag zum Greifen nah vor uns. Wir mussten nur das Kondom in seiner Verpackung auf dem Nachttisch liegen lassen, nur einmal vielleicht, und schon hätten wir die Schwelle zur Elternschaft überschritten. Wie jemand, der noch nie an Selbstmord gedacht hat, sich auf der Terrasse eines Wolkenkratzers plötzlich vom Abgrund angezogen fühlt, spürte ich das Verlockende einer Schwangerschaft. Juan strich mir eine Strähne aus dem Gesicht und begann mich überschwänglich zu küssen. Ich spürte an meinem Oberschenkel, dass er eine Erektion hatte, bereit, sich auf der Stelle dem Diktat der Natur zu beugen. Ein paar Minuten lang gab ich mich dieser überwältigenden Kraft fasziniert hin. Dann meldete sich – zum Glück – mein Überlebensinstinkt, der bis dahin geschlafen hatte, und ich sprang aus dem Bett. Obwohl draußen Schnee fiel, lief ich auf die Terrasse und zündete mir eine Zigarette an. Ich sagte mir, dass meine biologische Uhr meinen Verstand außer Gefecht gesetzt hatte. Sollte ich keine effektive Strategie des Widerstands finden, wäre das Leben, das ich mir so mühevoll aufgebaut hatte, in großer Gefahr.
Ich sprach das ganze Wochenende kein Wort mehr. Am Montag schlug ich ohne Termin in der Praxis meines Gynäkologen auf und bat ihn, mir die Eileiter abzuklemmen. Nachdem er mir eine Reihe von Fragen gestellt hatte, um zu prüfen, wie sicher ich mir war, schaute der Arzt in seinem Terminkalender nach. Ich bekam noch in derselben Woche einen Operationstermin und war überzeugt, die beste Entscheidung meines Lebens getroffen zu haben. Der Chirurg erledigte seine Arbeit fachmännisch, aber während der Genesung infizierte ich mich mit einem dieser Krankenhauskeime, die so schwer auszurotten sind. Ich kehrte mit Fieber nach Hause zurück und erzählte tagelang keiner Menschenseele, was ich getan hatte, nicht einmal Juan. Später dann, als ich als geheilt galt, rief ich Alina an, denn ich war überzeugt, dass sie die Einzige war, die mich verstehen konnte.
Von da an wurde die Beziehung mit Juan immer schwieriger. Während wir früher gern still Zeit miteinander verbracht hatten – ich las, und er malte in seinem Atelier, wir sahen uns Filmklassiker an oder spazierten über den Friedhof neben unserem Haus –, hatten wir jetzt das Gefühl, unsere Zeit zu verplempern. Unmerklich erschöpfte sich unsere Geduld. Wir verzweifelten aneinander. Es war kein langer Leidensweg und auch keine sonderlich schmerzhafte Trennung, einfach nur die Erkenntnis, dass wir unterschiedliche Lebensentwürfe hatten. Schließlich war ich diejenige, die auszog. Ich verließ die Wohnung mit drei bescheidenen Koffern, die im Keller eines Freundes zwischengeparkt wurden, dann suchte ich mir den billigsten Flug nach Kathmandu heraus und pilgerte einen Monat lang zu den verschiedenen Klöstern. In dieser Zeit schickte Juan mir ein paar E-Mails, die ich in dem heruntergekommenen, verstaubten Internetcafé von Pharping las. Seine Briefe waren eine Art Schlusswort, mit dem er das Offensichtliche erklärte. Ich las sie aus Respekt vor unserer Geschichte und konnte mir immer schon denken, was drinstand, bis er in einer der letzten E-Mails schrieb, er sei jetzt mit einer kanadischen Bildhauerin zusammen, die er auf einem Kolloquium kennengelernt habe, und sie erwarteten ein Baby. »Ich kenne dich, Laura. Ich weiß, du würdest es nicht gern von jemand anderem hören, daher sage ich es dir lieber selbst.« Die Nachricht machte mich traurig, aber ich denke, in gewisser Weise half sie mir, mit der Vergangenheit zu brechen. Es war an der Zeit, mein Leben radikal zu ändern. Ich beschloss, Paris zu verlassen und nach Mexiko zurückzugehen, um dort meine Masterarbeit zu Ende zu bringen.
4
Anfang Februar kehrte ich nach Mexiko zurück, die Jacarandabäume breiteten gerade eine violette Blütendecke über die Straßen, und alles wirkte idyllisch und ein wenig irreal. Ich lud Alina zum Abendessen ein, in ihrem Viertel, in ein japanisches Restaurant, das sie sehr mochte. Es war das erste Wiedersehen nach meiner Rückkehr. Sie hatte kurz zuvor Geburtstag gehabt, und um ihn nachzufeiern, bestellten wir alle möglichen Leckereien: gesalzenen Lachs, Sesamspinat, in Rinderfilet gewickelten Spargel, zwei Udon-Gerichte und zwei Karaffen Sake. Durchs Fenster wehte eine warme Brise herein. Wir sprachen über meine Trennung von Juan, über seine baldige Vaterschaft und über meine Entscheidung, zurückzukommen. Dann wollte sie wissen, wie es mir gesundheitlich ging. Ich beruhigte sie und erzählte, die Infektion sei schnell besiegt gewesen und die Operation genau der richtige Eingriff, das Beste, was Frauen in den Dreißigern, die immer schon wussten, dass sie keine Kinder wollen, tun könnten, eine wirkungsvolle Schutzimpfung gegen den gesellschaftlichen Druck.
Darauf stießen wir an, und der Alkohol weckte in mir eine Freude, wie ich sie seit vielen Monaten nicht mehr empfunden hatte.
»Du solltet das auch machen lassen«, sagte ich und schenkte mir noch etwas Sake nach. »Du ahnst nicht, wie gut es sich anfühlt!«
Sie hörte mir kommentarlos zu. Wenn ich lachte, fiel sie ein, und nachdem wir angestoßen hatten, beschloss sie, mir zu sagen, was sie wirklich davon hielt. Sehr taktvoll, fast ängstlich, gestand sie mir, sie respektiere meine Entscheidung, teile meinen Standpunkt aber nicht mehr. Denn sie würde jetzt gern schwanger werden. Sie erzählte, sie und ihr Partner hätten vor mehr als einem Jahr aufgehört zu verhüten, nur sei bisher noch nichts passiert.
»Vielleicht passt da irgendetwas nicht«, rätselte sie, und die Frustration war ihr deutlich anzuhören. »Wir haben sämtliche Tests über uns ergehen lassen, keiner liefert einen Hinweis, dass einer von uns beiden unfruchtbar ist. Deshalb werden wir diese Woche mit einer Behandlung beginnen.«
Sie erklärte, sie sei zu allem bereit, selbst eine In-vitro-Befruchtung oder eine Eizellentransplantation käme für sie in Frage.
Diese Neuigkeit überraschte mich nicht nur, sie sorgte auch dafür, dass ich an dem Abend überhaupt nichts mehr sagte. Ich tat auch nicht so, als würde ich mich freuen oder als sei ich an Details interessiert. In einer Freundschaft wie der unseren war für Heuchelei kein Platz. Während Alina über ihrem Nudelteller die neuesten Techniken der künstlichen Befruchtung beschrieb und dabei vom Hölzchen aufs Stöckchen kam, schlossen sich langsam meine Ohren wie zwei lichtempfindliche Pflanzen. Mich überkam Wehmut, noch bevor etwas geschehen war. Bilder unserer gemeinsamen Jugend gingen mir durch den Sinn, noch ganz scharf und doch bereits getrübt von dieser unmittelbar bevorstehenden Zukunft. Ich verließ das Restaurant in gedrückter Stimmung. Sollte die Behandlung anschlagen, würde Alina zu jenen Frauen gehören, mit denen ich früher einmal befreundet gewesen war und die sich, nachdem sie Kinder bekommen hatten, nur noch im Park oder im Kino trafen, wo sie sich völlig bescheuerte Filme ansahen, eine Truppe, zu der ich auf keinen Fall dazugehören wollte. Aber selbst bei einem Misserfolg würde es kein Zurück geben. Von nun an trennte uns ein unsichtbarer Graben: Sie betrachtete die Mutterschaft als ein erstrebenswertes Frauenschicksal, während ich mich vorsichtshalber einer Operation unterzogen hatte.
Außerdem hatte Alina mir erzählt, sie sei jetzt bei einer Psychologin in Therapie. Nach ihrer Rückkehr aus Frankreich habe sie damit angefangen. Bei einer Frau in den Sechzigern namens Rosa, von der sie andere Psychotherapeuten mit einer gewissen Verehrung habe sprechen hören und die offenbar bei ihrer Entscheidung fürs Kinderkriegen eine wichtige Rolle gespielt hatte.
»Ist das nicht irre? Jahrelang hatte ich Angst, denselben Fehler zu machen, wie meine Mutter ihn mit meiner Schwester und mir gemacht hat. Ich musste das erst einmal verarbeiten, um überhaupt erkennen zu können, dass ich in Wahrheit sehr wohl eine Familie haben möchte. Ich will diese Erfahrung machen, Laura. Unbedingt. Tut mir leid, wenn ich dich damit enttäusche.«
5
In jenen ersten Monaten in Mexiko-Stadt zog ich auf der Suche nach einem Ort, an dem ich mich niederlassen konnte, von einer Wohnung zur nächsten. Außer für die Arbeit an der Dissertation traf ich so gut wie keinen Menschen. Sonntagmorgens frühstückte ich bei meiner Mutter. Wir sprachen über Politik, Romane und die Nachrichten aus der Zeitung. Ich ging mit ihr einkaufen, und dann hörte ich die ganze Woche nichts mehr von ihr. Die meisten meiner Freundschaften hatten den Distanztest nicht bestanden. Ich dachte oft an Alina. Ich vermisste sie zwar, besuchte sie aber nicht – worüber hätte ich mit ihr reden sollen, über Methoden zur Kinderwunscherfüllung, über die Stillberatung der La Leche Liga? Aber weder mein Schweigen noch mein Mangel an Begeisterung hinderten sie daran, mich anzurufen, so oft es ging, bis ich schließlich ranging und wir dank ihrer Beharrlichkeit in Kontakt blieben.
Die Angst, die all diese Frauen befällt, die um jeden Preis ein Kind bekommen wollen, hat mich schon immer fasziniert. Ich habe miterlebt, wie Menschen ein Vermögen für Krankenhausbehandlungen ausgaben, die Dienste von Samenbanken in Anspruch nahmen oder den Bauch einer fremden Frau mieteten, nur weil sie ein Kind haben wollten, während andere, die sich aus Versehen schwängern ließen, dies als ein Riesenunglück erlebten. Über sechs Monate lang tat Alina alles in ihrer Macht Stehende, um schwanger zu werden. Alle möglichen Ärzte und Spezialkliniken suchte sie auf, ohne je die Hoffnung zu verlieren. Sie bekam hochdosierte Hormone verabreicht, ihr Gewicht ging rauf und runter, und ihre Stimmungsschwankungen schüttelten sie durch wie eine Zentrifuge. Unterdessen musste ich immer wieder an Jetsün Milarepas Verse denken, in denen es um die Haltung der Menschen geht: Beim Versuch, glücklich zu werden, stürzen sie sich kopfüber ins eigene Unglück. Nachdem sie sämtliche Mittel und Wege ausprobiert hatte, blieb Alina nichts weiter übrig, als sich mit ihrer Unfruchtbarkeit abzufinden und zu ihrem alten Leben zurückzukehren. Sie reiste wieder um die Welt, um mit den Künstlern der Galerie, in der sie arbeitete, an Messen und Vernissagen teilzunehmen. Sie kam auch wieder mit mir ins Theater und in die Cineteca, wo wir uns experimentelle Filme ansahen, über die wir anschließend gern bei einem Gin Tonic oder einer Flasche Rotwein diskutierten.
An einem besonders öden Sonntagnachmittag, als ich beim Überarbeiten eines Artikels heftig mit meiner Müdigkeit rang, rief Alina mich auf dem Handy an.
»Ich habe gute Neuigkeiten«, sagte sie, »und du sollst sie als Erste erfahren.«
Mehr brauchte sie nicht zu erklären. Ich kannte sie seit Jahren, und ihr Tonfall verriet deutlich genug, was sie mir verkünden wollte. Als sie schließlich das Wort »schwanger« in den Mund nahm, spürte ich einen Hüpfer in der Brust, der sich so täuschend echt wie Freude anfühlte, dass ich ganz durcheinander war. Wieso um Himmels willen freute ich mich? Alina war dabei, aus meinem Leben zu verschwinden, wollte sich der Mütter-Sekte anschließen, diesen leblosen Kreaturen, die wie Zombies mit dunklen Augenringen Kinderwagen durch die Straßen schoben! In weniger als einem Jahr würde sie sich in einen Erziehungsautomaten verwandelt haben. Mit der Freundin, auf die immer Verlass war, würde es dann vorbei sein, und ich saß hier am anderen Ende der Leitung und gratulierte ihr noch dazu? Ich muss gestehen, zu hören, wie glücklich sie war, wirkte ansteckend. Auch wenn ich mein Leben lang dafür gekämpft hatte, dass mein Geschlecht von dieser Last befreit würde, beschloss ich, nicht gegen diese Freude anzukämpfen.
6
Gestern Nachmittag ist der Junge von nebenan wieder ausgerastet. Ich hatte mich gerade auf dem Balkon zum Innenhof niedergelassen, mit einem Minztee und einem Roman von Mircea Cărtărescu, dessen Fan ich in den letzten Monaten geworden bin. Der Roman schildert das Leben eines Lehrers, in dessen Bukarester Schule eine Läuseplage ausbricht, die sich nicht unter Kontrolle bringen lässt. Gerade als ich mir die Korridore dieser – der Schilderung nach recht düsteren – kommunistischen Schule aus den 1970er-Jahren vorzustellen versuchte, hörte ich, wie etwas, das sich nach einem schweren Gegenstand anhörte, gegen die Wand geschlagen wurde. Darauf folgte, wie immer, Geschrei.
»Holt mich hier raus, bitte! Holt mich raus aus diesem verdammten Kopf«, schrie er, während die Schläge immer lauter wurden. »Ich hasse dieses Scheißleben! Ich will raus hier!«
Ich fragte mich, ob der schwere Gegenstand, eine Bowlingkugel vielleicht oder ein gläserner Aschenbecher, in Wahrheit sein Schädel war, den der Junge zerschmettern wollte. Und ich fragte mich, ob mein Nachbarsjunge schon von klein auf so war oder ob irgendeine Art von Missbrauch ihn für alle Zeiten geschädigt hatte. Mein Gedanke war, dass ein Kind seines Alters doch nicht solche Wörter kennt, es sei denn, sie sind ihm von zu Hause vertraut. Dann hörte man, wie aus einem anderen Zimmer oder jedenfalls aus ein paar Metern Entfernung, die ebenfalls erhobene Stimme seiner Mutter: »Das reicht, Nico!«, befahl sie ohne großen Nachdruck. »Hör jetzt auf damit!«
Was ging dieser Frau nur durch den Kopf? Fühlte sie sich in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, dass ihr Sohn immer so einen Rabatz machte? Versuchte sie wenigstens, etwas dagegen zu unternehmen? Ich hatte den Jungen noch nie gesehen, aber ihr war ich schon einmal begegnet, besser gesagt, ich war schon ein paarmal im Hauseingang an ihr vorbeigekommen, da raucht sie nämlich abends immer und telefoniert mit dieser Mädchenstimme, die so gut zu ihr passt. Sie ist dünn und nervös und trägt fast immer Sportklamotten. Das Einzige, worauf sie sehr zu achten scheint, sind ihre Nägel. Sie trägt sie kurz, mal rot, mal schwarz lackiert. Fast immer farblich zum Lippenstift passend.
Wenn ich höre, wie apathisch sie auf die Anfälle ihres Kindes reagiert, sage ich mir, sie hat sich wahrscheinlich damit abgefunden, dass ihr Leben immer so weitergehen wird. Der Junge ist das einzige Kind dieser alleinstehenden Frau, und sie hat ihn – so meine Vermutung – nicht gewollt. Es heißt ja, Gewalt führt zu weiterer Gewalt, man müsse nur Zeuge einer solchen Szene werden, und sei es als Ohrenzeuge, schon schwinge das eigene Gehirn mit. Gestern war ich nach wenigen Minuten ebenfalls verärgert und wollte gegen die Wand schlagen. Ich empfand es als ungeheuer respektlos, dass meine Nachbarn mir ein solches Spektakel zumuteten. Einen Moment lang dachte ich daran, bei ihnen zu klopfen und zu verlangen, dass sie sofort mit dem Lärm aufhörten, doch dann sagte ich mir, mein Besuch würde alles nur noch schlimmer machen. Vielleicht konnte die Frau ihren Sohn ja nur mit einer Tracht Prügel dazu bringen, sich ruhig zu verhalten. Er tat mir leid, und das beschwichtigte meine Wut. Ich beschloss, mich wenigstens dieses eine Mal nicht aufzuregen, und ging aus dem Haus, um das Geschrei nicht länger mit anhören zu müssen.
7
Eine Schwangerschaft stellt vieles auf den Kopf. Schon vor der Geburt begann sich Alinas Leben auf schwindelerregende Weise zu verändern: Sie durfte keinen Kaffee mehr trinken und nicht mehr rauchen, musste Folsäure und andere Nahrungsergänzungsmittel schlucken, ständig zum Frauenarzt rennen, zum Bluttest und zum Ultraschall. Aurelio und sie richteten die Wohnung für das Baby ein. Zusammen klapperten sie sämtliche Möbelgeschäfte ab, gingen alle Websites durch und ließen sich am Ende ein Gitterbettchen aus Dänemark schicken.
Ich sah mir unterdessen Dutzende von Mietwohnungen in verschiedenen Stadtteilen an, bis ich schließlich meine aktuelle im Viertel Colonia Juárez fand, in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, prächtig, sonnendurchflutet und mit Parkett, außerdem unweit der Wohnung meiner Mutter gelegen. Preislich ein Schnäppchen. Ich unterschrieb den Vertrag sofort, konnte aber erst einen Monat später einziehen, weil die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Bis dahin bat ich Alina um Asyl, obwohl ich wusste, dass es für sie nicht gerade der günstigste Zeitpunkt war. Die beiden erklärten sich, ohne zu zögern, bereit, als sei das eine Selbstverständlichkeit.
Kaum war ich bei ihnen untergekommen, wurde ich krank. Wahrscheinlich forderten Stress und Ungewissheit ihren Tribut. Ich verbrachte lange Tage und Nächte im Fieberwahn. In meinen Albträumen tauchten wieder die Tarotkarten auf, die ich Jahre zuvor gelegt hatte. Es erschienen mir Aurelio und Alina, durchbohrt von sechs Schwertern. Das Gesicht des Erhängten hingegen war verdeckt, und sosehr ich mich auch bemühte, ich erhaschte nicht den geringsten Hinweis darauf, wer es sein könnte. Während dieser ganzen Zeit achtete Alina darauf, dass ich genug zu essen bekam und es warm hatte. Allmählich ließ das Fieber nach. Eines Morgens, als es mir wieder besser ging, suchte ich lange im Internet nach Einrichtungstipps für meine neue Wohnung. Es war niemand da, die Sonne schien angenehm ins Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch lagen Alinas Geburtsurkunde und darauf der zinnoberrote Reisepass, den sie zusammen mit der französischen Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Ich schlug die erste Seite auf, um mir ihr Foto anzusehen, und fand sie darauf ganz besonders hübsch. Sie musste sich noch nie schminken, denn ihre Lippen sind voll und dunkelrosa und ihre Wimpern beneidenswert dicht. Aber nicht das macht sie so attraktiv, sondern ihr Selbstvertrauen. Dann nahm ich die Geburtsurkunde in die Hand, und als ich das Datum, die Uhrzeit und den Geburtsort las, bekam ich Lust, noch einmal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Also wechselte ich von der Einrichtungsseite zu einer Astrologieseite, um herauszufinden, ob irgendetwas in Alinas Horoskop die schrecklichen Karten erklären konnte, die ich in jener Nacht in dem Legebild gesehen hatte. Ich gab ihre Daten ein. Binnen weniger Sekunden wurden mir ihr Sternzeichen und ihr Aszendent angezeigt, die ich bereits kannte, aber auch andere Daten, die eine größere Krise vorhersagten. Die Sonne im achten Haus deutete auf ernste gesundheitliche oder existenzielle Probleme in der Lebensmitte hin, während Saturn im neunten Haus bedeutete, dass eine unvorstellbare Herausforderung nahte. Diese Position des Saturn komme häufig in den Horoskopen von Märtyrern vor, warnte die Website.
Je mehr wir eine Person lieben, desto verletzlicher und unsicherer werden wir. Ich begriff, was für einen bedeutenden Platz Alina in meinem Leben einnahm. Es gibt Menschen, ohne die wir uns in dieser Welt nicht denken können. Alina war für mich so ein Mensch. Sollte sie eines Tages nicht mehr sein, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Mit großem Unbehagen schloss ich den Laptop und schwor mir, nicht noch einmal die Nase in das Schicksal meiner Freundin zu stecken.
Als die Renovierungsarbeiten in der Wohnung, die ich gemietet hatte, abgeschlossen waren, trommelten Aurelio und Alina einige Bekannte zusammen, die mir beim Umzug halfen. Lea war da, unsere Freundin aus Marseille, die mit einem Mexikaner verheiratet war, Patricio, der Tänzer, außerdem Lucía und Isabel, die mit Alina in der Galerie arbeiteten. Zwei Wochen später veranstalteten wir eine große Einweihungsparty, zu der fast alle unsere Pariser Freunde kamen, um sich die Wohnung anzuschauen. Wir tranken und tanzten wie früher. Alina hielt sich an Mineralwasser mit Minze. Zu dem Zeitpunkt war sie in der vierzehnten Woche, und man begann ihr bereits anzusehen, dass sie in anderen Umständen war. Vor den erstaunten Augen all derer, die meine Feldzüge gegen die Mutterschaft kannten, verkündete ich höchstpersönlich in Jubeltönen, dass sie schwanger war. Eine Schwangerschaft verändert so manches, auch unsere Beziehung zu anderen: die Freundinnen, die sich gegen eigene Kinder entschieden hatten, sahen sie nun mit anderen Augen, als leide sie an einer ansteckenden Krankheit. Dagegen merkten jene, die selbst Kinder haben wollten, dass ihnen die Zeit davonlief, und brachten ihr eine neidgetrübte Bewunderung entgegen. Ich weiß nicht, ob sich auch nur eine von ihnen aufrichtig mit mir für sie gefreut hat.
8
Ende der sechzehnten Woche schickte der Gynäkologe Alina zu einem sogenannten 3D-Ultraschall, bei dem sie sämtliche Knochen des Fötus vermessen und mit ausgefeilter Technik das Innere der Gebärmutter filmen, um zu prüfen, wie die Organe entwickelt sind. Ich begleitete sie zu der Untersuchung, und wir mussten einmal die ganze Stadt durchqueren, um zu der hypermodernen Wolkenkratzerzone von Colonia Santa Fe zu gelangen, einem Viertel, das sich in meinen Augen nicht nur von Mexiko-Stadt, sondern vom ganzen Rest des Planeten unterschied. Die Spezialpraxis befand sich im achtzehnten Stock eines Gebäudes, dessen große Panoramafenster zu einem Slum hinausgingen. Drei adrette und kultivierte Paare, alle mit Ehering, saßen mit uns im Wartezimmer. Im Vergleich zu ihnen wirkten Alina und ich mehr als nur casual