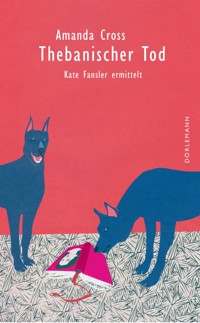14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Aufruhr in Harvard: Eine Frau auf dem neuen Lehrstuhl an der englischen Fakultät! Janet Mandelbaum ist kühl, klug und schön. Und stößt die alteingesessene Herrenriege gekonnt vor den Kopf. Umso größer der Skandal, als Janet nach einer Party betrunken in der Badewanne aufgefunden wird – und das in Gesellschaft. Kate Fansler kommt ihrer Kollegin zu Hilfe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Amanda Cross
Die Tote von Harvard
Roman
Aus dem Englischenvon Helga Herborth
DÖRLEMANN
Die amerikanische Originalausgabe »Death in a Tenured Position« erschien 1981 bei Ballantine Books, New York. Trotz intensiver Nachforschung konnte der Verlag keinen Kontakt zur Übersetzerin herstellen. Wir bitten, berechtigte Ansprüche dem Verlag zu melden. Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten. Copyright © 1981 Carolyn Heilbrun © 2024 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Illustration von Anna Sommer Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-893-8www.doerlemann.ch
Inhalt
Prolog
Sollte es unter Ihnen, was ich hoffe, leidenschaftliche Verfechter der Bildung von Frauen geben, kann ich mir keinen besseren Weg denken, die Sache zu befördern, als Radcliffe-Lehrstühle in Harvard zu errichten. In welcher Fakultät die Lehrstühle eingerichtet werden, spielt keine Rolle, Hauptsache, sie werden von einer Frau besetzt.
Giles Constable
Radcliffe Centennial News
Andrew Sladovski, Anglistikdozent, Harvard University, an Peter Sarkins, Anglistikdozent, Washington University, St. Louis:
Lieber Peter,
wahrscheinlich hast Du, als Du den Umschlag in der Hand hieltest, gerätselt, was Deinen alten Andy dazu inspiriert haben könnte, Dir zu schreiben. Gib die Raterei auf. Du kommst eh nicht drauf: Harvard wird im Fachbereich Anglistik einen Lehrstuhl an eine Frau vergeben! Und jetzt summen hier alle so aufgeregt herum wie Tennysons (oder waren es Poes?) Bienen. Versteht sich von selbst, dass Hopkins, unser allseits geliebter Präsident, außer sich ist. Noch vor kurzem hat er vor dem versammelten Fachbereich verkündet, seiner Meinung nach sei das Frauenproblem so gut wie aus der Welt, und man brauche sich keine Sorgen mehr um die Frauenquote an den Fakultäten zu machen. Und nun trifft ihn dieser Schlag! Wäre er nicht solch ein Scheißkerl, ich hätte vielleicht sogar Mitleid mit ihm. Jetzt machen sich alle Sorgen wegen der Menopause – das scheint absolut das Einzige zu sein, woran sie denken können, wenn eine Frau ihre männlichen Domänen zu penetrieren droht – wie entlarvend die Sprache doch ist! Bisher weiß niemand, wer diese Frau sein wird. Ich jedenfalls hoffe auf eine knallharte Feministin, die ihnen die Hölle heiß macht. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Lizzy meint, dass sie es schaffen werden, eine renommierte Professorin zu finden, die dem naiven Glauben anhängt, Qualifikation sei wichtiger als das Geschlecht. Ich überlasse es Lizzy, diesen Brief mit kritischen Anmerkungen zu schmücken …
Allen Adam Clarkville, Anglistikprofessor, Harvard University, an Mark Peterson, Anglistikprofessor an derselben Universität, derzeit in Ferien:
Lieber Peterson,
sollte es möglich sein, dass die Neuigkeiten noch nicht bis zu Dir nach Bellagio vorgedrungen sind? Da noch keine erschütterten Telegramme eingetroffen sind, nehme ich also an, dass Du im Gebirge herumkraxelst und völlig ahnungslos bist. Bitte, Peterson, stürze in keine Schlucht, denn ich brauche jede nur denkbare Unterstützung. Irgendein niederträchtiger Millionär hat Harvard eine Million Dollar für einen neuen Lehrstuhl im Fachbereich Anglistik angeboten – unter der Voraussetzung, dass er mit einer Frau besetzt wird. Die erfreuliche Tatsache, dass bei uns noch nie eine Frau einen Lehrstuhl hatte, macht uns zweifellos zum geeigneten Opfer seiner Wohltätigkeit. Und keine Chance, sie zu den Historikern oder Literaturwissenschaftlern abzuschieben! Ich glaube wirklich, diese Hetero-Typen haben mehr Angst vor Frauen als wir. Hopkins meinte neulich doch allen Ernstes, dass man bei Abendgesellschaften nach dem Essen wieder die Geschlechtertrennung einführen sollte. Ich will jetzt nicht zitieren, was Sam Johnson über lehrende Frauen zu sagen hatte, das überlasse ich lieber dem guten Fronsy. Wenn es ja nicht hieße, dass ich für den Rest meines Berufslebens bei jeder Sitzung diese Frau anstarren muss, dann hätte ich meine helle Freude an der Aufregung, die hier herrscht. Aber trotz allen hysterischen Gezeters – Harvard hat offensichtlich nicht die Absicht, eine Million Dollar auszuschlagen. Und noch mehr: Wer der Spender auch sein mag (hat sich übrigens je einer mit dem Phänomen des männlichen Feministen befasst? Natürlich denkt man sofort an John Stuart Mill), es kursiert das Gerücht, falls dieser Lehrstuhl erfolgreich ist, wolle er eine weitere Million für eine zweite weibliche Professur springen lassen. Man weiß wirklich nicht, ob man Beifall klatschen oder sabotieren soll. Dir brauche ich wohl nicht zu erzählen, was meiner Meinung nach einigen unserer würdigen und gesetzten Kollegen durch den Kopf geht …
Frank Williams, Anglistikprofessor, Harvard University, an Frederick Held, Anglistikprofesser, Columbia University:
Lieber Fred,
Du wirst erraten, warum ich Dir schreibe. Betrachte diesen Brief als offizielle Bitte und schlage uns jemanden vor, eine Frau, die die nötigen Voraussetzungen mitbringt und sich für den Lehrstuhl, der inzwischen wohl in aller Munde ist, eignet. Unser Präsident denkt nicht daran, das Geld abzulehnen, obwohl er von vielen Seiten unter Druck gesetzt wurde, es zu tun. Meine Meinung zu dem Ganzen werde ich Dir bei nächster Gelegenheit lieber mündlich mitteilen. Da ich – Gott will mich für meine Sünden strafen – der Vorsitzende des Berufungskomitees bin, muss ich einen Vorschlag machen. Ich wende mich also an Dich, weil es bei Euch mehr Frauen gibt und Du außerdem Frauen an anderen Universitäten kennst – dank Deines natürlich zu Recht gerühmten liebenswerten und unvoreingenommenen Charakters. Die Dame, die wir suchen, sollte sich einen guten wissenschaftlichen Ruf gemacht haben und, wenn möglich, nicht zu hysterischen Szenen neigen. Wir wurden strengstens instruiert, die Sache zügig anzugehen, und dafür, dass ich mich auf einen Termin festgelegt habe, hat man mir gnädig erlassen, eine Frau in das Berufungskomitee aufzunehmen. Am Radcliffe wird sich großes Geheul erheben – denn schließlich hat man ihnen bei allen Fragen, die mit Frauen zu tun haben, ein Mitspracherecht zugesichert (könnten die Frauen doch nur unter sich bleiben!) –, aber ich bleibe hart. Diese Fakultät fällt ihre letzte nur von Männern verantwortete Entscheidung!
All die Leichen, die in ihren Gräbern rotieren werden! Ich weiß schon, warum ich mich für die Feuerbestattung entschieden habe. Dass Hopkins außer sich ist, brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Fran hat in einem neuen Roman von Iris Murdoch die ideale Beschreibung der Situation gefunden: Sic biscuitus disintegrat – so schwinden alle Hoffnungen dahin. Mir kommt gerade eine wunderbare Idee. Meinst Du, wir können Iris Murdoch bekommen? Dann würden wir ihren verehrten Gatten, John Bayley, den hervorragenden Literaturkritiker, gleich dazunehmen. Er könnte die Vorlesungen halten (schließlich müssen Ehemänner ja auch noch ein paar Rechte haben), und sie könnte in Ruhe ihre Romane schreiben. Das ist der angenehmste Gedanke, der mir gekommen ist, seit diese lästige Geschichte passiert ist …
Eins
Desillusionierung im Leben ist das Herausfinden, dass niemand mit dir übereinstimmt … Das Ausmaß, in dem sie übereinstimmen, ist wichtig für dich, bis das Ausmaß, in dem sie nicht mit dir übereinstimmen, von dir vollkommen erkannt wird. Dann sagst du, du willst für dich selbst und Fremde schreiben, du willst für dich selbst und Fremde sein, und das macht dann einen alten Mann oder eine alte Frau aus dir.
Gertrude Stein
Making of Americans
Kate Fansler betrachtete die Reihe von Männern auf der anderen Seite des breiten Konferenztisches und dann die Männer zu ihrer Rechten und Linken. Außer ihr hatte man, um den Schein von Gleichberechtigung zu wahren, noch eine Frau ins Komitee berufen; sie war schwarz und heute nicht anwesend. Sie hatte so viele Verpflichtungen, dass diese, obwohl die Mitgliedschaft in diesem Komitee ein hohes Privileg bedeutete, sich gelegentlich in die Quere kamen. Kate hatte gelernt, Ärger zu verbergen. Es sich nicht anmerken zu lassen, wenn sie sich langweilte, gelang ihr weniger gut. Während sie also ihren Blick über die Männer schweifen ließ, stellte sie fest, dass die gegenwärtige Dekade sich für sie dadurch auszeichnete, in der Gesellschaft vieler Männer und einiger weniger Frauen an hochglanzpolierten Konferenztischen zu sitzen und über die akademischen Probleme der Siebzigerjahre zu debattieren. Manchmal sah Kate in Gedanken ihren Grabstein vor sich, mit der in Marmor gemeißelten Inschrift: »Die Alibi-Frau«. Und über der Inschrift schwebten gleichgültige androgyne Engel.
Um fünf Uhr stand sie auf, fest entschlossen, sich aus dem Raum zu schleichen. Sie wusste, bald würde einer der Männer aufstehen, um seine Fahrgemeinschaft nicht warten zu lassen. Wenn sie ein paar Minuten vor ihm ging, konnte ihr niemand einen Vorwurf machen. Keine Minute länger ertrug sie das männliche Gepluster und umständliche Getue. Sie musste entweder verschwinden, oder sie würde laut schreien. Natürlich nahm kaum jemand von ihrem Abgang Notiz, obwohl einige Männer ihr mechanisch zuwinkten. Wodurch sich die Achtzigerjahre auszeichnen würden, wusste Kate nicht. Sie hoffte jedenfalls inständig, es mochten keine Komiteesitzungen sein, sondern etwas, wenn schon nicht Aufregenderes, so doch zumindest … weniger Alibihaftes.
Sowie sie den Raum verlassen hatte, kehrten ihre Lebensgeister zurück. Sie beschloss heimzugehen, sich einen Drink zu mixen und die Füße hochzulegen. Vielleicht hatte Reed, der um die Welt tingelte und Vorträge über Polizeimethoden hielt, ihr geschrieben. Oder besser, die Post hatte sich vielleicht dazu bewegen lassen, seine Briefe zuzustellen. In der Damentoilette im Erdgeschoss blickte Kate amüsiert auf eine kleine runde Plakette, die am Spiegel klebte: »Vertrau auf Gott: SIE wird für dich sorgen.« Kate lächelte und machte sich auf den Heimweg.
Kate trank ihren Martini und versuchte abzuschalten und dachte, dass Gott – egal welchen Geschlechts – nach Meinung vieler Leute sehr gut für sie gesorgt hatte. Kate konnte dem nicht widersprechen. Sie hatte all die Vorteile ihrer mit Reichtum und gesellschaftlicher Stellung gesegneten Familie genossen, und gleichzeitig war es ihr gelungen, dem zu entgehen, was sie als überwältigende Nachteile einer solchen Herkunft empfand. Soll heißen: Kate wusste ihre Privilegien zu schätzen – was sie nicht schätzte, waren die Ansichten und gesellschaftlichen Konventionen ihrer Kaste. Schon zu einem Zeitpunkt, als solch ein Vorhaben in ihren Kreisen als höchst exzentrisch galt, hatte sie sich entschlossen, Karriere zu machen und war Literaturprofessorin an einer der größten und angesehensten Universitäten New Yorks geworden. Erst spät, zumindest nach dem gängigen Urteil, hatte sie einen Mann geheiratet, der ihr eher Kameradschaft bot als Taumel der Sinne. Sie betrachteten beide die Ehe nicht als ununterbrochene Kette von erotischer Lust und Diners in den besten Restaurants. Reed Amhearst war als Bezirksstaatsanwalt in ihr Leben getreten. Er agierte noch immer in den höheren Rängen staatlicher Gerichtsbarkeit, hatte aber in den letzten Jahren seine Aktivitäten deutlich zu Gunsten eines humanen Strafvollzugs verlagert. Sein momentaner Aufenthalt in Afrika galt einer Sache, die ihm sehr am Herzen lag. Obwohl er schon seit Wochen fort war, lauschte Kate immer noch um diese Zeit auf seinen Schritt.
Kate wusste, dass ihr Desinteresse Folge ihres wohleingerichteten Lebens war. Oder, um es etwas hochtrabender und Kates Beruf angemessener auszudrücken: Ein Mensch, dem keine neue Herausforderung mehr gestellt wird, versinkt in die Todsünde der geistigen und moralischen Trägheit. Eigenartig, dachte Kate, dass es so viele Jahre dauert, bis man eine simple Tatsache begreift: Immer scheint das gerade vor einem liegende Ziel – der nächste Job, die nächste Veröffentlichung, Liebesaffäre, Ehe – alles Glück der Welt bereitzuhalten. Aber ist das Ziel einmal erreicht, stellt sich diese Befriedigung nicht ein, zumindest nicht auf lange Sicht. Egal, wie sehr man auch versucht, alle Segnungen zu genießen – Muße, Gesundheit, Geld, ein Zimmer für sich allein –, immer kommt man an den Punkt, wo man wieder nach vorn starrt, aufs nächste Ziel. In ihrer Kindheit hatte Kate dieses Phänomen bei den Freundinnen ihrer Mutter beobachtet, die ständig umzogen und irgendwelche Häuser oder Appartements neu einrichteten. Wo es keine wirkliche Not zu überwinden gilt, schafft man sich künstliche Nöte. Vielleicht ist das die Hauptkrankheit unserer Zeit. Deshalb fragt sich jeder: Was jetzt, welchem neuen Ziel, welchem Vorhaben soll ich mich als Nächstes verschreiben?
Während Kate sich einen zweiten Martini mixte und den Gedanken ans Abendessen aufschob, fragte sie sich, ob sie nicht vielleicht durch irgendwelche dunklen Mächte, gegen die, wie die Eklektiker sagen, menschlicher Wille nichts ausrichtet, verlockt worden war, Verbrechen aufzuklären. Mit Reeds Hilfe natürlich. Hatten eigentlich alle Menschen Freunde oder Bekannte, die ständig in Dramen von Tod und Leidenschaft verstrickt waren? Doris Lessing hatte kürzlich geschrieben, der Roman sei dabei, die Fessel des Realismus abzuschütteln, »denn das, was um uns herum geschieht, wird täglich wilder, fantastischer und unglaublicher«. Kate glaubte ihr.
Es war jedoch schon lange her, seit sie das letzte Mal Detektivin gespielt hatte. Keiner wünschte sich Leichen herbei. Es gab weiß Gott genug Gewalt in der Welt. Was wollte sie also? Vielleicht das Gefühl haben, dass sie noch in den Lauf der Dinge eingreifen und die Welt, wenn auch nur minimal, menschlicher machen konnte. Reed und Kate waren zwar durch Kontinente voneinander getrennt, verfolgten aber das gleiche Ziel. Während er aktiv eingriff, saß sie an Konferenztischen, umgeben von aufgeblasenen Männern. Zum ersten Mal in ihrem den Geisteswissenschaften gewidmeten Leben fragte sie sich, welcher Sinn darin lag.
Immerhin schaffte sie es, sich aufzuraffen. Sie nahm das Glas mit in die Küche und beschloss zu essen. Nein, um die Todsünde geistiger und moralischer Trägheit ging es nicht, dachte sie, während sie mit einer Gabel die Eier verrührte; viel eher um das, was die Franzosen aboulie nennen: L’absence morbide de volonté. Unsinn, murrte Kate, und stellte die Omelettpfanne auf den Herd. Wenn du nicht aufpasst, hörst du dich bald an wie eine von George Eliots entschlusslosen Heldinnen, über die du endlose Vorlesungen hältst. Mir wenigstens, dachte Kate, hat man beigebracht, auf Gott zu vertrauen und darauf zu warten, dass SIE sich meiner annimmt.
Als Kate am nächsten Nachmittag vor ihrem Büro ankam, um ihre Studentensprechstunde abzuhalten, stand eine Frau gegen die Tür gelehnt. Neben ihr saß, auf den Hinterbeinen kauernd, die Vorderpfoten nach vorn gestreckt und so, als koste ihn diese Ruhestellung all seine Willenskraft, ein großer weißer Bullterrier, die Sorte Tier, die Kinder als Vorbild nehmen, wenn sie einen Hund malen sollen. Kate erinnerte sich vage an das Schild neben der Eingangstür zur Baldwin Hall: Hunde nicht erlaubt.
»Sie sind Kate«, sagte die Frau. Ob das eine Frage oder Feststellung sein sollte, war unklar. Kate kramte nach ihrem Schlüssel und nickte. Mit einem Ruck, der drohend aussah, erhob sich der Hund. »Sitz, du Luder«, sagte die Frau leise. »Kann ich Sie einen Moment sprechen? Haben Sie Angst vor Hunden? Ich kann Jocasta auch draußen lassen.«
»Kommen Sie herein«, sagte Kate. »Und bringen Sie, ehm, Jocasta mit.« Zusammen betraten sie den Raum. Kate fand, dass Jocasta nicht so aussah, als wüsste sie die Einladung zu schätzen.
»Danke«, sagte die Frau. Sie zog ihre Daunenjacke aus; darunter kamen ein T-Shirt mit einem Bild von Virginia Woolf und eine Arbeitshose zum Vorschein. Ihr langes Haar hing glatt bis auf die Schultern. Sie trug eine große Brille und hatte die Bewegungen einer Frau, die all die vorsichtigen kleinen Gesten, die gemeinhin als weiblich gelten, endgültig hinter sich gelassen hatte. Ende dreißig, dachte Kate, vielleicht auch Anfang vierzig, zum Teufel, welche Rolle spielte das?
»Setzen Sie sich doch.«
»Ich heiße Joan Theresa«, sagte die Frau und ließ sich auf den Stuhl vor Kates Schreibtisch fallen. »Sitz, Jocasta, sitz und bleib sitzen.« Jocasta ließ sich erneut widerwillig auf die Hinterbacken nieder und rutschte mit den Vorderpfoten so weit nach vorn, dass sie, selbst bei strengster Interpretation des Wortes sitzen, eben noch saß. Jeder Muskel verriet ihre Anspannung; ihr Blick ruhte auf Kate.
»Sie kennen mich nicht«, sagte Joan Theresa. »Ich lebe in Cambridge, Massachusetts. Wir sind mehrere Frauen und haben dort ein Café. In der Hampshire Street. Es heißt ›Vielleicht nächstes Mal‹ – Jocasta, du Luder, sitz! Oder ich setz dich auf Dosenfutter. Entschuldigung«, sie wandte sich wieder an Kate. »Ich fürchte, Sie machen sie nervös. Nein, nicht Sie natürlich, die Umgebung hier. Sie wundern sich bestimmt, warum ich hier bin.«
Wundern, dachte Kate, ja, ich wundere mich, aber so sehr auch wieder nicht. Worüber soll man sich heutzutage noch wundern? »Haben Sie vor, nach New York zu ziehen?«, fragte Kate. »Wollen Sie hier studieren?«
»An dieser Universität? Diesem Stall! Entschuldigung, aber Sie haben mir einen Schreck eingejagt. Nein. Ich bin hergekommen, um mit Ihnen zu reden.«
»Macht es Ihnen etwas aus«, fragte Kate, »wenn ich rauche?«
»Ja, es macht mir etwas aus«, sagte Joan Theresa. »Mir wird übel davon.«
Kate steckte ihre Zigarette wieder in die Packung. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte Kate (wie sie hoffte, nicht ungeduldig), »außer, dass ich weder rauche noch Jocasta nervös mache?«
»Ich wollte nicht unhöflich sein. Man hat mir zwar gesagt, dass Sie ziemlich direkt und streng sind, aber nicht wie straight. Sie heißen Kate Fansler. Ist Fansler der Name Ihres Mannes?«
»Nein, der meines Vaters. Theresa, nehme ich an, ist der Name Ihrer Mutter?«
»Na, das ist gut«, sagte Joan Theresa. »Gefällt mir, dass Sie das sagen.« Kate spürte, wie sich Joan Theresa und Jocasta plötzlich entspannten, kaum merkbar zwar, aber doch schienen beide ein wenig von ihrem Misstrauen aufzugeben. Jocasta legte den Kopf auf den Boden. Trotzdem war Kate sich bewusst, dass sie genau beobachtet wurde. Der Regenmantel, den sie am Haken aufgehängt hatte, war ein modischer Regenmantel. Ihre Schuhe waren zwar flach, aber modern. Ihre Strumpfhosen bedeckten rasierte Beine. Zu dem Hosenanzug aus weichstem Wildleder trug sie einen Kaschmirpullover mit Rollkragen, und auf dem Revers ihrer Jacke steckte eine Nadel, eine goldene. Kein Zweifel, Kate war fürs Patriarchat ausstaffiert.
»Meine Kleidung«, sagte Kate, »macht mir mein Leben leichter – so wie die Ihrige Ihnen das Leben erleichtert. Möchten Sie etwas Bestimmtes von mir?«
»Ja. Aber nicht für mich«, sagte Joan. »Für Janet Mandelbaum. Sie sagte, Sie würden sich an sie erinnern. Mandelbaum ist der Name ihres Mannes, aber sie sind geschieden.«
»Ich weiß«, sagte Kate.
»Ich hatte auch mal einen Mann«, sagte Joan. Sie rutschte auf ihrem Stuhl herum, und der Hund setzte sich zögernd auf. »Sitz, Mädchen. Wissen Sie, woran meine Ehe endgültig in die Brüche ging? Damals war ich gerade in meiner Gib-dir-Mühe-und-sei-eine-gute-Ehefrau-Phase; das war, ehe ich den Vornamen meiner Mutter zu meinem Nachnamen machte. Mein Mann, der es ziemlich schwer hatte und mit der Welt nicht zurechtkam, fand eines Tages Pferdemist im Schlafzimmer. Er bildete sich allen Ernstes ein, ich hätte mir die Mühe gemacht, den dorthin zu schaufeln oder vielleicht sogar ein Pferd ins Zimmer zu bugsieren, nur damit er in Pferdemist treten konnte. Die Wahrheit, die er nie hören wollte, war ganz einfach und ohne jede Bösartigkeit. Jocasta war damals noch klein und hatte die Angewohnheit, alles, was interessant roch, zu verschlingen. Ich war mit ihr im Park spazieren gegangen, und dort hatte sie Pferdeäpfel verschluckt. Als wir wieder zu Hause waren und ich die Lust meines Mannes befriedigend im Bett lag, kam Jocasta offenbar zu dem Schluss, dass die Pferdeäpfel nicht an der richtigen Stelle saßen, und sie spuckte sie, rund und unversehrt, auf den Schlafzimmerboden. Ich stell mir gern vor, dass Jocasta die Pferdeäpfel genau in dem Moment herauswürgte, als mein Mann … na, egal. Und die Moral von der Geschichte hat mit dem zu tun, warum ich hier bin. Männer sind immer davon überzeugt, dass man ihnen absichtlich Pferdemist in den Weg legt, um sie zu ärgern.«
Stille trat ein, während der Kate über Janet Mandelbaum nachdachte, die, wie es aussah, der Grund für diesen außergewöhnlichen Besuch war. Kate hatte kürzlich gelesen, dass Janet als erste Professorin an die anglistische Fakultät von Harvard berufen worden war. Natürlich war Janet keine Jüdin; der Name Mandelbaum stand für die einzige liberale Phase in ihrem Leben. Sie hatte den Namen beibehalten, denn mit diesem Namen hatte sie sich ihren wissenschaftlichen Ruf gemacht, einen beachtlichen Ruf. Ihre Arbeit über die Lyrik des siebzehnten Jahrhunderts war zweifellos das Beste, was seit T. S. Eliot auf diesem Gebiet geschrieben worden war, und damals in den Fünfzigern stürzten sich alle auf die Lyrik des siebzehnten Jahrhunderts. Auch ihre späteren, weniger spektakulären Veröffentlichungen hatten Beachtung gefunden. Aber es war wohl vor allem ihr erstes Buch, das ihr den Ruf nach Harvard eingebracht hatte.
»Janet war nie Feministin«, sagte Kate.
»Was Sie nicht sagen! Nun, ich würde es anders ausdrücken«, Joan machte eine ausholende Geste. »Sie war nie eine Frau, jedenfalls was ihre Arbeit angeht.«
»Ich weiß«, sagte Kate. »Deshalb hat sich Harvard wohl für sie entschieden. Außerdem hat sie sich schon mit Mitte zwanzig die Gebärmutter herausnehmen lassen und wird also nie in die Wechseljahre kommen, in der, wie jedermann weiß, alle Frauen durchdrehen. Ehrlich gesagt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Sie und Janet etwas miteinander zu tun haben. Eine höchst unwahrscheinliche Kombination.«
»Stimmt! Aber Tatsache ist, dass Janet in Schwierigkeiten steckt. Und sie hat die Schwestern mit hineingezogen.«
»Die Schwestern?«
»Unsere Kommune. Nichts Religiöses. Wir sind einfach eine Gruppe von Frauen, die einander unterstützen.«
»In der Hampshire Street.«
»Sie begreifen schnell. Ich seh schon, dass man Köpfchen braucht, um es im Establishment zu was zu bringen. Janet wurde völlig betrunken im antiken Badezimmer eines Holzhauses auf dem Campus aufgefunden, das zur anglistischen Fakultät gehört. Man hat die Schwestern in die Sache hineingezogen. Wir haben aber nichts damit zu tun.«
In diesem Augenblick klopfte es an der Tür. Kate öffnete, und vor ihr stand ein Student. Seine Augen hefteten sich auf Jocasta, die seinen Blick mit einem Knurren erwiderte und sich drohend erhob. Kate trat vor die Tür und schloss sie hinter sich. »Mr. Marshall«, sagte sie. »Ich weiß, Sie haben einen Termin. Könnten Sie noch ein paar Minuten warten? Bleiben Sie unten in der Halle, bis Sie meine, ehmmm, Gäste herauskommen sehen, ja?« Mr. Marshall nickte, ohne den Blick von Kate zu wenden. In zehn Minuten wird die ganze Fakultät von der Geschichte wissen, dachte Kate. Aber welcher Geschichte?
Am Abend trafen sich alle drei in Kates Appartement. Kate hatte die Füße hochgelegt. Joan Theresa saß mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, und Jocasta schlief auf der Couch. Kate trank Scotch, Joan Kaffee, und Kate rauchte. Sie hatte einen Tischventilator aufgestellt, um den Rauch von Joan Theresa wegzublasen.
»Sagen Sie bloß nicht, ich sollte aufhören«, sagte Kate. »Ich habe es oft versucht und finde mich schrecklich, weil ich rauche, aber wenn ich nicht rauche, finde ich mich noch schrecklicher. Was um Himmels willen passiert mit Janet in Harvard?«
Jocasta drehte sich mit zufriedenem Schnaufen auf die andere Seite. Joan verlagerte ihr Gewicht von einem Bein aufs andere. »Dass Janet Mandelbaum und eine der Schwestern gemeinsame Sache machen, ist genauso unwahrscheinlich wie Nixon als Wahlkampfleiter für Ted Kennedy. Ausgeschlossen! Aber – trotzdem. Ich hab mir schon gedacht, dass Sie nicht wissen, was eine Schwester wirklich ist.«
»Nein, nicht wirklich. Sie halten ja offenbar nicht alle Frauen für Schwestern, in dem Sinne, wie die Franzosen von Brüderlichkeit sprechen.«
»Ich bezweifle, dass alle Männer Brüder sind oder je waren, auch wenn sie alle unter einer Decke stecken. Frauen, die Schwestern sind, haben dem männlichen Establishment den Rücken gekehrt und nichts mit den patriarchalischen Institutionen zu tun. Und sie verachten sie zutiefst. Das Patriarchat unterdrückt die Frauen und beutet sie aus, und deshalb sind all seine Institutionen für uns Schwestern gestorben. Wir hätten nichts dagegen, sie in die Luft zu jagen; aber auch wenn wir das nicht tun, werden wir doch zumindest nie in diesem verdorbenen Verein mitmachen. Frauen, die keine Schwestern sind, spielen mit im Männersystem, entweder weil sie Spaß daran haben oder weil sie meinen, sie könnten es verändern.«
»Wie ich.«
»Verzeihung, ja.«
»Und der Wunsch der Schwestern, die patriarchalischen Institutionen in die Luft zu jagen, ist wörtlich zu verstehen, nehme ich an.«
»Nein, nicht wörtlich. Gewalt und Zerstörung sind Männerspiele. Aber wo sie nur können, werden die Schwestern die männlichen Institutionen für ihre eigenen Ziele nutzen. Sie werden sogar lügen; bisher wurden ihre Offenheit und ihr Vertrauen immer missbraucht. Eine Frau wie Janet Mandelbaum ist für mich schlimmer als ein Mann. Sie konspiriert mit Männern gegen andere Frauen. Und wir haben nichts im Sinn mit Frauen, die sich mit Männern zusammentun, sei es in ihrer Arbeit oder sonstwo.«
»Moment«, sagte Kate. »Ich möchte für mich das Recht in Anspruch nehmen, nicht mit Janet Mandelbaum in einen Topf geworfen zu werden. Es gibt Abstufungen.«
»Wären Sie nach Harvard gegangen, wenn man Sie gefragt hätte? Oder Yale? Oder Princeton? Das ist ja alles dasselbe.«
»Nein, das wäre ich nicht, aber nicht aus den ehrenwerten Motiven, die Sie vielleicht vermuten. Erstens würde man mich in jedes Komitee berufen, als die Alibi-Frau, die überall dabeisitzt, aber nichts zu sagen hat. Zweitens finde ich Harvard, wo seit Generationen alle Männer meiner Familie studieren, entsetzlich selbstgefällig, genau wie sie, und eine Institution wie Harvard sträubt sich gegen jede Veränderung. In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts schrieb Henry James einen Roman, in dem eine junge Frau einen Besucher durch Harvard führt und ihm alle Gebäude zeigt. Dabei macht sie die Bemerkung, dass in keinem davon Platz für eine Frau ist. Harvard hat sich seither nicht sehr verändert. Vor kaum mehr als zehn Jahren durften Frauen viele der Bibliotheken nicht benutzen. Nein, aus welchen Gründen auch immer, ich wäre nicht nach Harvard gegangen, wenn man mich gebeten hätte, und auch nicht nach Yale oder Princeton. Aber trotzdem bin ich in Ihren Augen wie Janet, oder?«
»Das stimmt.«
»Warum sind Sie dann hier? Warum schnarcht Jocasta so zufrieden auf meiner Couch? Ich fürchte fast, dass Sie Frauen verachten, die mit dem Patriarchat zusammenarbeiten, aber nichts dagegen haben, diese Frauen für Ihre Zwecke einzuspannen.«
»Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Eine Gewohnheit von mir«, sagte Kate. »So, und jetzt müssen Sie mir nur eins erklären: Wie konnte sich eine echte Schwester je mit Professor Mandelbaum einlassen?«
Joan streckte ihre Beine aus und saß in einer Pose da, die nur für einen durchtrainierten Körper bequem sein konnte. Daran, wie es um ihre eigene Kondition bestellt war, wollte Kate lieber nicht denken. Sie vertrat zwar die Ansicht, dass Sport sehr wichtig für Frauen sei und wilde, aggressive Spiele jungen Mädchen sehr gut täten, war aber selbst Zeit ihres Lebens vor jeder sportlichen Betätigung zurückgeschreckt. Spazierengehen war für sie die einzige körperliche Ertüchtigung, bei der sie sich nicht lächerlich vorkam. Ihr schlanker Körper war, wie der größte Teil ihres Vermögens, ererbt und nicht ihr eigenes Verdienst.
»Wie gut kennen Sie Harvard?«, fragte Joan.
»Überhaupt nicht. Viel zu wenig jedenfalls, um etwas Gescheites damit anzufangen. Eigentlich kenne ich Harvard nur von den Abschlussfeiern irgendwelcher Neffen her. Gehen Sie am besten von völliger Ignoranz aus.«
»Die Verwaltung der anglistischen Fakultät ist in einem dieser umgebauten Holzhäuser untergebracht, die Harvard im Laufe der Zeit nach und nach aufgekauft hat und für alle möglichen Zwecke nutzt. Das, von dem die Rede ist, hat früher einem Burschen namens Warren gehört, so sagt man jedenfalls, der an Asthma oder Arthritis oder ich weiß nicht was litt. Er hatte die Gewohnheit, auf seinem rundherum verglasten Balkon zu sitzen, weil er die Feuchtigkeit nicht vertragen konnte, und von dort aus zuzuschauen, wie seine Gäste sich amüsierten. Außerdem soll das Haus einmal ein Versteck für entflohene Sklaven gewesen sein, aber Gott allein weiß, was in Harvard wahr ist und was Legende. Jedenfalls wurde nur wenig verändert, der Balkon hat immer noch seine Glasverkleidung, und im zweiten Stock ist ein antikes Badezimmer mit allem Drum und Dran von damals, einer Badewanne mit Mahagoniumrandung und Toilette mit Ziehkette für die Wasserspülung. Das Ganze wirkt wie das erste Beispiel eleganter Badezimmerausstattung. Die Dusche funktioniert noch. Sie war für Janet voll aufgedreht. Heute dient der Raum als Damentoilette, weil doch hin und wieder eine Dozentin über die Schwelle des Hauses tritt und es ja immerhin ein paar Studentinnen in Harvard gibt. Aber der wahre Grund sind die Sekretärinnen, die Mädels, wie man sie dort bestimmt nennt.«
»Na gut«, sagte Kate. »Bis jetzt kann ich Ihnen folgen. Würde ich in Cambridge leben, ich wäre Harvard dankbar, dass es diese alten Häuser nicht abgerissen hat, um irgendwelche Glas- oder Betonmonstrositäten zu errichten. Aber ich nehme an, diese Meinung weist mich eher als Mitglied des Establishments aus denn als Schwester?«
»Das sehen Sie ganz richtig«, sagte Joan. »Die Männergesellschaft weiß, was in ihrem Interesse ist. Gelegentlich fällt das mit dem Interesse von Frauen zusammen, aber nur sehr selten, und dann rein zufällig. Egal, Janet Mandelbaum wurde eines Abends in dieser mahagonigerahmten Badewanne gefunden, voll wie eine Haubitze und bewusstlos. Sie lag im Wasser, nur der Kopf schaute heraus. Und Luellen May, eine der Schwestern, war bei ihr.«
»War bei ihr?«
»Ja. Jemand hatte im Café angerufen und behauptet, in der Badewanne läge eine Schwester. Luellen ging hin. Natürlich war es eine Falle.«
»Ist die Geschichte an die Öffentlichkeit gedrungen?«
»Nein. Harvard hat dichtgehalten, im eigenen Interesse. Aber es gab eine Menge Zeugen, und die Sache hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen – auf die mieseste Art.«
»Was sagt Janet zu dem Ganzen?«
»Sie sagt, sie hat keine Ahnung, wie sie in die Badewanne gekommen ist. Das glaubt ihr natürlich keiner. Jeder denkt, sie hat gesoffen bis zum Umfallen. Natürlich ist die Geschichte für Professor Mandelbaum einfach schrecklich. Und das Allerschrecklichste ist wohl für sie, dass jetzt alle glauben, sie hätte was mit Luellen. Unsere Janet will ja noch nicht einmal mit dem weiblichen Teil der Studentenschaft etwas zu tun haben.«
»Die Geschichte kann aber keine großen Kreise gezogen haben«, sagte Kate, »sonst hätte ich davon gehört.«
»Ich wette, Ihre männlichen Kollegen wissen Bescheid. Glauben Sie, die würden Ihnen so was erzählen?«
Kate schüttelte langsam den Kopf. »Ein oder zwei vielleicht, wenn sie mich zufällig allein erwischt hätten. Was soll ich Ihrer Meinung nach bei dem Ganzen tun?«
»Janet möchte, dass Sie nach Harvard kommen und ihr helfen.«
»Das finde ich eigenartig«, sagte Kate. »Wir haben gleichzeitig Examen gemacht. Damals haben wir uns natürlich oft gesehen. Kennen Sie Gertrude Stein? Sie sagte über ihren Bruder Leo: ›Wir waren immer zusammen, und jetzt waren wir überhaupt nicht mehr zusammen. Nach und nach sahen wir uns nie wieder.‹ Wann möchte Janet, dass ich nach Harvard komme?«
»Ich weiß nicht, bald. Vielleicht nach den Weihnachtsferien.«
»Und warum bringen Sie, die Sie Janet doch verachten, mir diese Botschaft?«
»Na, ich habe gedacht, wir alle haben gedacht, wenn Sie kommen, um Janet zu helfen, könnten Sie ja vielleicht auch etwas für Luellen tun. Sie streitet vor Gericht um das Sorgerecht für ihre Kinder. Und diese Geschichte tut ihr nicht gut.«
Sie saßen eine Weile schweigend da und schauten Jocasta zu, die völlig entspannt auf der Couch schlief, nur ihre Pfoten zuckten heftig. Offenbar wurde ihre Hundeseele von aufregenden Träumen gejagt.
»Ich weiß«, sagte Joan, während sie aufstand, »Sie werden es sich noch überlegen wollen. Vielleicht wird sich Janet bei Ihnen melden. Auf, Jocasta, du faules Luder!« Das faule Luder reagierte nicht. Joans schriller Pfiff ließ den Kopf des Tieres hochschnellen.
»Ich habe mir immer gewünscht, so pfeifen zu können«, sagte Kate. »Aber sagen Sie mir eines: Sie würden jeden Mann anlügen und jede Frau, die mit Männern zusammenarbeitet, Sie betrachten das sogar als Ihre Pflicht. Warum sollte ich Ihnen also glauben?«
»Sie brauchen ja nichts zu glauben«, sagte Joan. »Prüfen Sie es nach. Warum fahren Sie nicht hin und sehen selbst? Wir haben immer eine Matratze für Sie, wenn Sie eine brauchen. Stimmt’s, Jocasta?«
»Hampshire Street«, sagte Kate. »Vielleicht werde ich einen Kaffee brauchen.«
»›Vielleicht nächstes Mal‹ heißt unser Treff. Jeder in Cambridge kann Ihnen den Weg zeigen.«
Als sie gegangen waren, las Kate gedankenverloren ein paar von Jocastas weißen Haaren von der Couch. Sie hätte gern einen Hund gehabt, aber ein Tier passte weder in ihr noch in Reeds Leben. »Pferdemist«, murmelte sie kichernd. Es irritierte sie, dass sie sich so von Jocasta angesprochen fühlte, aber noch mehr irritierte sie, dass sie die männliche Institutionen hassende Joan Theresa sympathisch fand. »Schwestern!«, schnaubte Kate. Dann ging sie zum Fenster. Unten raste Joan Theresa mit langen Schritten die Straße hinunter und Jocasta, die Ohren angelegt, mit Volldampf hinterher.
Zwei
Du hast solche Angst, dein moralisches Empfinden zu verlieren, dass du höchstens riskierst, es durch eine Schlammpfütze zu ziehen.
Gertrude Stein
»Natürlich«, fuhr Mark Evergreen fort, als der Kellner ihre Wassergläser gefüllt hatte und sie ihrem Lunch im Fakultäts-Club überließ, »ist er vom anderen Ufer.«
»Ja, ja – das andere Ufer – das Unbekannte, das Neugier weckt, mit Sehnsucht erfüllt, die Menschen zum Aufbruch treibt.«
»O je«, sagte Mark, »ich hätte es nicht so platt heraussagen sollen. Du ärgerst dich.«
»Nur wegen des Wortes. Ich trauere um Worte. Das fremde, das andere Ufer, das war einmal ein wunderschönes poetisches Bild. Wie soll man diesen Ausdruck heute noch gebrauchen? Er würde jene Art Gekicher hervorrufen, das ich als Kind immer erntete, wenn ich ganz unschuldig von Elfen sprach und nicht ahnte, dass das Wort eine doppelte Bedeutung hat. Wenn es wirklich so weit kommt, dass das andere Ufer nur noch Homosexualität für uns bedeutet, werden die Elfen vielleicht wieder sein können, was sie einmal waren und im Dickicht der Wälder in Sicherheit leben.«
»Gegen Homosexuelle als solche hast du nichts?«
»›Als solche‹! Wirklich, Mark – welche Ausdrucksweise! Aber mein Sprachempfinden einmal beiseite – ich bin froh um die Veränderungen in den Siebzigerjahren. Die meisten Dekaden unseres Jahrhunderts waren fürchterlich – die Dreißiger, die Fünfziger, die Siebziger. Sie waren geprägt von Depression, Hexenjagd und der Verlogenheit derer, die Macht und Einfluss hatten. In den Siebzigern passierten immerhin einige erfreuliche Dinge, und dazu gehört, dass man Homosexuellen endlich mit mehr Offenheit und Verständnis begegnete. Ein bezaubernder Freund von mir – wie von einem anderen Ufer im vollen schönen Sinn dieses Ausdrucks, denn er ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch – vertraute mir an, er sei aus seinem Kämmerchen hervorgekommen und zeige sich jetzt im Licht. Da hast du mal ein Bild, das keine unberechtigten Forderungen an unsere Sprache stellt – ja wirklich, etymologisch gesehen, ist es völlig korrekt und leuchtet außerdem jedermann ein. – Nun, bemerkenswert ist, dass mein Freund vorher genauso nett, unterhaltsam, vertrauenswürdig und informiert war wie jetzt. Für mich hat er sich dadurch nicht verändert – außer, dass er jetzt den schönen Ausdruck vom anderen Ufer so einseitig mit Beschlag belegt.«
»Kate, stimmt irgendetwas nicht? Ich weiß, dass du zu Vorträgen aus dem Stegreif neigst, aber heute kommst du mir noch sprunghafter vor als sonst. Was soll ich dir noch von Clarkville erzählen? Du kennst bestimmt seine Veröffentlichungen so gut wie ich.«
»Gewiss, aber du kennst ihn besser, und ich frage mich …«
»Du hast von diesem Janet-Mandelbaum-in-der-Badewanne-Trara gehört. Ich hätte es mir denken können.«
»Um genau zu sein: Ich habe nicht davon gehört; man hat es mir erzählt. Und da du Clarkville so gut kennst: Weißt du, was genau passiert ist?«