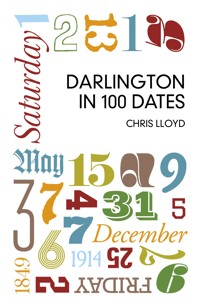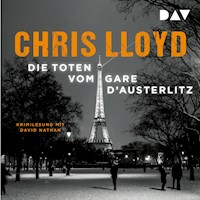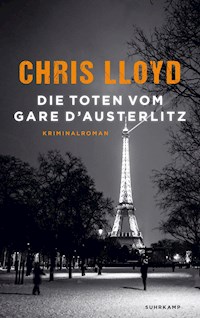
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eddie Giral
- Sprache: Deutsch
Freitag, 14. Juni 1940: An dem Tag, als die Nazis in Paris einmarschieren, werden an der Gare d'Austerlitz vier Polen ermordet aufgefunden, und ein weiterer begeht kurz darauf Selbstmord. Inspecteur Éduard Giral beginnt gegen alle Widerstände zu recherchieren. Sehr bald mischen sich in seine Ermittlungen Wehrmacht, Gestapo und Geheime Feldpolizei ein, während im Hintergrund der enigmatische, skrupellose Major Hochstetter von der Abwehr die Strippen zieht und ihm mal als Gegenspieler, mal als Verbündeter begegnet.
Als unvermittelt Girals verlorener Sohn Jean-Luc auftaucht, der seinen Vater für einen Opportunisten und Feigling hält, muss er multivektorales Überlebensschach spielen, mal mit der einen, mal mit der anderen der beteiligten Gruppen (schein)paktieren, um seinen Sohn irgendwie aus der Schusslinie zu schaffen und letztendlich seinen Job als Polizist zu machen und die Morde aufzuklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Chris Lloyd
Die Toten vom Gare d'Austerlitz
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Andreas Heckmann
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Freitag, 14. Juni 1940
1
2
3
4
Mittwoch, 20. Mai 1925
Samstag, 15. Juni 1940
5
6
7
8
9
Sonntag, 24. Mai 1925
Sonntag, 16. Juni 1940
10
11
12
13
Donnerstag, 28. Mai 1925
Montag, 17. Juni 1940
14
15
16
17
Sonntag, 7. Juni 1925
Dienstag, 18. Juni 1940
18
19
20
21
Freitag, 19. Juni 1925
Mittwoch, 19. Juni 1940
22
23
24
25
Freitag, 19. Juni 1925
Donnerstag, 20. Juni 1940
26
27
28
29
30
31
Freitag, 19. Juni 1925
Freitag, 21. Juni 1940
32
33
34
35
36
Donnerstag, 2. Juli 1925
Samstag, 22. Juni 1940
37
38
39
40
41
Sonntag, 5. Juli 1925
Sonntag, 23. Juni 1940
Oper
Triumphbogen
Invalidendom
Panthéon
Sacré-Cœur
Le Bourget
Nachtrag
Anmerkung des Autors
Danksagung
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Freitag, 14. Juni 1940
1
Zweierlei geschah am 14. Juni 1940.
Vier Unbekannte starben in einem Bahndepot, ein fünfter Mann sprang vom Balkon.
Es geschah noch mehr am 14. Juni 1940.
Die Soldaten der Panzerjäger-Abteilung 187 wollten beim Einmarsch in Paris möglichst gut aussehen, also wuschen sie sich im trüben Wasser des Ourcq-Kanals, sechs Kilometer vor der Stadt. Beim Wettlauf um die besten Quartiere bezog Generalmajor Bogislav von Studnitz das Hôtel de Crillon, und deutsche Offiziere legten ihre verstaubten Uniformen auf die edelste Bettwäsche der Stadt. Und in der Sommersonne tröteten endlose Wehrmachtskapellen die menschenleeren Champs-Élysées entlang, bis schließlich ein riesiges Hakenkreuz über dem Grabmal des unbekannten Soldaten entrollt wurde – für den Fall, dass in Paris noch immer irgendwem nicht klar sein sollte, dass wir verloren hatten.
In meiner Welt aber starben vier Unbekannte in einem Bahndepot, und ein fünfter Mann sprang vom Balkon.
»So ein verdammter Gestank«, fluchte Auban.
»Respekt vor den Toten, wenn ich bitten darf«, sagte ich zu ihm. Ermittler Auban, ein Rabauke vom rechten Rand, der sich durch die dreißiger Jahre geschlagen hatte, war ein harter, muskulöser Bursche. Um das zu betonen, trug er sogar in der zunehmenden Hitze eines Sommervormittags eine schwere Lederjacke und ein weißes Hemd, so eng geschnitten, dass es die Brust betonte. Er funkelte mich an und wandte sich ab.
»Hier entlang, Inspektor Giral«, erwiderte er mit zusammengebissenen Zähnen; Angst überwog unübersehbar seine sonst so anmaßende Frechheit. Ein kurzer Blick nach rechts und links verriet mir, warum.
Längs der Gleise standen reihenweise deutsche Soldaten – ein Spalier anonymer Gestalten, die reglos zugesehen hatten, wie ich über die rußverschmierten Schwellen des Depots zu Auban ging. Die Männer rechts verdeckten zum Teil die tiefstehende Sonne; ihre langen Schatten fielen auf das Öl und den Dreck des Depots, und sie musterten uns genau. Links dagegen starrten harte junge Gesichter teilnahmslos. Aus kaum fünfzig Metern Entfernung fixierte mich ein Offizier mit ausdrucksloser Miene. Das waren die ersten Deutschen, die ich an diesem Tag sah, sie gehörten zur Vorhut, die in die Stadt einmarschiert war. Sie beobachteten uns stumm, ihre Maschinenpistolen wiesen zu Boden, das Feldgrau ihrer Uniformen sog die dunklen Wolken vom Himmel.
»Sind die schon die ganze Zeit hier?«, fragte ich Auban. Er nickte.
Wir stießen zu sechs Schutzpolizisten, die neben drei Güterwagen auf uns warteten. Das sonst so betriebsame Depot südlich des Gare d'Austerlitz war ungewöhnlich still. Keine Zugbewegungen. Wir bahnten uns entlang der Gleise einen Weg durch den Müll. In den Straßen ringsum und überall in der Stadt war er wochenlang nicht abgefahren worden, während die Deutschen auf Paris vorgerückt und Abfälle die geringste Sorge gewesen waren.
Auban hatte Recht: Es stank. In der Luft lag der Geruch von Tod und Verwesung. Ob er vom Tatort kam, der auf mich wartete, oder von der Stadt, konnte ich nicht entscheiden. Unter dem wachsamen Blick der deutschen Soldaten passierten wir im Durcheinander der Gleise einen toten Hund; die geschwollene Zunge hing ihm aus dem Maul, seine Augen waren panisch geweitet. Fliegen schwirrten auf und setzten sich wieder auf das verwesende Fleisch. Ich zögerte kurz. Da war noch ein Geruch, schwach, aber beißend – wie bittere Ananas in schwarzem Pfeffer. Nur dass er etwas anders war als damals. Ich schüttelte den Kopf, um die Erinnerung loszuwerden.
Ein Polizeisergeant eilte am Gleis entlang auf uns zu. Mir stockte der Atem, und fast wäre ich getaumelt, was Auban indes, wie ein Seitenblick zeigte, nicht bemerkt hatte. Nur mühsam konnte ich angesichts des heranhetzenden Mannes meine Panik unterdrücken. Eine schwere Gasmaske verunstaltete sein Gesicht, und der Geruch, der am Rand meines Sensoriums gelauert hatte, flutete endlich mein Gedächtnis.
Mit dumpfer Stimme hielt der Sergeant uns Gasmasken hin. »Die müssen Sie aufsetzen, Eddie.«
Mit etwas zittrigen Fingern griff ich nach einer Maske. Es war das übliche Heeresmodell. Nicht viel besser als die, die wir hatten tragen müssen, als Deutschland zuletzt gegen uns in den Krieg gezogen war. Ich versuchte, meine Atmung unter Kontrolle zu halten und nicht wieder die dunkle Panik zu durchleben wie vor einem Menschenleben, als ich zuletzt so eine Maske getragen hatte. Ich erinnerte mich an einen anderen Morgen, damals, als ich kurz Gas in Nase und Augen brennen spürte, ehe ich noch rechtzeitig die Maske aufbekam und durch den gelben Nebel die Unglücklichen sah, die zu lange mit dem Aufsetzen gewartet hatten und nun qualvoll am Boden eines Schützengrabens starben.
»Nur eine Vorsichtsmaßnahme«, hörte ich den Sergeanten sagen. »Das Gas hat sich bestimmt schon verflüchtigt, aber wir gehen besser auf Nummer sicher.«
Er führte uns zu sechs Schutzpolizisten, die eng zusammenstanden und Masken trugen.
»Guten Morgen, Eddie«, sagte der einzige Zivilist zu mir. »Zuschauer haben wir ja nicht jeden Tag.«
Bouchard, der Gerichtsmediziner, war – obwohl nur ein paar Jahre älter als ich – immer im altmodischen Cutaway unterwegs und trug seine grau melierten Haare nach hinten gekämmt wie ein Philosoph der Belle Époque. Obwohl auch sein Gesicht unter einer Maske steckte, beruhigte mich seine Gegenwart.
»Schwieriges Publikum. Ich lasse Sie nachher den Hut rumreichen.«
Der Sergeant winkte uns, ihm zu folgen. Wortlos führte er uns zu drei Güterwagen auf einem Nebengleis, deren Schiebetüren geschlossen waren. Er zeigte auf den mittleren Waggon. Das Belüftungsgitter knapp unterm Dach war mit Lumpen verstopft. Ein kleines Loch zeigte, wo sich die Füllung gelockert hatte. Ich nickte dem Sergeanten zu, um ihm zu zeigen, dass ich verstanden hatte.
Wir drei gingen zum Waggon. Auban blieb zurück. Das Schloss war bereits geöffnet; eine Metallstange, offenkundig verkeilt, um die Tür versperrt zu halten, lag am Boden. Vorsichtig schob der Sergeant sie auf, beugte sich vor, erklomm die Metallstufe, zog sich hoch und wies auf etwas an der Wand gegenüber: ein Häufchen dunkle Glasscherben und ein Fleck, der auf dem Holzboden kaum zu sehen war. Gelblicher, vom Sergeanten aufgewirbelter Staub schwebte im spärlichen Licht und sank langsam wieder auf die rohen Bretter.
»Chlor«, sagte er mit verzerrter Stimme.
Ich kletterte hinein, Bouchard mir nach. Meine Augen mussten sich kurz an das Halblicht gewöhnen – und an den unwirklichen Anblick des trüben Innenraums durchs billige Glas der Maske. Ich wünschte, sie hätten es nicht getan. Ein Mann, dessen Hand noch zur Tür wies, lag zusammengesunken an der Wand gegenüber. Er war gestorben, als er das Schloss hatte aufbrechen wollen. Erneut sah ich die verzweifelten, vorquellenden Augen und die geschwollene Kehle, von denen ich gehofft hatte, sie nie wieder zu sehen. Der gleiche durchsichtige Speichel war vom Kinn auf die Brust geflossen. Ich atmete flach unter der engen Maske.
Der Sergeant wies nach links. Auch dort Glasscherben am Boden. An der Wand darüber zeigte ein feuchter Fleck, wo die Flasche am Holz zerbrochen war. Unter dem Gitter lag ein zweiter Mann, in der Hand etwas von der Füllung; auch sein Gesicht war rot und geschwollen. In seinen Zügen standen die gleiche Qual und Panik. Hinter ihm lagen noch zwei Männer. Kratzspuren auf den Planken zu ihren Füßen zeigten, dass sie vor dem Gas hatten fliehen wollen, ihre Köpfe waren in letzter Ergebung gegen die Wand geschmiegt. Ich hatte Schützengräben voller Männer gesehen, die so dalagen, doch selten war ihr Anblick so verzweifelt gewesen wie in diesem schmutzigen Güterwagen auf einem Nebengleis am ersten echten Morgen meines neuen Krieges.
Ich spürte eine Beklemmung nach meiner Brust greifen, die nicht vom Gas kam, sondern von dem Gefühl, die Maske kralle sich in mein Gesicht. Keine Sekunde konnte ich sie mehr tragen, riss sie vom Kopf, stand an der Waggontür und atmete die Außenluft gierig ein. Der Sergeant sprang auf mich zu, ich sah den Schrecken unter seiner Maske.
»Sind Sie wahnsinnig, Eddie?« Seine Worte waren kaum zu verstehen.
»Das Gas ist weg, das haben Sie doch selbst gesagt«, antwortete ich verärgert, um meine Angst zu verbergen. Dann wandte ich mich wieder zum Waggon, blieb aber an der Tür. »Hier können wir nicht arbeiten. Bringen Sie die Toten raus, damit Doktor Bouchard eine erste Untersuchung machen kann.«
»Das ist unüblich, Eddie«, widersprach Bouchard.
Ich betrachtete die Szenerie im Güterwagen und davor. »Was Sie nicht sagen. Schaffen Sie die Leichen raus.«
Widerwillig befahl der Sergeant einigen seiner Männer, die vier Toten ein Stück vom Waggon wegzutragen. »Einer von euch sammelt die Glasscherben der Gasbehälter und steckt sie in getrennte Schachteln«, befahl er. »Mit Handschuhen.«
»Und behalten Sie die Masken auf«, fügte ich hinzu. »Chlor ist schwerer als Luft. Falls davon noch was da ist, steht es am Boden des Waggons.« Das hätte ich mir sparen können, denn nur ich hatte die Maske abgezogen. »Entfernen Sie die Abdichtung von der Lüftung und schließen Sie die Türen. Das Gas muss ganz abgezogen sein, bevor wir die Wagen genauer untersuchen. Hat es sich erst richtig mit der Luft draußen vermischt, richtet es keinen Schaden mehr an.«
Bouchard war aus dem Waggon gestiegen und hatte seine Maske abgezogen. Er rückte die Halbbrille auf der Adlernase zurecht und sah zu mir hoch. Seine Miene war besorgt.
»Ich habe das alles schon erlebt«, versicherte ich ihm. »Das Gas ist weg, das weiß ich. Kann die Gerichtsmedizin von Lumpen Fingerabdrücke nehmen?«
Er blickte skeptisch. »Schwierig. Und es ist niemand mehr da, der es versuchen könnte. Nicht mit diesem Pack in der Stadt.« Er wies auf die Deutschen und folgte der ersten Leiche zu einem freien Fleck am Boden, zwanzig Meter vom Waggon entfernt.
Ich sprang vom Waggon, warf meine Maske auf den Boden, atmete im Weggehen tief ein und dachte ausnahmsweise nicht an den Ruß und die Korrosion, die der Stadt die Luft abschnürten. Schwerer schwarzer Rauch hing am Morgenhimmel und warf einen Schatten über Paris. Der Rauch kam von den Treibstofflagern vor der Stadt. Einige sagten, unsere abziehende Armee habe sie angezündet. Andere vermuteten, die amerikanischen Ölgesellschaften hätten die eigenen Depots angesteckt. So oder so, den Deutschen hatte das Öl nicht in die Hände fallen sollen. Allerdings schien das für die Besatzer keine Rolle zu spielen. Es waren nur wir Pariser, die unter dem Dreck litten, der sich in Mund und Nase und unter die Kleidung tastete. In der Nacht hatte es geregnet, zum ersten Mal seit einem Monat, und ich musste vorsichtig zwischen den Gleisen über die hölzernen Bahnschwellen gehen. Ihr Öl- und Rußbelag war dicker als sonst – und wegen des schwarzen Taus, der gefallen war, lebensgefährlich.
Ich sah Bouchard eine Voruntersuchung der vier Leichen beginnen, die auf Planen am Boden lagen. Das war natürlich ungewöhnlich, erschien mir aber als einzig mögliche Option. Die eigentliche Obduktion würde er in der Gerichtsmedizin durchführen. Jenseits der drei Wagen schauten die Deutschen über das Gleisgewirr hinweg weiter stumm zu. Ich hatte sie fast vergessen. Hinter ihnen stand ein zusammengewürfeltes Durcheinander aus Behelfshütten, die im Laufe der Jahre eine niedrige Silhouette gebildet hatten und meist illegal erbaut worden waren. Wären die Soldaten nicht gewesen, hätte ich ein paar Flics dort nachschauen lassen. Nördlich der Waggons lagen Werkstätten und überdachte Gleise und dahinter links der für Passagiere zugängliche Bereich. Im Süden verschwanden die Gleise auf ihrem Weg ins Umland in den Straßen der Stadt. Ich sah sie schmaler und schmaler werden und wäre ihnen einerseits gern gefolgt, andererseits aber nicht, wie ich erstaunt feststellte. Hinter mir führten viele Gleise von Süden nach Norden. In der Mitte stand ein wackliger Turm, zu dem eine schmale Treppe hinaufführte; von dort ließ sich das gesamte Depot übersehen.
Ein Schutzpolizist, vom Sergeanten geschickt, kam mich holen. Auch er hatte die Maske abgezogen und schleppte nervös sein Gewehr über der Schulter. Seit die Deutschen in den Ardennen durchgebrochen waren, trug die Polizei in der Stadt Gewehre – wohl um jede Straßenecke zu verteidigen. Nun wirkten die Waffen wie ein nutzloses Stück roter Stoff, das eine Provokation für die einmarschierten Truppen darstellte. Der Polizist vor mir trug sein Gewehr unwillig.
»Die Arbeiter, die den Waggon geöffnet haben, sind da drüben, Eddie«, erklärte der Sergeant, als ich wieder zu ihm stieß, und führte mich zu einem stämmigen Mann um die fünfzig in Lederjacke und blauer, ölbefleckter Latzhose. Er sah aus wie Mussolini im Kleinformat, nur mit dunklem Haarschopf und ohne das streitsüchtige Kinn.
»Le Bailly«, stellte er sich vor. »Ich bin hier auf dem Bahnhof der Gewerkschaftsfunktionär.«
»Das sollten Sie im Moment besser für sich behalten.« Ich wies andeutungsweise zu den Deutschen. »Waren die schon da, als Sie den Waggon entdeckt haben?«
Er nickte. Der Boden unter uns erzitterte. Le Bailly und ich sahen uns an und erkannten die Erschütterung. »Da kommen noch mehr von den Dreckskerlen«, sagte er.
Der Lärm von Lastwagen und Panzern, die durch die Straßen unserer Stadt rumpelten und deren Reifen und Ketten den Boden erzittern ließen, unterstrich nur die seltsame Stille im Bahndepot. Mittendrin klingelte ein Telefon. Ich blickte auf und sah den deutschen Offizier ruhig in ein Feldtelefon sprechen, das ein Soldat für ihn hielt. Dabei ließ er uns und die übrigen Polizisten nicht aus den Augen und nickte. Ich wandte mich wieder Le Bailly zu.
»Haben Sie sonst noch jemanden gesehen?«
»Nein.« Er wies auf zwei andere Arbeiter ein kleines Stück weiter. »Wir haben nur den Geruch bemerkt, und ich hab ihnen gesagt, sie sollen schnellstens weg von den Waggons. Ich war im letzten Krieg. Diesen Geruch vergisst man nicht.«
Da musste ich ihm Recht geben. Ich rief Auban heran und trug ihm auf, mit den beiden Arbeitern zu sprechen, einem großen Schwermütigen mit wucherndem Oberlippenbart und einem gedrungenen, rundköpfigen Schwergewicht, dessen Miene so feindselig war wie Aubans Gefälligkeit.
Ich sah ihm nach und wandte mich wieder an Le Bailly. »Woher sind die Waggons?«
»Die standen über Nacht hier und waren für einen Zug bestimmt, der am Morgen fahren sollte. Aber heute ruht der Verkehr.«
Ehe ich eine weitere Frage stellen konnte, hörte ich ein Geräusch. Le Bailly reagierte im gleichen Moment wie ich. Noch eine Erinnerung an den letzten Krieg: Gewehre, die entsichert wurden. Ich drehte mich um und sah den deutschen Offizier auf die Polizisten bei den Waggons zugehen. Seine Soldaten folgten ihm mit erhobenen Waffen. Die Truppen von der anderen Seite kamen unterdessen auf uns zu. Ich spürte die Pistole in meinem Holster. Der Offizier sprach mit einem der Uniformierten, und der zeigte auf mich. Prompt kam der Deutsche auf mich zu, flankiert von vier Soldaten.
»Sie leiten hier die Ermittlungen?«, fragte er mich in passablem Französisch. Er hatte die Luger gezogen und hielt sie vage in meine Richtung. Von dieser Sorte hatte ich im letzten Krieg jede Menge erlebt, auf unserer Seite und der des Feindes. Sie wirkten, als sähen sie sich andauernd auf einem Schimmel und würden auf uns andere, die wir im Dreck verfaulten, herabschauen. Mit seinen weißblonden Haaren und den markanten Wangenknochen schien er unberührt von dem Ruß und dem Gestank, mit dem wir anderen uns konfrontiert sahen.
»Ja. Die Gegenfrage erübrigt sich.«
»Warum das?«
»Sie sind als Einziger nicht verdreckt.«
Er richtete die Luger etwas betonter auf mich, und ich sah ihn zögern: Sollte er unsicher lachen oder mich erschießen? Beherrschung und ein mattes Grinsen siegten. »Ich bin Offizier der Wehrmacht. Sie irren, wenn Sie denken, ich nehme es hin, derart angeredet zu werden.«
Ich wies auf die von den deutschen Soldaten mit gezückten Waffen abgeführten Polizisten. »Und ich bin müde und wütend und versuche, meine Arbeit zu erledigen, obwohl Sie und Hitler mir in die Quere kommen. Sie irren, wenn Sie denken, ich nehme es hin, dass meine Mitarbeiter derart malträtiert werden.«
Sein Grinsen wurde etwas breiter. »Das merke ich mir.« Er wandte sich ab und rief seinen Soldaten einen Befehl zu. Sie wichen ein wenig von den anderen Polizisten zurück und senkten die Gewehre. Der Offizier drehte sich mir wieder zu; seine weiterhin erhobene Waffe war nicht direkt bedrohlich, aber deutlich genug. »Ich bin Hauptmann Karl Weber von der 87. Infanterie-Division der Wehrmacht und muss Ihnen mitteilen, dass das deutsche Oberkommando den Befehl gegeben hat, alle Franzosen zu entwaffnen.«
»Aber wir sind die Polizei.«
»Die Polizei auch. Ich muss Sie bitten, Ihre Waffen abzugeben.«
Wie die Soldaten die Polizisten anstarrten, ließ mich an Füchse im Hühnerstall denken. Ich sah keine Alternative. »Habe ich Ihr Wort, dass den Polizisten nichts passiert?«
»Ja.«
Ich bedeutete den anderen, ihre Waffen abzugeben. Die Soldaten sammelten die Pistolen und Gewehre eilig ein und brachten sie einem Unteroffizier am Rand des Geländes. Hauptmann Weber behielt mich die ganze Zeit im Auge. Seine Miene war ein seltsames Zugleich von distanzierter Herablassung und lächelnder Unverfrorenheit.
Ich händigte ihm meine Pistole aus.
»Danke«, sagte er.
Er rief einen Befehl, und die Soldaten hoben ihre Waffen. Ich hörte einen sein Gewehr spannen, sah Weber an und spürte meine Wut wachsen. Doch mit mattem Lächeln rief der Offizier einen zweiten Befehl, und seine Männer zogen sich auf ihre ursprünglichen Linien längs der Gleise zurück.
»Ich lasse Sie jetzt weiter ermitteln«, sagte er und machte sich zu seinen Soldaten auf. »Ich denke, wir wissen jetzt, woran wir miteinander sind.«
»Warum sind die immer noch da?«, fauchte der Sergeant. »Wir sind unbewaffnet.«
Bouchard und ich schauten unwillkürlich auf. Reglos wie die Heldenstatuen, die sie so liebten, standen die deutschen Soldaten noch eine Stunde später aufgereiht da, während wir Bouchard bei der Untersuchung der vier Toten zusahen. Nur der Offizier redete und ließ eine Litanei von Bemerkungen los, die wir in der Ascheluft nicht verstanden, die die Männer rechts und links von ihm aber lachen ließen.
»Nicht wegen uns«, sagte ich zum Sergeanten. »Sondern zur Gleissicherung. Damit unsere Armee nicht mit der Bahn ausbrechen oder in die Stadt vorstoßen kann.«
»Haben wir denn eine Armee?«, bemerkte Bouchard.
Zwei junge Polizisten kamen mit Kartons. »Die beiden Gasbehälter«, sagte einer. »Was davon übrig ist.«
»Aufs Revier damit«, sagte ich. »Zu Sergeant Mayer.«
Mit deutlich erleichterter Körpersprache eilten sie zu den am Südeingang des Depots geparkten Streifenwagen und verließen die Szene. Auban und acht Schutzpolizisten warteten in der Nähe auf Bouchards Weisung, die Leichen wegzutragen. Zu den drei Bahnarbeitern waren sechs weitere gekommen; alle standen ein Stück entfernt. Ihre Neugier war größer als die Angst vor den Deutschen.
Der Sergeant und ich durchsuchten die Kleidung der Toten. Sie war einst von guter Qualität gewesen, nun aber zerlumpt. Alle Taschen waren leer. Kein Geld. Keine Papiere, um sie zu identifizieren.
»Ausgeraubt?«, fragte der Sergeant. »Oder Flüchtlinge?«
»Oder beides.« In einer Jacke entdeckte ich ein Etikett und zeigte es ihm. »Vermutlich Ausländer. Diese Jacke kommt aus einem Ort namens Bydgoszcz.«
»Das ist in Polen. Hab ich in der Wochenschau gesehen.«
Unwillkürlich betrachtete ich die vier Männer. Was mochte sie hergeführt haben, zu ihrem Tod in einem dreckigen Bahnwaggon in einer fremden Stadt, ohne alle Habe und ohne Ausweis?
»Es dürfte Chlorgas gewesen sein«, unterbrach Bouchard meine Gedanken. »Wenn ich sie aufgeschnitten habe, weiß ich mehr, aber davon können wir ausgehen.«
»Chlor?« Ich war mir nicht sicher. Der Geruch war nicht ganz so, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
»Wie sind sie denn gestorben?«, fragte Auban den Arzt. Er hatte nicht im letzten Krieg gedient und besaß das krankhafte Interesse derer, die zu Unrecht glauben, sie hätten etwas verpasst.
»Ganz grässlich, wenn Sie es wirklich wissen wollen. Das Chlor hat mit der Flüssigkeit in ihren Lungen reagiert, sich in Salzsäure verwandelt und sie von innen zerfressen.«
»Oh Gott«, sagte der Sergeant. »Was für ein qualvoller Tod.«
Nun wäre meine Stimme doch beinahe gebrochen. »Ja. Ich hätte nicht gedacht, das noch mal zu sehen. Wir können nur hoffen, dass es wirklich das letzte Mal war.«
»Würden Sie darauf wetten, Eddie?«, fragte Bouchard und richtete sich langsam auf.
2
Ich war allein in einem Strom von Gleisen. Die letzten Flics hatten die vier Leichen zu einem Lastwagen getragen. Auban war gegangen. Bouchard hatte seine Tasche zuschnappen lassen und wartete auf mich.
»Gehen wir zusammen zum Parkplatz?«, fragte er.
»Ich bleibe noch. Wann obduzieren Sie?«
»Morgen.«
»Heute Nachmittag.«
Bouchard nickte und betrachtete die Soldaten ringsum. Sie schienen unruhig zu werden. »Bleiben Sie nicht zu lange, Eddie.«
Ich sah ihm nach, warf dann dem deutschen Offizier einen kurzen Blick zu. Die Sonne stand inzwischen hoch, ein Schweißtropfen lief mir über die Wange. Ich rieb ihn weg, entdeckte einen Rußfleck auf der Fingerkuppe, schaute ein letztes Mal auf den Waggon, der noch immer Spuren des verschütteten Gifts in die Luft abgab, musterte das Depot und ging südlich zum Tor und zu meinem Wagen, wobei mir metallgraue Blicke folgten. Ich hörte einen Gewehrbolzen schnappen, und als ich aufsah, stand ein Soldat neben Hauptmann Weber und schob eine Patrone in den Verschluss. Weber sah mich an, hatte noch immer die gleiche Miene distanzierter Geringschätzung und richtete seine Finger wie eine Pistole auf mich.
Ich hob die Hand zum Gruß. »Nicht, wenn ich dich zuerst erwische«, murmelte ich lächelnd.
Im Auto entgleiste meine Mimik, ich stützte den Kopf in die Hände. Die Gasmaske. Ich schloss kurz die Lider und sah sofort eine Rauchwolke. Langsam tauchte ein Graben aus dem Dunst, und der Lärm von Granaten und Gewehren wurde schnell lauter. Eilends öffnete ich die Augen wieder, und gleich waren Bilder und Geräusche verschwunden. Ich spürte mich am ganzen Körper zittern. Diese Bilder hatte ich über zehn Jahre aus meinem Kopf halten können und geglaubt, sie nie mehr zu sehen.
»Sofern die mich nicht zuerst erwischen.«
Ich vergewisserte mich, außer Sicht der Deutschen zu sein, griff nach der Leiste, die ich hinterm Armaturenbrett angebracht hatte, zog die daran mit einer Klemme befestigte Luger hervor und betrachtete sie. Die Waffe hatte ich einem deutschen Offizier in den Schützengräben vor Verdun abgenommen und bewahrte sie normalerweise in meiner Wohnung auf, als Teil eines überwunden geglaubten Rituals. Noch einmal würde ich es nicht wagen, die Augen zu schließen. Kopfschüttelnd zog ich stattdessen die kleine Manufrance-Pistole aus dem Klemmverschluss gleich daneben. Sie sah aus wie ein Kinderspielzeug, erfüllte aber ihren Zweck. Ich klemmte die Luger wieder hinters Armaturenbrett und schob die Manufrance unters Hemd in den Hosenbund.
»Ich bin Polizist und trage eine Waffe«, sagte ich und dachte dabei an den strahlenden Hohn im Blick des deutschen Offiziers.
Ich fuhr Richtung Fluss und Polizeizentrale. In den leeren Straßen war eine Unwirklichkeit der anderen gewichen. Unser Scheinkrieg war plötzlich real geworden, fühlte sich aber so illusorisch an wie sein Vorgänger. Paris war bald einen Monat lang eine Geisterstadt gewesen und wurde nun heimgesucht vom Getöse schwerer Reifen und Stiefel auf Kopfsteinpflaster. Ich hörte harte, kriegerische Musik durch die Säle der Stadt hallen, als ich über ausgestorbene Alleen und verlassene Boulevards fuhr, an leeren Mietshäusern und verrammelten Läden vorbei, die mir wie Münzen auf den Lidern eines Toten erschienen. Je reicher die Gegend, desto leerer die Straßen. Millionen waren vor der Ankunft der Deutschen aus der Stadt geflohen, zwei Drittel der Bevölkerung. Die Alten und Armen aber hatten sich nicht absetzen können. So wenig wie die Polizisten. Es gab kein Leben, keinen Betrieb. Paris war noch da, aber es war nicht mehr Paris.
Kaum bog ich in eine Hauptstraße, stoppte mich ein deutsches Motorrad mit Beiwagen. Ich griff nach der Pistole im Hosenbund, aber die beiden Soldaten wandten sich von mir ab und sahen einer Blaskapelle zu, die siegreich an einigen französischen Zivilisten vorbeimarschierte, in deren Mienen Furcht und Trotz standen. Ein kleiner Junge schmiegte sich an seine Mutter und wollte nicht hinsehen. Ein älteres Paar weinte lautlos. Die Kapelle zog vorbei, und der Soldat im Seitenwagen winkte mir, weiterzufahren. Unsere Straßen gehörten jetzt den Deutschen; unsere Rolle war es, ihnen Platz zu machen.
Während die Kapelle leiser wurde, bauten zwei deutsche Soldaten, die ihr im feldgrauen Lastwagen gefolgt waren, vor dem Rathaus des Arrondissements einen Lautsprecher auf. Neugierig stieg ich aus, um zu sehen, was vorging, und stand neben einem alten Mann in einem einst weißen, längst kragenlosen Hemd.
Der Lautsprecher erwachte pfeifend zum Leben und teilte uns in akzentlastigem Französisch mit, dass deutsche Truppen Paris besetzt hatten.
»Was ihr nicht sagt«, höhnte der Alte. Er gefiel mir.
Der Metalltrichter ermahnte uns, Ruhe zu bewahren – eine Aufforderung, der unbedingt Folge zu leisten sei.
»Das dürfte reichen«, ergänzte mein Kommentator.
Uns wurde zudem mitgeteilt, das deutsche Oberkommando toleriere keinerlei Feindseligkeit. Aggression oder Sabotage würden mit dem Tod bestraft. Waffen seien abzuliefern, und alle müssten die kommenden achtundvierzig Stunden zu Hause bleiben.
»Nur für den Fall, dass es Ihnen schwerfällt, ruhig zu bleiben.« Der Alte sah mich kopfschüttelnd an und schlurfte davon. Mit seinem Gesicht wie ein alter Armeestiefel wirkte er, als sei er schon bei der Belagerung von Paris durch die Deutschen 1870/71 dabei gewesen.
Ich sah zu, wie die beiden Soldaten den Lautsprecher auf den Lastwagen luden und abfuhren, sicher zum nächsten Rathaus auf ihrer Liste. Die wenigen Menschen, die die Botschaft vernommen hatten, liefen auseinander und gingen – sofern sie bei Verstand waren – nach Hause, um ihre Fensterläden zu schließen und ihre Türen abzusperren.
Ich fuhr zur Zentrale der Kriminalpolizei am Quai des Orfèvres 36, von uns Mitarbeitern nur »die Sechsunddreißig« genannt. Dort wurde mir als Erstes mitgeteilt, ich müsse meine Waffe abgeben.
»Hab ich schon«, sagte ich dem Kommissar und berichtete von den deutschen Soldaten auf den Abstellgleisen. Von der Manufrance im Hosenbund erzählte ich nichts.
Als Zweites bekam ich gesagt, ich müsse meine Uhr eine Stunde vorstellen.
»Wir haben jetzt Berliner Zeit«, teilte Kommissar Dax mir mit.
»Ich nicht.« Meine Uhr ließ ich, wie sie war. Dass die Deutschen uns nun, da sie in Paris standen, vorschrieben, wie spät es bei uns war, verstimmte mich mehr als alles, was ich an diesem Vormittag sonst gesehen hatte. »Die können auf mich warten.«
»Die ganze deutsche Armee soll auf Sie warten?«
»Daran werden die sich gewöhnen. Oder sie stellen meine Zeiger um. Aber dann stelle ich sie einfach wieder zurück.«
Dax hob nur die Schultern. Er war ungemein dünn, hatte von Wein und deftigen Eintöpfen aber einen vorspringenden Bauch, trug eine Hornbrille im hageren Gesicht und zuckte zur Kompensation seiner Einsilbigkeit erstaunlich expressiv die Achseln. Ich berichtete ihm von den vier Leichen, die auf den Abstellgleisen gefunden worden waren.
»Wissen wir, um wen es sich handelt?«, fragte er.
»Noch nicht. Sie hatten keine Papiere dabei, aber ich glaube, es sind Polen. Womöglich Flüchtlinge.«
»Oder Widerstandskämpfer. Vielleicht galt das Gas den Deutschen, und die Behälter sind versehentlich zerbrochen?«
»Kann ich mir nicht vorstellen – ohne gezielte Wucht lassen die sich nicht zerbrechen. Und die Männer hatten keine anderen Waffen dabei. Ich denke, sie wollten einfach raus aus der Stadt, und jemand hat sie aufgehalten.«
»Wir müssen ermitteln, woher das Gas stammt, Eddie. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und tun Sie nichts ohne mein Wissen. Am wenigsten jetzt.«
»Die Deutschen vor Ort – können wir denen die Sache nicht einfach zur Last legen, und fertig?«
Dax verdrehte die Augen und ging in sein Büro zurück. Ich hab's ja gesagt: Er ist ausdrucksstark.
Einen Moment sah ich durchs Fenster des Ermittlerbüros. Ich hätte Lastkähne auf dem Fluss sehen sollen, Autos, die sich drei Stockwerke unter mir aggressiv durch den Verkehr drängeln, Männer und Frauen, die eilig zu Fuß unterwegs sind, Liebende, die sich auf der alten Steinbrücke küssen, Polizisten, die das Gebäude betreten oder verlassen. Stattdessen sah ich nichts. Keine Bewegung, kein Leben. Graue Straßen unter der schwarzen Rauchwolke vom brennenden Öl im Norden der Stadt. Südlich der Seine lag das fünfte Arrondissement, mein Bezirk, ein überstürzt verlassener Filmset, der auf die Rückkehr der Schauspieler wartete. Aber ich konnte hören. Ein Grollen schwerer Fahrzeuge, die noch immer durch die Stadt rollten, sporadischer zwar, aber heftig genug, um die Scheiben zum Klirren zu bringen.
»Richtung Süden«, sagte Tavernier, ein alter Polizist, ausdruckslos. Bis zu diesem Tag hatte er gedacht, er sitze nur noch seine Tage bis zur Rente ab. »Die Deutschen. Viele bleiben hier, aber die meisten durchqueren die Stadt und fahren nach Süden, an die Front.«
Ich nickte nur. Barthe, ein Raubein aus Grenoble mit knolliger Säufernase, mischte sich ins Gespräch. »Einige unserer Jungs sollen bei der Porte d'Orleans durchgekommen sein, um sich zu unserer Armee im Süden durchzuschlagen. Die Boches haben sie nicht erwischt.«
Boches – so hatten wir die Deutschen im letzten Krieg genannt, und das Wort erlebte seit Beginn des neuen Kriegs ein Comeback. Auch das hatte ich nie wieder erleben wollen.
»Gut«, unterbrach Tavernier meine Gedanken. »Heute Morgen habe ich eine französische Einheit auf dem Rückzug durch meine Gegend gesehen. In panischer Flucht. Dabei habe ich bisher nichts Schlechtes über die Deutschen gehört. Aus Polen hört man ganz andere Geschichten.«
»Und aus den Niederlanden. Hoffentlich bleibt es so. Rotterdam haben sie nämlich völlig zerbombt.«
Ich brachte es nicht fertig, mich an dem Gespräch zu beteiligen. Also ging ich runter zu Mayer, dem diensttuenden Sergeanten der Asservatenkammer.
»Ich muss Ihnen was zeigen«, sagte er zu mir.
Er ließ mich kurz warten und weichte ein paar Lumpen in Wasser ein, das er aus einer Glasflasche goss. Ich staunte, dass er den alten Soldatentrick kannte. Um im letzten Krieg gekämpft zu haben, war er zu jung. Er war ein schlanker Elsässer mit feinen Zügen, Anfang dreißig, mit den Händen eines Konzertpianisten und der Psyche eines Terriers, dem man einen Knochen vorenthält. Nicht zum ersten Mal wünschte ich, er wäre ein Ermittlerkollege und Auban würde hier im Keller schmachten. Er gab mir einen Lumpen. Ich wollte ihn nicht sofort benutzen.
»Nachrichten von Ihrer Familie?«, fragte ich.
Wie alle Straßburger waren seine Eltern im September evakuiert worden – zwischen dem Einmarsch der Deutschen in Polen und unserer Kriegserklärung an Berlin. Sie waren zu Mayer nach Paris gezogen, beim Anrücken der Deutschen aber geflohen. Weil Hitler das Elsass als deutsch betrachtete, hatten die Franzosen von dort zu Recht Angst vor dem, was die Besatzer für sie vorgesehen haben mochten. Mayer selbst war geblieben, denn er wollte nicht glauben, dass die Deutschen ihn in Paris herausgreifen würden.
»Sie sind noch immer in Bordeaux. Ich weiß nicht, wohin sie weiterfahren.«
Wir bedeckten Nase und Mund mit den Lumpen, und Mayer führte mich zu einem begehbaren Schrank, auf dessen Regal eine Metallkassette stand. Er nahm sie und öffnete den Deckel. Drinnen waren die Scherben der Behälter, mit deren Gas die vier Männer getötet worden waren.
Er wies auf die Lumpen vor unseren Gesichtern. »Sehr wahrscheinlich sind die Scherben inzwischen harmlos, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.«
Ich auch, sagte ich mit einem Blick, und als ich daran dachte, wie ich mir im Güterwagen die Maske vom Kopf gezerrt hatte, liefen mir Schweißtropfen in die Augen.
»Was fällt Ihnen daran auf?«, fragte Mayer durch den dünnen Stoff.
»Das Gas ist aus Frankreich«, sagte ich überrascht. Auf den Scherben waren mühsam Wortfragmente auszumachen.
»Genau. Phosgen. Aus unseren Beständen vom letzten Krieg.«
Ich schüttelte den Kopf und führte Mayer zurück in den Hauptraum. Nachdem die Tür geschlossen war und wir die Lumpen abgenommen hatten, holte ich tief Luft. Nie hatte Polizistenschweiß in einem schimmeligen Keller so raffiniert gerochen. »Ich denke nicht, dass es Phosgen ist. Es riecht nach verdorbener Ananas, also nach Chlor. Nur dass ich mich an Chlor anders erinnere.«
»Ob Phosgen oder Chlor – das Gas ist über zwanzig Jahre alt. Nach dem Krieg wurde so was nicht mehr hergestellt, und die Armee hat es nicht mehr in Gebrauch. Der Geruch muss sich durch Zersetzungsvorgänge verändert haben.«
»Hat die Armee noch Gasvorräte?«
»Nicht, dass ich wüsste, aber das lässt sich jetzt nicht sagen.«
Ich lachte gequält. »Keine Vorräte, keine Unterlagen, keine Armee. Wer es eingesetzt hat, besaß es also noch als Souvenir aus dem letzten Krieg.«
»Oder er hat es von jemandem gekauft, der ein geheimes Lager davon besitzt. Ich staune, dass es nicht mehr Schaden angerichtet hat. Es hätte sich weiter verteilen sollen.«
»Das mag am Alter liegen. Es hat nicht so gut gewirkt wie kurz nach der Herstellung. Darum war es vermutlich auch kein Phosgen, denn das wirkt zu langsam: Symptome zeigen sich mitunter erst nach zwei Tagen. Wer schnell töten will, nimmt Chlor. Und im Waggon schwebten gelbe Partikel. Die Armee hat Chlor damals nicht mehr verwendet, weil man die gelbe Wolke kommen sah. Phosgen ist farblos.«
Trotz meiner Argumente war ich mir noch nicht sicher. Der Geruch stimmte nicht. Ich schloss kurz die Augen und sah die gelbe Wolke einmal mehr auf unsere Gräben zutreiben, sah die Männer, die reihenweise panisch um ihr Leben fürchteten.
»Warum wurde das Gas in Glasbehältern gelagert?« Mayers Frage holte mich rechtzeitig zurück.
»Die kamen in den Sprengkopf der Granate, zerbrachen beim Aufprall des Geschosses und setzten das Gas frei.«
»Ich dachte, gasbestückte Granaten abzufeuern, verstößt gegen die Haager Landkriegsordnung.«
»Stimmt. Aber das hat niemanden gehindert.«
Mayer schloss die Kassette. »Und jetzt geht das wieder los.«
»Nicht viel.«
Ich war von Mayer in das Zimmer zurückgegangen, das ich mir mit drei weiteren Kriminalbeamten teilte. Sie waren nicht da, also rief ich Auban herein und fragte, was er von den beiden Arbeitern im Bahndepot erfahren hatte. Das war seine Antwort. Nicht viel.
»Haben Sie sich wenigstens ihre Namen geben lassen?«
Er zuckte die Achseln, als hätte er nie eine dümmere Frage gehört.
»Gut, also fahren Sie zurück ins Depot und befragen die beiden. Ich will ihre Aussagen bis heute Nachmittag. Und dann prüfen Sie die Gebäude, von denen man die Abstellgleise überschaut, und sorgen dafür, dass die drei Waggons an Ort und Stelle bleiben, bis wir sie freigeben.«
»Mensch, Giral, das sind vermutlich bloß ein paar Flüchtlinge.«
»Dann sind es eben tote Flüchtlinge. Und es ist unsere Aufgabe, herauszufinden, was passiert ist und wer das getan hat. Sie sind Ermittler – benehmen Sie sich auch wie einer.«
Er warf mir einen Blick zu, der mich einschüchtern sollte, war aber so klug, nichts mehr zu sagen. Ich sah zu, wie er sich langsam vom Türrahmen löste und sich zu gehen anschickte, als unvermittelt ein Durcheinander gedämpfter Stimmen durch das Büro hinter ihm drang.
Ich stand auf, sah eine Gestalt in Paradeuniform am anderen Ende des langen Ermittlerzimmers, folgte Auban und erblickte Roger Langeron, den Polizeipräfekten von Paris. Groß und gebieterisch, mit sauber gestutztem Schnurrbart und runder Brille, musste er nur wenige Sekunden warten, bis es still war und alle Augen sich auf ihn richteten. Ich kam näher und sah, dass sein Gesicht grau war; das grelle Licht über ihm spiegelte sich auf seiner Glatze und warf karge Schatten auf seinen Hals. Dax neben ihm wirkte noch dünner und größer als sonst.
»Ich besuche alle Polizeireviere der Stadt, um unsere Männer zu beruhigen«, teilte Langeron uns mit, »und um Sie über die Entwicklungen zu informieren. Ich habe im Hôtel de Crillon mit General von Studnitz gesprochen, und er hat mich gefragt, ob ich die Ordnung garantieren kann.«
»Ordnung«, sagte eine Stimme.
»Allerdings – Ordnung. Ich habe ihm gesagt, die könne ich garantieren, wenn man mich in Ruhe arbeiten lasse. Er hat mir versichert, solange die Ordnung bewahrt werde, könne ich auf den Schutz seiner Truppen zählen und werde nichts von ihm hören.«
»Solange wir mitspielen, geschieht uns also nichts«, bemerkte ich und konnte nicht anders.
»Genau, Inspektor Giral. Solange wir mitspielen.« Ich sah die Scham in seinem Blick, die auch wir anderen über die Einnahme der Stadt empfanden. »Und ich habe darum gebeten, dass Sie Ihre regulären Schusswaffen zurückbekommen. Auf eine Antwort warte ich noch. In der Zwischenzeit haben wir die Deutschen außerdem gebeten, die achtundvierzigstündige Ausgangssperre aufzuheben, die sie ursprünglich angeordnet haben. Falls sie das tun, gibt es dafür eine nächtliche Ausgangssperre von neun Uhr an.«
Alle im Zimmer ließen die Neuigkeiten auf sich wirken; niemand hatte dazu etwas zu sagen.
»Neun Uhr unserer Zeit? Oder neun Uhr Berliner Zeit?«, fragte ich.
Niemand lachte.
3
Ich starrte auf das verschrammte Holz meines Bürotischs, und schließlich traf mich die enorme Tragweite der neuen Ordnung der Dinge.
Als laste das Gewicht von Paris auf seinen Schultern, so hatte Langeron gewirkt, als er sich verabschiedete, um die undankbare Aufgabe fortzusetzen, die Polizisten der Stadt ruhig zu halten. Mit meinem Gewicht auf den Schultern war Auban kurz danach fluchend zum Bahndepot aufgebrochen.
So war ich allein im Büro und fragte mich, wo in drei Teufels Namen ich eine Untersuchung beginnen sollte, da die Stadt ja besetzt war. Normalerweise hätte ich zu ermitteln versucht, wer die Toten waren, doch das schien plötzlich unmöglich zu sein. Zumal in einer Stadt, aus der Tausende geflohen waren und die Tausende als Flüchtlinge durchquert hatten, erst in Rinnsalen, dann in einer Flut, als die Deutschen durch Belgien und die Niederlande vorstießen und unsere Armee auf dem Weg nach Paris unter sich begruben.
Ich dachte an die Menschen, mit denen ich zu anderer Zeit gesprochen hätte, und betrachtete hilflos das Telefon. Vielleicht hätte ich ein Gespräch zur polnischen Polizei angemeldet, um mich nach Vermissten zu erkundigen. Ich hätte mit jemandem in unserer Armee gesprochen, um die Spur der gestohlenen Gasbehälter zu verfolgen. Und ich hätte die Personalakten aller Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft durchgehen und in den Lebensläufen nach Hinweisen auf ihre Beteiligung suchen können.
Nach Lage der Dinge war all das unmöglich. Und es gab keine Ministerien, an die ich mich wenden konnte. Nicht in Paris. Sie hatten sich allesamt vor Ankunft der Deutschen abgesetzt und vorher noch das letzte Blatt Papier verbrannt. Ich hatte Rauch aus den Innenhöfen steigen sehen, als Bedienstete Rollwagen voller Akten zu den Feuern karrten, damit die Unterlagen nicht den anrückenden Deutschen in die Hände fielen. Die Polizei immerhin war vernünftig genug gewesen, ihre Akten nicht abzufackeln. Wir hatten alles auf einem Lastkahn die Seine hinuntergeschafft. So war es dem Zugriff der Besatzer entzogen. Allerdings hatte nun auch ich keinen Zugriff mehr darauf.
Als mir dämmerte, dass wir womöglich nie erfahren würden, wer die Opfer waren, beschloss ich, zunächst selbst herauszufinden, woher das Gas gekommen war. Falls jemand Giftgas aus dem letzten Krieg verkaufte, würden andere davon wissen. Aber erst würde ich ein letztes Mal zu ermitteln versuchen, wer die vier im Güterwagen gestorbenen Männer waren.
Ich verließ die Sechsunddreißig, nahm mein Auto und sah, dass alles geschlossen hatte: Läden waren verrammelt, Märkte leer, Cafés und Restaurants zugesperrt, die Terrassentische und -stühle im halbdunklen Inneren gestapelt. Am Rathaus hatten die Deutschen die Trikolore schon eingeholt und durch ein riesiges Hakenkreuz ersetzt. Die blutrote Fahne riss eine klaffende Wunde in die Fassade des Gebäudes, die bis in die Fundamente sickerte. Panzerabwehrkanonen waren an jeder Ecke des Platzes postiert, und ein luchsäugiger Feldwebel, der in der Sommerhitze schwitzte, bedeutete mir, Abstand zu halten. Mein Wagen war als einziger unterwegs. Die können Ausgangssperren verhängen und aufheben, so viele sie wollen, dachte ich – niemand bei Verstand geht ausgerechnet heute auf die Straße. Außer mir.
Auf zwei Seiten von Gleisen, auf der dritten von der Seine abgeriegelt, wirkte der Ziegelbau der Gerichtsmedizin noch immer wie ein Gefängnis des neunzehnten Jahrhunderts, aus dem es kein Entrinnen gab. Vor kaum hundert Jahren, als die Leichenhalle noch auf der Île de la Cité gewesen war, hatte es als schick gegolten, die unidentifizierten Leichen anschauen zu kommen, die hinter einem Sichtfenster auf schwarzen Marmorfliesen lagen. Mein erster Gedanke war, wir hätten seither Fortschritte gemacht, doch dann fielen mir das Gas und die Schützengräben und die vier Männer ein, die qualvoll gestorben waren, weil jemand einen Glasbehälter neben ihnen zerbrochen hatte, und ich dachte noch mal nach.
Bouchard war allein im Obduktionssaal. Zwei Tote lagen abgedeckt auf den gefliesten Tischen der Pathologie, er arbeitete an einem dritten, fuhrwerkte in der Brust herum, suchte nach etwas und sah dabei doch aufmerksam in meine Richtung.
»Bin gleich bei Ihnen, Eddie.«
Er zog etwas aus dem Körper und legte es in eine Nierenschale. Das schien ihm zu gefallen. Mit dem rechten Handrücken schob er die Halbbrille höher, rieb sich die Nasenwurzel, richtete sich auf und streckte sich. Seine Augen waren müde.
Ich wies auf den Toten und die beiden, die unter Tüchern lagen. »Wo ist der Vierte?«
»Das sind nicht deine, Eddie. Das ist eine Wasserleiche – die beiden drüben haben sich umgebracht. Frisch reingekommen.«
»Selbstmorde?«
»Haben vermutlich die Niederlage nicht verkraftet. Oder hatten Angst vor dem, was die Deutschen tun würden. Wer weiß? Wir alle haben doch Schauergeschichten gehört.«
»Und wo sind die Männer vom Bahndepot?«
Bouchard unterbrach seine Untersuchung, wusch sich die Hände und wies auf den Kühlraum. »Da durch.«
»Und wo sind die Kollegen? Hier herrscht ja Grabesruhe.« Eigentlich hätten noch zwei Pathologen Dienst haben sollen.
»Fragen Sie mich was Leichteres. Lannes war gestern da, aber heute hat ihn niemand gesehen. Rougvie ist seit fast einem Monat nicht aufgetaucht; er meinte, er wolle Paris verlassen, ehe es plattgemacht wird. Also schnippele ich hier ganz allein arme Seelen auf, die sich die Pulsadern aufgeschnitten oder Gift genommen haben, statt sich dem zu stellen, was die Deutschen für uns in petto haben.«
Er ersparte mir den Anblick der nur mit wenigen Stichen zugenähten Körper und nahm stattdessen seine Notizen. »Wie vermutet, Eddie: Die Lungen sind stark säuregeschädigt, sehr wahrscheinlich durch Chlorgas. Und bei meinen gegenwärtigen Mitteln ist das praktisch alles, was ich Ihnen sagen kann.«
Ich dachte an die Beschränkungen, unter denen ich inzwischen arbeitete, und wusste, dass ich ihn nicht drängen konnte. »Irgendwelche Hinweise auf ihre Identität?«
»Nur das, was Sie in ihren Sachen gefunden haben.«
Ich sah die sauber gestapelte Kleidung auf dem Tisch noch mal durch und stieß erneut auf das Etikett aus Bydgoszcz. Noch immer hatte ich Zweifel. »Sind Sie sicher, dass es Chlor war?«
»Angesichts der Schäden kann ich unmöglich sagen, ob sie ertrunken oder erstickt sind. Diese Frage kann Ihnen niemand beantworten, aber ich schätze, es war Chlor.« Er legte seine Notizen weg. »Und hier kann niemand untersuchen, um welche Substanzen es sich genau gehandelt hat.«
Als wir in den Obduktionssaal zurückkehrten, knallte eine Tür. Zwei Träger waren mit einer Bahre gekommen und setzten sie auf den Fliesentisch neben der Tür.
»Anscheinend noch ein Selbstmord, Doktor Bouchard«, sagte einer von ihnen. »Sie wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Zehntes Arrondissement.«
Bouchard sah erst mich an, dann die Decke. Nicht minder frustriert als er, ließ ich ihn in einsamer Bestürzung in seinem Obduktionssaal zurück.
»Sie fahren noch mal los«, sagte Dax, als ich in die Sechsunddreißig zurückkam.
»Ach ja?«
»Südlich der Seine wurde ein Toter auf der Straße gefunden. Die Schutzpolizei ist verständigt, aber ich will, dass die Kripo sich ansieht, was da los ist.«
»Warum erzählen Sie das mir? Ich habe die vier Leichen im Depot. Und nur Auban als Hilfe. Schicken Sie einen anderen.«
Mit müder Geste wies Dax auf das Büro hinter mir. Auban war zurück, und auch zwei, drei andere waren da, aber sonst war das Zimmer leer. Unsere Zahl hatte etwas abgenommen, weil einige der jüngsten Polizisten zur Reserve eingezogen worden waren, doch es hätten mehr von uns im Haus sein müssen. »Sehen Sie sich das an, Eddie. Wäre schön, wenn die alle Außendienst schieben würden, aber wollen Sie darauf wetten? Ich möchte, dass Sie das erledigen. Sie sind offenbar der Einzige, der diese Aufgabe heute übernehmen kann. Nehmen Sie Auban mit.«
»Nein, Kommissar, schicken Sie jemand anderen.«
Seine Stimme wurde streng, und er warf mir den Blick zu, an den ich mich über die Jahre hatte gewöhnen müssen. »Ich muss Sie nicht noch mal bitten, Eddie, oder?«
Er wandte sich ab, und das war's. Ich sagte Auban, er solle seine Sachen nehmen und mitkommen. Darüber wirkte er so erfreut wie ich.
»Was haben Sie von den beiden Bahnarbeitern erfahren?«, fragte ich ihn unterwegs.
»Nichts. Die haben nichts gesehen, nichts gehört. Nur vier Leichen in einem Waggon und jede Menge deutsche Soldaten. Zeitverschwendung.«
Ich war zu müde, um zu widersprechen, und fuhr wortlos weiter. Auf der sonst belebten Rue des Écoles mussten wir warten, weil eine ältere Frau mitten auf der Straße lockend nach einer Schildpattkatze schnippte. Außer den beiden und uns war dort niemand unterwegs. An einer stillen Kreuzung sahen wir vier alte Männer stumm auf einer Bank vor einem geschlossenen Café sitzen und auf einer umgedrehten Kiste trotzig Karten spielen.
Nur in der Rue Mouffetard sahen wir weitere Geschöpfe, teils tot, teils lebendig. Zwei Streifenpolizisten bewachten nervös eine Gestalt nahe dem Rinnstein und waren deutlich erpicht darauf, von der Straße zu kommen, um nicht deutschen Truppen zu begegnen. Über die Gestalt war eine graue, von frischem Blut dunkle Decke gebreitet. Eine breite rote Spur floss über die Straße und endete als Rinnsal an einem Gully. Auch auf dem Gehsteig waren Blutspritzer. Alle Fenster, von denen aus sich die Szene betrachten ließ, waren mit Läden verschlossen. Die Concierge ging leise jammernd vor der Haustür auf und ab. Einer der beiden Polizisten erzählte mir, sie sei für das Gebäude verantwortlich, in dem der Tote gelebt habe.
»Sie sagt, er hat ganz oben gewohnt.« Er wies auf einen Balkon. »Von dort ist er gesprungen. Ansonsten hat sie nur gebrabbelt.«
»Sprechen Sie mit ihr«, sagte ich zu Auban. »Finden Sie wenigstens bei ihr heraus, was sie weiß.«
Ich beobachtete, wie er auf sie zuschlenderte. Ihr linker Fuß steckte in einem schweren schwarzen Stiefel mit orthopädischer Sohle; ihr schütteres weißes Haar stand wie elektrisiert auf einem schmalen Schädel. Paris war eine Stadt der Älteren und Verzweifelten. Unterlegt war das alles vom Krach der Deutschen in den Straßen ringsum, als würden in einiger Entfernung immerfort Gewehre geladen.
Ich wandte mich wieder dem Toten zu, holte tief Luft, hob die Decke an und sah das friedliche Gesicht eines Mannes von Mitte dreißig. Oder doch ein halbes friedliches Gesicht. Er lag auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gewandt. Sein Profil war heil und gefasst. Darunter aber sah man, wie der Aufprall seinen Schädel zerschmettert, seinen Leib zerrissen und die Hälfte seiner Gestalt ins Kopfsteinpflaster gepresst hatte. Ein Selbstmord mehr, mit dem die Stadt leben musste. Ich schlug die Decke weiter zurück. Ein Bein war unnatürlich verdreht, und beide Arme steckten unter dem Oberkörper. Am meisten aber sprang mir sein dicker grauer Mantel ins Auge. Ein seltsames Schlussritual, überlegte ich. Der Tag war viel zu heiß und zehrend für dieses Kleidungsstück. Warum mochte er vor seinem Selbstmord einen Mantel übergezogen haben? Ich fragte den einen Schutzpolizisten, ob die Gerichtsmedizin informiert sei.
»Die haben gesagt, sie sind unterwegs, Inspektor.«
Ich dankte und zog die kratzige Decke wieder über den Toten. Überall waren Sachen verstreut, die Menschen auf der Flucht vor den Deutschen fahren gelassen oder weggeworfen hatten, um nur rasch wegzukommen. So war es überall in der Stadt. Auf dem Gehweg lagen ein zerbrochener Nachttopf, eine staubige, verdreckte Tischdecke und ein Kinderteddy mit angenagtem Ohr, der Blutspritzer des Toten abbekommen hatte. Ich musste den Blick von ihm losreißen. Als ich stattdessen zu Auban schaute, der mit der Concierge sprach, reagierte er plötzlich überrascht. Und rief mich dann so dringlich, wie ich es nie bei ihm erlebt hatte.
»Wo ist der kleine Jan?«, jammerte die Concierge immer wieder.
»Heißt er Jan?«, fragte ich. Auban schüttelte energisch den Kopf.
»Sie sagt, er hatte einen kleinen Sohn. Das ist Jan.«
Ruckartig sah ich zum Balkon hinauf und rief dann den Flics zu: »Schnell hoch in seine Wohnung! Da ist ein kleiner Junge. Kümmern Sie sich um ihn.«
Die Concierge jammerte weiter. »Da oben ist er nicht. Ich hab schon nachgesehen. Der kleine Jan ist nirgends.«
Ich betrachtete wieder die Gestalt unter der Decke und schloss kurz die Augen. »Der Mantel.«
Als ich zur Leiche rannte, hielt Bouchard und stieg aus. Ich kümmerte mich nicht um ihn und rief den Polizisten zu: »Nein, suchen Sie die Straße ab!« Vor Staunen reagierten sie nicht, aber es gab auch nichts zu suchen. Ganz langsam machte ich die letzten Schritte auf den Toten zu. Bouchard erreichte ihn im selben Moment wie ich.
»Was ist, Eddie?«
»Wir müssen unter dem Toten nachsehen.«
»Erst muss ich ihn untersuchen.«
»Glauben Sie mir: Wir müssen darunter nachsehen.«
Ich zog an der Decke, aber Bouchard übernahm, hob sie ab und drehte die Leiche vorsichtig auf die Seite.
»Großer Gott«, rief er.
Ich schloss die Augen ein zweites Mal und öffnete sie langsam wieder.
Unter dem Mann, umhüllt von dem schweren Mantel, lag sein kleiner Sohn, zerquetscht zwischen der Umarmung des Vaters und dem Kopfsteinpflaster der leeren Straße.
4
»Ich kannte ihn kaum«, sagte Madame Benoit, die Concierge, ein ausgefranstes Taschentuch fest umklammert. »Er war Pole, Flüchtling. Seit November hier. Blieb für sich, zahlte seine Miete, das war's. Ein anständiger Mann, denke ich, aber immer sehr traurig.«
Noch ein Flüchtling aus Polen? »Und wie hieß er?«
Wir saßen allein an einem Tisch ihrer kleinen Wohnung am Ende eines dunklen Korridors im Erdgeschoss. Auban und die Schutzpolizisten hatte ich wieder zur Sechsunddreißig geschickt, und Bouchard war gefahren, kaum dass die Leichen abtransportiert waren. Das Leben der alten Concierge spielte sich in diesem Zimmer ab, zwischen Tisch, ausgeblichenem Sofa und Erinnerungen an lang vergangene Zeiten. Zwei Türen führten, wie ich annahm, ins Schlafzimmer und ins Bad.
»Fryderyk. Den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Sein Sohn heißt Jan. Ich weiß, dass seine Frau in Polen getötet wurde und er mit ihm davongekommen ist – das ist alles. Er hat den Kleinen abgöttisch geliebt, aber der hat kein Wort gesagt. Und ist seinem Vater keinen Moment von der Seite gewichen. Meist waren sie zu seltsamen Tageszeiten unterwegs. Fryderyk hatte Arbeit und wollte den Jungen wohl nicht allein lassen. Und er war sehr bestürzt über die Nachricht, dass die Deutschen auf Paris vorrücken.«
Das konnte ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich hatte er sich deshalb umgebracht. Aus Kummer über den Tod seiner Frau und weil er keine zweite deutsche Invasion ertragen konnte. Wie alle hatte ich die Gerüchte darüber gehört, was die Nazis in Polen getan hatten, aber wie die meisten wusste ich wenig. Und ich zweifelte, wie viel ich der Propaganda beider Seiten glauben sollte. Er aber hatte das vermutlich gewusst. Ich suchte mir vorzustellen, wie verzweifelt er gewesen sein musste, um sich mit seinem kleinen Sohn im Arm vom Balkon zu stürzen, und unwillkürlich stieß ich einen langen, traurigen Seufzer aus. Noch ein Selbstmord an einem Tag voller Verzweiflung.
»Ich muss mich noch in seiner Wohnung umsehen«, sagte ich zu Madame Benoit.
Sie stieg mit mir bis unters Dach, wollte aber nicht über die Schwelle treten. Im Vergleich zu dieser Wohnung war meine der Spiegelsaal von Versailles. Zwei nicht zueinander passende Stühle an einem Küchentisch, ein Gaskocher und ein Schrank teilten sich das Zimmer mit zwei Sesseln und einem Radio. Nichts zeugte vom leichten Leben Paris flutender Flüchtlinge, das einige Rechte uns einreden wollten. Eine Glastür führte auf den kleinen Balkon mit seinem kunstvollen Eisengeländer. Ich stand auf dem schmalen Vorsprung, beugte mich vor und versuchte mir Fryderyks letzte Gedanken vor seinem Schritt ins Leere vorzustellen, mit dem in der Wärme des Mantels an ihn gekuschelten kleinen Sohn, der nicht wusste, was sein Vater vorhatte, sondern darauf baute, er werde ihn beschützen. Ich musste diese Gedanken abschütteln und wieder reingehen.
Ich durchsuchte das Wohnzimmer, fand aber nichts, keine persönliche Habe, keinen Abschiedsbrief. Im Küchenbereich waren nur zwei Becher, zwei Teller und zweimal Besteck; eine dritte Garnitur war nicht nötig. In einem schrecklichen Moment der Klarheit begriff ich, warum er es getan hatte. Im winzigen Bad lagen Rasierpinsel, Rasiermesser und ein Stück Seife. Pinsel und Messer waren von guter Qualität, die Seife dagegen war billiges Zeug vom Markt. Wie mochte das Leben dieses Mannes gewesen sein, ehe er Flüchtling geworden war? Nicht so hart wie später, das stand fest.
So traurig mich die beiden Toten machten, war mir doch klar, dass wir kaum etwas tun konnten. Normalerweise untersuchten wir Selbstmorde immer, aber die Zeit war alles andere als normal, und ich ahnte, dass der Tod von Fryderyk und Jan ohne Ermittlungen bleiben würde. Von draußen warf ich einen flüchtigen Blick ins Schlafzimmer und sah nur ein Bett mit dünner Tagesdecke, einen kleinen Nachttisch, einen alten Schrank. Als ich die Tür weiter aufdrückte, stieß sie gegen etwas.
Gegen einen Tresor, einen alten, muffigen Safe aus Gusseisen auf vier kleinen, soliden Rädern, der hinter der Tür kauerte wie eine schlammverkrustete Kröte. Ein bleicher Griff hing wie eine träge Zunge vom rostigen Einstellrad auf der abblätternden Farbe der Tür. Einen Moment lang musterte ich den Tresor, verglich ihn mit der spartanischen Tristesse der übrigen Wohnung. Er war ganz und gar fehl am Platz.
»Gehört der Tresor zum Mobiliar oder hat Fryderyk ihn mitgebracht?«, fragte ich Madame Benoit.
Sie bekreuzigte sich, bevor sie über die Schwelle trat. »Weder noch. Er hat ihn bald nach seinem Einzug gekauft. Mein Mann musste ihn mit hochschleppen, obwohl er wirklich nicht mehr jung ist.«
»Die Kombination kennen Sie vermutlich nicht?«
Richtig vermutet. Ich zog am Griff, aber der Tresor war verschlossen. Trotz des Rosts war er so robust, mir keinen Zugriff zu gewähren. Auf der Suche nach einem Zettel mit der Kombination öffnete ich den Nachttisch. In der Schublade lag nur ein Gegenstand. Ich setzte mich aufs Bett und schaute ihn mir an.
Ein polnischer Pass mit den Fotos von Fryderyk und Jan.
»Gorecki«, sagte ich. Der Nachname, den Madame Benoit nicht aussprechen konnte.
Ich sah vom Ausweis zum Tresor hinter der Tür. Dreierlei fiel mir auf.
Erstens: Wozu brauchte ein Flüchtling, der kaum mehr als zwei Tassen und einen alten Rasierpinsel besaß, einen Tresor?
Zweitens: Für einen Flüchtling hätte sein Ausweis so wertvoll sein sollen wie ein Barren Gold. Was also mochte für Fryderyk kostbarer gewesen sein als sein Pass, sodass er einen Tresor gekauft hatte, um es aufzubewahren?
Drittens die Worte im Pass: Ich verstand kaum, worum es ging, doch wie mindestens einer der vier Toten vom Depot kam auch Fryderyk aus einer polnischen Stadt namens Bydgoszcz.
Als ich in die Sechsunddreißig zurückkehrte, erwartete mich ein Geschenk. Meine Waffe. Sie lag auf Dax' Schreibtisch.
»Vorhin kam eine neue Anweisung«, sagte er. »Langeron hat den Deutschen abgerungen, dass wir bewaffnet sind, wenn wir Ordnung wahren sollen. Und sie haben die Waffen selbst zurückgebracht. Alles unterschrieben und erfasst.«
Das mit den Unterschriften und der Erfassung gefiel mir nicht. Er bedeutete mir, meine Pistole zu nehmen. Ich schob sie in den Hosenbund, ohne die dort verborgene Manufrance sehen zu lassen. Hoffentlich würde die Hose nicht sacken.
»Und die zweitägige Ausgangssperre wurde aufgehoben – zugunsten einer nächtlichen Sperrstunde ab neun.«
»Ab acht.«
»Wie du meinst, Eddie. Für die Polizei gilt sie sowieso nicht, also keine Sorge.«
Ich verließ sein Büro, legte Fryderyk Goreckis Pass in meine Schreibtischschublade und machte Feierabend. Ermitteln konnte ich kaum etwas, zumindest aber nach Angehörigen suchen, um sie zu informieren.
Über eine leere Brücke und durch ausgestorbene Straßen fuhr ich den kurzen Weg nach Hause. Offenbar hatte niemand bekannt gegeben, dass die Ausgangssperre bis zum Abend ausgesetzt war. Ich sah auf meine Uhr. Bis neun war es noch eine Stunde – oder zwei, wenn man Pariser Zeit nahm. Vor dem Haus tat ich die Manufrance in ihr Versteck zurück, starrte aufs Armaturenbrett, um mich zum Aussteigen aufzuraffen, gab aber schließlich nach, griff wieder unter die Armaturen, zog die Luger heraus und schob sie in meine Tasche.
»Hoffentlich bereust du es diesmal nicht«, sagte ich zu mir.
Oben in der Wohnung strich ich den Käse von letzter Woche auf das Brot vom Vortag und setzte mich zum Essen an den Küchentisch. Nach dem Besuch in Fryderyks winziger Bleibe erschien mir mein Zuhause ausnahmsweise wie ein Palast – und für wenige, seltene Momente sogar als Zuflucht.
Ich stellte den Teller in die Spüle, ging ins Wohnzimmer, nahm eine alte Blechkiste von den überladenen Bücherregalen links und rechts des Ofens und setzte mich in einen der beiden Sessel. Die Kiste hatte ich seit über zehn Jahren nicht geöffnet und fand darin, was ich suchte: die mit den Jahren angelaufene Patrone einer Luger. Ich rollte sie zwischen den Fingern, bis ich die schwache Delle entdeckte. Unfroh stellte ich fest, dass die Patrone noch die gleiche Macht über mich hatte wie früher. Vorsichtig platzierte ich sie auf den niedrigen Tisch zwischen Sessel und Kamin und legte die Luger daneben. Kaum betrachtete ich beide zusammen, fiel mir das Ritual wieder ein, und ich wusste sofort, dass ich die Wohnung verlassen musste.
Ziellos ging ich durch die Straßen. Die Ausgangssperre der Deutschen rückte näher, aber für Kontrollen hatte ich meinen Polizeiausweis. Mir war ohnehin nicht danach, mich nach ihrer Zeit zu richten. Der schwarze Rauch der letzten Tage hing weiter in der Luft, und an diesem warmen Abend roch ich den Ruß im Dunst, spürte das Öl in der Nase. Eine Tür in meiner Erinnerung, von der ich gehofft hatte, sie sei für immer verschlossen, hatte sich einen winzigen Spalt weit geöffnet und eine dunklere Wahrheit preisgegeben. Mit der Gasmaske am Morgen hatte es begonnen, mit den links und rechts aufgereihten deutschen Soldaten, mit dem Anblick der Luger im Wagen und der Patrone zwischen meinen Fingern. Jetzt ging es weiter mit Gedanken an Jan, der geglaubt hatte, sein Vater werde ihn immer beschützen, und an Fryderyk, der geglaubt hatte, das nicht mehr zu können, und keine andere Möglichkeit als den Selbstmord gesehen hatte.
Als ich in der Dämmerung über den Place Edmond Rostand schlenderte, der an warmen Freitagabenden sonst voller Leute war, dachte ich an die Leichentücher auf Bouchards Untersuchungstischen und an die Handvoll Menschen in Paris, die heute auch keine Alternative gesehen hatten. Fryderyks Tat war nur eine mehr an einem Tag, der so viele Selbstmorde gezeitigt hatte, dass sie hier im Ausland bald vergessen wäre. Ich hätte gern gefragt, was sie alle zu ihrem Tun getrieben hatte. Aber das konnte ich nicht. Ich wusste es. Wieder spürte ich das raue Metall der Luger-Patrone, roch den beißenden, penetranten Geruch. Beim Gehen schloss ich die Augen, doch was auf den belebten Straßen der Stadt zu jeder anderen Zeit ein planloser Selbstmordversuch gewesen wäre, war heute eine sinnlose und einsame Geste – nicht meine erste.
Quietschende Bremsen ließen mich stehen bleiben, und als ich die Augen öffnete, sah ich eine deutsche Patrouille. Vier Soldaten im Geländewagen musterten mich misstrauisch und brachten mich in eine andere Realität zurück.
»Freut mich sehr, Sie zu sehen«, sagte ich zu einem nervösen Gefreiten, dessen übergroße Feldmütze ihm auf die abstehenden Ohren drückte. Ich lächelte sogar. Seine drei Kameraden blieben im Auto, dessen Motor dumpf weiterbrummte.
»Papiere«, befahl er mir mit Akzent. »Es ist nach neun. Sie dürfen um diese Zeit nicht außer Haus sein.«
»Oh doch.« Ich zog meinen Ausweis aus der Tasche und zeigte ihn. »Polizei. Keine Ausgangssperre.«
Zweifelnd begutachtete er den Ausweis und zeigte ihn einem bulligen Feldwebel, der es sich – Gewehr lässig im Schoß – auf der Rückbank bequem gemacht hatte. Der Unteroffizier nickte nur, und der Gefreite gab mir den Ausweis zurück.
»In Ordnung, Monsieur.« Seltsam höflich verbeugte der junge Mann sich knapp. »Bitte setzen Sie Ihren Weg fort.«
Er lächelte zaghaft und kehrte zum Geländewagen zurück, der losjagte, kaum dass er eingestiegen war.
»Das habe ich vor«, versicherte ich der abziehenden Abgaswolke.