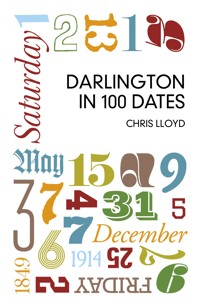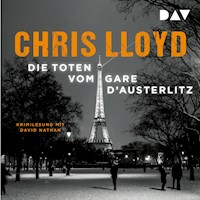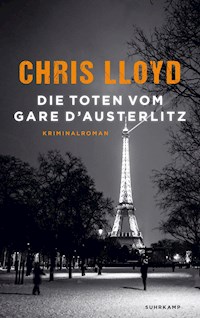15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eddie Giral
- Sprache: Deutsch
Paris, September 1940. Nach drei Monaten unter Nazi-Besatzung kann Inspecteur Eddie Giral eigentlich nicht mehr viel schocken. Denkt er zumindest, bis er auf ein Mordopfer trifft, das eigentlich im Gefängnis sitzen sollte. Giral weiß das deswegen so genau, weil er ihn erst kürzlich selbst eingebuchtet hat …
Dieser Tote ist weder der erste noch der letzte Kriminelle, der aus dem Gefängnis und auf die Straße gelassen wird. Aber wer zieht die Fäden, und warum? Diese Fragen führen Giral von Jazzclubs zu Opernsälen, von alten Flammen zu neuen Freunden, von den Lichtern von Paris zu den dunkelsten Landstrichen und zu der höchst beunruhigenden Erkenntnis, dass man, um das Richtige zu tun, sich manchmal auf die falsche Seite schlagen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Chris Lloyd
Paris Requiem
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Stefan Lux
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5373.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen AusgabeSuhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© 2023 by Chris Lloyd
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: pxhidalgo/Depositphotos (Eiffelturm); CPA Media Pte Ltd/Alamy Stock Photos/mauritius images (Flugzeuge)
eISBN 978-3-518-77772-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meine Mum und meinen Dad, Averil und Mervyn Lloyd.
Motto
»Die Hölle ist leer
Und all die Teufel sind hier.«
William Shakespeare, Der Sturm
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
November 1940
Ouvertüre September 1940
1
2
3
4
5
6
7
8
Akt 1 Oktober 1940
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Akt 2 November 1940
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Anmerkungen des Autors
Danksagungen
Informationen zum Buch
Paris Requiem
November 1940
Ständig diese Eulen.
Als hätte es nicht gereicht, endlose Kilometer durch den dunklen Wald zu fahren, die Scheinwerfer bis auf einen schmalen Schlitz abgedunkelt. Nein, ständig tauchte so ein mieses kleines Exemplar der Strigiformes auf und erinnerte einen daran, dass man nichts Gutes im Schilde führte. Ganz abgesehen davon krochen deutsche Soldaten durch die Wälder, die den Standpunkt der Eulen offensichtlich teilten.
Ich stieg aus dem Wagen, das Echo des Schreis verhallte in der Nacht. Auch der Nachhall in meinen Eingeweiden klang ab. Ich lauschte konzentriert und wartete, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. In dem Moment, wo ich die Scheinwerfer des Wagens ausgeschaltet hatte, hatte die Schwärze vom einen auf den anderen Moment die Regie übernommen und alles ausgefüllt. Das hier war nicht einfach Dunkelheit, es war die völlige Abwesenheit von Licht. Ich lebe in Paris unter den Nazis, glauben Sie mir, ich kenne den Unterschied.
Kaum hatte ich mich vergewissert, dass mein Magen wieder an Ort und Stelle war, rief die Eule schon wieder. Ein gequälter Laut, der die finstere Stille der Nacht durchbrach. Ich habe mit angehört, wie Pariser Zuhälter von Rivalen abgestochen wurden und weniger Theater gemacht haben.
Während ich die Tür leise schloss, ließ mich ein anderes Geräusch innehalten. Ein Hund bellte. Irgendwo weit weg. Keine Ahnung, ob er einem Bauern oder einem Soldaten gehörte. Ich lauschte, aber das Tier gab Ruhe. Ich wünschte nur, die Eule würde sich ein Vorbild nehmen. Auch andere Tiere machten sich bemerkbar, nicht durch Laute, sondern durch Gerüche, die aus wechselnden Richtungen mit der Brise heranwehten. Der Gestank von Mist kitzelte in meiner Nase. Unwillkürlich drehte ich den Kopf, um ihn loszuwerden, so als wollte ich ein Niesen unterdrücken, aber es half nichts. Schweine. Was jemanden dazu bewegen konnte, in dieser Wildnis zu wohnen, war mir unbegreiflich. Ich hatte zu lange im Lärm und Ruß von Paris gelebt, um dem Mist und der Unwirtlichkeit hier draußen etwas abgewinnen zu können.
Ich tastete mich zum Heck des Citroëns und öffnete ungeschickt den Kofferraum. Ein anderer, weniger intensiver Gestank schlug mir entgegen und ließ mich zurückzucken. Kurz wandte ich das Gesicht ab, dann atmete ich tief durch und beugte mich hinein. Als meine Hand eine Decke berührte, zog ich sie schnell zurück. Ich hatte gespürt, wie das, was sich darunter verbarg, nachgab, und unterdrückte ein Würgen. Behutsamer nahm ich einen zweiten Anlauf, streckte die Hände wieder aus, schob die schwere Masse unter der Decke ein wenig zur Seite und fand, wonach ich suchte. Als ich das raue Holz des Griffs berührte, nahm ich den Spaten ganz vorsichtig heraus, um nicht gegen die Seite des Wagens zu stoßen und verräterischen Lärm zu machen.
Aus demselben Grund ließ ich den Kofferraum offen, legte mir den Spaten über die Schulter und drehte mich um. Aus den Augenwinkeln versuchte ich, den Waldrand im Blick zu behalten. Das erneute Bellen eines Hundes im Ohr und die beißend kalte Luft in der Nase, ließ ich die Sicherheit des Autos hinter mir und tastete mich ins Dunkle vor.
Wieder rief die Eule.
Ouvertüre September 1940
1
»Ich wäre nur zu gern unten im Süden geblieben.« Boniface legte eine Pause ein und nahm einen winzigen Schluck von seinem Kaffee. »Aber meine Alte wollte rechtzeitig zum Schulbeginn der drei Mädchen zurück nach Paris.«
Die anderen Polizisten im Bon Asile nickten, als hätte Boniface die selbstverständlichste Sache der Welt geäußert. Durch das tabakbraune Fenster des Cafés sah ich einen langsam vorbeifahrenden deutschen Kübelwagen. Paris war von den Nazis besetzt, aber Boniface sorgte sich, dass seine Kinder den Beginn des Schuljahrs verpassen könnten. Er war nicht der Einzige. Hinter den deutschen Soldaten sah ich zwei kleine Jungen zum Unterricht bummeln, als wäre dies ein x-beliebiger September.
»Außerdem hat sie die Geschäfte vermisst«, fügte er hinzu. »Nicht dass es viel zu kaufen gäbe.«
Seine Stimme erinnerte an eine Venusfliegenfalle. Sirupsüß hinter scharfen Zähnen, ein nektargefüllter Hohlraum. Wie bei einer fleischfressenden Pflanze war auch bei Boniface die äußere Form entscheidend, die Substanz bloß eine überzuckerte Falle. Einige der jüngeren Kollegen auf ihren vom Zigarettenrauch fleckigen Stühlen saugten jedes einzelne Wort von ihm auf. Andere schenkten ihm weniger Aufmerksamkeit, ich überhaupt keine.
Ich gab mir keine Mühe, ein Gähnen zu unterdrücken, faltete meine Zeitung zusammen und brachte meine Kaffeetasse zum Tresen. Das Bon Asile – der Name war schon in besseren Zeiten Etikettenschwindel gewesen – war ein schäbiger Tempel zu Ehren des Zigarettenqualms. Es lag in einer der schmalen Straßen der Île de la Cité, hinter der Sechsunddreißig, wie wir das Polizeirevier am Quai des Orfèvres bezeichneten.
»Kaffee«, sagte ich mit leiser Stimme zu Louis und stellte meine fast volle Tasse unsanft auf den Tresen. »Nicht dieses Ersatzzeug.«
Hinter dem Tresen zuckte Louis theatralisch die Achseln. »Rationierung, Eddie. Ich bekomme nichts Anständiges.«
Ich warf einen kurzen Blick zum Tisch, an dem die anderen Flics gebannt Boniface und seinen Geschichten lauschten. Dann deutete ich auf den Schrank am Ende des Tresens und sagte leise: »Richtigen Café, Louis. Sonst sage ich deiner Frau, was du in dem anderen Schrank aufbewahrst.«
Er wurde bleich und machte mir einen neuen Kaffee. Schon beim Geruch geriet ich in Verzückung.
Als ich zurück an den Tisch kam, hielt Boniface immer noch Hof. »Ich versteh nicht, warum Sie je aus dem Süden weggezogen sind, Giral«, sagte er zu mir, als ich mich setzte. »Ich fand die Puppen dort sehr entgegenkommend.«
»Die müssen am Boden zerstört gewesen sein, als Sie abgehauen sind.« Ich trank einen Schluck von dem starken Kaffee und vergaß für einen Moment, wo ich war.
»Warum sind Sie nicht dageblieben, Boniface?«, fragte einer der Flics interessiert. »Das hätte ich an Ihrer Stelle gemacht.«
»Die Versuchung war groß«, erklärte Boniface. »Mann, und wie groß sie war. Schön in der Sonne liegen und Paris mitsamt den Boches euch überlassen. Aber wie gesagt, meine Alte wollte zurück. Die Kinder, ihr wisst schon, die Schule.«
»Welche Alte?«, fragte der Kollege und löste schallendes Gelächter aus. Die leichtgläubigeren Kollegen liebten Bonifaces Angebereien über die Frau und die Geliebte, die er in der Stadt angeblich hatte, beide mit von ihm gezeugten Kindern.
Wieder griff ich zur Zeitung. Wenigstens wollte ich mir aussuchen, wessen Lügen ich mir zu Gemüte führte. Bonifaces Stimme wurde zum Hintergrundgeräusch, als solche war sie beinahe beruhigend. Er besaß auch die Angewohnheit, jede kleinste Äußerung mit einem verschwörerischen Zwinkern zu unterstreichen. Seine brillantineglänzenden Haare mit der kleinen Locke über dem rechten Ohr deuteten darauf hin, dass er sich für eine Art Maurice Chevalier hielt. Ich sah ihn eher als schwachen Abklatsch von Madame Pompadour.
»Ich bin überrascht, dass man Sie zurückgenommen hat«, bemerkte Barthe, einer der älteren Kollegen, und stürzte seinen Frühstückbrandy hinunter.
Boniface lachte. »Commissaire Dax konnte es gar nicht erwarten, mich wieder an Bord zu haben. Ein Schuss Männlichkeit für diesen Laden. Dax weiß, dass so etwas nicht schaden kann.«
»Außerdem sind wir hoffnungslos unterbesetzt, wegen dem Krieg und allem«, bemerkte ich, ohne den Blick von der Zeitung zu heben.
»Aber Sie sind ja auch noch da, Eddie. Sie gehören praktisch zum Mobiliar.« Ich nahm die Überraschung und den Unmut in seiner Stimme wahr.
Ich blickte auf. Seine triumphierende Miene fiel in sich zusammen, als er merkte, dass die anderen verlegen die Blicke abwandten.
»Inspecteur Giral.« Eine neue Stimme brach das Schweigen.
Ich drehte mich um und sah, dass ein junger Kollege in Uniform das Café betreten hatte. Die Uniformierten machten normalerweise einen Bogen um das Lokal und überließen es den Ermittlern.
»Was gibt's?«
»Commissaire Dax will Sie sprechen. Er sagt, es ist dringend.«
Ich erhob mich vom Stuhl und baute mich vor dem jungen Mann auf, der sofort erbleichte. »Wo waren Sie vor zehn Minuten, als ich Sie gebraucht hätte?«
»Sie haben's falsch angepackt, Eddie«, sagte Boniface. »Sie hätten zurück in den wilden Süden gehen sollen, als es noch möglich war. Mit den anderen Ziegenfressern die Beine hochlegen. In Paris hätte Sie keiner vermisst.«
Ich beugte mich hinunter und tätschelte ihm kräftig die Wange. Alle am Tisch mühten sich nach Kräften, uns nicht anzusehen. Boniface wirkte immer überraschter.
»Vielleicht haben Sie die Deutschen in der Stadt bemerkt«, sagte ich und starrte ihm direkt in die Augen. »Die sind nicht das Einzige, was sich hier verändert hat.«
»Warum setzen Sie sich nicht?«, begrüßte mich Commissaire Dax.
Das hatte ich schon getan. Ich lehnte mich auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch zurück und zuckte die Achseln. Draußen vor dem Fenster schaffte der Septemberhimmel es nicht, die Morgenluft zu erwärmen. Leblos hing er über den von Uniformen und Resignation ergrauten Straßen. Trotzdem war es im Zimmer stickig, eine Fliege schlug immer wieder gegen die Fensterscheibe. Ich wusste, wie sie sich fühlte.
Dax holte aus einem Schrank zwei Gläser und eine Flasche Whisky. Dann schenkte er uns beiden ein Schlückchen ein. Ich sah auf die Uhr. In diesen Zeiten schien Barthe nicht der Einzige zu sein, der die Arbeit mit einem Aperitif einläutete. Dax ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen, wobei die Luft mit einem Furzgeräusch aus dem Kissen entwich. Er war so schmal wie eh und je, seine strenge Hornbrille wackelte auf dem schmalen Nasenrücken, aber seine Ernährungsweise schlug sich in einem zusehends wachsenden Bauch nieder. Ich fragte mich, woher er die Lebensmittel bekam, um sich diese Wampe anzufressen. Und den Whisky. Er schien meine Gedanken zu erraten.
»Major Hochstetter«, erklärte er und schwenkte die Flasche.
Hochstetter war der Offizier der Deutschen Abwehr, dessen Job darin bestand, mir das Leben schwer zu machen. Ich hatte ihn jetzt mehrere Wochen nicht gesehen, trotzdem verletzte es mich, nicht auf der Liste für Gratis-Whisky zu stehen.
Dax stieß mit dem Glas gegen meins, das noch zwischen uns auf dem Schreibtisch stand, und trank. Er wirkte erschöpft. Das taten wir alle. Dafür sorgte der Hunger. Und der Umstand, dass die Nazis sich bei uns breitgemacht hatten.
»Trinken Sie«, drängte er mich. »Wir stecken alle zusammen drin.«
Ich nahm mein Glas. »Manche allerdings ein Stück tiefer als andere.«
Der Whisky schmeckte gut, das musste ich Hochstetter lassen. Er kannte sich aus. Der seltene Luxus brannte mir im Mund und in der Kehle.
Jetzt war Dax mit Achselzucken dran. »Wie Sie meinen, Eddie. Es hat Sie nicht davon abgehalten, ihn zu trinken.«
»Warum wollten Sie mich sehen?«, fragte ich.
»Im Jazz Chaud ist eine männliche Leiche gefunden worden, die Umstände sind verdächtig.«
Ich warf einen demonstrativen Blick auf mein Glas. »Dann ist es ja nicht eilig, oder?«
»Ich versuche nur, Sie bei Laune zu halten, Eddie. Verstehen Sie? Und die Leiche wird schon nicht weglaufen.« Ich sah zu, wie er sein Glas leerte und sich zwei Fingerbreit nachschenkte. »Der Laden ist von den Deutschen dichtgemacht worden, aber die Hausmeisterin hat die Leiche entdeckt, als sie heute Morgen nach dem Rechten gesehen hat. Anscheinend hat er versucht, den Safe auszuräumen.«
»Den Safe auszuräumen? Wo der Laden zumachen musste? Dann kann er nicht der Hellste gewesen sein. Was wissen wir sonst noch?«
»Das ist alles, Eddie. Die uniformierten Kollegen sind vor Ort und warten auf Ihr Eintreffen.«
Ich stand auf. »Dann muss ich mich wohl für die Verspätung entschuldigen?«
Dax setzte die Okkupation zu. Noch vor wenigen Monaten hätte er mich in sein Büro zitiert, mir von dem verdächtigen Todesfall erzählt und mich losgescheucht. »Nehmen Sie Boniface mit. Er ist nach drei Monaten im sonnigen Süden ein bisschen eingerostet.« Dann entließ er mich mit einem Wink.
Als Antwort schenkte ich mir noch zwei Fingerbreit Whisky ein, stürzte sie vor seinen Augen hinunter und verließ das Büro.
Ich holte Boniface aus dem Ermittlerbüro. Vor der Sechsunddreißig stiegen wir in seinen Wagen und fuhren in südlicher Richtung über den Fluss. Ich hatte mir ausgerechnet, dass Boniface, wenn er hinter dem Steuer säße, nicht so viel reden würde. Aber ich irrte mich. Er plapperte wie ein Wasserfall.
Das Jazz Chaud war ein Club in Montparnasse. Auf dem Weg dorthin fuhren wir erst über breite Boulevards, dann durch schmale Straßen. Die Stadt füllte sich wieder. Die Menschen, die in den Wochen vor der Invasion aus Angst vor den Deutschen geflohen waren, kehrten langsam nach Hause zurück. Es war nicht so geschäftig wie in der Zeit, ehe die Nazis beschlossen hatten, uns zu besuchen, aber die Stadt gähnte, streckte die Glieder, sah sich benommen um und überlegte, wie sie den Tag gestalten wollte. Die Panik des Sommers hatte sich als unbegründet erwiesen, die Deutschen behandelten uns mit seltsamer, höflicher Förmlichkeit. Fürs Erste.
»Als würden wir alle wie die Opferlämmer warten.«
Ich drehte mich zur Seite und sah, dass Boniface mich aufmerksam anstarrte. »Was haben Sie gesagt?«, fragte ich.
Er hatte angehalten und deutete auf das Leben ringsum. »Wir. Hier in der Stadt. Ein letztes kurzes Abenteuer, bevor wir uns blind in die Schlange vor dem Altar einreihen.«
Er wandte sich ab und stieg aus. Einen Moment konnte ich ihm nur hinterhersehen, den Geruch seiner Pomade noch in der Nase. Dann folgte ich ihm.
Das Jazz Chaud nahm die komplette Fläche eines schmalen dreistöckigen Gebäudes zwischen anderen schiefen Häusern ein, die wahllos zusammengewürfelt wirkten und an eine Reihe beschädigter Grabsteine erinnerten. Obwohl es langsam wärmer wurde, zitterte ich. Dies war eine Straße, in die die Sonne sich nicht verirrte. Was zum Glück auch für die Deutschen galt. Zumindest sah es im Moment danach aus.
Das Gesicht des uniformierten Polizisten vor dem Eingang war grünlich, er roch nach Erbrochenem. Ausnahmsweise zog ich den Geruch von Bonifaces Haaren vor. Zum ersten Mal fragte ich mich tatsächlich, was uns drinnen erwartete.
Im Eingangsbereich entdeckte ich Boniface, der sich über eine Frau mittleren Alters beugte. Sie weinte in einen verschlissenen Schal, nur hin und wieder hob sie den Kopf, um gequält nach Luft zu schnappen. In den Armen hielt sie eine dreifarbige Katze, die sie fest an ihre Brust drückte. Laut miauend versuchte das Tier, sich zu befreien. Boniface berührte das Gesicht der Frau, sprach mit sanfter, beruhigender Stimme auf sie ein und ermunterte sie, zu erzählen, was sie wusste. Ich nickte ihm zu und ging durch eine zweite Doppeltür, die in den eigentlichen Club führte.
Als junger Flic in den Zwanzigern hatte ich nebenher in einem ähnlichen Club in Montmartre gearbeitet und samstagabends Krawallmacher mit den Köpfen zusammengeknallt. Aber seitdem hatte ich keinen Fuß mehr in einen Jazzclub gesetzt. Und diesen Laden hier kannte ich nicht. Damals war ich in meiner Freizeit nie so weit in den Süden der Stadt gekommen, um mich zu amüsieren. Bei der Arbeit bekam ich genug davon zu sehen. Sofort erkannte ich den altvertrauten Geruch von Alkohol und Parfum wieder, den scharfen Gestank von Bleichmittel, den tristen Anblick einer Bühne, auf der sich tagsüber nichts abspielte. Aber diese Eindrücke waren schwach, verwässert. Der Club war geschlossen worden, bevor die Besatzer eingetroffen waren, die dann in einem ihrer willkürlichen Akte administrativen Eifers die Wiedereröffnung untersagt hatten. Auf der Bühne war seit Monaten kein Ton gespielt worden. Wie alles andere hier war auch sie von einer Staubschicht bedeckt: die Stühle, das Klavier, die Notenständer und Mikrofone. Für einen winzigen Moment fragte ich mich, was aus den ganzen Musikern geworden sein mochte, denen hier und denen, die ich früher gekannt hatte. Vor allem aus den Afroamerikanern, die nach dem letzten Krieg in Paris geblieben waren, weil sie sich nicht mehr mit den Problemen herumschlagen wollten, die sie in Amerika unweigerlich erwarteten.
Ein zweiter Uniformierter stand hier drinnen herum und schaute sehnsüchtig zur geschlossenen Bar hinüber. Er war älter als sein Kollege an der Tür und wirkte wie ein harter Hund. Seinem Alter nach hatte er beim letzten Mal, als wir unseren Nachbarn Auge in Auge gegenübergestanden hatten, wahrscheinlich genügend Grausiges für ein ganzes Leben mit angesehen.
»Was liegt an?«, fragte ich ihn.
»Es ist schlimm, Inspecteur.« Seine Stimme war merkwürdig hoch und passte schlecht zu seiner korpulenten Gestalt und dem stechenden Blick. Er deutete mit dem Kopf auf eine Tür. »Da durch.«
»Ist der Besitzer hier?«
»Wir erreichen ihn nicht. Außer uns ist niemand da.«
Ich nickte und wandte mich zur Tür, auf die er gedeutet hatte. Als Dax von einem Toten im Club gesprochen hatte, war ich von einem Unfall ausgegangen. Einem unglückseligen Safeknacker, der beim Versuch, hier einzusteigen, aus einem Fenster gefallen war. Die Reaktionen der beiden Flics zeigten mir, dass ich mich geirrt hatte. Ich überquerte die Tanzfläche, meine Gedanken rasten, ich versuchte mir auszumalen, was ich vorfinden würde.
Unmöglich.
In einem Büro, neben dem offenen Safe, saß ein Mann auf einem verzierten, aber ausgeblichenen Chefsessel. Jemand hatte ihn an den Stuhl gefesselt, seine Handgelenke waren mit Zwirn an die handgearbeiteten hölzernen Spindeln unter den mit Leder gepolsterten Armlehnen gefesselt. Bevor ich mich um den Mann kümmerte, schaute ich instinktiv in den Safe. Er war leer. Entweder weil er von vornherein leer gewesen war oder weil jemand anders sich mit dem Inhalt aus dem Staub gemacht hatte.
Jetzt wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu. In einem Punkt traf alles, was ich bisher gehört hatte, zu. Der Mann war zweifellos tot. Ich nahm ein Geräusch hinter mir wahr und sah Boniface mit entsetzter Miene ins Zimmer treten.
»Heilige Muttergottes, so etwas hätte ich nicht erwartet«, sagte er, seine Stimme klang ausnahmsweise heiser.
Ich konzentrierte mich wieder auf die Gestalt im Sessel, registrierte die panisch aufgerissenen Augen, das Blut am Zwirn um seine Handgelenke, wo er versucht hatte, sich zu befreien. Seine weit ausgestreckten Beine, als hätte er versucht, seinen Kopf so weit wie möglich vor dem Angreifer in Sicherheit zu bringen.
Jemand hatte ihm den Mund zugenäht.
Grobe, dicke Stiche mit demselben Zwirn. Sein Mund war gespitzt wie zu einem angstvollen Kuss. Am Kinn klebte ein Bart aus getrocknetem Blut, das einen Kontrast zu den farblosen Lippen bildete.
»Ich auch nicht«, sagte ich zu Boniface. »Das ist Julot le Bavard. Er müsste eigentlich im Gefängnis sitzen.«
2
Das Dachfenster war nicht aufgestemmt worden.
Ich hatte Boniface unten gelassen, um die Hausmeisterin zu befragen – sein duftiger Charme schien sie zu beruhigen, sodass ich dachte, er werde wahrscheinlich mehr aus ihr herausbekommen als ich. Inzwischen war ich die Treppe hinaufgestiegen, um das Dach zu kontrollieren. Julot war alte Schule, er hatte unumstößliche Gewohnheiten, eine verräterische persönliche Handschrift. Das war einer der Gründe, warum er im Gefängnis saß. Oder hätte sitzen sollen.
Ich schaute mich oben in sämtlichen Räumen um. Eine seiner Gewohnheiten bestand darin, in die Häuser, die er ausräumen wollte, über die Dächer und ein Fenster im obersten Stockwerk oder – seine Lieblingsvariante – ein Dachfenster einzusteigen.
»Warum hast du dein Vorgehen geändert?«, fragte ich ihn, auch wenn er mich nicht hören konnte. »Und was wolltest du in einem Laden, der geschlossen ist?«
Julot war kein Superhirn, aber auch ihm musste klar gewesen sein, dass ein leerer Club auch einen leeren Safe bedeutete. Es sei denn, er hätte etwas anderes erfahren. Was trotzdem nicht das Abweichen von seinem üblichen Vorgehen erklärte. Mit einem letzten Blick auf das Doppelfenster in der Dachschräge ging ich zurück nach unten, wo Boniface der Hausmeisterin gerade erklärte, sie könne nach Hause gehen.
»Sie haben uns sehr geholfen«, versicherte er ihr in diesem besonderen Tonfall. Aber es funktionierte. Hatte sie vor einer halben Stunde noch geheult, so schwebte sie jetzt davon, als wäre sie dreißig Jahre jünger und hätte den Morgen mit ihrem Liebhaber verbracht.
Als sie gegangen war, stellte ich mich zu Boniface in den Alkoholdunst des schwach beleuchteten Saals. Noch wollte ich nicht ins Büro zurück.
»Mehr oder weniger, was wir schon wussten«, sagte er auf die Aussage der Hausmeisterin bezogen. »Der Club muss von den Deutschen geschlossen worden sein, sodass im Safe ganz sicher kein Geld lag. Sie kommt jeden Montagmorgen, um nach dem Rechten zu sehen, sonst ist hier keiner. Geputzt wird nicht, weil der Besitzer es sich nicht mehr leisten kann.«
»Hat sie gesagt, wer der Besitzer ist?« Ich fragte mich, ob es eine Gestalt aus meiner Vergangenheit sein konnte.
»Jean Poquelin. Er ist weg.« Dann zitierte er aus dem Gedächtnis: »›Mit einer seiner Freundinnen.‹ Sie weiß nicht, wo er ist, aber er soll morgen zurückkommen.«
»Nehmen Sie ihn genauer unter die Lupe. Wir müssen diesen Monsieur Poquelin sprechen, sobald er wieder hier ist.« Der Name sagte mir nichts. »Hat sie eine Ahnung, ob er das Büro benutzt hat, vor allem den Safe?«
»Soweit sie weiß, nicht. Ich habe sie danach gefragt.«
Wir gingen zurück, um uns das Büro gründlicher anzusehen. Der Schreibtisch war leer bis auf eine Kladde und ein Kassenbuch, die frei von der auf allen anderen Oberflächen liegenden Staubschicht waren. Als ich mit dem Finger über die grüne Tischlampe fuhr, war er grau. Das Büro schien benutzt, aber nicht geputzt zu werden. Was uns nicht weiterhalf.
Genau wie ich vermied es Boniface, die auf dem Chefsessel sitzende Näharbeit zu betrachten. Aus dem Augenwinkel nahm ich sie zwangläufig wahr.
»So etwas macht man nicht mit jemandem, den man beim Ausräumen des Safes erwischt«, sagte ich zu Boniface. »Man schießt auf ihn oder schlägt ihn nieder. Oder ruft uns an. Oder erst das eine und dann das andere.«
»Und wenn er ein erfahrener Einbrecher war, wäre er hier sowieso nicht eingestiegen.«
Ich brummte zustimmend. Vor seinem Ausflug ans Mittelmeer hatte ich nie mit Boniface zusammengearbeitet. Ich hatte ihn immer eher als den Schaum, nicht als den Kaffee eingeschätzt. Deshalb überraschte mich seine Beobachtungsgabe. Ich erzählte ihm von Julots üblichem Vorgehen. »Ich glaube nicht, dass er aus eigenem Willen hergekommen ist. Und ganz sicher war er nicht allein. Julot wäre nur unter Zwang durch die Tür gekommen. So etwas hätte sein Stolz nicht zugelassen.«
»Also hat ihn jemand dazu gebracht, einzubrechen und den Safe zu öffnen. Und dann hat man ihm das hier angetan.«
»Warum? Warum hat man ihn nicht einfach umgebracht und die Leiche verschwinden lassen?«
»Vielleicht sollte es eine Warnung sein.«
»Was mich noch neugieriger darauf macht, was dieser Jean Poquelin zu sagen hat. Alle Anzeichen deuten auf einen Bandenmord hin. Wenn es eine Warnung sein soll, muss Poquelin der Adressat sein.« Ich zwang mich, Julot anzusehen. »Nichts von alldem erklärt allerdings, warum Julot nicht im Gefängnis sitzt. Er hatte noch mindestens vier Jahre Haft vor sich.«
»Woher wissen Sie das?«
»Weil ich ihn in den Knast gebracht habe.«
Boniface schien etwas erwidern zu wollen, aber in diesem Moment öffnete sich die Tür, und der zweite Streifenpolizist ließ jemanden ins Zimmer.
»Eddie, guten Morgen.«
Ich drehte mich um und sah, wie Bouchard, der Pathologe, seinen uralten Homburg abnahm und ihn lässig auf einen Kleiderständer in einer Zimmerecke hängte. Lächelnd wandte er sich mir zu, seine Augen wirkten durch die halbkreisförmigen Gläser der stets auf der krummen Nase sitzenden Brille stark vergrößert. Mit seinen grau gesprenkelten zurückgekämmten Haaren ließ er an einen Akademiker aus dem neunzehnten Jahrhundert denken.
»Morgen, Boniface«, fügte er hinzu. »Es überrascht mich, Sie wieder hier zu sehen. Haben Sie, wo immer Sie waren, zu viele Ehemänner gegen sich aufgebracht? Nein, sagen Sie nichts, es interessiert mich nicht.«
Mir war immer klar gewesen, warum ich Bouchard mochte. »Morgen, Doc.« Ich mochte es auch, ihn Doc zu nennen. Er hasste es.
»Also dann, was haben wir hier?« Bouchard stellte seinen Arztkoffer zu Julots Füßen. Er beugte sich vor, um die groben Stiche zu betrachten, mit denen die Lippen zusammengehalten wurden. »Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass wir nicht nach einem Chirurgen suchen.«
»Oder nach einer Schneiderin«, sagte Boniface in honigsüßem Ton, aber mit süffisantem Grinsen.
Bouchard funkelte ihn an. »Haben Sie sonst nichts zu tun?«
»Doch, haben Sie«, sagte ich zu Boniface. »Ich möchte, dass Sie herausfinden, warum Julot vorzeitig aus Fresnes entlassen wurde. Gehen Sie zum Richter und fragen Sie ihn nach dem Grund.«
Er nickte zustimmend, wobei jedes einzelne seiner geölten Haare an Ort und Stelle blieb, was mich irgendwie ärgerte.
Bouchard nahm mehrere Instrumente aus seinem Koffer und wandte sich Julot zu. Ich versuchte, nicht hinzusehen. Um mich abzulenken, betrachtete ich die Wände des Büros. Es funktionierte, aber anders als erwartet. Vier gerahmte Fotos, die in einem Viertelkreis an der Wand hinter dem Schreibtisch hingen, fesselten meine Aufmerksamkeit. Auf der Stelle vergaß ich Julot mit seinen Basse-Couture-Lippen, Bouchard mit seinen namenlosen Instrumenten und Boniface mit seinem Redestrom. Stattdessen starrte ich auf die Fotos oder, präziser ausgedrückt, auf die fotografierten Menschen. Natürlich waren sie älter als zu der Zeit, als ich sie gekannt hatte, trotzdem wusste ich, wer sie waren.
»Warum wurde er Julot le Bavard genannt?«, fragte Boniface in meinem Rücken. Ich zuckte zusammen. Er war noch immer nicht gegangen. »Julot der Schwätzer. War er etwa ein Spitzel?«
Ich drehte mich zu Boniface um. »Nein, er war kein Spitzel. Er hat einfach ununterbrochen gequasselt.«
»Ein Spitzel?« Denise spuckte das Wort zusammen mit ein paar an ihren Zähnen klebenden Tabakfäden aus. Wütend drückte sie die Zigarette in dem Blechaschenbecher aus, die Glut zischte in einer kleinen Pfütze verschütteten billigen Cognacs. »Julot war alles Mögliche. Aber sicher kein Spitzel. Das wissen Sie selbst, Eddie.«
Sie sah mir ins Gesicht. Jahrelanges Rauchen und das Leben mit Julot hatten Spuren hinterlassen, aber die inzwischen getrockneten Tränen waren echt gewesen. Ich hatte mich dafür gewappnet, ihr die Todesnachricht zu überbringen, aber die Buschtrommeln in Belleville waren mir zuvorgekommen. Als ich sie fand, saß sie in einem Café an der Rue des Envierges, einen Arm um ihren Oberkörper geschlungen, in der anderen Hand einen Brandy. Drei andere Einbrecher-Ehefrauen hatten der wie betäubt Wirkenden Gesellschaft geleistet. Für den Moment hatten sie sich in eine Ecke des Cafés zurückgezogen, damit wir ungestört reden konnten. Sie warfen mir kalte und drohende Blicke zu. Belleville war Julots Terrain, ein am rechten Seineufer gelegenes heruntergekommenes Viertel voll kurviger gepflasterter Gassen und verschwiegener Ecken.
»Warum sollte jemand so etwas mit Julot machen, Eddie?«, fragte sie in ihrem schockierten Zustand zum dutzendsten Mal.
»Das wollte ich Sie fragen, Denise. Kennen Sie jemanden, der sauer genug auf Julot war, um ihm so etwas anzutun?«
»Außer mir, meinen Sie?« Sie lachte, in ihrer rauen Stimme schwangen Verbitterung und Traurigkeit mit. Denise war Julots Exfrau. Sie hatte sich irgendwann scheiden lassen, nachdem sie jahrelang ertragen hatte, dass ihr Mann den größeren Teil der Ehe in Fresnes oder anderen Einrichtungen verbracht hatte statt zu Hause. »Niemanden. Und fragen Sie mich nicht noch mal, ob er jemanden verpfiffen hat. Sie wissen, dass das nicht Julots Stil war.«
Ich konnte ihr nur zustimmen. Auch die beiden folgenden Fragen musste ich mit Vorsicht stellen. »Könnte es sein, dass er zu viel über irgendetwas geredet hat? Wissen Sie von einer Sache, an der er beteiligt war?«
Ich rechnete mit einer bissigen Bemerkung, stattdessen wirkte sie nachdenklich. »Nicht dass ich wüsste, Eddie. Aber Sie kennen ja Julot, geredet hat er immer gern.«
»So kann man es ausdrücken.« Verglichen mit Julot hatte Boniface sich ein Schweigegelübde auferlegt.
»Besser gesagt: Der Drecksack hat praktisch nie den Mund gehalten.« Wieder lachte sie. »Sein Mund war schneller als der Sieger in Longchamp. Das war einer der Gründe, warum ich ihn irgendwann rausgeschmissen hab.«
»Das ist nicht ganz fair, Denise. Schließlich hieß er Julot le Bavard. Sie hätten also wissen können, was Sie erwartet.«
Sie warf mir einen schnellen Blick zu, brachte aber ein klägliches Lächeln zustande, das ihre Mundwinkel in tiefe Falten legte. »Vielleicht haben Sie recht. Ich hab den Kerl immer noch geliebt, auch wenn ich nicht mit ihm leben konnte. Harmlos war er, stimmt's, Eddie? Er hätte keiner Menschenseele etwas angetan.«
Ich hob meine Kaffeetasse und stieß mit ihr an. »Einer der nettesten Menschen, die ich je verhaftet habe. Hat niemals Ärger gemacht.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Wenn Sie bloß darauf geachtet hätten, ihn nicht so häufig zu verhaften.«
Eine Weile hingen wir unseren jeweiligen Gedanken nach. Ihre Freundinnen in der Ecke wurden langsam unruhig. Schließlich fragte ich: »Wann ist er aus dem Gefängnis gekommen? Er hatte seine Strafe noch nicht abgesessen.«
»Ich weiß es nicht. Ich hab heute erst erfahren, dass er raus war. Schon über einen Monat, sagen die Leute.«
»Was sagen sie sonst noch? Wie kommt es, dass er früher entlassen wurde?«
»Sie sind der Flic. Sagen Sie es mir.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn er noch in Fresnes gewesen wäre, hätte ihm nichts passieren können.«
»Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde.« Jetzt war ich es, der ironisch lachte.
»Jedenfalls wäre er dort sicherer gewesen als hier draußen.« Ihre Miene war ausdruckslos. »In letzter Zeit hat sich alles verändert.«
»Seit den Deutschen?«
Sie schüttelte den Kopf, antwortete aber nicht.
»Was meinen Sie, Denise?«
Lachend drückte sie die Zigarette aus, aber ihr Blick wurde hart. »Auch ich bin kein Spitzel, Eddie.«
Ihre Freundinnen schienen zu spüren, dass die Stimmung unseres Gesprächs umschlug. Sie kamen herüber und setzten sich zu uns. Die Älteste des Trios, eine Xanthippe mit Haarknoten, schlechten Zähnen und entsprechendem Atem, rückte ganz nah an mich heran und starrte mir in die Augen. Ich begriff den Wink mit dem Zaunpfahl.
»Falls Sie etwas hören, geben Sie mir Bescheid«, sagte ich beim Aufstehen zu Denise.
»Eins sag ich Ihnen, Eddie. Julot kann dankbar sein, dass er tot ist. Hätte ich gewusst, dass er aus dem Knast ist, hätte ich den Bastard selbst umgebracht.«
Ich überließ sie und ihre drei Freundinnen ihrem Groll und verließ Belleville in südlicher Richtung. Inzwischen hatte ich gelernt, welche Strecken ich nehmen musste, um Adolfs Blaskapellen und deutschen Patrouillen auszuweichen. Wenn man die Gedanken konsequent abschottete, konnte man fast vergessen, dass man in einer besetzten Stadt lebte. Dann aber überquerte ich die Seine und wurde von einem Motorrad mit Beiwagen gezwungen, an den Straßenrand zu fahren, um zwei Dienstwagen vorbeizulassen. Auf den Rücksitzen glitzerten Eichenlaub und Tressen. Fast vergessen, habe ich gesagt.
Bouchard saß an einem Schreibtisch im Sektionssaal und trank schlechten Kaffee. Hier, in einer Ecke weit weg von den Obduktionstischen, blätterte er durch eine Zeitung. L'Œuvre, wie ich sah, ein pazifistisches, linksgerichtetes Blatt, das seltsamerweise jetzt, wo wir Besucher hatten, eine Pro-Nazi-Haltung angenommen hatte. Er warf es mit offensichtlich angewiderter Miene in den Papierkorb. Irgendwo auf dem Gang schlug eine Tür zu. Ein junger Mann trat ein und ging wieder hinaus, ohne ein Wort mit Bouchard oder mir zu sprechen.
»Ziemlich lebhaft hier«, bemerkte ich.
»Ein seltener Zustand in einem Leichenschauhaus.«
Er stand auf und führte mich an einen der Tische. Unter einem weißen Tuch zeichnete sich ein Hügel ab, der einmal ein Mensch gewesen war. Es wurde niemals leichter. Bouchard zog das Tuch beiseite, unter dem Julot zum Vorschein kam. Die Nähte an seinem Mund waren entfernt worden.
»Wie ist er gestorben?«, fragte ich.
»Laienhaft ausgedrückt, an Asphyxie. Jemand hat ihm die Nase zugehalten, bis er starb.«
»Und den Mund bedeckt.«
Bouchard legte das Laken wieder über Julot und schüttelte den Kopf.
»Das war nicht nötig. Die Lippen wurden ante mortem zugenäht.«
3
Boniface erwartete mich vor meinem Büro.
»Bin gerade erst gekommen«, sagte er. »Sie können sich nicht vorstellen, wie lange es gedauert hat, durch die Stadt zu kommen.«
Ich sah auf meine Armbanduhr. Seit dem Beginn der Okkupation galt in Paris die deutsche Zeit, eine Stunde vor der französischen, aber ich hatte mich geweigert, meine Uhr umzustellen. Es hatte nicht lange gedauert, bis ich gelernt hatte, mit der falschen Zeitangabe zurechtzukommen.
»Wie meinen Sie das, durch die Stadt? Ich habe Sie bloß zum Richter im Palais de Justice geschickt. Das ist gleich um die Ecke.«
»Alles zu seiner Zeit, Eddie. Alles zu seiner Zeit.«
Dabei zwinkerte er mir zu. Ich stöhnte und ging voran ins Büro, das ich mit zwei anderen Inspecteurs teilte. Einer war unterwegs, der andere hatte es wie Boniface gemacht, nur dass er – wohin auch immer er geflohen sein mochte – nicht zurückgekehrt war.
»Was haben Sie herausgefunden? Ich gehe doch davon aus, dass Sie mit dem Richter gesprochen haben?«
Er nickte lächelnd. Noch ein Zwinkern, und ich schwöre, ich hätte ihn aus dem Fenster im dritten Stock geworfen. »Hab mich mit Richter Clément unterhalten. Mann, seine Sekretärin ist wirklich süß, finden Sie nicht? Die entzückende Mathilde.« Plötzlich zeigten seine Augen mehr Glanz als die Haare.
»Der Richter, Boniface.«
»Genau. Also, Richter Clément hat keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass Julot Bewährung bekommen hätte, endgültig entlassen oder auf Hafturlaub wäre. Er sagt, er habe aus Fresnes überhaupt nichts zu Julot bekommen. Keinen Antrag von ihm oder von einem Anwalt, nichts über dringende familiäre Anlässe. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum Julot auf freiem Fuß war.«
»Wie kommt es dann, dass er trotzdem draußen war?«
»Ich hab noch mehr. Nach dem Besuch beim Richter bin ich nach Fresnes rausgefahren, um zu sehen, was da läuft.«
»Sie haben was gemacht?«
»Alle mauern, Eddie. Keiner wollte mit mir reden. Als ich nach Julot gefragt hab, haben sie mich vom einen zum anderen geschickt. Mir erzählt, er wäre immer noch im Knast, aber ich dürfte ihn nicht sehen. Als ich hartnäckig blieb, hieß es, ihm wären Besuche und sonstige Privilegien gestrichen worden. Ich sagte, ich sei Polizist und hätte das Recht, ihn zu sehen. Darauf meinten sie, ich solle mit einem richterlichen Beschluss zurückkommen.«
»So ein Blödsinn. Glauben Sie, das Gefängnis deckt ihn?«
»Wahrscheinlich steckt noch mehr dahinter. Ich hab mit dem Direktor gesprochen, der ziemlich nervös wirkte. Ich könnte es nicht genau benennen, aber irgendetwas stimmte nicht.« Er ließ seine Worte einen Moment einwirken, dann fuhr er fort: »Eine Sache noch … Ich sollte meine Waffe abgeben, als sie mich reinließen.«
»Ihre Waffe? Das ist nicht erlaubt. Sie sind Polizist, Sie können sich nicht unbewaffnet in Fresnes aufhalten. Ich gehe davon aus, dass Sie die Waffe behalten haben.«
»Ich musste sie abgeben. Sonst hätten sie mich nicht zum Direktor vorgelassen.« Er grinste anzüglich. »Nachdem ich bei ihm war, hab ich noch mit seiner Sekretärin gesprochen. Kein Hingucker, aber eifrig, Sie verstehen schon.«
»Kommen Sie auf den Punkt, Boniface.«
»Der Punkt ist, dass sie mir die Akten im Büro des Direktors gezeigt hat. Heimlich, ohne dass er etwas mitbekommen hat.« Plötzlich öffnete er die Hand, prahlerisch, wie ein billiger Magier. »Buff. Keine Akte über Julot. Verschwunden.«
»Alles weg, Eddie. Sie müssen morgens kommen, wenn Sie das beste Stück wollen.«
»Das beste Stück?«
»Okay, ein gutes Stück.« Nachdenklich bewegte Albert den Kopf hin und her. »Okay, ein halbwegs anständiges Stück.«
»Oder etwas, das entfernt an das Fleisch erinnert, das wir früher hatten«, präzisierte ich. Er nickte zögerlich.
Albert war mein Metzger. Und das ist weniger großartig, als es klingen mag. Er war mein Metzger, weil die Deutschen Anfang August die Rationierung noch einmal verschärft hatten. Was bedeutete, dass man, wenn man sich bei den Behörden hatte registrieren lassen, sich auch beim örtlichen Bäcker oder Metzger registrieren lassen musste. Von da an durfte man nur noch bei ihnen einkaufen. Wenn sie nichts mehr hatten, bis man den Anfang der Schlange erreicht hatte, oder wenn man zu spät kam, bekam man nichts zu essen. Oder man ging zum Schwarzmarkt, einem der wachsenden Geschäftszweige unter unseren neuen Herren. Ich hatte auf dem Rückweg aus der Sechsunddreißig hereingeschaut und gewusst, dass ich wahrscheinlich nicht viel bekommen würde. Trotzdem hatte ich auf ein karges, aber einfallsreiches Abendessen gehofft.
»Ich bekomme einfach keine Lieferungen, Eddie. Es war schon schlimm, bevor die Boches kamen, aber jetzt ist es noch schlimmer. Ich habe ein Stück Lammnacken, wenn Sie wollen.«
Widerstrebend nickte ich. Er nahm ein winziges Stück Fleisch aus der Theke. Karg war noch zu viel gesagt.
»Das ist praktisch nur Knochen«, protestierte ich. »Da ist kaum Fleisch dran.«
»Nehmen Sie es oder lassen Sie es hier, Eddie. Es ist alles, was ich habe.«
Ich zahlte einen Betrag, der vor dem Krieg für eine kleine Wohnung gereicht hätte, und sah zu, wie er das Lamm geschickt in Papier einwickelte.
»Immerhin ist Fleisch noch nicht offiziell rationiert«, bemerkte ich.
»Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ab nächsten Monat fangen sie damit an. Dann braucht man für Fleisch Lebensmittelkarten, so wie es jetzt schon mit dem Brot läuft.«
»Glorreiche Zeiten, nicht wahr?«
Ich nahm meinen Festschmaus und trat hinaus in den ausklingenden Spätsommertag. Hier draußen, in der scheinbaren Normalität des Sonnenlichts konnte ich mir einen angewiderten Blick auf das Päckchen in meiner Hand nicht verkneifen. Während des Pseudokriegs vor der Besatzung hatte unsere eigene Regierung an bestimmten Tagen Fleisch, Zucker und Alkohol verboten, auch wenn sich kaum jemand daran gehalten hatte. Aber seit die Deutschen gekommen waren, um ihr Brot in unsere Sauce zu tunken, war alles viel schlimmer geworden. Seit fast zwei Monaten mussten wir inzwischen vor unseren jeweiligen mairies Schlange stehen, um Lebensmittelkarten für 350 Gramm Brot, für Zucker und Reis zu bekommen. Jetzt sah es so aus, als werde auch Fleisch einbezogen. Gerüchteweise würden als Nächstes Käse und Kaffee folgen. Ich dachte noch einmal an den Whisky in Dax' Schublade und spürte ein absurdes Verlangen.
Langsam ging ich nach Hause. Weil die Berliner Zeit galt, bekam man das Gefühl, die Sonne stünde für die Tageszeit zu hoch am Himmel. Ich hatte mich an das veränderte Licht noch nicht gewöhnt. Manchmal hatte ich das Gefühl, der Einzige zu sein. Die Straßen waren belebt, belebter noch als vor wenigen Wochen. Die Pariser, die aus ihren Schlupfwinkeln zurückgekehrt waren, saugten die zusätzlichen Sonnenstunden auf, als wäre in ihrer Abwesenheit nichts Besonderes passiert. Als ich an der Schlange vor einem Kino vorbeikam, hätte ich die Leute am liebsten im Nacken gepackt, sie geschüttelt und ihnen gesagt, sie sollten sich umschauen. Sich die grauen Uniformen ansehen, die durch die Stadt stiefelten, die in Deutsch beschriebenen Schilder vor Orten, die nicht mehr betreten durften, die Berge von Sandsäcken vor Kirchen und Denkmälern. Und die blutroten Fahnen mit dem Hakenkreuz, die an jedem offiziellen Gebäude hingen.
Weil ich mich noch nicht bereit für meine leere Wohnung fühlte, machte ich einen Umweg durch den Jardin du Luxembourg, der in diesen Tagen zu einer Art Oase der Hoffnung geworden war. Jedenfalls solange man es schaffte, die rot-weiß-schwarzen Wachhäuser vor dem Palast und die riesige, in der vom Dach herabwehenden Brise flatternde Naziflagge zu übersehen. Görings Bande von der Luftwaffe hatte das prachtvolle alte Gebäude als Pariser Zweitwohnung in Beschlag genommen. Nirgends war man sicher vor ihren Verwüstungen. Jedenfalls nirgends, wo man sich gern aufhielt.
Als ich zwei plaudernden Familien auswich, erinnerte ich mich an einen anderen Tag hier in den Gärten, kurz nachdem Adolfs Gefolgsleute in die Stadt eingerollt waren. Der Park war leer gewesen, mit Ausnahme weniger Soldaten, die sich entweder umschauten oder die Papiere der Passanten überprüften. Nur wenige in der Stadt gebliebene Pariser waren unterwegs, sie eilten mit gesenkten Blicken umher, vermieden Augenkontakt. Plötzlich hatte ich ein starkes Verlustgefühl gespürt. Wut über den Tod der Stadt, die ich erstmals als Rekonvaleszent während des letzten Krieges besucht hatte. Verzweiflung bei dem Gedanken, dass diese Stadt nie wiederkehren würde. Dass ich nie wieder im Sonnenschein durch die Menge spazieren würde. Aber jetzt passierte es tatsächlich. Gedämpft, anders, aber es passierte. Überall um mich herum rannten Kinder und plauderten Erwachsene. Gruppen deutscher Soldaten lachten nachsichtig mit den Kindern und umgarnten junge Frauen und alte Männer. Ich fühlte mich gleichzeitig wütend und verzweifelt. Diesmal allerdings eher auf meine französischen Landsleute als auf den Eindringling.
Aber ich ärgerte mich auch über mich selbst. Wegen meiner Unvernunft. Die Deutschen waren hier, daran würde sich so schnell nichts ändern. Die von ihrem Exodus Zurückkehrenden konnten sie so wenig vertreiben wie ich. Währenddessen mussten sie leben, sich ernähren, ein Dach über dem Kopf haben, Geld verdienen, ihre Kinder zur Schule schicken. Es war eine neue Normalität, eine befleckte Version der alten, jedenfalls die, die uns aufgezwungen war, mit der wir leben mussten.
»Also komm damit zurecht oder lass es bleiben«, hörte ich mich laut sagen. Ich wusste nicht mal genau, was ich damit meinte.
Zu Hause legte ich das Fleisch zusammen mit einer Kartoffel und einer Tomate, die ich vom opulenten Festmahl des gestrigen Abends übrighatte, in einen Suppentopf und ließ alles in der Hoffnung einkochen, dass etwas halbwegs Essbares dabei herauskommen würde. Ich sah eine Weile dabei zu und malte mir aus, wie ich einen Teil von Dax' Whisky abzapfen könnte. Aber in dem Moment, als mir klar wurde, dass ich die Idee ernst zu nehmen begann, ging ich hinüber in mein kleines Wohnzimmer.
Ich setzte mich auf den bequemeren meiner beiden alten Sessel, sah Julots Mund wieder vor mir – die groben Stiche, die seine Lippen fest zusammenhielten – und versuchte, mir die Angst und den Schrecken vorzustellen, die er durchgemacht haben musste. Für einen kurzen Moment spürte ich Mitleid. Ich erinnerte mich an einen Einsatz vor fast zwanzig Jahren. Damals hatte ich einen Einbrecher über die Dächer im 19. Arrondissement gejagt, bis ich stürzte und er entkam. Obwohl ich ihn nicht genau zu Gesicht bekam und ihm nichts anhängen konnte, wusste ich, dass es Julot war. Kurz darauf kam er mich im Krankenhaus besuchen. Er brachte eine Flasche teuren Wein mit, blieb eine Stunde und trank mit mir. Natürlich war der Wein gestohlen, aber ich hielt den Mund. Später wurde der dämliche Idiot dabei erwischt, wie er den Rest der Beute ans Restaurant des ursprünglichen Besitzers verkaufen wollte, und er bekam zwei Jahre in Fresnes.
Ich musste lächeln und prostete ihm mit einem Glas Wein zu, das ich nicht mehr hatte. Immer noch fragte ich mich, was der Grund gewesen sein mochte, warum er nicht im Knast gesessen hatte. Aber mir fiel keine Erklärung ein.
Ich dachte auch an Boniface. Wie Julot konnte er den Mund nicht halten und ging mir schrecklich auf die Nerven, aber in ein oder zwei Punkten hatte er mich wirklich überrascht. So ungern ich es mir eingestand, bewunderte ich die Hartnäckigkeit, mit der er einfach nach Fresnes marschiert war und gründlicher nachgebohrt hatte, als ich es ihm nach seinem leeren Geschwätz zugetraut hätte.
Gleichzeitig wusste ich, dass all diese Überlegungen mich von dem einen Gedanken ablenkten, der zwangsläufig hochkam, sobald ich ein wenig Ruhe fand. Dem Gedanken an meinen Sohn. Jean-Luc. Den ich verlassen hatte, als er noch ein Kind gewesen war und der mit dem Einmarsch der Nazis – wenn auch für kurze Zeit – wieder in meinem Leben aufgetaucht war. Mein Sohn, der als Soldat die Niederlage der französischen Truppen in der Schlacht bei Sedan miterlebt hatte und dem ich praktisch vor den Augen der Deutschen zur Flucht aus Paris verholfen hatte. Den ich wiedergefunden und bereitwillig wieder verloren hatte. Das war jetzt drei Monate her, seitdem hatte ich nichts von ihm gehört.
Deshalb suchte ich Ablenkung in den Gedanken an Julot und Boniface. Und an Jean Poquelin, den Besitzer des Jazzclubs, mit dem ich sprechen wollte. Ich schaute an die Wände meines Zimmers und die ganz überwiegend mit Büchern beladenen Regale. Auf dem obersten Bord, dem schnellen Zugriff entzogen, stand eine alte Blechdose. Ich besaß weder Fotos von meinem Sohn noch von mir und meinem früheren Leben. Bilder von mir selbst konnte ich nicht ertragen, was auch bedeutete, dass ich keine von anderen hatte. Sämtliche Erinnerungen befanden sich in meinem Kopf. Es gab Zeiten, in denen ich sie am liebsten auch von dort verbannt hätte.
Im Augenblick wünschte ich mir allerdings, ich hätte das eine oder andere Foto. Nur nicht von mir.
Im Geiste sah ich die Bilder an den Bürowänden des Jazzclubs vor mir, in dem Julot gefoltert und ermordet worden war.
Sie zeigten vertraute Gesichter. Es hätte mich nicht wundern sollen, ich hatte schließlich in einem Jazzclub gearbeitet. Die Fotos stammten aus dieser Zeit und zeigten Menschen, die ich damals gekannt hatte.
Während der Geruch von etwas Angebranntem mich zurück in die Gegenwart holte, erinnerte ich mich an die Aufnahme des Mannes, bei dem es sich wahrscheinlich um Jean Poquelin handelte.
Allerdings kannte ich ihn unter anderem Namen.
4
»Soll ich auf Ihr Auto aufpassen, Monsieur?«
Ich sah auf einen Jungen hinunter, der mir gerade bis zur Taille reichte. Ich hatte an einer der breiteren Straßen in Belleville gehalten, weil ich mich nicht im Gewirr der schmalen kopfsteingepflasterten Gassen verirren wollte. Er streckte mir erwartungsvoll die Hand entgegen, sein Gesicht war blass. Wir befanden uns in einem Viertel, wo das Sonnenlicht sich nicht ins Gewirr der Häuser mit ihren abblätternden Fassaden hineintraute. Von der Nase des Jungen zog sich ein Schleimfaden bis auf die Oberlippe, seine Augen wirkten tellergroß. Er trug einen fadenscheinigen Pullover aus zehnter Hand, schmutziger als der Bürgersteig. Immer wieder musste er das Kleidungsstück hochziehen, damit es ihm nicht vom schmalen Leib fiel.
»Es geht schon, Junge.« Der Morgen war lang gewesen.
»Ihre Entscheidung, Bulle.«
Ich musterte ihn ein zweites Mal und reichte ihm eine Fünf-Centimes-Münze. Wahrscheinlich war das einfacher als die Suche nach vier neuen Reifen.
Die Stammgäste im Le Peloton verstummten, sobald ich einen Fuß ins Lokal gesetzt hatte. Außer dem Geräusch eines Glases, das auf einen abgenutzten Holztisch gestellt wurde, war nichts zu hören. Der Junge war nicht der Einzige, der einen Polizisten auf Anhieb erkannte.
»Komme ich rechtzeitig zum Treffen der Petites Sœurs des Pauvres?«, fragte ich. Niemand antwortete.
Ich stellte mich mit dem Rücken zum Zinktresen an die Bar und schaute in ein Dutzend Gesichter. Die Mienen reichten von mürrisch bis feindselig. Jeder Quadratzentimeter der Wand war mit ausgeblichenen Tour-de-France-Plakaten tapeziert, auf denen sepiafarbene Helden der Vergangenheit grinsten und Pokale küssten. Keiner der Gäste machte den Eindruck, als würde er je auf ein Fahrrad steigen, es sei denn, auf ein gestohlenes. In meinem Rücken spürte ich, wie Pottier, der Besitzer, mich empört anstarrte.
»Ihr werdet sicher verstehen«, wandte ich mich an die Versammelten, »dass ich einen harten Vormittag hatte und bloß meinen Job machen will.«
»Leck mich, Bulle«, brummte jemand.
Ein junger Rabauke, der etwas beweisen wollte, baute sich bedrohlich direkt vor mir auf. Ich hielt seinem Blick stand, legte beide Hände an sein Gesicht, küsste ihn auf die Stirn und knallte seinen Kopf in aller Ruhe gegen den Tresen. Dann sah ich zu, wie er auf den Boden fiel. Einen Sekundenbruchteil bevor ich ihn geschlagen hatte, hatte er etwas gesagt, ein Wort, das ich nicht verstanden hatte. Ich ging nicht davon aus, dass er vorhatte, es zu wiederholen. Auch wenn ich ihn freundlich darum bat.
»Bedauerlich«, sagte ich laut. »Hat irgendjemand verstanden, was er gesagt hat?«
Keiner rührte sich, keiner sagte etwas. Ein paar jüngere Gauner wechselten überraschte Blicke. So kannten sie mich nicht. Einer, der schon gesessen hatte, sah mir kurz in die Augen und wandte den Blick ab. Er erinnerte sich an die guten alten Zeiten.
»Na gut. Wie gesagt, der Tag hat nicht gut angefangen. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Julot le Bavard.«
Bei der Erwähnung seines Namens strömte eine Welle der Sympathie durch den Raum. Aber ich registrierte noch etwas anderes: Angst.
»Ich habe Julot gemocht«, fuhr ich fort. »Ich wüsste gern, wer seine Lippen zusammengenäht und ihm dann im Todeskampf die Nase zugehalten hat. Bis zum bitteren Ende. Ich bin sicher, dass viele von euch es auch gern wüssten. Also werde ich jetzt gehen, aber noch eine Weile im Viertel bleiben. Falls irgendjemand mir verraten will, was hier vor sich geht, kann er einfach kommen und mit mir reden. Wer das tut, ist kein Verräter, sondern er hilft, Julots Mörder zu finden.« Ich sah auf den jungen harten Kerl hinunter. Kein sanfter Kuss eines Prinzen würde ihn in nächster Zeit aufwecken, also stieg ich über ihn hinweg und ging zur Tür. »Ich wisst sicher, wo ihr mich findet.«
Natürlich wussten sie es. Andere Stadtteile hatten Springbrunnen, Belleville seine Buschtrommeln. Das Wasser, das es in Belleville gab, floss in trüben Bächen über die Kopfsteinstraßen, schmutzige Kinder spielten im Schlamm und Unrat, den es hinterließ. Gerade kam ich an einer Gruppe solcher Kinder vorbei, alle in schmuddeligen, übergroßen, gebrauchten Kleidungsstücken. Ich war unterwegs zu einem Ort, den ich kannte und der sicher vor neugierigen Blicken war.
Ich konnte es nicht lassen, mich umzusehen. Auf meiner Strecke musste ich auf die Sicherheit der schmalen Gassen verzichten und mich auf die offenen Straßen wagen. Ich sage Sicherheit, aber das alles war in Belleville relativ.
Ich dachte an die Gesichter im Le Peloton. Auch ich spürte ihre Angst.
Ich kam mir vor wie ein Beutetier.
Nachdem ich die Stufen zu der Stelle hinuntergestiegen war, wo die Rue Piat auf die Rue Vilin trifft, wartete ich dort. Alle glauben, dass niemand mit der Polizei spricht. Aber sie tun es doch. Um einem Rivalen eins auszuwischen, reden sie mit der Polizei. Um nicht nach Fresnes zu müssen, reden sie mit der Polizei. Um Essen auf den Tisch zu bekommen, reden sie mit der Polizei. Sie würden mit jedem reden. Vor allem jetzt, wo Essen so schwierig zu bekommen war.
Ich wusste, dass mein Vorgehen ein letztes Mittel war. Hinter mir lag ein frustrierender Morgen. Ich hatte den Tag im Jazz Chaud in Montparnasse begonnen und den Mann gesucht, der sich inzwischen Jean Poquelin nannte. Aber er war nicht aufzutreiben, der Club geschlossen. Von dort aus war ich über den Fluss hierhergefahren, nach Belleville, in dieses verwachsene, hügelige Viertel auf dem rechten Seineufer. Eine ganze Welt von dem Paris entfernt, in das die Deutschen zum Plündern eingefallen waren. Vergeblich hatte ich den Vormittag mit der Suche nach jemandem zugebracht, der mit mir reden würde. Der mir einen Anhaltspunkt dafür liefern würde, wer Julot ermordet hatte. Und warum er nicht im Gefängnis saß. Langsam begriff ich, dass diese zweite Frage mir dringender erschien als die nach Julots Tod. Im Stillen entschuldigte ich mich bei ihm, was nichts daran änderte, dass ich so empfand.
Es gab einen Grund dafür, dass niemand etwas sagen wollte. Angst. Etwas noch Stärkeres als Angst. Grauen. Ich musste wissen, was dieses Grauen auslöste.
»Ich hab keine Ahnung, Eddie, ehrlich«, hatte Émile vor zwei Stunden erklärt, einer von Julots Einbrecherkumpeln. Ich sah das Grauen in seinen Augen. »Ich weiß nicht, warum er aus dem Gefängnis raus war. Er hat nichts gesagt.«
»Er hat dir nichts verraten?«
Energisch schüttelte Émile den Kopf.
»Das ist seltsam, findest du nicht? Julot le Bavard hält einfach den Mund? Irgendwas muss er gesagt haben.«
»Ich wusste nicht mal, dass er draußen war. Ich hatte ihn nicht gesehen.«
»Um dir nichts verraten zu haben, muss er sich doch wohl mit dir getroffen haben.«
Es hatte keinen Sinn. Ich ließ ihn gehen. Er wieselte los, nervös an seinen Hasenzähnen saugend und die Ohren panisch gespitzt. Er blieb nicht der Einzige, der so verängstigt wirkte, der so bemüht jedes Wissen abstritt. Deshalb war ich ins Le Peloton gegangen. Um den Baum zu schütteln und zu sehen, was herabfiel.
Nichts fiel vom Baum. Das Einzige, was ich gehört hatte, war ein einzelnes Wort, das ein draufgängerischer Ganove gesagt hatte, bevor ich ihm eins überzog. Und ich hatte es nicht einmal verstanden. Ich gab auf, stieg die Treppe hoch. Die Straße war leer, alle Türen geschlossen. Niemand wollte über eine Plaudertasche reden.
Aber anscheinend wollte jemand schreiben.
An die gegenüberliegende Hauswand war ein einzelnes Wort geschmiert, Tränen aus weißer Farbe liefen am blätternden Putz herab. Die Farbe war noch feucht. Als ich gekommen war, hatte dort noch nichts gestanden. Aber ich kannte das Wort nicht.
Ich kehrte zu meinem Auto zurück, wo der schmächtige Junge einen weiteren Sou verlangte.
»Als Prämie«, argumentierte er. »Weil ich gut aufgepasst habe.«
Ich stieg ein und drehte den Zündschlüssel. Der Wagen sprang problemlos an.
»Auf keinen Fall, du halbe Portion«, sagte ich und fuhr los.
»Capeluche?«
Unten in der Asservatenkammer im Keller der Sechsunddreißig versuchte ich es bei Mayer mit dem Wort, das an die Hauswand geschmiert worden war.
»Sagt mir nichts, Eddie, tut mir leid.«
»Ich vermute, es ist entweder ein Name oder ein Pariser Slangausdruck, den Leute wie wir nicht kennen«, sagte ich und nahm meinen Zettel zurück.
Er lachte leise. Genau wie ich war Mayer Außenseiter. Aber während ich aus dem Süden kam, stammte er aus dem Norden, ein Elsässer. Ein nachdenklicher, intelligenter Mann mit einer Nase für die Wahrheit und der Zähigkeit, ihr nachzujagen. Hier unten war sein Talent eindeutig verschwendet.
»Für mich sieht's wie ein Spitzname aus. Irgendwas Neues von Jean-Luc?«
Seine Frage versetzte mich in Alarmbereitschaft. Er war einer der wenigen Kollegen, die von meinem Sohn wussten. Ich war selbst überrascht, wie dringend ich das Thema vermeiden wollte.
»Nichts. Und bei dir? Bist du schon Deutscher?«
Er wirkte schockiert. »Über so was solltest du nicht mal Witze machen, Eddie. Ich weiß nicht, was los ist, aber den Nazis traue ich alles zu. Sie schleichen sich von hinten an uns ran, während wir mit etwas anderem beschäftigt sind. Wenn wir sie entdecken, sind wir am Arsch. So arbeiten sie.«
Seine Vehemenz befremdete mich, aber ich wusste, was dahintersteckte. Die Deutschen hatten ein Auge auf das Elsass und seine Bewohner geworfen. Der Waffenstillstand, den wir im Juni gezwungenermaßen unterzeichnet hatten, erwähnte weder das Elsass noch Lothringen explizit, aber in der Praxis hatte Adolf beides annektiert. Zollkontrollen waren eingeführt und Gauleiter, deutsche Verwaltungschefs, ernannt worden. Frankreich endete wieder an den Vogesen. An Mayers Stelle würde ich mir Sorgen machen, was die Zukunft – und die Nazis – bringen würden. Kurz flammte ein Schuldgefühl auf, weil ich mit einer flapsigen Bemerkung von meinen eigenen Sorgen hatte ablenken wollen.
»Du bist Polizist, Mayer. Das wird nicht passieren.«
Seine Miene blieb ausdruckslos. »Und wenn doch? Wer steht für mich ein, wenn sie mich holen kommen?«
Ärgerlich über mich selbst ging ich auf die Suche nach Barthe und Tavernier. Ich fand beide auf dem Treppenabsatz im dritten Stock, wo sie ein bisschen Sonnenlicht tankten. Barthe stand auf sicheren Füßen. Es war mir ein Rätsel, wie er das schaffte. Er begann jeden Tag mit einem Brandy und legte dann im Laufe der Zeit immer gnadenloser nach. Sein Lebenszyklus wurde von einer steten Folge süßlich riechender Bargläser bestimmt. Neben ihm stand Tavernier, der die Last der Welt auf seinen Schultern zu tragen schien. Er war schon dabei gewesen, die Tage bis zum Ruhestand zu zählen, aber mit der Ankunft der Deutschen hatte sich diese Möglichkeit in Luft aufgelöst. Die beiden ähnelten zwei alten Knastbrüdern, die ihre Zeit absaßen und sich nach Kräften mühten, nicht aufzufallen.
Dax zuckte nur die Schultern, als er das Wort hörte.
»Wahrscheinlich bedeutet es nichts«, sagte er abwesend und rückte seine Brille zurecht. »Julot war Berufskrimineller. Er kannte die Risiken. Zerbrechen Sie sich nicht zu sehr den Kopf darüber, was mit ihm passiert ist. Ernsthaft, Eddie, ich will nicht, dass Sie zu viel Zeit damit vergeuden.«
Offen gesagt wussten wir beide, wie unwahrscheinlich das war. »Ich will wissen, warum er nicht im Gefängnis saß. Und warum der Mord so brutal war. Wir müssen wissen, was da läuft.«
»Was da läuft?«
Er nahm einen Stapel mit Anordnungen des deutschen Militärbefehlshabers und warf sie hoch in die Luft. Sie landeten schwer auf seinem Schreibtisch und auf dem Fußboden, die Hakenkreuze erinnerten an winzige Giftspinnen, die den Raum zwischen uns heimsuchten. »Das hier läuft, Eddie. Julot könnte aus Dutzenden Gründen aus Fresnes entlassen worden sein. Und die haben alle nichts mehr mit uns zu tun.«
»Ich kann nicht einfach meine Hände in Unschuld waschen.«
»Ich weiß, dass Sie das nicht können. Aber Sie werden in Zukunft lernen müssen, dass Ihre Hände auch mal schmutzig bleiben.«
Ich sah zu, wie er den Papierstapel wieder aufsammelte. Seine Miene verriet eine Mischung aus Schuldgefühlen und der Angst, bei der Entweihung von Nazi-Unterlagen erwischt zu werden.
»Von allem anderen einmal abgesehen, ergibt das Bild keinen Sinn.«
»Spielen Sie nicht den Witzbold, Eddie, dafür habe ich keine Zeit.«
Ich beobachtete, wie er mit leicht zitternden Händen Ordnung in die Dokumente zu bringen versuchte. Dabei warf er mehrmals Blicke zur Schublade mit dem Whisky hinüber. Er stand näher am Abgrund, als ich gedacht hatte.
»Der Eigentümer des Jazzclubs«, beharrte ich, »Jean Poquelin.« Gerade rechtzeitig ermahnte ich mich, Dax nicht zu verraten, dass das nicht sein richtiger Name war. »Er wurde heute zurückerwartet, aber ich habe heute Morgen im Club vorbeigeschaut. Alles sah immer noch ziemlich verrammelt aus. Ich habe das Gefühl, er kommt nicht wieder.«
»Warum?«
»Nur eine Ahnung.«
Wir wurden durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Zum ersten Mal in der kurzen Zeit, die ich ihn kannte, war ich froh über Bonifaces Auftauchen. Er beugte sich durch die offene Tür und schenkte uns sein unvermeidliches Zwinkern. Es machte mir nicht mal etwas aus.
»Gerade kam ein Anruf, Eddie. Jean Poquelin, der Besitzer des Jazz Chaud, hat sich gemeldet, um zu sagen, dass er wieder da ist. Wir können ihn besuchen, wann immer wir wollen.«
Mit einem weiteren Zwinkern zog er sich zurück.
Überrascht drehte ich mich zu Dax um.
»Dann haben Sie ja richtiggelegen, hm?«, spottete er.
So vergnügt hatte ich ihn den ganzen Vormittag noch nicht gesehen.
5
Jean Poquelin erwartete mich mit einer Waffe.
Mit vorsichtigen Schritten durchquerte ich sein Büro und näherte mich dem Schreibtisch. Der Chefsessel, in dem Julot gefoltert worden war, stand in einer Ecke des Zimmers, eine Spur von Fingerabdruckpulver markierte den Weg, auf dem er geschoben worden war. Der Bewohner des Zimmers hatte sich offenbar gescheut, darauf Platz zu nehmen, und stattdessen lieber einen der vier schweren Sessel von einem gegenüberliegenden Couchtisch herüberziehen lassen.
Ich machte eine Kopfbewegung in Richtung der Waffe. Es war ein uralter, verschrammter Revolver, der aussah, als sei er über die Jahre hinweg durch die Hände einiger zwielichtiger Besitzer gegangen.
»Den wirst du nicht brauchen.«
»Meinst du wirklich?« Seine Stimme klang neutral.
Ich war mit ihm allein. Boniface hatte darauf zu bestehen versucht, mich zu begleiten, aber ich hatte ihn nicht dabeihaben wollen. Nicht bei diesem ersten Gespräch.
»Glauben Sie wirklich, dass es sicher ist?«, hatte Boniface mich gefragt. In dem Moment hatte mich seine Frage geärgert. Mit dem Revolver vor Augen entlockte die Erinnerung mir ein Lächeln.
Jean Poquelin starrte mich über seinen festungsartigen Schreibtisch hinweg an und schob den Sessel mühsam auf dem widerspenstigen Teppich nach hinten, um sich zu erheben. Er musterte mich von oben bis unten, dann kam er so vorsichtig wie ich um den Tisch herum und machte einen weiteren Schritt auf mich zu. Als er sich vorbeugte, registrierte ich, dass er den Revolver auf dem Schreibtisch gelassen hatte.
»Mein Gott, Eddie, bin ich froh, dich zu sehen.«
Ich ließ seine Umarmung zu und schob ihn dann sanft von mir weg.
»Jean Poquelin?«
Er zuckte die Achseln. »So heiße ich.«
»Nein, tust du nicht. Du bist Fran. Fran Aveyron. Warum der falsche Name?«