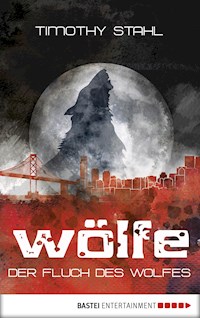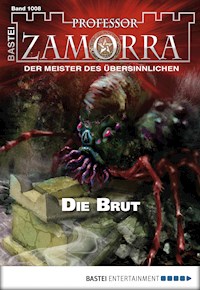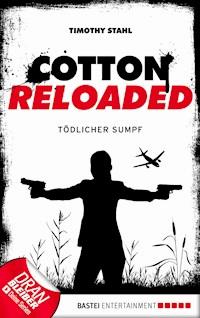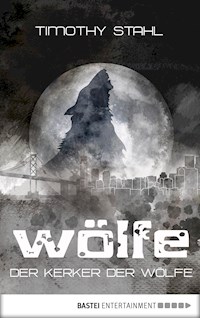1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die UFO-AKTEN
- Sprache: Deutsch
Unheimliche Dinge geschehen in einem Haus in den Harwich Hills unweit Los Angeles: Die Familie Zhou wird offenbar von einem Poltergeistheimgesucht, der es vor allem auf ihren zehnjährigen Sohn Jon abgesehen hat!
Plötzlich steht ein mysteriöser Fremder vor der Tür, um den Zhous zu helfen - doch das erfahrene Medium muss um sein Leben fürchten und ergreift Hals über Kopf die Flucht. Mit etwas dermaßen Fremdartigen wie in diesem Haus wurde der Mann, der weiß, wie man mit Toten und Geistern spricht, in seinem ganzen Leben noch nicht konfrontiert!
Als Cliff Conroy und Judy Davenport auf den Fall angesetzt werden, stoßen auch sie schnell an die Grenzen all dessen, was sie bislang kannten und zu wissen glaubten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Das unheimliche Haus
UFO-Archiv
Vorschau
Impressum
Timothy Stahl
Das unheimliche Haus
Es ist eine heiße Nacht im Juli, der Mond steht hoch über den Bergen. Stanley Wexler verrichtet gerade seinen Dienst in der kalifornischen Neubausiedlung Harwich Hills, als er plötzlich ein Geräusch hört. Konzentriert blickt sich der Wachmann um. Da sieht er einen Schemen, der sich im lichtlos schwarzen Rechteck eines Fensters bewegt.
Wexler zieht seine Waffe, hält den Atem an und späht zu dem Haus hinüber. Die Siedlung ist noch unbewohnt; eigentlich dürfte sich niemand darin aufhalten. Hat sich ein Landstreicher hier eingenistet?
Sekunden verstreichen, doch nun regt sich nichts mehr.
Fast lautlos haucht der Mitarbeiter des Objektschutzes den angehaltenen Atem aus. Trotzdem weicht die Anspannung nicht von ihm, als er auf das Haus zu schleicht...
Neubausiedlung Harwich HillsSan Bernardino County, Kalifornien,04. Juli 2021, 22:13 Uhr
Eigentlich waren sie alle unheimlich – die umstehenden, noch leeren Häuser. Zu einem großen Teil befanden sie sich im Rohbauzustand, waren noch nicht mehr als Balkengerüste. Im Schein des Mondes warfen sie bizarre, einander kreuzende und die Augen täuschende Schatten.
Ein paar Hundert neuer Häuser waren ringsherum im Entstehen begriffen. Ihre Zahl entsprach leicht der einer Kleinstadt – nur breitete sich eine echte Kleinstadt, die im Laufe der Zeit natürlich gewachsen war, über eine sehr viel größere Fläche aus als die hier aus dem Boden gestampfte, ummauerte und mit Toren gesicherte Wohnsiedlung Harwich Hills. Benannt war sie nach den Hügeln im Osten, über die vor nicht ganz 200 Jahren ein Siedler namens Harwich gekommen war, um dieses Stück Land für sich und seine Familie zu beanspruchen. Mit dem jetzigen Verkauf dieses Landes hatten seine Nachfahren nun ein Vermögen gemacht, das gewiss um ein Vielfaches größer war, als hätte ihr Ahnherr seinerzeit Gold in dieser Erde gefunden. Die Parzellen hatten für teures Geld den Besitzer gewechselt, und trotzdem hatten sich die Verkäufer der Interessenten kaum erwehren können. Dazu gehörten allerdings keine Leute wie Stanley Wexler.
Oh, interessiert hätte ihn so ein Grundstück durchaus! Nur leisten hätte er es sich nie im Leben können. Geschweige denn, ein Haus darauf zu bauen. Und einen Pool in den Garten, mit allen Schikanen, um dem Nachbarn in nichts nachzustehen. Und die Kinder auf eine teure Schule zu schicken, damit auch die mit den Nachbarn mithalten konnten ...
Stanley zügelte seine abschweifenden Gedanken, rief sich zur Ordnung, ein Ruck ging durch seine leicht untersetzte Gestalt. Er hätte so ein Haus doch gar nicht gewollt, und einen Pool auch nicht, er schwamm ja noch nicht einmal gerne. Und Kinder hatte er gar keine, nicht einmal eine Frau, mit der er welche hätte haben können. In seiner Zwei-Zimmer-Wohnung wartete nur seine Katze auf ihn, heute Nacht sicher besonders ungeduldig. Die Feuerwerke, die anlässlich des heutigen Nationalfeiertags abgebrannt wurden, verwandelten den Himmel über dem Großraum Los Angeles in ein einziges buntes Flackern, das vor Stunden begonnen hatte und noch Stunden andauern würde. Und immer wieder krachte es wie von Kanonenschüssen, mal näher und lauter, mal leiser und weiter weg.
Hunderttausende Menschen waren es, die da feierten, relativ gesehen ganz in der Nähe.
Trotzdem fühlte Stanley Wexler sich allein.
Wäre ihm hier draußen, in dieser Einsamkeit, inmitten all dieser Rohbauten, irgendetwas zugestoßen – keiner dieser Menschen hätte etwas davon mitbekommen. Niemand wäre gekommen, um ihm zu helfen.
Das war im Grunde die Geschichte seines Lebens: Kein Mensch hatte ihn je richtig wahrgenommen, und niemand hatte ihm je geholfen.
Aber warum war er dann eigentlich wie besessen von dem Wunsch, anderen zu helfen? Er wusste es nicht. Ein Therapeut hätte sicher eine Antwort gefunden. Stanley hatte nie eine haben wollen. Viel wichtiger war ihm, sich diesen Wunsch zu erfüllen.
Und das hatte er geschafft.
Obwohl er in der Schule kein Ass im Sport gewesen war und schon als Kind mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte – ein Kampf, den er tapfer führte, aber nie ganz gewann –, war er zur Tauglichkeitsprüfung für eine Laufbahn bei der Polizei von Los Angeles angetreten. Und er hatte sich nicht entmutigen lassen, als er beim ersten Mal durchgefallen war. Auch nach dem zweiten Fehlversuch nicht. Und schließlich waren aller guten Dinge drei und Stanley drin gewesen.
Er hatte sich den Respekt seiner Kollegen und Vorgesetzten verdient und war das geworden, was man einen guten Polizisten nannte, so wie man sich einen Freund und Helfer im besten Sinne vorstellte.
Für Stanley Wexler war ein Traum wahr geworden.
Dann hatte ihn die raue Wirklichkeit eingeholt.
Zu Stolpersteinen waren ihm ausgerechnet seine Courage und sein Pflichtgefühl geworden.
Er hatte in jener verhängnisvollen Winternacht seinen verletzten Partner nicht in der Gasse liegen lassen wollen, hatte weder auf die Verstärkung noch den Rettungswagen gewartet, hatte sich nicht damit begnügt, dem Kollegen aus sicherer Deckung heraus Feuerschutz zu gewähren.
Nein, Stanley hatte sich zu Paul Ross begeben, er hatte sich neben ihn gekniet, seine Hand genommen, ihm zugeredet.
Paul hatte im Sterben gelegen, unübersehbar. Sein Bauch war von Kugeln zerfetzt, das dunkle Uniformhemd klatschnass und glänzend von Blut, und auch anstelle der Worte, die er sagen wollte, kam ihm nur noch Blut über die Lippen.
Aber nicht das war es, was Stanley nie vergessen würde – sondern der Ausdruck in Pauls Augen, das Lächeln, das er trotz allem zustande gebracht hatte, die Dankbarkeit, dass er, Stanley, hier war, in diesem Moment ...
... und den furchtbaren Schmerz natürlich, als die fliehenden Typen ihm, Stanley, mit ihrem schweren Fluchtwagen, einem SUV, übers linke Knie fuhren. Zweimal. Mit Vorder- und Hinterrad.
Das Bein hatten die Ärzte retten können, das Knie wie ein Puzzle mit ein paar hundert Teilen wieder zusammengesetzt. Nur war es danach fast steif, daran änderten auch die Reha und sein eiserner Wille nicht viel. Und in diesem Zustand taugte er nicht mehr für den Streifen-, sondern nur noch für den Innendienst.
Wäre ihm das gegen Ende seiner Laufbahn passiert, im Alter von fünfzig oder mehr Jahren, hätte Stanley sich mit diesem Los vielleicht abgefunden. Mit gerade mal dreißig hatte er es nicht gekonnt.
Und deshalb arbeitete er jetzt, mit zweiunddreißig, für einen privaten Sicherheitsdienst, inzwischen in der Sparte »Mobiler Objektschutz«, nachdem er als Aufpasser in einem Einkaufszentrum angefangen hatte. Noch nicht einmal ein Jahr lang hatte er auf dieser Einstiegsstufe bleiben müssen. Seine Qualitäten besaß er also offenbar noch, auch mit lädiertem Knie, ...
... das er allerdings just in diesem Moment wieder einmal verwünschte. Denn ganz so zügig, wie er es sich gewünscht hätte, schlich er nicht auf das unheimliche Haus zu. Er zog das linke Bein ein bisschen nach, etwas, woran er sich grundsätzlich zwar gewöhnt hatte. Aber in einer Situation wie dieser kam er sich mit seinem Handicap dann doch wie Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame vor. Was natürlich übertrieben war, das wusste er – nur akzeptierte sein verfluchtes Verantwortungsbewusstsein eben nichts unter hundert Prozent, und es verlangte auch den Einsatz dieser hundert Prozent.
Aber, verdammt, er hatte sie nun mal nicht mehr!
Dann solltest du dich nicht in einem solchen Job nachts im Dunkeln und fern jeder Hilfe herumtreiben, flüsterte es in ihm.
Stanley ignorierte diese böse innere Stimme, die sich immer wieder einmal zu Wort meldete. Oder wenigstens antwortete er ihr nicht. Das tat er nur manchmal, im Bett, wenn er nicht schlafen konnte – oder sie, die Stimme, ihn nicht schlafen ließ. Dann entspannen sich zwischen ihnen mitunter regelrechte Diskussionen, über den Sinn des Lebens, seines Lebens, eines solchen Lebens ...
Aber – nicht – jetzt!, kapitulierte er nun doch, und in diesem Augenblick war es die Stimme in ihm, die ihn in Ruhe ließ.
Danke ...
Er schaltete die Laserzielhilfe seiner Waffe ein. Ein rotes Pünktchen erschien auf der mit Dämmmaterial verkleideten Hauswand vor ihm, fünfzehn, höchstens zwanzig Schritte entfernt.
Im Fenster darüber glaubte er abermals eine Bewegung auszumachen.
Mit einem Ruck hob er die Waffe entsprechend an. Der rote Punkt schnellte an der Wand hoch und fiel durch den leeren Fensterrahmen in die Schwärze dahinter, wo sich nichts rührte.
Nichts mehr rührte – oder gar nichts gerührt hatte? Das war die Frage, der Stanley auf den Grund gehen musste.
Ohne die Waffe zu bewegen, warf er einen Blick zurück zu seinem Wagen. Ein kleines Jeep-Modell, das auch auf unbefestigten Straßen gut fuhr.
Eigentlich hätte er der Zentrale melden müssen, dass er das Fahrzeug verlassen hatte. Er hätte den Grund nennen und die Situation schildern müssen, und in der Zentrale hätte man dann entschieden, ob er sich die Sache näher anschauen sollte, ob man Unterstützung schickte oder gleich die Cops alarmierte. Dabei ging es nicht nur um seine, Stanleys, persönliche Sicherheit, sondern auch darum, den Anforderungen der Versicherung Genüge zu tun.
Denen entsprach beispielsweise auch Stanleys Waffe, bei der es sich nicht etwa um eine Knarre, eine Wumme, ein Schießeisen eben handelte – sondern nur um eine Elektroschockpistole, einen Taser X2, der zwei mit Widerhaken versehene Projektile verschoss, die über isolierte Drähte mit der Kartusche verbunden blieben und von der Waffe ausgehende elektrische Impulse in den Körper der Zielperson leiteten, die so für die Dauer des Stromflusses immobilisiert wurde.
Eine richtige, geladene Schusswaffe gab man einem Baustellen-Cop nicht in die Hand. Die Versicherungssumme hätte in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden. In der Regel trugen nur Personenschützer scharfe Waffen. Auf Baustellen gab es nicht viel zu holen, auch nicht in den anderen Objekten, die Stanley während einer Nachtschicht anfuhr. Und im Falle eines Falles war ja sowieso nicht er es, der einen Diebstahl oder Einbruch persönlich vereitelte. Dafür war ja immer noch die Polizei zuständig.
Die richtige Polizei ...
Er knirschte mit den Zähnen. Und ging weiter. Er würde sich nicht zum Gespött machen, indem er der Zentrale meldete, dass er einen Schatten gesehen zu haben glaubte. Einen Schatten oder was auch immer – im schlimmsten Fall irgendeinen Burschen, der ein paar Schrauben klaute, vielleicht auch nur irgendein Viech, einen Kojoten oder Vogel.
Oder eben gar nichts ...
Er nickte.
Genau.
Und dann sah Stanley Wexler doch etwas. Nur nicht im Haus, sondern am Himmel.
Im ersten Moment glaubte er wieder an eine Täuschung. Im zweiten an einen verirrten Feuerwerkskörper, eine Rakete, die nicht steil nach oben, sondern zur Seite geflogen war, aber ... bis hierher? Wo im weiten Umkreis alles dunkel war, noch kein Mensch lebte und niemand feuerwerkte?
Außerdem ist das Ding doch viel zu groß ...
Ja, es schien weit weg zu sein, auf halber Strecke etwa, schätzte Stanley, zwischen dem Ort, an dem er stand, und den Hügeln im Osten, auf die der Mond inzwischen ein Stück herabgesunken war. Hätte er das Ding, wenn es sich nur um eine Feuerwerksrakete oder dergleichen handelte, überhaupt noch sehen können? Das war doch eine dreiviertel Meile, bis dorthin, mindestens.
Komisch ...
Er drehte sich um, schaute über das Lichtermeer der Umgebung, das vor allem aus westlicher Richtung heranbrandete. Wie mit glühenden Krakenarmen schien der Moloch Los Angeles alle Counties ringsherum zu umschlingen und an sich ziehen zu wollen. Und im Osten nur Dunkelheit, finster wie die Nacht auf einem anderen, noch unbewohnten Planeten – Dunkelheit, der Mond und dieses seltsame Ding eben, das jetzt trudelnd dem Boden entgegenraste, offenbar aufschlug und ... ja, was eigentlich?
Stanley wusste es nicht. Er sah es nicht, von hier aus jedenfalls nicht. Dutzende aufragender Rohbauten nahmen ihm die Sicht.
Auf der Unterlippe nagend schaute er hoch zu dem Fenster, hinter dem er etwas zu sehen geglaubt hatte. Der rote Laserpunkt machte die Bewegung mit und stocherte dort oben im Dunkeln, ohne auf etwas zu treffen.
Weil da eben ganz einfach nichts war. Und etwas anderes jetzt viel interessanter!
Stanley Wexler lief zu seinem Jeep. Das kaputte Knie machte ihm auf einmal kaum noch zu schaffen. So geschmeidig wie lange nicht stieg er ein, fuhr los und davon, auf Pisten ins Hinterland am Fuß der Harwich Hills, hinein in ihre vom Mond geworfenen Schatten, die wie schwarze Löcher im karg bewachsenen Boden zu gähnen und den Jeep zu verschlucken schienen.
Zurück kam Stanley Wexler nicht.
Nach Hause auch nicht.
Vermisst wurde er natürlich. Gesucht auch, aber nicht gefunden.
Er blieb verschwunden.
Spurlos.
Neubausiedlung Harwich HillsSan Bernardino County, Kalifornien,04. Juli, 22:14 Uhr
Zwei Augenpaare beobachteten den uniformierten Wachmann – wie er aus dem Jeep mit dem aufgedruckten Namen der Firma, für die er arbeitete, stieg; wie sein Blick über die Front des Hauses wanderte; und wie er sich dann in Bewegung setzte, vorsichtigen Schrittes näher schlich und ...
»Verdammt, der Typ hat eine Waffe!«, zischte eine helle Stimme in der Finsternis der ersten Etage des noch längst nicht fertigen Hauses, und nun war es nur noch ein Augenpaar, das den Mann da draußen beobachtete.
Kurz geisterte ein roter Punkt durch die Schwärze des Raumes.
»Das ist nur eine Elektroschockpistole oder so was«, flüsterte eine zweite, dunklere Stimme. »Diese Leute laufen nicht mit scharfen Waffen herum. Außerdem ist das Ding viel zu klobig, um eine echte ...«
»Nur? Na, du bist gut! Ich möchte auch nicht von einem Elektroschocker getroffen werden!«
»Krieg dich ein. Das passiert schon nicht.«
»Sagst du!«
»Nun sei doch still!«
»Lass uns abhauen, bitte.«
»Nein, das wäre doch viel gefährlicher!«
»Gefährlicher als hier hocken zu bleiben und uns erwischen zu lassen?«
»Wer sagt denn, dass er überhaupt hier heraufkommt?«
»Das ist sein Job!«
»Ich glaube nicht, dass man ihm genug bezahlt, um sich dermaßen in Gefahr zu begeben, mit nichts weiter als einem Taser in der Hand.«
»Ach, du kennst doch diese Möchtegern-Helden, die man bei Sicherheitsfirmen antrifft. Alles verhinderte oder geschasste Cops, die der Welt beweisen wollen, dass sie eben doch was auf dem Kasten haben.«
»Blödsinn. Und still jetzt.«
»Ja, ja, ich sage ja schon nichts mehr.«
Einen Moment lang waren nur die langsamen, leisen Schritte des Mannes draußen zu hören. Dann verstummte auch dieses Geräusch.
»Was ist?«, wisperte die helle Stimme.
»Er ist stehen geblieben«, antwortete die andere. »Irgendetwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Er guckt da rüber, nach Osten, wenn ich mich nicht täusche.«
»Und was ist da?«
»Keine Ahnung, ich kann von hier aus nichts sehen.«
»Und was macht der Typ jetzt?«
»Scheint zu überlegen.«
»Zu überlegen? Was denn?«
»Was weiß ich? Bin ich Gedankenleser?«
»Sorry, ich bin eben nervös.«
»Schon gut. Ah, er kehrt um!«
»Echt?«
Und schon spähten wieder zwei Augenpaare zum Fenster hinaus.
»Er steigt in sein Auto ein«, fuhr die hellere Stimme aufatmend fort.
Ein Motor sprang an.
»Ja, er fährt weg.«
Sie hörten das Knirschen von Reifen auf Erde und Kies. Scheinwerferlicht streifte kurz über die Fassade des Hauses und schnitt durch die Dunkelheit im Raum. Dann entfernte sich das Motorengeräusch des Jeeps.
»O Mann, das hätte jetzt aber böse enden können«, sagte sie und atmete hörbar auf.
»Allerdings«, pflichtete er ihr bei. »Der hätte uns glatt mit herabgelassener Hose erwischt.«
»Wie das denn? Deine Hose liegt doch dahinten.«
Sie lachten.
Dann machte das nackte Pärchen in der ersten Etage des Rohbaus dort weiter, wo es beim Eintreffen des Wachmannes aufgehört hatte, und genoss dabei die schöne Aussicht auf das Feuerwerk über Los Angeles.
»Turn the clock to zero, boss.The river's wide, we'll swim across.Starting up a brand new day.«– Gordon »Sting« Sumner
Neubausiedlung Harwich HillsSan Bernardino County, Kalifornien,05. Juli, 06:03 Uhr
Obwohl er beschissen losgegangen war, schien dies ihr Glückstag zu sein!
Tina Rodriguez jubilierte innerlich und verkniff es sich gerade noch, vor Freude auf die Hupe ihres Pick-ups zu drücken.
Jetzt nur nicht im letzten Moment noch auffallen ...
Sie hatte gestern zu lange gefeiert, vom 4. Juli in den 5. hinein, war zu spät aufgewacht, und das auch nicht in ihrem eigenen Bett.
Arbeitsbeginn auf der Baustelle war für sie offiziell um halb sechs. Und als leider notorische Zuspätkommerin war der Stein, den sie bei ihrem Vorarbeiter im Brett hatte, mittlerweile leider zu Staub geworden.
»Beim nächsten Mal schick ich dich gleich wieder nach Hause, Kindchen«, hatte er sie beim letzten Mal – und das war erst vorige Woche gewesen – gewarnt, und sein zerknautschtes Großvatergesicht hatte zwar den freundlichen Ausdruck nicht verloren, aber der in seinen Augen war ernst und stahlhart gewesen. »Das ist nicht fair den anderen gegenüber, verstehst du? Ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen, dass ich die Zügel bei dir nicht schon längst fester angezogen habe. Vielleicht ist es ja meine Schuld, dass du ständig zu spät kommst. Weil es keine Konsequenzen für dich hat außer ein paar mahnenden Worten. Aber wie gesagt, Kleines ...«
»Ich hab's verstanden, Boss«, hatte Tina erwidert, und sie hatte es auch so gemeint. Sie wusste, was auf dem Spiel stand, sie wusste, dass sie einfach nur von Glück reden konnte, dass es leicht war, sie zu mögen und ihr alles Mögliche durchgehen zu lassen. Das war schon immer so gewesen – vielleicht zu ihrem Pech, wie sich nun, da der Ernst des Lebens längst begonnen hatte, herausstellte.
Aber, ¡por Dios!, sie war jung, sie war voller Leben, sie hatte Freude daran ... warum, ¿qué diablos?, ging das denn nicht alles zusammen?
Weil das Leben nun mal weder ein Wunschkonzert noch ein Ponyhof war, darum. Ein Spruch, den sie über die Jahre so oft zu hören bekommen hatte, dass er ihr irgendwann aus den Ohren herausgekommen war. Aber weil ihn doch jeder, dem sie ihr Leid klagte, auf der Pfanne hatte, musste wohl etwas dran sein ...
Tina Rodriguez lenkte ihren Pick-up auf die große Abstellfläche, die man für die Fahrzeuge der Baustellenarbeiter eingeebnet hatte. Sie bot Platz für hunderte Autos, schließlich zogen sie hier quasi eine Kleinstadt hoch, und entsprechend groß war die Zahl der Beschäftigten in allen Gewerken.
Die riesige Baustelle selbst war noch gute hundertfünfzig Meter entfernt. Normalerweise hätte die Piste dorthin so gut wie leer vor Tina gelegen um diese Uhrzeit, weil die Kollegen ihren Dienst bereits vor über einer halben Stunde angetreten hätten.
Heute nicht – und das war der Grund, der sie bei ihrer Ankunft hatte jubilieren lassen.
Auf der Fläche zwischen dem Parkplatz und der Baustelle wimmelte es nur so von Leuten. Von Hunderten Männern und Frauen mit Bauhelmen und Warnwesten in Leuchtfarben. Aus irgendeinem Grund kamen sie nicht auf die Baustelle. Ließ man sie nicht, oder weigerten sie sich? Gab es einen Streik? Tina konnte sich an keinen Aufruf dazu erinnern. Es gab auch gar keinen Anlass dazu. Die Bezahlung war okay, die Arbeitsbedingungen auch.
Ihren Helm in der Hand, die gelbe Warnweste über die Schulter geworfen, stiefelte sie los, grüßte und wurde gegrüßt. Dann hörte sie ihren Namen.
»Tina!«