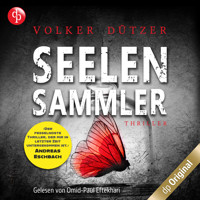Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hannah Bloch
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, 1947. In den Trümmern der Stadt fahndet die junge Hannah Bloch, eine Überlebende der Aktion T4, im Auftrag der Amerikaner nach Kriegsverbrechern. Ihre Aufgabe führt sie nach England, wo sie dem Mörder ihres Geliebten auf die Spur kommt. Sie verfolgt ihn quer durch Europa. Auf ihrem Weg lernt sie den ehemaligen KZ-Häftling Pawel kennen, der nur einen Gedanken kennt: Rache. In ihm findet sie einen Gleichgesinnten, doch Pawel hütet ein dunkles Geheimnis. Sein Hass droht nicht nur ihn zu vergiften, sondern auch Hannah …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Dützer
Die Ungerächten
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Tony Hisgett; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lufthansa_Ju_52_3_(7576559812).jpg
ISBN 978-3-8392-6874-2
Zitat
Auge um Auge – und die ganze Welt wird blind sein
(Mahatma Gandhi)
Charaktere in der Reihenfolge ihres Auftritts
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
Hannah Bloch: Halbjüdin
Ruth Obermayer: Hannahs beste Freundin
Scott Young alias Walter Ritter: Lieutenant der US-Army
Rolf Heyrich alias Paul Schneller: SS-Oberscharführer
Pawel Kowna alias Jakob Demsky: ehemaliger KZ-Häftling
Gerhard Theissen: SS-Hauptscharführer
Gustav Bolkow: Kapo im KZ Sachsenhausen
Anton Kaindl*: Lagerkommandant des KZ Sachsenhausen
Milena Kowna: Pawels Schwester
Josef Kowna: Pawels Vater
Hannelore Kowalski: Oberschwester der Zwischenanstalt Herborn
Dr. Werner Heyde* : Obergutachter der Aktion T4
Joschi: Hannahs stummer Beschützer
Claudius Brendel: katholischer Pfarrer
Hartmut Mitschke: Schrotthändler
Fritz Brunner: ehemaliger Leiter des Anstaltswesens Hessen-Nassau und Landesrat
Max Pohl: Kurierflieger
Esther Olszewski: Pawels Geliebte
Ari und Jaron: Esthers Freunde
Harald Lenz: Staatsanwalt
Heinz Borsig: Brunners Adjutant
Georg Quabbe*: Generalstaatsanwalt in Hessen
Walter Schellenberg*: Chef des SD
Bernhard Krüger*: SS-Sturmbannführer
Friedrich Schwend*: SS-Sturmbannführer
Gisela Wollner: Lenz’ Sekretärin
Rudolf Aschenauer*: Strafverteidiger
Gräfin Cornelia von Gessnitz: Gründerin der Stiftung »Heilende Hände«
Rudi Voss (der Köter): Bandenchef
Kalle: Ruths rechte Hand
Robert Hornickel, genannt Bommi: Wirt des Klävbotz
Leni: ehemalige Köchin in Brunnes Haus
Heinrich Richter (Hein das Wiesel): ein alter Feind Hannahs
Walter Menzel: korrupter Angestellter des Passamts
Vincent Kollweit: Domvikar
Major Foley: Scotts Vorgesetzter in Boston
Frederic de Stuyvens: Ruths Liebhaber
Captain Miller: Scotts Vorgesetzter in Frankfurt
Bischof Alois Hudal*: Rektor des deutschen Priesterkollegs Santa Maria dell’Anima in Rom
Pater Ansgar: Prior von St. Markus
Robert Krüger: ehemaliger Gestapo-Kommissar
Johannes Neuhäusler*: Weihbischof von München und Freising
Albrecht Herrmann: Generalvikar des Weihbischofs Neuhäusler
Karl Morgenschweis*: Gefängnispfarrer in Landsberg
Gottfried Mettmann: Händler, Schieber
Captain Lloyd A. Wilson*: Direktor des Kriegsverbrechergefängnisses Landsberg
Lucius D. Clay*: Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone 1947–1949
Emil Mahl*: Krematoriumskapo in Dachau
Ernst Wilhelm Bohle*: Gauleiter
Werner Hess*: evangelischer Pfarrer
Hans Eisele*: KZ-Arzt
Elmar Bär: Rechtsanwalt
Otto Ohlendorf*: Amtschef im Reichssicherheitshauptamt
Anneliese Schudt: Brunners Hausmädchen
Franz Pobitzer*: Franziskanerpater
Jonas Schickl: Bauer, Schleuser
Sepp Höllinger: Wirt
Bruno Rizoli: Pater, Fluchthelfer
Ambros Gruber: Bürgermeister von Graun
Prolog
Hannah fürchtete die Dunkelheit. Sie sickerte wie schwarze Tinte aus ihren Augenwinkeln und brachte ihre Schwester mit, die Angst. Einen schrecklichen Augenblick lang schwebte Hannah verloren zwischen Traum und Wirklichkeit. Innere und äußere Welt, Vergangenes und Gegenwart vermischten sich und waren bald nicht mehr zu unterscheiden. Weggefährten tauchten auf, die vor vielen Jahren verstorben waren, und gesellten sich wie selbstverständlich zu denen, die lebten.
Die Traumgestalten beunruhigten Hannah nicht. Sie war über neunzig, da war es ganz normal, dass der Verstand ihr ab und zu Streiche spielte und sie am helllichten Tag einnickte. Doch die Todesangst längst vergangener Tage und die schreckliche Ahnung, dass der anbrechende Tag der letzte sein könnte, hatten sie seit sechzig Jahren nicht mehr heimgesucht.
Sie kämpfte sich durch die Begebenheiten eines langen Lebens an die Oberfläche ihres Bewusstseins zurück. Die Geister der Vergangenheit verblassten, die Erinnerungen jedoch, die so unerwartet aufgetaucht waren, wirkten nach. Ihr Herz pochte ängstlich und beruhigte sich nur langsam.
Hannahs Blick irrte umher und richtete sich auf den Fernsehbildschirm. Im klaren Licht der Wirklichkeit erkannte sie, dass der Mann, der mit von Hass verzerrtem Mund die Menge aufpeitschte, nicht Lubeck war. Die Ähnlichkeit allerdings war da und sie hatte die Angst in ihr wachgerufen. Er besaß die gleichen kalten Augen, die harten Lippen und das dunkelblonde, streng gescheitelte Haar.
Die Karikatur, die sie vor fast achtzig Jahren in ihr Schulheft gemalt hatte, kam ihr in den Sinn: ein Ziegenbock mit Klumpfuß und dem Gesicht von Joseph Goebbels – Hitlers Einpeitscher. Mit der unbedachten Kritzelei hatte alles begonnen, ihr junges Leben hatte seine Unschuld verloren.
Der namenlose Schreihals im Fernsehen benutzte beinahe die gleichen Worte wie Goebbels, um die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Sie waren wieder da, die Verführer und Wölfe im Schafspelz. Die braune Hydra war erwacht und streckte ihre geifernden Köpfe aus, um jeden zum Schweigen zu bringen, der sich ihr in den Weg stellte. Hannah hatte Jahre ihres Lebens damit zugebracht, sie zu jagen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Mochten andere den Kampf nun weiterführen. Steinalt, wie sie war, fehlte ihr die Kraft dazu. Fahrig tastete sie nach der Fernbedienung, die leise klappernd zu Boden fiel.
»Warte, Omi Hanni. Ich heb sie auf.«
Judith bückte sich und legte das Gerät mit der spielerischen Geschmeidigkeit der Jugend an seinen Platz zurück. Wie sehr sie Malisha ähnelt, dachte Hannah. Alles wiederholt sich. Das Gute … und das Böse. Das Alte muss sterben, um dem Neuen Platz zu machen. Ihr wurde kalt. Fröstelnd rieb sie sich die Unterarme und zog die Wolldecke höher.
»Alles okay?«, fragte Judith.
Hannah nickte. »Ich war eingeschlafen und hatte einen bösen Traum. Das ist alles.«
Ihre Urenkelin runzelte besorgt die Stirn. »Du bist ganz blass. Man könnte meinen, du hättest ein Gespenst gesehen.«
»Vielleicht habe ich das sogar«, antwortete Hannah.
Judith warf einen Blick auf den Fernseher.
»Er ist es gewesen, nicht wahr? Er hat dich erschreckt.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Weil er aussieht wie der Mann in deinem alten Fotoalbum.«
Einmal mehr war Hannah überrascht über das feine Gespür ihrer Urenkelin. Man kann ihr nichts vormachen, dachte sie zufrieden.
»Ja«, sagte sie, »er hat mich wohl ein bisschen erschreckt.«
»Du solltest dir das Geschrei dieser rechten Idioten nicht anschauen.« Judith schaltete erbost den Fernseher aus.
»Man darf nicht wegschauen«, sagte Hannah. Als müsse sie sich diese Erkenntnis selbst wieder ins Gedächtnis rufen, wiederholte sie den Satz. »Man darf nicht wegschauen.«
Judith zog das abgegriffene Album aus dem Regal im Wohnzimmerschrank und blätterte darin. Hannah wusste, dass die alten Schwarz-Weiß-Fotografien sie faszinierten und ihr ein Fenster in eine völlig andere Welt öffneten; in eine Zeit, in der Hannah so jung gewesen war wie ihre Urenkelin heute.
Das Mädchen betrachtete ein Gruppenbild, auf dem Lubeck zu sehen war. Das Personal der Tötungsanstalt Hadamar hatte sich während einer Weihnachtsfeier ablichten lassen. Hannah überlegte, ob es 1943 oder 1944 gewesen war. Sie wusste es nicht mehr.
»Wer war er?«, fragte Judith.
»Einer von ihnen«, antwortete Hannah leise. »Ein Arzt, der Kranke ermordet hat.«
Ihre Urenkelin zog die Nase kraus, ein sicheres Zeichen, dass sie angestrengt nachdachte. Nun würden die Fragen kommen. Judith war ein wissbegieriges Mädchen von vierzehn Jahren. Sie war nun in dem gleichen Alter, in dem Hannah gewesen war, als die Nazis ihre Kindheit jäh beendet hatten. Einen Moment lang versank sie erneut in der Vergangenheit und hörte die schrille Stimme von Pilz, dem kahlköpfigen Mathematiklehrer.
Nun, was denn, was denn? Was soll denn aus dir werden, Hannah Bloch?
»Wir haben in der Schule gelernt, dass die Nazis die Juden ermordet haben«, sagte Judith, »aber ich wusste nicht, dass sie auch Kranke getötet haben.« Das durchsichtige Schutzpapier knisterte, als sie eine Seite umblätterte. »Du hast mir nie gesagt, wer der blonde Soldat ist.«
Hannah stützte sich auf und schob ihre Brille über die Nase. »Das ist Hans Simonek.«
»Süß«, kommentierte Judith das Foto.
Hannah lächelte. »Ja, das war er.«
Judiths Augen leuchteten. »Du warst in ihn verliebt, ich seh’s dir an. Erzählst du mir von ihm? Was ist aus ihm geworden?«
Hannahs Lächeln erstarb. »Sie haben ihn erschossen, weil er nicht mehr für Hitler kämpfen wollte.«
Das Funkeln in den Augen ihrer Urenkelin erlosch. Behutsam fuhr sie mit den Fingerspitzen über das sepiabraune Bild; eine Geste, die Hannah einen Stich ins Herz versetzte, denn sie erinnerte sich an eine verlorene Liebe und den Schmerz, der damit verbunden war.
»Tut mir leid, Oma. Ich hätte nicht fragen sollen.«
»Unsinn, es ist wichtig, dass nichts davon in Vergessenheit gerät.«
»Wer hat ihn getötet?«, fragte Judith vorsichtig.
»Ein Mann namens Heyrich.«
»Ist er dafür bestraft worden?«
»Ja, das ist er. Ich habe ihn gejagt, bis ich ihn gefunden hatte.«
Judiths Augen wurden groß. »Du? Das musst du mir erzählen. Von Anfang an.«
Hannah lächelte. Ihre Urenkelin war eine aufmerksame Zuhörerin, und vor allem interessierte sie sich für die alten Geschichten aus Kriegstagen.
»Angefangen hat es am 22. Dezember 1939«, sagte Hannah, »in einem Klassenzimmer in Frankfurt an einem kalten Wintertag. Erinnerst du dich an die schlimmen Träume, die du als Kind hattest?«
»Ja. Du sagtest dann, ich würde im Pudding stecken«, antwortete Judith.
»Im Sirup«, verbesserte Hannah. »Mir ging es genauso. An jenem letzten Schultag vor Weihnachten erlitt ich einen epileptischen Anfall vor all den Kindern in der Klasse und vor meinem Lehrer. Du musst wissen, er war ein fanatischer Nationalsozialist. Die Nazis planten, alles Leben zu beseitigen, das sie als lebensunwert erachteten. Sie waren davon überzeugt, dass Kranke und Menschen mit Behinderung das deutsche Volk schädigen und die arische Rasse verunreinigen würden. Darum sollten diese Menschen sterben. Darum sollte ich sterben. Mein Lehrer meldete mich daher den Behörden. Deine Ururgroßmutter Malisha und ich mussten aus Deutschland fliehen.«
»Wohin seid ihr gegangen?«
»Wir kamen nicht weit. Der Mann mit der Narbe verfolgte uns, bis er uns gefunden hatte.«
»Aber du warst doch nur ein Kind.«
»Es ging ihm um Malisha«, erklärte Hannah. »Er hatte sich in sie verliebt, aber meine Mutter wies ihn ab – ein großer Fehler, denn Lubeck besaß Macht und Einfluss.«
»Ich hätte genauso gehandelt«, sagte Judith.
»Ja, sicher hättest du das«, sagte Hannah lächelnd. Was wusste dieses Kind schon von den Kellern der Gestapozentrale in Frankfurt, die sie die Villa genannt hatten, oder von den Gaskammern der Mordanstalten, vom Gestank der Öfen, in denen sie die Leichen der Ermordeten verbrannt hatten. Asche war wie schwarzer Schnee aus dem eisgrauen Himmel gefallen und hatte sich auf ihr Haar und ihre Schultern gelegt.
»Wie hat Lubeck auf die Abfuhr reagiert?«, fragte Judith.
»Er nahm sich mit Gewalt, was er haben wollte.«
»Hat er Malisha gezwungen, ihn zu heiraten?«, fragte Judith schockiert.
»Sie zog es vor, für ihre Überzeugungen zu sterben. Malisha wurde verhaftet, weil sie den Nazis Widerstand leistete. Die Gestapo hat sie ermordet.«
»Das wusste ich nicht«, sagte Judith betroffen. »Ich weiß so wenig über diese schlimme Zeit. Was hast du ohne sie gemacht? Du warst doch noch so jung.«
»Sie steckten mich in eine der Anstalten, in der sie die kranken Menschen töteten, weil ich an einer leichten Form von Epilepsie litt. Ich hatte Freunde, die mir halfen, sonst hätte ich nicht überlebt – Ruth und Thea, Lissy und Scott.«
»Scott – das ist der amerikanische Soldat, von dem du mir erzählst hast, nicht wahr?«
»Ja. Lubeck hat übrigens für seine Verbrechen bezahlt, viele andere gingen straffrei aus.«
»Es gab doch die Nürnberger Prozesse«, sagte Judith.
Hannah nickte. »Die Anführer dieser Mörderbande mussten sich vor Gericht verantworten, aber viele kleine Nazis und Mitläufer sind nach Südamerika geflohen. Scott und ich haben sie gejagt, und ein paar von ihnen haben wir geschnappt.«
»Auch den Mörder von Hans?«
»Ja, auch den. Doch das ist eine andere Geschichte.«
»Erzählst du sie mir? Bitte.«
Hannah schloss die Augen und wanderte in Gedanken in der Zeit zurück.
»Alles begann am 22. April 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen …«
Teil 1 Das Versprechen
1
22. April 1945
Eine unnatürliche Stille lag über Block 13. Jede Abweichung vom gewohnten Tagesablauf ließ Pawel Kownas Herz schneller schlagen, denn sie bedeutete nichts Gutes. Er lauschte auf die Geräusche, die das morgendliche Erwachen des Lagerbetriebs ankündigten. Das Gebrüll der Kapos, wenn sie die Türen der Baracken aufrissen, das Gebell der Hunde, mit denen die Wachen patrouillierten, und das Trampeln und Scharren tausender Füße auf dem Appellplatz. Nichts davon war zu hören.
Bedeutete das Schweigen, dass der letzte Tag im Lager endlich angebrochen war? Die Anzeichen dafür waren im Lauf der Nacht deutlicher geworden, die hektische Betriebsamkeit der Lagerleitung erzeugte Unruhe unter den Häftlingen. Obwohl die Wachmannschaften alles unternahmen, um ihre aufkommende Panik vor dem Einmarsch der Russen zu verbergen, übertrug sich die wachsende Nervosität auf die Gefangenen in Block 13.
Heute war Pawels fünfhundertsiebenundvierzigster Tag im Lager. Für jeden einzelnen dieser Tage hatte er eine Kerbe in das Gestell aus rohen Brettern geritzt, in dem er mit Dutzenden anderen Häftlingen eng aneinandergepresst die Nächte verbracht hatte. Nicht viele schafften es, so lange in Sachsenhausen zu überleben. Das Glück durfte ihn jetzt nicht im Stich lassen, denn die Freiheit war nicht mehr fern.
Vielleicht erwischt es mich heute, dachte er. Sollte er der Nächste sein, den Theissen aus der Reihe zog, um seine sadistischen Spielchen mit ihm zu treiben? Auf welche Weise ihm der Tod wohl gegenübertreten würde, wenn es so weit war?
Pawel drehte sich auf den Rücken und versuchte, sich vorzustellen, wie es wohl sein mochte, wenn der Krieg zu Ende wäre. Er roch die Ausdünstungen seiner Leidensgenossen und hörte das hundertfache Atmen, das Stöhnen und ängstliche Wimmern der Schlafenden. Manche schrien des Nachts und schlugen um sich, weil die allgegenwärtige Todesangst sie in ihre Träume verfolgte. Die meisten jedoch schliefen wie Tote, weil sie zu erschöpft waren, um träumen zu können.
Über das leise Trommeln des Regens auf dem Dach der Baracke legte sich ein Geräusch, das er vor ein paar Tagen zum ersten Mal bemerkt hatte, leise und weit entfernt. Nun war es lauter, ein tiefes Donnern und Grollen, das an ein aufziehendes Gewitter erinnerte.
»Das ist Geschützfeuer«, flüsterte er.
Waren die Russen so nah? Niemand informierte die Gefangenen über den Verlauf des Krieges, doch Gerüchte über die Erfolge der Rotarmisten machten bereits länger die Runde. Die Anspannung der Deutschen bestätigte die Nachrichten, die sich wie ein Lauffeuer verbreiteten, obwohl die Lagerleitung sie zu unterdrücken versuchte. Der Terror der Nazis ging dem Ende zu. In die Hoffnung, dem Wahnsinn entfliehen zu können, mischte sich nun die Angst, noch zu den letzten sinnlosen Opfern zu gehören. Diese Furcht war nicht unbegründet, Pawel kannte die Nazis. Er wusste, was in ihren kranken Hirnen vorging. Wenn sie die Bühne der Geschichte verlassen mussten, würden sie nicht alleine abtreten, sondern alle mit in den Untergang reißen, derer sie habhaft werden konnten. Denn wenn die Welt von den ungeheuerlichen Verbrechen erfuhr, die in den Lagern verübt worden waren, würden die Sieger kein Pardon gewähren.
Chaim, der neben ihm lag, regte sich. »Hörst du das?«, fragte er leise.
»Ja. Die Russen sind da.«
»Ob sie rechtzeitig kommen werden, um uns zu befreien?«
»Ich weiß es nicht.«
Die Tür zur Baracke flog auf, der Wind fegte nasskalte Luft ins Innere. Wachmannschaften stürmten herein, allen voran der glatzköpfige Bolkow, der bereitwillig die Rolle des Kapos übernommen hatte. Er trug eine Armbinde über der schwarzen Jacke und schwang einen Axtstiel. Jeder, der im Lager Sachsenhausen ankam, begriff rasch, dass die SS Handlanger brauchte. Helfer, die die Häftlinge bei der Arbeit beaufsichtigten, Verfehlungen meldeten und sich bei der Bestrafung die Hände schmutzig machten. Deshalb sortierte der Lagerkommandant, SS-Standartenführer Anton Kaindl, Berufsverbrecher und ehemalige Angehörige der SA bei ihrer Ankunft aus. Die meisten waren sofort bereit, für besseres Essen und Privilegien wie Alkoholrationen mit äußerster Brutalität gegen die anderen Gefangenen ihres Blocks vorzugehen.
Bolkow klapperte mit dem Axtstiel an den Streben der Schlafpritschen entlang und drosch auf jeden ein, der nicht schnell genug auf den Füßen stand.
Ganz gegen seine Gewohnheit betrat nun SS-Hauptscharführer Gerhard Theissen die Baracke. Pawels Ahnung, dass etwas Besonderes bevorstand, wurde zur Gewissheit. Theissen wippte auf den Fußspitzen, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und sah ungeduldig zu, wie die Wachen und Kapos die Häftlinge aufscheuchten.
»Raus! Alle raus! Beeilung, wird’s bald? Ich werde euch Beine machen, faules Pack!«
So schnell sie konnten, stürmten die Gefangenen aus der Baracke. Am Ausgang entstand ein wildes Gedränge, das Bolkow dazu nutzte, um auf die Wehrlosen einzuprügeln. Er zerrte Pawel am Ärmel, der in Windeseile aus dem Bettgestell gesprungen und in die zerschlissenen Schnürschuhe geschlüpft war.
»Los, los! Antreten zum Appell!«
Pawel stolperte ins Freie und rannte auf den riesigen Platz zu. Aus allen Teilen des Lagers strömten Häftlinge herbei und stellten sich in Reihen auf. Pawel ordnete sich in seinen Block ein und hielt Ausschau nach seinem Vater. Wie auch seine Schwester Milena war Josef Kowna zeitgleich mit ihm ins Lager gekommen. Seitdem hatte er beide nur zweimal gesehen, das letzte Mal vor einem Monat. Er wusste nicht, ob sie überhaupt noch lebten. Milena war jung und kräftig, aber Josef ein kränklicher, alter Mann, der den unmenschlichen Bedingungen im Lager nicht gewachsen war. Pawel war darum in höchster Sorge um ihn.
Die Posten trieben die letzten Nachzügler auf dem Appellplatz zusammen. Pawel fröstelte in der kalten Luft, der Regen durchnässte seinen gestreiften Drillichanzug. In Gruppen von fünfhundert Häftlingen eingeteilt und vor Kälte und Furcht zitternd, warteten sie über eine Stunde auf Befehle. Wer seinen Platz verließ oder zusammenbrach, wurde umgehend erschossen, das war jedem klar. Pawel sah zu dem Turm neben dem Hauptgebäude hinüber. Auf der Plattform stand ein Maschinengewehr, mit dem die SS den gesamten Platz bestreichen konnte.
Die brodelnde Unruhe unter den Verzweifelten drohte in Panik umzuschlagen. Dies war kein normaler Morgenappell. Wachen und Offiziere liefen hektisch umher, unter ihnen der verhasste Theissen.
Sie räumen das Lager, schoss es Pawel durch den Kopf. Er hatte den Gedanken kaum zu Ende geführt, als die ersten Gefangenen seines Blocks sich unter den Befehlen der Wachposten in Bewegung setzen mussten. Schlamm spritzte von den Reifen eines offenen Wagens auf, der über den durchweichten Appellplatz raste. Walter Schmidtke, Kaindls wegen seiner Gewaltexzesse verhasster Adjutant, saß am Steuer, sein Chef auf dem Rücksitz. Kaindl hatte sich in seinen schwarzen Ledermantel gehüllt und die Schildmütze mit Reichsadler und Totenkopf in die Stirn gezogen. Dem Horch folgten drei Kübelwagen, besetzt mit den oberen SS-Rängen. Die Mörder setzten sich ab.
In der Ferne rollte der Donner des Geschützfeuers der Roten Armee über den Horizont. Pawel schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Soldaten rechtzeitig eintrafen, um ein Massaker zu verhindern.
Jemand verpasste ihm einen Stoß zwischen die Schulterblätter, der ihn beinahe zu Boden warf. Die Kapos schrien Befehle, die Menge kam in Bewegung. In Viererreihen marschierten sie auf das Tor zu. Ein Raunen griff um sich.
»Wohin bringen sie uns?«
»Werden sie uns freilassen?«
»Nein, sie werden uns töten. Uns alle. Niemand wird überleben, sie wollen keine Zeugen.«
Die Wachen begleiteten den Zug. Mit Pistolen und Gewehren bewaffnet, brüllten sie Befehle, knüppelten wahllos auf die Marschierenden ein und erstickten die zunehmende Unruhe unter den Gefangenen. Auch sie waren nervös. Außer Kaindl und Theissen schien niemand zu wissen, wohin es ging.
Sie marschierten etwa eine Stunde, da fielen die ersten Schüsse. Pawel sah mehr als einmal die Schwächsten stolpern und zu Boden stürzen. Wer liegen blieb, wurde erschossen. Er dachte an seinen Vater und stellte sich auf die Zehenspitzen, um die Kolonne besser überblicken zu können, aber er konnte weder ihn noch Milena entdecken.
Gegen Mittag erreichten sie eine Anhöhe. Pawel blickte zurück und sah einen endlosen Zug zerlumpter und ausgemergelter Gestalten in der gestreiften Häftlingskleidung, ein unendlich müder Wurm, der vor Erschöpfung kaum kriechen konnte. Er schätzte die Zahl der Elenden auf mehrere Tausend.
Wenigstens habe ich Schuhe an den Füßen, dachte er. Den Männern, die hart arbeiteten, hatte man häufig welche zugeteilt. Die Frauen dagegen mussten barfuß gehen.
Noch immer regnete es in Strömen. Obwohl der April bereits zu Ende ging, fegte ein bitterkalter Wind über die weite Ebene. Der Hunger wühlte in Pawels Eingeweiden, er atmete stoßweise und achtete darauf, nicht hinzufallen. Er war stets kräftig und zäh gewesen, deshalb hatten sie ihn zur Arbeit in der Klinkerfabrik des Außenlagers eingeteilt – eine unmenschliche Schufterei, die auch die Zähesten nur wenige Monate überlebten. Wenn selbst er am Ende seiner Kräfte war, bedeutete der Marsch ins Ungewisse für seinen Vater den sicheren Tod.
Er dachte an Milena. Ob Theissen seiner Mätresse das Privileg warmer Kleidung gewährte? Vielleicht war er ihrer längst überdrüssig geworden. Pawel hatte seiner Schwester mit Theissens Hilfe einen Posten in der Schreibstube verschafft, in der Hoffnung, damit wenigstens ihr Überleben zu sichern. Seither verdrängte er die Vorstellung, welchen Preis sie dafür zahlen musste. Trotzdem war dies der einzige Weg gewesen, Milena das Überleben zu sichern.
Er wich einer tiefen Pfütze aus und hob den Kopf, um in den Himmel zu blicken, der sich grau und milchig über ihm erstreckte. Die Sonne blieb hinter den Wolken verborgen, und so fand er keine Möglichkeit, einigermaßen die Richtung zu bestimmen, in die sie liefen. Das dumpfe Grollen der Geschütze lag hinter ihm, demzufolge marschierten sie nach Westen. Der Westen, das bedeutete Freiheit! Es hieß, die Amerikaner hätten bereits den Rhein überquert.
Wieder hallte das Echo von Schüssen über das flache Land. Leichen blieben auf dem Boden liegen, die Überlebenden trotteten abgestumpft weiter.
Pawel schätzte, dass es später Nachmittag war, als der Zug einen Bogen beschrieb. Der Regen ließ nach, die Sonne stand nun wie ein fahler, dunstiger Fleck am Himmel. Sie liefen weiter in nordwestliche Richtung, bis es zu dämmern begann.
Plötzlich schrie Bolkow: »Stopp! Stopp!«
Der Zug kam zum Stillstand. Jeder sank dort zu Boden, wo er gerade stand. Pawel sah Gerhard Theissen, der auf einem braunen Pferd saß und sich umschaute.
Ein schlammbespritzter Pritschenwagen rumpelte vorbei. Männer und Frauen, die Armbinden des Roten Kreuzes trugen, blickten mit versteinerten Mienen auf die Elenden herab und warfen Brote in die Menge, um die sich die Kräftigsten balgten. Pawel erwischte ein knochenhartes Stück Schwarzbrot, an dem er zu nagen begann. Der Durst machte ihn fast wahnsinnig.
Ein zweiter Wagen stoppte in einiger Entfernung, endlich teilten Soldaten Wasserrationen aus. Drei Dutzend Häftlinge drängten sich bereits um die Ladefläche. Bevor Pawel den Wagen erreichte, waren die Tanks leer, der Fahrer fuhr wieder los. Auch der Laster, von dem aus die Brote verteilt worden waren, entfernte sich. Die Rationen reichten nur für einen Bruchteil der Marschierenden, der Rest musste hungern oder sterben.
Einige der Durstenden wandten sich ab, legten sich bäuchlings auf den Boden und soffen wie Hunde aus Pfützen. Pawel stolperte in den Straßengraben. Er schöpfte mit der hohlen Hand schmutziges Regenwasser und trank. Dann kroch er frierend und hungrig auf die Straße zurück und rollte sich auf dem nassen Asphalt zusammen. Kurz darauf war er vor Erschöpfung eingeschlafen.
Beim ersten Schimmer des Tageslichts ging es weiter. Teile der Wachmannschaften hatten die Nacht zur Flucht genutzt. Die Angst vor den Russen war größer als die Angst, als Deserteur aufgegriffen zu werden. Theissen sammelte seinen geschrumpften Trupp um sich und trieb die Menge unbarmherzig an. Wer nicht schnell genug auf den Beinen war, den traf ein Knüppel oder gleich eine Kugel. Kaum hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt, da erfüllte ein bedrohliches Summen die Luft und schwoll zu einem Dröhnen an. Zwei Jagdflieger rasten im Tiefflug über die weite Ebene. Sie wendeten und kehrten zurück, schossen jedoch nicht. An ihren Heckleitwerken leuchteten rote Sowjetsterne. Pawel sah, dass Theissen und Bolkow blitzschnell in den Graben sprangen. Ein paar Häftlinge winkten tatsächlich und riefen aus heiseren Kehlen: »Hurra!«
Wozu das alles?, dachte Pawel. Warum machen sich die Nazis nicht aus dem Staub? Warum quälen sie uns noch immer, wo es doch längst vorbei ist?
Sie marschierten einen weiteren Tag und einen dritten, immer Richtung Nordwesten. Träge rechnete er nach. Wenn sie am Tag etwa dreißig Kilometer zurücklegten, mussten sie inzwischen in der Nähe von Wittstock/Dosse sein.
Am frühen Abend erreichten sie den Belower Wald. Man errichtete ein provisorisches Lager, SS-Posten umstellten das Waldstück und überließen die Menschen sich selbst, ohne für Unterkunft oder Nahrung zu sorgen. Hier hatte Pawel unbeschwerte Kindheitstage verbracht, kannte jeden Baum und jeden Strauch.
Da die Zahl der Wachen ständig sank und es nicht mehr genug Stacheldraht gab, um das gesamte Gelände abzusichern, hätte er sich davonschleichen können, doch er wollte seinen Vater und Milena nicht im Stich lassen. Seine so gewonnene Freiheit wäre mit Schuld belastet gewesen. Also blieb er und hoffte, obwohl es längst nichts mehr zu hoffen gab.
Mit Einbruch der Dämmerung hörte der Regen schließlich ganz auf. Sie lagerten auf Wiesen und Lichtungen, eine Kontrolle der Massen durch die SS war kaum mehr möglich. Immer größere Gruppen von Häftlingen flohen im Schutz der Dunkelheit.
Wieder gab es kärgliche Rationen: verschimmeltes Brot, einen Becher Suppe, die fast nur aus Wasser bestand, aber wenigstens den Durst löschte. Pawel streifte zwei Stunden umher und suchte nach seiner Familie. Er fand sie nicht.
Am nächsten Morgen kamen drei Lastwagen an, aus denen Offiziere der Waffen-SS sprangen. Sie teilten die Menge in Gruppen von je dreihundert Gefangenen ein. Theissen fuhr mit einem Kübelwagen davon. Ein junger Soldat – ein halbes Kind noch – stieß Pawel vorwärts. Der Zug setzte sich abermals in Bewegung und gelangte nach einstündigem Marsch in eine geräumte Kaserne. Die Häftlinge wurden auf die Baracken verteilt, aber der Platz reichte nicht für alle. Hunderte schliefen im Freien auf dem Appellplatz.
Pawel war einer der Letzten, die es schafften, in eine der Bretterbuden zu gelangen. Bolkow baute sich vor dem Eingang auf und schrie nutzlose Befehle, die niemand mehr befolgte. Pawels Eingeweide zogen sich vor Hunger schmerzhaft zusammen. Er rollte sich in eine freie Ecke unter einem Fenster und blickte durch die schmutzige Glasscheibe auf ein kleines Stück des Himmels. Was würde nun geschehen?
Aus dem Augenwinkel sah er, dass drei ausgezehrte Gestalten auf Bolkow zutaumelten, ihn umringten und um Essen bettelten. Der Kapo schlug einen von ihnen nieder und rief nach Verstärkung. Theissen betrat die Baracke, zog seine Waffe aus dem Holster und erschoss die beiden anderen Gefangenen. Das Töten war für ihn zu einer beiläufigen, alltäglichen Sache geworden. Danach bat niemand mehr um Essen oder Wasser.
Pawel dämmerte dahin und verlor jegliches Zeitgefühl. Als ihn der Hunger weckte, war es dunkel geworden, Regen prasselte auf das Barackendach. Der undichte Fensterrahmen klapperte im Wind, kalte Luft strich durch die Ritzen und hüllte Pawel in eine eisige Decke. Die Stille wurde vom Seufzen und Jammern der Verhungernden unterbrochen. Durch den Spalt des Fensterrahmens kroch Zigarettenrauch, zwei Männer unterhielten sich leise. Es waren Bolkow und Theissen.
»Es ist also abgemacht?«, fragte der Kapo.
»Wenn du deine Arbeit gut machst, bekommst du Sachen aus der Kleiderkammer. Ich warte im Wald hinter der Scheune«, antwortete Theissen. »Und dann nichts wie weg.«
»Warum der Aufwand?«, fragte Bolkow.
»Glaubst du wirklich, die SS ist scharf darauf, dass die Russen herausfinden, was wir hier mit den KZ-Häftlingen machen? Das darf niemand jemals erfahren. Morgen Mittag, wenn die Scheune brennt, ist das Problem beseitigt. Wir müssen uns vorher passende Sachen raussuchen. Lade jetzt die Benzinkanister auf. Pass auf, wir …«
Ein Windstoß drückte den Fensterrahmen in die Zarge, nur abgehackte Wortfetzen drangen noch herein. Pawel blickte sich um. Keiner der Schlafenden ahnte etwas. Nicht wenige glaubten, dass die Terrorherrschaft der Nazis in ein paar Tagen oder Stunden vorbei sein würde.
Warum hatte ihn das Schicksal dazu ausersehen, als Einziger die Wahrheit zu erfahren? Was er zufällig mit angehört hatte, ließ keinen anderen Schluss zu: Die Nazis ließen niemanden am Leben, weil sie es sich gar nicht leisten konnten. Sie würden jeden Beweis ihrer abscheulichen Verbrechen beseitigen.
Schwankend richtete Pawel sich auf. Er war so schwach, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte, dabei war er zu Beginn der Lagerhaft einer der Kräftigsten gewesen. Nun schlotterte der Drillich um seinen ausgezehrten Körper. Auch wenn er die etwa achtzig Gefangenen warnen würde, die in der Baracke zusammengepfercht waren, was sollten sie unternehmen, unbewaffnet und all ihrer Energie beraubt? Nur ein Wunder konnte sie retten, und seinen Glauben an das Eingreifen Gottes hatte Pawel längst verloren.
Er rutschte kraftlos an der Bretterwand herab und verharrte in der Dunkelheit. Als der neue Morgen graute, kauerte er noch immer unter dem Fenster, gelähmt von der Hilflosigkeit und dem schrecklichen Konflikt, der in ihm tobte. Sollte er den anderen mitteilen, was er wusste? Oder war es besser, sie ahnten nichts, weil sie ohnehin sterben würden?
Motorenlärm riss ihn bald darauf aus seiner Starre. Bolkow stieß die Tür auf und betrat in Begleitung mehrerer Männer in Wehrmachtsuniformen die Baracke.
»Alle Mann raus und antreten!«, brüllte er.
Etwa ein Drittel der Häftlinge war zu schwach, um aufzustehen. Die SS prügelte sie aus den improvisierten Schlafstellen und trieb sie nach draußen. Auf dem Appellplatz standen mehrere Laster und Fuhrwerke. Die Wachmannschaften aus Sachsenhausen hatten Verstärkung durch Wehrmacht und Volkssturm bekommen, überall patrouillierten SS-Männer mit Schäferhunden.
Wer nicht mehr laufen konnte, wurde von den Soldaten wie Vieh auf die Fahrzeuge verladen. Türen wurden zugeworfen, Motoren dröhnten auf. Pawel bewegte sich mechanisch wie eine Maschine.
Während des etwa einstündigen Marsches versuchten erneut mehrere Häftlinge zu fliehen. Zwei Männern gelang die Flucht in den nahen Wald. Die, die es nicht schafften und von den Kugeln der SS durchsiebt wurden, zählte er nicht. Bolkow wich nicht von seiner Seite, aber Pawel wäre ohnehin nicht geflohen. Lieber ging er mit seiner Schwester und seinem Vater in den Tod, als sie im Stich zu lassen.
Der Wald lichtete sich und machte einer weiten Ebene Platz. Inmitten brachliegender Felder erhob sich eine große Scheune aus roh behauenen Brettern mit einem Wellblechdach. Männer des Volkssturms klappten die Seitenteile der offenen Laster herunter und trieben die Menschen mit Knüppeln von den Ladeflächen.
Endlich entdeckte Pawel seine Schwester. »Milena!«, rief er, »Milena! Ich bin hier!«
Sie stand neben einem Pferdefuhrwerk und half einer alten Frau herunter, hörte ihn aber nicht. Theissen beobachtete die Szene und schnalzte ungeduldig mit der Zunge.
Pawel löste sich aus der Menge und hinkte auf Milena zu. Bolkow fluchte und riss ihn zurück. Pawel versetzte dem Kapo einen kraftlosen Schlag, den dieser gar nicht zu bemerken schien.
»Milena!«
Ihre Blicke trafen sich in dem Augenblick, als Theissen seine Waffe zog und ihr in den Kopf schoss. Die zweite Kugel traf die am Boden liegende alte Frau. Pawel schrie schmerzerfüllt auf. Er wollte zu seiner Schwester, doch Bolkow hielt ihn fest, zerrte ihn herum und schlug ihm ins Gesicht. Theissen sah kurz auf und wandte sich gleichgültig ab.
Die Wachen trieben etwa zweihundert Menschen in die Scheune; Männer und Frauen, Junge und Alte. Pawel bewegte sich betäubt und willenlos inmitten der Menge. Ohne Unterlass sah er Theissen, der Milena die Pistole an den Kopf hielt und abdrückte.
»Pawel!«
Jemand rief seinen Namen.
»Pawel, du bist es!«
Ein dürrer alter Mann schob sich zwischen den dicht gedrängt stehenden Menschen hindurch und kam auf ihn zu. Entsetzt erkannte Pawel in der gealterten Gestalt seinen Vater. Die bartstoppeligen Wangen waren eingefallen, die einstmals wachen, regen Augen stumpf und trüb.
Er breitete die Arme aus und drückte den Alten an sich. Eine Weile standen sie eng aneinandergepresst stumm im Halbdunkel der Scheune.
»Milena ist tot!«, sagte Pawel mit erstickter Stimme.
Josef nickte. Er weinte.
Unvermittelt kam Bewegung in die Menge. Eine Frau kreischte entsetzt auf. Vor dem hellen Rechteck des Himmels zeichneten sich scharf wie Scherenschnitte die Silhouetten von vier mit Maschinenpistolen bewaffneten Gestalten ab. Männer des Volkssturms schleppten Kanister herbei und bespritzten die vorne Stehenden mit Benzin. Die Menge wich panisch zurück. Pawel verlor durch seinen Vater, der sich an ihn klammerte, das Gleichgewicht und stolperte. Der Sturz rettete ihm das Leben, denn in diesem Moment eröffnete die SS das Feuer. Ein lebloser Körper begrub Pawel unter sich, dann noch einer. Das Knattern der automatischen Waffen hielt etwa dreißig Sekunden an, danach herrschte Totenstille. Sein Vater grub die Finger in Pawels Ärmel und drückte so fest zu, dass Pawel einen Schrei unterdrücken musste. Er konnte nicht sehen, was nun geschah, begriff aber, dass das Wunder, an das er nicht geglaubt hatte, eingetreten war. Sie lebten.
Jemand stöhnte, worauf ein kurzer Feuerstoß folgte, dann war es still. Pawel hörte ein leises Plätschern. Panik ergriff ihn. Ihm wurde klar, dass er nur überlebt hatte, um qualvoll bei lebendigem Leib zu verbrennen.
Ein machtvolles Fauchen fuhr über die Leichen hinweg, gefolgt von einer Hitzewelle, die Pawel den Atem raubte. Die SS-Mannschaften schlossen die Scheunentore und sperrten das Tageslicht aus, blutrote Höllenglut loderte auf.
Pawel tätschelte die Wangen seines Vaters. Der schlug die Augen auf und verzog vor Schmerz das Gesicht.
»Mein Bein«, krächzte er, »mein Bein.«
Pawel zwängte sich zwischen den Toten hindurch. Er selbst war unverletzt, aber das linke Hosenbein seines Vaters war vom Knie abwärts voller Blut.
Die Feuerwalze raste unerbittlich auf ihn zu, der dichte Qualm nahm ihm die Sicht. Es stank bestialisch nach verbranntem Fleisch. Er hustete und würgte und suchte die Umgebung nach einem Fluchtweg ab.
Die Scheune bestand aus einer hölzernen Fachwerkkonstruktion mit senkrechten Schalungsbrettern, Wellblechplatten bildeten das Dach. Das Gebäude würde binnen Minuten lichterloh brennen. Pawel tastete die Rückwand ab und schob mehrere Strohballen zur Seite, um zu sehen, was sich dahinter verbarg. Er bemerkte, dass auch andere das Massaker überlebt hatten. Verzweifelt versuchten sie, mit Kleidungsstücken das Feuer auszuschlagen.
In der Rückwand entdeckte er zwei Bretter, deren untere Enden abgefault waren. Tageslicht schimmerte durch die Ritzen. Pawel legte sich auf den Rücken und begann, mit den Füßen auf das morsche Holz einzutreten. Die Flammen leckten bereits an den Holzstützen empor, das Atmen fiel ihm mit jedem Zug schwerer. Er hoffte, dass die Mörder sich aus Angst vor dem Feuer von der Scheune fernhielten. Wenn sie die Rückseite bewachten, waren er und sein Vater verloren.
Allmählich gaben die Bretter nach, Stücke verfaulten Holzes flogen davon. Endlich war das Loch groß genug, um ins Freie kriechen zu können.
Der Waldrand lag etwa hundert Schritte entfernt, weder SS noch die Männer des Volkssturms waren zu sehen. Er fragte sich, warum sie bei der Mordaktion mitmachten. Entweder hatte man sie dazu gezwungen oder sie waren genauso fanatisch wie die Teufel in den schwarzen Uniformen.
Sein Vater war kaum bei Bewusstsein. Pawel schob seine Arme unter die Achseln des alten Mannes und zog ihn an die Scheunenwand. Er kroch ins Freie, drehte sich um und zerrte ihn nach draußen.
Die Scheune brannte inzwischen wie eine riesige Fackel, im Inneren konnte niemand mehr am Leben sein. Beißender schwarzer Qualm drang durch die Ritzen und Spalten, selbst in einiger Entfernung war die Hitze unerträglich. Pawel rüttelte seinen Vater an der Schulter. Der Alte hustete und schlug die Augen auf.
»Komm!«
Pawel half ihm auf und stützte ihn. Er machte sich Sorgen wegen der Schusswunde und des Blutverlusts. »Wenn wir den Wald erreichen, sind wir in Sicherheit«, keuchte er.
Der alte Mann schüttelte müde den Kopf. »Ich schaffe es nicht. Du musst allein gehen.«
»Ich lasse dich nicht zurück. Niemals.«
Ohne auf seinen Protest zu achten, betrat Pawel die Wiese und sah sich wachsam um. Die brennende Scheune gab ihnen Deckung, ein stürmischer Wind fachte die Flammen an, die turmhoch in den Himmel loderten. Ein Teil des Daches stürzte ein, Funken stoben auf.
Nach wenigen Schritten spürte Pawel, wie erschöpft er war. Das Gewicht des apathischen alten Mannes zog ihn unerbittlich zu Boden. Sein Vater stöhnte vor Schmerz, er stolperte und stützte sich unwillkürlich auf sein verwundetes Bein.
Der Waldrand, der ihm vorhin so nah vorgekommen war, schien jetzt mit jedem Schritt wie ein Trugbild weiter vor ihm zurückzuweichen. Jeden Augenblick rechnete er damit, dass sie entdeckt wurden. Ein überraschter Ausruf, ein Schuss, dann wäre es vorbei. Aber nichts geschah.
Sie schafften es bis zu einer Gruppe Kiefern mit tief herabhängenden Zweigen. Pawel brach in die Knie, sein Vater fiel zu Boden und blieb auf dem Rücken liegen. Pawel sah zur Scheune zurück. Die Lastwagen fuhren ab, ein Soldat auf einem der Fuhrwerke kämpfte mit den Zugpferden, die von den Flammen in Panik versetzt wurden. Niemand schien auf den Gedanken zu kommen, dass jemand der Feuerhölle entkommen sein könnte. Pawel konnte selbst kaum glauben, dass sie lebten.
Da er kein Messer hatte, versuchte er, mit den Zähnen vom zähen Drillichstoff seiner Hose einen Streifen abzureißen, um die Schusswunde zu verbinden. Der Ausdruck in den Augen seines Vaters erschreckte ihn – so still, so friedlich und demütig.
»Wir müssen weiter«, sagte er.
Unmerklich schüttelte der Alte den Kopf. »Ich würde dich nur aufhalten. Meine Reise endet hier.«
Wütend zerrte Pawel an dem Stoff. »Sag so etwas nicht. Du wirst sehen, wir schaffen es. Wir werden Hilfe finden, irgendwo. Die Nazis sind am Ende.«
»Es ist zu spät.«
Tränen schossen ihm in die Augen. »Nein, das ist es nicht. Glaubst du wirklich, das Schicksal hat uns das Lager, den Marsch und das Feuer überstehen lassen, damit wir hier sterben?«
Sein Vater tastete nach Pawels Hand. »Du musst leben, denn du hast eine Aufgabe.«
Pawel sah ihn verständnislos an. »Was meinst du?«
»Milena … und all die anderen. Sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Jemand muss sie rächen. Versprich mir, dass du die Deutschen für ihre Verbrechen bestrafen wirst. Du wirst nicht allein sein. Der Schrei nach Vergeltung wird sich überall erheben. Und du … musst dir Freunde suchen, Gleichgesinnte, musst …« Sein Brustkorb hob sich stockend, das fahle Gesicht glänzte wächsern. »Versprich es mir.«
Pawel zögerte. Ein Versprechen, das er einem Sterbenden gab, würde er einhalten müssen, auch wenn es seinen weiteren Lebensweg bestimmen sollte.
»Versprich es mir.«
Pawel nickte. »Ich verspreche es.«
»Gut.«
Der Alte schloss die Augen. Nach einer Weile hörte er auf zu atmen. Pawel blieb neben dem Toten sitzen, hielt seine Hand und weinte die Tränen, die er sich all die Monate versagt hatte.
Er wusste nicht, wie lange er neben seinem toten Vater ausgeharrt hatte, als er Stimmen hörte, die ihn aus seiner Starre rissen. Er kroch ins Unterholz und verbarg sich in einer von Haselnusssträuchern überwucherten Senke. Durch die Zweige sah er zwei Männer, die so dicht vor ihm standen, dass er sie beinahe mit der ausgestreckten Hand hätte berühren können. Einer der beiden rollte ein Bündel zusammen und warf es ins Unterholz. Es war eine SS-Uniform. Der zweite Mann trug einen dunklen Wollmantel und eine olivgrüne Feldmütze der Wehrmacht. Es war Bolkow. In dem anderen Mann erkannte Pawel SS-Hauptscharführer Gerhard Theissen.
»Machen wir, dass wir fortkommen«, sagte Theissen.
Bolkow nickte. »Meine Freunde warten bereits auf uns. Wir müssen uns beeilen.«
Sie entfernten sich rasch nach Westen, Pawel blieb allein zurück. Die Mörder würden nun in der Menge der Flüchtenden untertauchen, sich neue Papiere besorgen und niemals für ihre Untaten bestraft werden. Pawel ballte die Fäuste und grub die Fingernägel in die Handflächen, bis der Schmerz unerträglich wurde. In diesem Augenblick schwor er beim Tod seiner Schwester, das Versprechen, das er seinem Vater gegeben hatte, unter allen Umständen einzulösen. Er würde Theissen suchen und ihn eines Tages finden, auch wenn er der Jagd nach ihm sein Leben opfern musste. Und der Tod des verfluchten Mörders sollte erst der Beginn seiner schrecklichen Vergeltung sein.
2
Zwei Jahre später, 8. März 1947
Hannah Bloch schlug den Kragen ihrer pelzgefütterten Fliegerjacke hoch, um sich vor der beißenden Kälte zu schützen. Trotz der warmen Armeestiefel, der olivgrünen Hose und dem Wollschal fror sie. Ihr Atem kondensierte auf der Fensterscheibe der Straßenbahn, die sich ihren Weg durch die Trümmerwüste Frankfurts bahnte. Hannah wusste, dass sie großes Glück gehabt hatte, weil Scott Young, Lieutenant der US-Army und Agent des CIC, einen Narren an ihr gefressen hatte. Er versorgte sie mit allem, was nötig war, um in der zerstörten Stadt zu überleben. So war auch die schicke Jacke ein Geschenk von ihm.
Sie lehnte die Stirn gegen die kalte Glasscheibe und dachte an die vergangene Nacht. Scott besaß alles, was sich eine Frau wünschen konnte. Er war klug, aufmerksam und hatte Humor. Er sah blendend aus und war ein zärtlicher Liebhaber. Sie wusste, dass er sie aufrichtig liebte und bei jeder Gelegenheit auf Händen trug. Eigentlich sollte sie mit einem solchen Mann an ihrer Seite überglücklich sein, denn es erging ihr weit besser als der großen Mehrheit der Bevölkerung. Die meisten Menschen waren vollauf damit beschäftigt, ihr Überleben zu organisieren und schlugen sich nicht mit einem komplizierten Liebesleben herum. Die Stadt war voll mit Frauen, die darauf warteten, dass ihre Männer endlich heimkehrten oder dass sie wenigstens Gewissheit über deren Schicksal erlangten. Niemand wusste genau, wie viele Ehemänner, Väter und Söhne auf den Schlachtfeldern Russlands für den Wahn vom Großdeutschen Reich ihr Leben gelassen hatten. Wie so oft in ihrem Leben hatte Hannah Glück im Unglück gehabt, dennoch brachte sie es fertig, mit dem Schicksal zu hadern und sich über ihre Gefühle im Unklaren zu sein.
Seit Wochen grübelte sie darüber nach, was sie für Scott empfand. An ihm lag es nicht, dass sie regelmäßig Phasen des Trübsinns durchlebte. Er gab sich große Mühe, ihr zu helfen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch die Bilder in ihrem Kopf verfolgten sie auch, wenn sie mit ihm zusammen war. Sie schlichen sich in ihre Träume und schoben sich am Tag immer dann vor ihre Augen, wenn sie glaubte, die schrecklichen Ereignisse loslassen zu können: die Nacht bei der Kapelle, die Grube, Lubeck, der sie zwang, zu graben, bis sie auf die Leichen der Deserteure stieß und damit auf die Erkennungsmarke – den furchtbaren Beweis, dass ihre erste große Liebe Hans Simonek tot war. Vielleicht hätte sie ihn vergessen können, wenn sie sich ehrlich darum bemühte, aber sie wollte es nicht. Solange sie die Erinnerung an ihn wachhielt, lebte er in ihrem Herzen weiter. Und das war ihr Problem.
Die Straßenbahn rumpelte über die notdürftig ausgebesserten Schienen zum Sperrbezirk, den die Amerikaner eingerichtet hatten. Hannah zog die Fliegerjacke enger um ihre Schultern und hörte das Papier in der Innentasche knistern. Trotz ihrer düsteren Stimmung musste sie unwillkürlich lächeln. Fast schämte sie sich wegen ihrer trübseligen Laune, denn die vergangenen Tage waren mit freudigen und aufregenden Ereignissen angefüllt gewesen. Sie zog die CPL aus der Tasche und strich sie glatt. Die internationale Commercial Pilot Licence war auf ihren Namen ausgestellt und trug das Datum vom 7. März 1947 – ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag. Irgendwie hatte Scott es geschafft, die Flugprüfung auf genau diesen Tag zu legen. All ihre Träume hatten sich erfüllt. Sie besaß nun die Erlaubnis, Flugzeuge bis zur Größe einer Junkers 52 zu fliegen. Und damit nicht genug, sie war die einzige Frau, der diese Ehre im Nachkriegsdeutschland bisher zuteilgeworden war. Deutlich erinnerte sie sich an die im Sonnenlicht blitzende Douglas DC-2, an die strengen Blicke des Prüfers und ihre schweißnassen Hände in den ledernen Fliegerhandschuhen, als sie die Maschine getrimmt und die Motoren gestartet hatte. Scott hatte sie als Navigator begleitet.
Eine Stunde später besaß sie eine Pilotenlizenz. Das Mädchen, das in den Wolken nach Bildern gesucht hatte, war erwachsen geworden und erlebte, wie sein Traum Wirklichkeit wurde. Der einzige Wermutstropfen war die Tatsache, dass bislang kein Deutscher die Erlaubnis erhielt, ein Flugzeug zu besitzen oder gar zu fliegen. Nur ausländische Fluggesellschaften wie die Pan American World Airways durften die Flughäfen in Frankfurt und Berlin ansteuern. Wenn sie als Pilotin arbeiten wollte, musste sie darauf hoffen, eine Anstellung bei einer dieser Gesellschaften zu ergattern. Scott hatte bereits versucht, ihr schonend beizubringen, dass die Aussichten dafür schlecht standen. Trotzdem hatte er ihr die Ausbildung bei der US-Army ermöglicht. Noch war ihr nicht ganz klar, warum er das getan hatte, aber er dachte eben praktisch. Vielleicht hatte er bereits einen Plan, mit dem er sie überraschen wollte.
Scott Young arbeitete für den CIC, einen amerikanischen Geheimdienst, dessen Hauptaufgabe in Europa darin bestand, Kriegsverbrecher aufzuspüren. Hannah dachte daran, wie sie Scott im Klingelpütz, dem Kölner Gefängnis, kennengelernt hatte. Wäre sie ihm nicht begegnet, würde sie noch immer eine Haftstrafe wegen Schieberei, Dokumentenfälschung und Schwarzmarkthandel absitzen. Scott hatte sie es auch zu verdanken, dass sie die Gelegenheit erhielt, den Gutachterärzten der Aktion T4 und dem untergetauchten Personal der Tötungsanstalten nachzujagen.
Sie hatte fast zwei Jahre in verschiedenen Anstalten verbringen müssen und mit knapper Not überlebt, und sie kannte die Namen und Gesichter vieler Täter. Deshalb hatte Scott ihre Freilassung aus der Haft erwirkt. Seitdem half sie ihm, nach Ärzten und Pflegern der Mordanstalten zu fahnden. Den einen oder anderen hatten sie erwischt, viele waren jedoch auf freiem Fuß und machten unter falschen Namen bereits wieder Karriere.
Als Zivilangestellte der US-Army kam sie in den Genuss, die als Roundup bezeichnete Straßenbahnlinie 13 benutzen zu dürfen, die vom Bahnhof durch das Sperrgebiet zum Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte im I.G.-Farben-Haus führte. So brauchte sie nicht jeden Morgen zu Fuß den Weg durch die zerstörte Innenstadt zurückzulegen.
Hannah schob die Pilotenlizenz in ihre Jacke und blickte in Gedanken versunken hinaus. Vor den Fenstern zogen Schuttberge und ausgebombte Häuser vorbei. Frankfurt glich einem gigantischen Trümmerhaufen, in dem in Lumpen gehüllte Gestalten nach allem suchten, was ihr Überleben sicherte. Es würden Jahre vergehen, bis die Stadt zur alten Blüte zurückfand. Ob es überhaupt jemals gelingen würde?
Die Bahn drosselte das Tempo und stoppte an der Haltestelle Palmengarten. Die Türen öffneten sich, kalte Luft strömte ins Innere. Drei neue Fahrgäste stiegen ein.
Eine Frau mit hagerem Gesicht und verkniffenen Lippen ging durch den Mittelgang und setzte sich auf einen freien Platz. Hannah betrachtete sie flüchtig, ihre Gedanken weilten weit weg auf einer Wiese an einem Vorfrühlingstag des Jahres 1945. Sie schloss die Augen und sah Hans vor sich, die Grübchen, die sich an seinem Kinn bildeten, wenn er lachte, und seine Augen, die mit dem Himmel um das schönste Blau wetteiferten.
Hannah schüttelte die Erinnerungen ab, denn sie waren zu schmerzhaft. Sie bemerkte, dass die Frau ihren Hut abgenommen hatte. Eine eisige Klaue krallte sich um Hannahs Herz, eine lange verdrängte, alles verzehrende Furcht stieg in ihr hoch. Sie starrte gebannt auf das knochige Profil mit der Geiernase und dem Hexenkinn und wartete, bis die Frau ihr das Gesicht zuwandte. Hannah kannte sie. Nur hatte sie nicht damit gerechnet, an diesem Morgen in der Straßenbahn einer Toten zu begegnen.
3
Die Frau sah durch Hannah hindurch und schien sie nicht wahrzunehmen. Sie trug einen beigefarbenen, elegant geschnittenen Wintermantel, dazu passende Stiefel aus braunem Leder. Sie hieß Hannelore Kowalski, geboren am 23. September 1895 in Gießen. Vom 1. Januar 1938 bis zum 31. Dezember 1944 hatte sie als leitende Oberschwester in der Zwischenanstalt Herborn gearbeitet. Ihr Vorgesetzter war Dr. Herbert Moor gewesen. Ruths Schwester Thea hatte ihn Dr. Schnipp-Schnapp genannt, weil er die Zwangssterilisationen durchführte. Er stand auf der Fahndungsliste des CIC, galt jedoch als unauffindbar.
Sie hatte die Oberschwester mit den knochigen Wangen und der Hakennase, die ihr den Spitznamen der Geier eingebracht hatten, sofort wiedererkannt. Daran änderten auch die modische Kleidung und die dezente Schminke nichts. Hannelore Kowalski mochte sich gehäutet haben, unter der neuen Haut steckte dieselbe alte Giftschlange.
Hannah war inzwischen zu einer selbstbewussten jungen Frau herangereift, die sich vor niemandem fürchtete. In Gegenwart der verhassten Oberschwester kehrte jedoch die Todesangst zurück, die während des Aufenthalts in den Tötungsanstalten in Herborn und Hadamar ihr ständiger Begleiter gewesen war. Jeder Tag hätte der letzte sein können, wenn Ärzte wie Moor und seine gefühlskalten Helfer es so beschlossen. Hannah hatte in ihrer Kindheit unter einer leichten Form von Epilepsie gelitten, im Lauf der Jahre jedoch waren die Anfälle seltener geworden und hatten schließlich ganz aufgehört. Beim Anblick der ehemaligen Oberschwester spürte sie zum ersten Mal seit langer Zeit die vertraute Dunkelheit kommen, die einem epileptischen Anfall voranging. Ihr Puls beschleunigte sich und ihr Blickfeld verengte sich zu einem immer schneller kreisenden Tunnel. Erschrocken kämpfte sie gegen die heranrasende Finsternis an, in der winzige Blitze zuckten.
Lange verdrängte Bilder tauchten vor ihren Augen auf: das kleine Mädchen, dessen Beine zu kurz waren, um in den grauen Bus steigen zu können. Der kleine Ralfi, der sich ängstlich an Hannah geklammert und vier Wochen später tot im Keller der Anstalt gelegen hatte … und die Puppe. Als die Kowalski das Mädchen hochgerissen und in den Bus gestoßen hatte, hatte es die Puppe verloren, eine einfache Puppe mit Armen und Beinen aus gedrehten Hanffasern und kreuzförmig aufgestickten Augen. Das Kind war längst tot, die Puppe besaß Hannah noch heute.
Wie hypnotisiert starrte sie auf das Profil der früheren Oberschwester, die die Transporte in die Tötungsanstalten zusammengestellt hatte. Hannahs Wangen brannten, als lägen die Schläge, mit denen die Frau sie gequält hatte, nicht Jahre, sondern nur Minuten zurück.
Die Kowalski hatte einen kleinen Spiegel aus ihrer Handtasche geholt, musterte kritisch ihre Reflexion und schraubte die Kappe von einem Lippenstift. Die Geste war so alltäglich und harmlos, dass sie auf eine plumpe Weise entwaffnend wirkte. Selbst Hannah vergaß beinahe, dass die Oberschwester Hunderte Unschuldige in den Tod geschickt hatte.
Sie rief sich die Einzelheiten der Akte ins Gedächtnis, die sie vor einer knappen Woche bearbeitet hatte. Laut Zeugenaussagen war Hannelore Kowalski im Frühjahr 1944 von Herborn in die Anstalt Grafeneck gewechselt und dort an den sogenannten »Abspritzungen« beteiligt gewesen. Sie hatte Dutzende Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eigenhändig mit Scopolamin getötet.
Im Gegensatz zu Moor war Hannelore Kowalski von der Fahndungsliste gestrichen worden, weil ihr Mann sie vor einem Monat für tot hatte erklären lassen. Offiziell wurde sie seit einem Bombenangriff auf Gießen im Frühjahr 1945 vermisst. Nun saß sie quicklebendig in der Straßenbahn und zog ihren Lippenstift nach. Offenbar fühlte sie sich völlig sicher. Da sie die Linie 13 benutzte, musste sie gute Verbindungen zu den Amerikanern besitzen. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, schien es ihr finanziell gut zu gehen.
Während Hannah sich von ihrem Schock erholte und darüber nachdachte, wie sie vorgehen sollte, stoppte die Bahn an der nächsten Haltestelle. Die Kowalski verstaute Spiegel und Lippenstift in ihrer Handtasche und stand auf.
Hannah trug weder ihre Uniform noch hatte sie die Befugnis, jemanden festzunehmen. Ihre Aufgabe bestand darin, Listen mit dem Personal der Tötungsanstalten zu erstellen und belastendes Material zu sammeln, das in einem Prozess verwendet werden konnte. Trotzdem musste sie etwas unternehmen. Wenn sie den Geier aus den Augen verlor, würde sie die Frau vermutlich nicht wieder aufspüren können.
Die Türen glitten auseinander, Hannelore Kowalski stieg aus. Hannah folgte ihr in einigem Abstand, vorbei an ausgebombten Mietshäusern und Trümmergrundstücken. Gigantische Schuttberge versperrten ganze Straßenzüge. Hannah nutzte herabgestürzte Mauern und Stapel aufgetürmter Ziegel als Deckung.
Die ehemalige Oberschwester ging über Nebenstraßen nach Osten und überquerte den Börneplatz. Hannah wartete, bis sie die andere Seite erreicht hatte, und eilte an den Ruinen der Synagoge vorbei. Vor vielen Jahren war sie hier Opfer eines bösen Streichs geworden. An jenem Tag hatte ihr Leben eine unheilvolle Wendung genommen. Ob es heute noch mal geschehen würde?
Sie kam an einer Parole vorbei, die an eine Hauswand geschmiert worden war. Seit ein paar Wochen tauchten sie überall auf.
Wir wurden ermordet! Rächt uns! Gedenkt unser!
Auch an den Grundmauerresten der Synagoge leuchteten die Buchstaben blutrot als Erinnerung an die Toten und Mahnung an die Lebenden. Manche behaupteten, sie wären tatsächlich mit Blut geschrieben worden.
Hannelore Kowalski nahm von den stummen Anklagen offenbar keine Notiz, obwohl sie allen Grund dazu gehabt hätte. Nach dreihundert Metern bog sie in eine Nebenstraße ein, die zu dem Haus führte, in dem Hannah und ihre Mutter gewohnt hatten, bevor die Nazis ihr Leben zerstörten. Im Erdgeschoss hatte sich Malishas kleiner Schneiderladen befunden.
Neben einer Litfaßsäule blieb die Kowalski kurz stehen und blickte sich misstrauisch um. Hatte sie bemerkt, dass ihr jemand folgte? Hannah drückte sich in einen Hauseingang und wartete.
Als die Frau weiterging, wagte sich Hannah aus ihrem Versteck und lief los, alles um sich herum vergessend außer der hageren Gestalt. Sie stieß mit einem alten Mann zusammen, der bei der Kollision zu Boden stürzte.
»Kannste nicht aufpassen, Mädchen? Einen alten Mann einfach umzurennen! Wo gibt’s denn so was?«
»Entschuldigung. Warten Sie, ich helfe Ihnen auf.«
Hannah beugte sich über den Alten und versuchte, die Kowalski nicht aus den Augen zu verlieren. Der Geier strebte eilig einem Torweg entgegen, der zu einem Hinterhof führte. An der Mauer hing ein weißes Schild mit der Aufschrift: Dr. med. Moor, Allgemeinmediziner.
Ihr Herz drohte zu zerspringen. Die Kowalski und Moor standen in Kontakt! Die Oberschwester hatte sie, ohne es zu ahnen, auf direktem Weg zu Dr. Schnipp-Schnapp geführt. Eilig zerrte sie am Arm des alten Mannes.
»Nich so hastig. Ein bisschen Geduld mit den morschen Knochen.«
Er stützte sich schwer auf ihre Schulter, fluchte lästerlich und kam unbeholfen auf die Beine. Sein Atem stank nach billigem Fusel.
»Da, sieh nur, was du angerichtet hast!«
Seine Drillichhose war an den Knien durchnässt und schmutzig, auf seiner fadenscheinigen Jacke breitete sich ein Fleck aus, es roch nach Schnaps. Er griff in die Tasche und zuckte zusammen. Von der Spitze seines Mittelfingers tropfte Blut. Offenbar war eine Flasche in seiner Jackentasche bei dem Sturz zerbrochen. Er begann zu jammern.
»Bis zum Schwarzmarkt aufm Römer bin ich gelaufen und jetzt isse kaputt!«
Hannah achtete kaum auf ihn und hielt Ausschau nach der ehemaligen Oberschwester. Sie war verschwunden. Der Mann packte indessen Hannahs Oberarm und schüttelte sie.
»Schau dir an, was se aus mir gemacht haben. Meine schöne Uniform ham se mir genommen.« Er presste verbittert die Lippen zusammen. »’ne feine Gegend war das … vorm Krieg.«
»Lassen Sie mich los!«
Er krallte seine knochigen Finger fester in das Leder ihrer Fliegerjacke.
»’ne feine Gegend. Und ich hab für Ordnung gesorgt. Da hat keiner ’nen armen Mann umgerannt. Siehste den Laden dahinten? Mit den Brettern vor dem Schaufenster?«
»Sie tun mir weh!«
Hannah befreite sich entschieden aus seinem Griff. Der Alte strauchelte und wäre beinahe erneut gestürzt. Er grinste und deutete auf die Durchfahrt zu einem Hinterhof.
»Da haben wir mit dem Pack richtig aufgeräumt … damals. Das waren noch Zeiten.«
Hannah erschrak. Der Alte sprach nicht von irgendeinem Laden, sondern vom Geschäft ihrer Mutter. Der Laden … Malisha, die sich verzweifelt wehrte, Lubeck und die scharfe Schneiderschere in Hannahs Hand. Plötzlich war alles voller Blut gewesen.
»Wie … wie meinen Sie das? Sie haben aufgeräumt?«, fragte sie.
Der Mann richtete sich kerzengerade auf und reckte das Kinn vor.
»November ’38 war das. Da haben wir’s dem Judenpack gezeigt. Mit eisernem Besen haben wir gekehrt, jawoll! Wir Polizisten hatten ja Anweisung, uns rauszuhalten. Aber ich hab trotzdem mitgemischt.« Er machte ein paar unsichere Schritte auf den Laden zu. »Und was hat es genutzt? Das deutsche Volk war es nicht wert. Ein Haufen Schwächlinge, der sich bei den Amerikanern anbiedert.«
Hannah starrte den Alten an. Nun glaubte sie tatsächlich, ihn zu kennen. Ja, er war es. Der Name wollte ihr nicht mehr einfallen, doch das Gesicht erschien ihr auf einmal vertraut. Er war älter geworden, war abgemagert und ungepflegt, darum hatte sie ihn nicht gleich erkannt. Sie sah ihn vor sich, wie er in seiner stramm sitzenden Polizeiuniform die Straße auf und ab patrouillierte und Malisha mit geilen Blicken begaffte. Wenn der Wachtmeister im Torweg zum Hinterhof aufgetaucht war und die Judenkinder verjagte, hatte sie sich zu Tode gefürchtet. Jahre später hatte sie ihn in der Reichskristallnacht vom Fenster der Wohnung im ersten Stock aus beobachtet. Mitgerissen von der Gewalt hatte er das Schaufenster des Schneiderladens zerschlagen und dabei triumphierend gegrölt, sein Gesicht vor Wut verzerrt. Hannah würde den 9. November 1938 niemals vergessen. Zum ersten Mal hatte sie geahnt, was die Zukunft für sie bereithielt. In jener Nacht hatte ihre Kindheit abrupt geendet, die Zeit des Spiels war für immer vorbei gewesen. Was folgte, waren Jahre des Grauens.
»Dreckiges Judenpack«, murmelte der Alte.
Erst die Kowalski und nun der Albtraumwachtmeister ihrer Kindheit. Sie waren überall. Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reichs waren die Hakenkreuzflaggen und SS-Uniformen verschwunden, doch die Männer, die sie getragen hatten, waren noch da. Wie Wölfe im Schafspelz leben sie unter uns, dachte Hannah. Und in ihren Köpfen ist der braune Spuk gegenwärtig, als wäre er nie weg gewesen.
»Hätten wir sie nur alle totgeschlagen, sage ich. Dann könnten sie jetzt keine Lügen über uns anständige Deutsche verbreiten. Wir …«
»Halten Sie den Mund.«
»Hä?«, machte er.
»Ich weiß, wer Sie sind. Glauben Sie etwa, ich hätte Sie vergessen?«
Misstrauisch kniff er die Augen zusammen. »Biste etwa auch eine von denen?«
Hannah erinnerte sich an sein aufgesetztes Imponiergehabe, an den eitlen Stolz, mit dem er die Uniform getragen hatte, in die sie Dummköpfe wie ihn gesteckt hatten.
»Nehmen Sie gefälligst Haltung an, Mensch!«, ahmte sie sein Gebrüll von damals nach. »Zeigen Sie mal Ihren Entnazifizierungsbescheid! Sie haben keinen? Dann wird’s Zeit, dass wir uns mal mit Ihnen beschäftigen.«
Er atmete schwer und glotzte sie böse aus blutunterlaufenen Augen an. Sie machte einen drohenden Schritt auf ihn zu, aufgebracht darüber, dass sie wegen ihm die Spur der Kowalski verloren hatte.
»Hauen Sie ab! Wird’s bald?«
Er wischte sich über den Mund, spuckte auf das Pflaster und trollte sich. Hannah sehnte sich nach Scotts Umarmung, nach jemandem, der sie festhielt und ihr versicherte, dass alles gut werden würde. Ihr war schwindelig. Die gefürchtete Dunkelheit lauerte an den Rändern ihres Blickfelds wie ein Schatten der Vergangenheit, den das Sonnenlicht nicht vertreiben konnte. Wenigstens die Praxis von Dr. Moor würde sie wiederfinden, und damit vielleicht auch Hannelore Kowalski.
Als Hannah die weiße Fassade des I.G.-Farben-Hauses vor sich sah, konnte sie sich nicht erinnern, wie sie hierhergelangt war. Die Begegnung mit dem Betrunkenen und der Frau, die sie jahrelang gequält hatte, wühlte sie mehr auf, als sie zugeben wollte. Sie wies sich am Kontrollpunkt der Sperrzone aus und hastete die Flure des Hauptquartiers der amerikanischen Streitkräfte entlang. Ohne anzuklopfen, stieß sie die Tür zu Scotts Büro auf.
Besorgt blickte er sie an. »Darling, du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.«
»Nicht eins, sondern gleich zwei.«
Er kam um den Schreibtisch herum, drückte sie sanft an sich und küsste sie auf die Wange. Seine warmen braunen Augen, das schmale Gesicht und die vertraute Nähe ließen Hannahs Anspannung abklingen. In seiner Gegenwart brauchte sie sich nicht zu verstellen und konnte sich fallen lassen, ganz sie selbst sein. Sanft fuhr sie durch sein dunkelblondes Haar.
»Ach Scott, manchmal glaube ich, es wird niemals enden. Sie sind überall.«
»Du bist blass wie der Mond. Was ist passiert? Erzähl!«
Sie streifte die Fliegerjacke ab, ließ sich in einen Sessel fallen und berichtete von ihren Begegnungen. Scott setzte sich auf die Kante des Schreibtischs und blickte gedankenverloren auf die zerstörte Stadt hinaus.
»Diese Verbrecher haben sich nicht in Luft aufgelöst, nur weil ihr den Krieg verloren habt. Es waren nicht nur die Görings und Himmlers, sondern vor allem die Meiers und Schmidts, die mitgemacht haben. Sorry, ich fürchte, es werden uns viele – wie sagt man in German? – durch die Lappen gehen.«
»Dann sollen wir die Mörder laufen lassen?«
»Nein, natürlich nicht. Think positive. Wir haben viel erreicht. Seit Dezember stehen die Organisatoren der Euthanasieverbrechen vor Gericht, unter ihnen Brandt und Victor Brack.«
»So viele von ihnen laufen frei herum.« Hannah sprang erregt auf. »Und was machen wir? Akten wälzen und sortieren! Es dauert alles viel zu lange. Inzwischen sind die meisten untergetaucht. Wir haben weder Heyde noch Eberl erwischt.«
»Aber Wahlmann und Gorgaß«, warf Scott ein. »Die anderen kriegen wir auch noch.«
Während er sie prüfend betrachtete, bildete sich über seiner Nasenwurzel eine senkrechte Falte. Ein sicheres Zeichen, dass ihm etwas missfiel oder Sorgen bereitete. So gut kenne ich ihn inzwischen, dachte Hannah.
»Du arbeitest zu viel«, fuhr er fort. »Es gibt mehr Dinge im Leben als die Jagd nach Kriegsverbrechern.«
»Was könnte wohl wichtiger sein, als den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen?«
»Wir beide. Wir sollten heute Abend ausgehen. Du brauchst ein bisschen Entertainment, etwas Ablenkung. Was meinst du?«
Hannah lief erregt auf und ab. Sie nahm Scotts Einladung kaum wahr, zu sehr war sie mit dem Erlebten beschäftigt.
»Paul Schiese ist noch immer Direktor in der Herborner Anstalt.« Das Werbeschild der Arztpraxis drängte sich vor ihr inneres Auge: Dr. med. Moor, Allgemeinmediziner.
»Moor war der Vorgesetzte der Kowalski. Sie arbeitet für ihn. Er betreibt ganz offiziell eine Praxis in Frankfurt! Das können wir nicht zulassen, wir müssen ihn sofort verhaften.«
»Darling.«
Sie schnappte sich ihre Jacke. »Komm. Wir werden ihm einen kleinen Besuch abstatten.«
»Warte, Hannah.«
Sie sah ihn irritiert an. »Was hast du?«
»Setz dich.«
Eine dunkle Vorahnung beschlich sie. »Du wusstest von Moor«, sagte sie.
»Ich wollte es dir die ganze Zeit schon sagen, aber du schienst mir nicht bereit dafür zu sein. Du bist so … fanatic. Hannah, du darfst nicht deine gesamte Zeit mit der Jagd nach Kriegsverbrechern verbringen. Es gibt so viel, was du nicht gesehen hast, so viel zu erleben. Vergiss die damned Nazis.«
»Rede nicht um den heißen Brei herum. Was willst du mir sagen, Scott?«
Er setzte sich hinter den Schreibtisch, zündete sich eine Chesterfield an und schaukelte auf dem Drehstuhl. »Die Administration beabsichtigt, die Verfolgung von Kriegsverbrechern in die Hände der deutschen Staatsanwaltschaften zu legen. Sehr bald schon.«