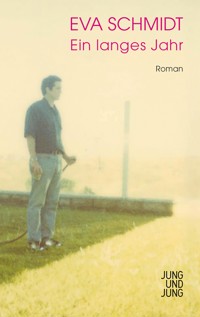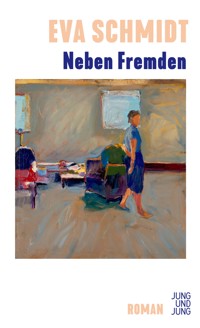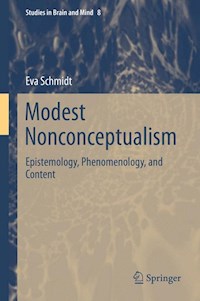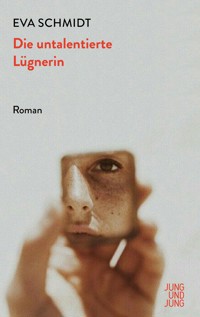
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem ihr Versuch, Schauspielerin zu werden, gescheitert ist, kehrt Maren zurück an den Ort ihrer Kindheit. Mit ihrer bevormundenden Mutter, einer so egozentrischen wie erfolglosen Künstlerin, und ihrem Stiefvater Robert, einem reichen Unternehmer, der für alle und alles aufkommt, lebt sie in dem luxuriösen Haus am See. Als die Spannungen zwischen Maren und ihrer Mutter zunehmen, bietet ihr Robert die Firmenwohnung an. Dort findet sie bald heraus, dass er offenbar ein Doppelleben führt, dass er ihre Mutter nie geliebt hat, dass so vieles anders sein könnte in ihrer kleinen Welt, als es schien. Und dass der Zwang zu lügen stärker wird, je mehr sie weiß.So wie es hinter der stillen Oberfläche ihrer Sätze rumort, so monströs sind die scheinbar alltäglichen Verhältnisse, von denen Eva Schmidt hier erzählt, so berührend wirkt der kühle Ton, den sie anschlägt: ein Psychogramm ohne Psychologie, ein gleichermaßen feinsinniger wie aufregender Roman über den Wunsch nach Nähe und die Sehnsucht nach Grenzüberschreitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© 2019 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,Umschlagbild: Der Rechteinhaber konnte trotz aller Anstrengungen nicht ermittelt werden. Wir bitten zur Abgeltung berechtigter Ansprüche umKontaktaufnahme mit dem Verlag ([email protected]).Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comeISBN 978-3-99027-168-1
EVA SCHMIDT
DieuntalentierteLügnerin
Roman
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
»Das Gedächtnis glaubt, ehe das Wissen erinnert.Glaubt weiter in die Vergangenheit zurück, als esgedenkt, weiter zurück noch als das Wissen fragt.«
William Faulkner
1
Mit neunzehn war Maren zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen. Sie war froh gewesen wegzukommen und hatte nicht vorgehabt, jemals wieder zurückzukehren. Vor allem nicht zu ihrer Mutter.
Ihre Reifeprüfung hatte sie erst im zweiten Anlauf geschafft, und allein die Vorstellung, sich den Anforderungen eines Studiums stellen und sich später in einem Beruf beweisen zu müssen, machte ihr Angst. Beinahe täglich kam ihre Mutter mit neuen Ideen, munterte sie auf, dies oder jenes zu versuchen, schien mehr als Maren selbst über ihre noch unentdeckten Talente und Fähigkeiten Bescheid zu wissen. Und als Maren eines Tages, weniger aus Entschiedenheit als aus Trotz, erklärte, sie würde gern am Theater arbeiten, drückte ihr die Mutter schon bald darauf alle möglichen Studienunterlagen und Anmeldeformulare in die Hand. Aber was immer sie unternahm, alles ging schief. Schlussendlich war es dann eine private Schauspielschule in München, an der sie aufgenommen wurde. Nahe des Englischen Gartens bezog sie eine Wohnung, lebte sich halbwegs ein, ging täglich an der Isar spazieren oder saß in einem kleinen Café in der Haimhauserstraße, in dem sie ihre Ruhe hatte und keinem ihrer Mitstudenten begegnete. Sie war lieber allein, fühlte sich in der Schule als Außenseiterin. Es war ihr schon immer schwer gefallen, sich in eine Gruppe einzufügen, an gemeinsamen Diskussionen teilzunehmen und ihre Vorschläge oder Ideen vor anderen zu präsentieren. Dennoch brachte sie einen Teil ihres Studiums einigermaßen erfolgreich hinter sich. Sie lernte viel, las mehr, als von ihr verlangt wurde, und erledigte ihre Aufgaben gewissenhaft. Manchmal, wenn auch selten, wurde sie gelobt, häufiger aufgefordert, am praktischen Unterricht, an den Übungen und Schulaufführungen engagierter mitzuwirken und mehr aus sich herauszugehen. Oft war sie nervös, manchmal ärgerte sie sich auch über sich selbst, weil es ihr nicht gelang, die Begeisterung der anderen für gemeinsame Projekte zu teilen. Sie ernährte sich schlecht, rauchte zu viel, betrieb keinen Sport und verlor, ohne es selbst zu bemerken, immer mehr an Gewicht. Obwohl sie Hunger hatte, konnte sie oft nichts essen. Dann wieder stopfte sie Unmengen von Süßigkeiten und Fertiggerichten in sich hinein, bis ihr schlecht wurde und sie sich übergeben musste. Nachdem sie ein paarmal ohnmächtig geworden war, sich ständig müde und schwach fühlte und häufig im Sitzen – einmal sogar im Stehen – eingeschlafen war, wurde ihr von der Schulleitung nahegelegt, das Studium aufzugeben. Jemand informierte ihre Eltern, die schließlich kamen, um sie abzuholen. Sie hatten von ihrem Zustand nichts gewusst. Maren war es gelungen, sie mehr als ein Jahr von sich fernzuhalten. Es gehe ihr gut, aber sie sei zu beschäftigt, um Besuch zu empfangen oder heimzufahren, hatte sie am Telefon oder in den Nachrichten, die sie per SMS oder E-Mail verschickte, erklärt.
Sie war so schwach, dass sie in den Wochen darauf zu Hause entweder schlief oder vor dem Fernseher saß, ohne hinterher sagen zu können, was sie gesehen hatte. Ihre Nahrungsaufnahme wurde streng überwacht, meistens von einer Haushälterin, die bemüht war, für Maren schmackhaftes, gesundes Essen zu kochen. Aber auch Vera, ihre Mutter, der Stiefvater und Ruben, ihr Halbbruder, wachten über sie. Doch Maren erholte sich nur langsam, nahm wohl ein wenig zu, versank aber zusehends in Apathie. Und als ihre Mutter sie vor die Wahl stellte, entweder freiwillig eine Therapie zu machen oder in eine Klinik eingewiesen zu werden, erklärte sie sich mit Ersterem einverstanden. Die Entscheidung hatte sie aus reiner Gleichgültigkeit getroffen. Sie verbrachte ein halbes Jahr in einer Therapiestation auf dem Land, wurde am Ende jedoch zu ihrem eigenen Erstaunen als geheilt entlassen.
Als sie an einem regnerischen Herbsttag aus dem Zug stieg, sah sie Robert, ihren Stiefvater, auf sie warten. Er stand auf dem Bahnsteig, suchte mit den Augen die Reihe der Waggons ab. Er trug Jeans und eine Lederjacke, seine blonden Haare hingen ihm in die Stirn. Robert war über fünfzig, sah aber wesentlich jünger aus. Als Kind hatte sie ihn gehasst, sie hatte ihm die Schuld daran gegeben, dass sich ihre Eltern getrennt hatten. Erst viel später hatte sie erfahren, daß Vera ihren Vater mit Robert betrogen und diesem anfangs sogar verschwiegen hatte, dass sie verheiratet war.
Jetzt hatte er sie entdeckt. Winkte. Kam auf sie zu. Als er sie umarmte, sie an sich ziehen wollte, wurde ihr Körper steif. Als er sie zu küssen versuchte, ein Kuss rechts, ein zweiter links, hielt sie ihm die falsche Wange hin, sodass ihre Nasen aneinander stießen und ihre Lippen sich berührten. Es war ihr peinlich, aber Robert lachte nur.
Gut siehst du aus, sagte er und strich ihr über die Haare. Dann griff er nach ihrem Gepäck. Auf der Rolltreppe sagte er, Vera habe keine Zeit gehabt mitzukommen, erklärte umständlich, warum und wieso und dass er an ihrer Stelle gekommen sei. Es war noch nicht spät, halb fünf zeigte die Bahnhofsuhr. Ihre Mutter würde erst am Abend nach Hause kommen. Robert redete ununterbrochen, während sie durch die Bahnhofshalle gingen.
Draußen regnete es. Man sah Menschen mit Schirmen den Platz überqueren, andere sich beeilen, um möglichst schnell unter ein Dach zu kommen. Graue Wolken hingen über der Stadt, es war so dunkel, als würde es bald Nacht. Lichter ankommender und abfahrender Autos blinkten aus allen Richtungen. Maren hatte nach der stundenlangen Zugfahrt Lust auf eine Zigarette. Sie fragte Robert, ob er etwas dagegen habe, irgendwo im Bahnhof noch etwas zu trinken. Er war einverstanden, sagte, vielleicht würde es später auch nicht mehr regnen, er hatte nämlich, nicht anders als sie, keinen Schirm dabei.
In einer Bar im ersten Stock des Bahnhofsgebäudes durfte man rauchen. Robert fragte, was sie trinken wolle, und bestellte zwei Gläser Sekt.
Auf deine Rückkehr, sagte er, als die Getränke kamen. Sie stießen an. Es war ruhig in der Bar. Der Kellner blätterte in einer Zeitung, er hatte wenig zu tun. Nur Robert redete immer weiter. Maren wünschte sich, er wäre still, es war ihr unangenehm, dass der Kellner alles mithören konnte. Deshalb beantwortete sie Roberts Fragen nur knapp. Er sprach über Dinge, die sich während ihrer monatelangen Abwesenheit ereignet hatten. Das Einkaufszentrum mitten in der Stadt, dessen Planung Jahre gedauert hatte, war nicht zustande gekommen. Ein Mann hatte seine beiden Kinder und seine Exfrau erstochen. Es handle sich um eine Familie türkischer Abstammung, sagte ihr Stiefvater. Bei den Landtagswahlen habe die Volkspartei am besten abgeschnitten. Er habe nichts anderes erwartet, meinte er mit zufriedener Miene. Maren antwortete nichts darauf. Es hatte keinen Sinn, mit ihrem Stiefvater über Politik zu sprechen. Als sie noch in die Schule gegangen war, hatte sie es ein paarmal versucht. Sie hatte ihm vorgeworfen, sein Geld in selbstgefällige Kunstprojekte und das Sammeln von Bildern zu stecken, anstatt soziale Einrichtungen zu unterstützen.
Sie erinnerte sich noch gut an eine Auseinandersetzung an einem Abend vor vielen Jahren. Sie war fünfzehn Jahre alt gewesen, in einem Alter, in dem sie sich wie viele ihrer Mitschüler mit Politik zu beschäftigen begann. Der Wohlstand ihrer Familie, für den sie sich in dieser Zeit oft schämte, spielte eine Rolle, dass sie sich mehr für linke, durchaus radikale Theorien interessierte. Ihre Welt bestand aus Schwarz und Weiß, und so schüchtern oder zurückhaltend sie sonst auch war, wurde sie schnell zum Hitzkopf, wenn es um Ungerechtigkeiten ging.
An jenem Abend hatte sie Robert seinen Reichtum vorgeworfen, den er, wie sie meinte, nur seinem Vater zu verdanken habe. Ihm außerdem Überheblichkeit und Desinteresse am Zustand der Welt unterstellt. Robert hatte darauf gelassen reagiert. Er sei ein großzügiger Arbeitgeber, hatte er gesagt, die Leute in seinem Unternehmen würden über Tarif bezahlt und gerne für die Firma arbeiten. Was er sonst mit seinem Geld anfange, sei seine Sache, hatte er gesagt.
Der Streit wäre vermutlich gar nicht eskaliert, wenn sich ihre Mutter nicht eingemischt hätte. In ihren Augen war Maren an allem schuld. Sie zerstöre die Familie, hatte Vera gesagt, lege es darauf an, sie, ihre Mutter, für was auch immer zu bestrafen, trete Roberts Großzügigkeit mit Füßen, treibe einen Keil zwischen sie und ihren Mann. In diesem Ton war es weitergegangen. Roberts Versuche, sie beide zu beruhigen, hatten an jenem Abend nichts bewirkt. Vera hatte gesagt, er solle verschwinden. Was sie ihrer Tochter zu sagen habe, gehe ihn nichts an.
Sie hatte sie angestarrt. Es war ein Blick, den Maren kannte. Ein Blick, der immer nur ihr gegolten hatte, nicht den anderen, nicht den Brüdern, nicht dem Ehemann, nicht den Freunden.
Aber Maren hatte nur gelacht. Sie solle ruhig weiterreden, hatte sie gesagt. Sie könne ihr alles sagen. Dass sie sich eine andere Tochter gewünscht habe zum Beispiel, hatte sie gesagt. Eine Tochter, die sie bewundern, in der sie sich selbst wiedererkennen könne, jedenfalls keine wie sie, die jede ihrer Lügen, ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Gier durchschaue, hatte sie gesagt. Oder so ähnlich. Immer wieder waren es die Augen der Mutter, die sie verfolgten. Der kalte, leere und doch erbarmungslose Blick, der immer nur ihr gegolten hatte.
Ja, hatte Vera gesagt. Ja. Sie war ganz ruhig gewesen. Vielleicht habe sie sich wirklich ein anderes Kind gewünscht. Ein Kind, wie es sich jede Mutter wünsche. Ein normales Kind, das sich nach seiner Mutter sehne, sich von ihr trösten und umarmen lasse. Kein Kind, das seine Mutter ablehne. Von Anfang an habe sie es gespürt.
Was?, hatte Maren gefragt.
Dass sie sie ablehne. Dass sie dieselbe Überlegenheit, denselben Stolz in sich trage wie ihr Vater. Dass sie ihm nicht nur äußerlich ähnlich sei. Dass ihr aus ihrem Gesicht Tag für Tag das Gesicht ihres Vaters entgegenblicke. Dieselbe Verachtung, hatte sie gesagt, derselbe unbegreifliche Stolz, dieselbe Härte.
Und wieder hatte Maren gelacht. Sofern sie sich richtig erinnerte. Ob sie sich von ihr durchschaut fühle?, hatte sie gefragt. Ob es nicht das sei, was sie so durcheinanderbringe? Ob sie selber noch nicht begriffen habe, wie sie die Dinge verdrehe, wie sie Tag für Tag nicht nur sich selbst, sondern auch andere belüge?
Worauf ihre Mutter (endlich, hatte sie gedacht) die Beherrschung verloren hatte. Sie hatte die Hand gegen sie erhoben und zugeschlagen. Einmal, zweimal, vielleicht dreimal. Nichts Schlimmes, nur ein paar Ohrfeigen, sie ließ es lachend über sich ergehen.
All das ging ihr durch den Kopf, während sie neben ihrem Stiefvater in der Bahnhofsbar saß und am liebsten mit dem nächsten Zug wieder abgefahren wäre.
Robert, der inzwischen eine weitere Runde Sekt bestellt hatte, blätterte in einer Zeitung. Maren zündete sich die dritte Zigarette an, sie wollte nicht nach Hause. In das große, schöne Haus, in dem nur noch Robert und ihre Mutter lebten, seit auch der jüngere Bruder weggezogen war. Maren dachte an ihren Vater, an seine Wohnung im zweiten Wiener Bezirk. Vom Balkon aus sah man auf die Donau und auf die Reichsbrücke. Es war eine Altbauwohnung mit hohen Räumen, zwei Zimmern, einer altmodischen Küche, einem Bad mit Fenster in den Innenhof. Ihr Vater lebte seit Jahren allein. Wenn sie ihn besucht hatte, war er nachts immer spät nach Hause gekommen und hatte auf der Couch geschlafen. Über Vera hatten sie nie viel gesprochen. Nur einmal, nach einem seiner Konzerte, von dem er ziemlich betrunken zurückgekommen war, hatte er Maren erklärt, dass er froh sei, seine Exfrau los zu sein. Zum Glück habe sie ihn verlassen. Er hätte es Maren wegen gar nicht gekonnt. Er hätte gewartet, bis sie älter gewesen wäre, bis sie es begriffen hätte, hatte er gesagt.
Es war jetzt still in der Bar, weil niemand mehr sprach. Draußen vor der Glasfassade gingen Menschen vorbei. Sie gingen zu den Bahnsteigen oder kamen von dort. Manchmal hörte man die Stimme eines Ansagers, den Gong, der die Ansage ankündigte, von den Zügen nicht viel mehr als die gedämpften Geräusche der Bremsen, wenn sie einfuhren, oder das Surren der Triebwagen, wenn sie starteten.
Maren zog ihren Pullover aus, rauchte und trank den Sekt, dessen Wirkung sie schon nach wenigen Schlucken spürte. In der hintersten Ecke der Bar saß ein Mann. Er trug einen dicken Mantel, sein Gesicht war nicht zu sehen. Er hatte ein Glas Bier vor sich stehen. Strähnige, graue Haare standen von seinem Kopf ab, fielen über den Kragen des Mantels. Zu seinen Füßen lag ein Hund.
Der Kellner schien eingenickt zu sein. Er hielt die Arme vor der Brust verschränkt, das Kinn war ihm fast auf die Brust gesunken. Die Ruhe wirkte ansteckend, auch Maren musste sich anstrengen, damit ihr nicht die Augen zufielen. Es war sehr warm, roch nach Metall und Kaffee, obwohl niemand Kaffee trank. Robert, der schon eine Weile nichts mehr gesagt hatte, starrte vor sich hin. Im Spiegel hinter der Theke, zwischen den vielen Flaschen, sah sie sein Gesicht. Es war ein Gesicht, das sie schon lange kannte, und wäre der Mann im Spiegel ein Fremder gewesen, hätte sie es gerne berührt.
Doch im selben Moment hörten sie das schrille Pfeifen eines Zuges und das Knirschen von Bremsen. Es war kein Bremsgeräusch, wie man es von einfahrenden Zügen kannte. Eher hörte es sich an, als würde ein Zug in voller Fahrt gestoppt werden.
Dann war es kurze Zeit still. Der Zug schien endlich zu stehen. Eine unheilvolle Ruhe breitete sich aus, wie immer, wenn man wusste, dass etwas geschehen war, aber höchstens ahnen konnte, was es war. Alle lauschten, als wüssten sie, dass es noch nicht vorbei wäre. Und es war auch nicht vorbei. Jetzt begann jemand zu schreien. Laut, gellend, unmenschlich. So, als habe jemand – es war nicht klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte – gerade den Verstand verloren.
Das kommt von einem der Bahnsteige, sagte Robert.
Sie horchten. Der Kellner, der schon beim ersten Pfeifton zusammengezuckt war und erschrocken die Augen aufgerissen hatte, sagte, er werde nachsehen. Er ging auf die Glastür zu, die sich vor ihm öffnete. Sie schauten ihm nach. Sahen, wie er vor der gläsernen Wand stehen blieb, aber nichts zu erkennen schien. Schließlich nahm er die Rolltreppe und fuhr nach unten.
Maren schaute ihren Stiefvater an. Er erwiderte ihren Blick, griff nach ihrer Hand und drückte sie. Sie warteten, sahen den Kellner schon bald zurückkommen. Er war blass im Gesicht, als er sich wieder hinter die Bar stellte, fischte eine Zigarette aus einer Packung, zündete sie an.
Was passiert sei?, fragte Robert.
Sieht aus, als habe sich jemand vor den Zug geworfen, sagte der Kellner. Vor einen Güterzug, der eigentlich durchfahren sollte. Man sieht nicht viel. Ein Wachmann steht auf dem Bahnsteig und versucht, Schaulustige zurückzudrängen. Der Zug ist erst am Ende des Bahnsteigs zum Stehen gekommen. Der Lokführer sitzt auf den Stufen des Triebwagens, er hält den Kopf in den Händen.
Schlimm, sagte Robert. Maren entzog ihm ihre Hand. Sie fühlte sich nicht gut, hatte Angst, dass ihr gleich schlecht werden würde, klammerte sich an den Tresen.
Nach einer Weile meinte der Kellner, es sei eine Zumutung, sich vor den Augen anderer umzubringen. Er rauchte und hatte sich zur Beruhigung ein Glas Cognac eingeschenkt. Bot Maren und Robert ebenfalls ein Glas an.
Gern, sagte Robert. So etwas schlägt auf den Magen.
Von fern war die Sirene eines Einsatzwagens zu hören.
Eine Frau sitzt auf dem Bahnsteig, sagte der Kellner, jemand hat einen Mantel um ihre Schultern gelegt. Bestimmt ist es die, die geschrien hat.
Vielleicht hat sie alles mit angesehen, meinte Robert. Oder es ist jemand, den sie kannte.
Der Kellner nickte. Maren schaute ihn an. Er war noch immer bleich im Gesicht, fast grau, seine Augen hinter den Brillengläsern wirkten viel zu groß. Er nahm einen weiteren Schluck, hustete, bis ihm die Tränen kamen.
Haut einen ganz schön um, sagte er, als der Anfall vorbei war.
Auch der Mann in der Ecke musste von all dem etwas mitbekommen haben. Jedenfalls schaute er her. Er hatte blutunterlaufene Augen und einen starren Blick.
Im Schnitt überfährt jeder Lokführer während seines Berufslebens drei Menschen, sagte der Kellner.
Was?, fragte Robert.
Statistisch gesehen, ergänzte der Kellner.
Spendierst du mir auch einen?, rief der Mann in der Ecke. Der Kellner nickte, schenkte ein weiteres Glas ein, schob es in seine Richtung. Schwerfällig erhob sich der Alte, kam wankend näher, griff gierig und so schnell nach dem Glas, als könnte man es ihm wieder wegnehmen. Ging damit zurück in seine Ecke.
Maren wollte gehen. Sie hatte ein ganzes und ein halbes Glas Sekt und den Cognac getrunken und eine weitere Zigarette geraucht, die ihr der Kellner angeboten hatte. In ihren Ohren rauschte es, ihre Finger fühlten sich taub an. Aber zum Glück war ihr nicht mehr schlecht.
Robert, sagte sie und schaute ihn an. Er fasste sie am Arm, hatte verstanden, dass sie gehen wollte.
Kann ich zahlen?, fragte er. Wir müssen aufbrechen.
Schon?, fragte der Kellner.
Ja. Alles zusammen, sagte Robert mit einer Handbewegung, die alle Getränke, auch die des Mannes in der Ecke, einschließen sollte. Aber der Kellner verrechnete nur den Sekt. Sagte, der Rest gehe aufs Haus.
Maren stolperte, als sie vom Barhocker herunterkletterte.
Hoppla, sagte Robert und fing sie auf. Dann, zum Kellner: Auf Wiedersehen. Und danke.
Nichts zu danken, erwiderte der Kellner. Schönen Abend noch.
Beim Verlassen der Halle sahen sie einen Rettungswagen vorfahren. Ein anderer stand mit rotierendem Blaulicht bereits im Eingangsbereich. Ein Polizeiwagen blockierte die Zufahrt. Aber der Regen hatte etwas nachgelassen.
Geht es?, fragte Robert, nachdem sie ihr Gepäck verstaut und im Wagen Platz genommen hatten. Sie nickte. Ihr Stiefvater startete, bahnte sich einen Weg aus dem Verkehrschaos. Als sie das Bahnhofsgelände hinter sich hatten, blitzte zwischen dunklen Wolken die Sonne hervor.
Das gibt einen Regenbogen, sagte Robert. Er hielt sich eine Hand über die Augen, weil es ihn blendete. Dann, sie fuhren jetzt nach Norden und hatten die Sonne in ihrem Rücken, legte er eine Hand auf ihr Knie.
Geht es?, fragte er noch einmal.
Ja, erwiderte Maren.
So etwas passiert einfach, sagte er.
Danach schwiegen sie, bis sie zu Hause ankamen. Es war eine Fahrt, die nicht lange dauerte.
2
Maren lief mit Pablo durch den Wald. Während ihres Aufenthalts in der Klinik war sie täglich eine größere Strecke gelaufen. Über die Wiesen, die zum Gebäude gehörten, und durch ein Stück Wald, in dem es auf und ab ging. Ihre Kraft war zurückgekehrt, außerdem hatte sie davon Hunger bekommen und sich wieder an regelmäßiges Essen gewöhnt. Es hatte viele Angebote gegeben, sich zu beschäftigen. Reiten, Malen, Theaterspielen, Gärtnern, einen Workshop für kreatives Schreiben, an dem sie teilgenommen hatte und gemeinsames Kochen. Gruppen- und Einzelgespräche mit den Therapeuten hatten ebenso zum Tagesablauf gehört wie die Arbeit an einem Nebengebäude, das renoviert und ausgebaut werden sollte. Ein kleiner Veranstaltungsraum mit einem Café für Besucher und Klienten sollte dort entstehen. Die Arbeit hatte ihr gefallen, sie hatte gemalt, Möbel restauriert, Fliesen verlegt. Abends war sie so müde gewesen, dass sie beim Lesen eingeschlafen war. In den Nächten hatte sie geträumt und tagsüber manchmal über ihre Träume gesprochen. Meist waren es gute Träume gewesen. Erst als sie entlassen wurde, war die Angst zurückgekehrt.
Sie lief, sprang über Wurzeln, bahnte sich eigene Wege quer durch den Wald, spürte den federnden Boden unter ihren Füßen. Manchmal stolperte sie über Schlinggewächse oder verfing sich in Dornen, und zwischendurch blieb sie stehen, um auf Pablo zu warten, der im steilen Gelände einer Spur nachjagte.
In der Nacht hatte es geregnet, noch immer tropfte Wasser von den Bäumen, lief ihr über das Gesicht und in den Kragen. Bald wäre sie wieder zu Hause, schon tauchten am Waldrand die ersten Häuser auf. Es waren große, oft herrschaftliche Häuser, alte Villen, die man aufwendig renoviert hatte, Neubauten mit ausladenden Terrassen, Wintergärten und Schwimmbädern. Dazwischen ein Bauernhof, umgeben von großflächigem Weideland, das nicht bebaut werden durfte. Es war die Gegend der Reichen, zu denen auch ihre Familie gehörte.
Seit ihrer Ankunft vor ein paar Wochen schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Maren hatte keine Ahnung, wie ihr Leben weitergehen sollte, wusste nur, dass sie bald wieder weg wollte. Ihre Tage bestanden aus Waldläufen, Lesen, Rauchen, Kaffeetrinken, Essen. An manchen Abenden kochte sie etwas, bevor Robert und ihre Mutter nach Hause kamen, dann saßen sie zu dritt am Tisch und versuchten, sich möglichst unverfänglich miteinander zu unterhalten. Besonders Robert war darum bemüht, lobte das Essen, obwohl Marens Kochkünste mehr als bescheiden waren und ihr manches misslang. Sprach über Politik, über das Wetter, über Veranstaltungen, die sie gemeinsam besuchen könnten, über kulturelle Ereignisse in der Stadt. Oft fragte sich Maren, wie Robert seinen Beruf und seine privaten Interessen unter einen Hut bringen konnte. Er führte ein erfolgreiches Unternehmen, war Vorstand des Kunstvereins, besaß eine umfangreiche Bildersammlung und hatte sich als Förderer von Kulturprojekten einen Namen gemacht. Daneben hatte er sich um die Familie gekümmert, hatte mit Maren und ihren Halbbrüdern viel unternommen. Inzwischen waren seine Bemühungen, ihr Familienleben möglichst harmonisch zu gestalten, allerdings nicht mehr besonders gefragt. Vera kam müde nach Hause, wollte sich nach einem Arbeitstag, den sie mit Malen oder mit Menschen, die sich für ihre Bilder interessierten, in ihrem Atelier verbracht hatte, entspannen. Die gemeinsamen Abendessen, die ohnehin nur sporadisch stattfanden, schienen ihr lästig. Lieber setzte sie sich mit einem Glas Champagner auf die Couch, blätterte in Illustrierten und Modezeitschriften, die sich im Wohnzimmer stapelten, oder schaute im Fernsehen einen Film. Auch das Essen schmeckte ihr nicht. Vera achtete auf ihre Linie, stocherte in dem Wenigen, das sie sich aufgeladen hatte, herum und ließ meistens etwas auf dem Teller liegen. Die einzigen Themen, die sie interessierten, betrafen ihre Kunst und die Resonanz auf ihre Ausstellungen, den Verkauf ihrer Bilder, die beiden Söhne, mit denen sie hin und wieder telefonierte, und Marens Zukunft. Und während Maren die unangenehmen Fragen ihrer Mutter und ihre unnützen Ratschläge über sich ergehen ließ, zielten Roberts Ablenkungsbemühungen darauf, sie davor zu schützen.
Maren betrat das Haus durch die Garage, reinigte Pablo die Pfoten, stellte ihre Wanderschuhe ins Regal und ging in den Flur. Sie hörte Schritte, vermutlich war Maria noch da. Es war kurz vor Mittag. Die Haushälterin stand mit einem umgebundenen Kopftuch in der Garderobe. Sie schlüpfte in ihren Mantel und sagte, sie habe gerade gehen wollen. Sie habe für Maren eine Suppe gekocht, sie sei bestimmt noch heiß.
Danke, sagte Maren und lächelte Maria an. Die Haushälterin war die gute Seele des Hauses, wie Robert immer wieder betonte.
Wie alt Maria wohl war? Fünfzig vielleicht? Oder jünger? Ihr Alter war schwer zu schätzen. Maren wusste nichts von ihr, obwohl sie seit Jahren für die Familie arbeitete. Sie schämte sich. Sie hatte Maria nie gefragt, ob sie einen Mann, ob sie Kinder hatte, wusste nicht einmal, wo sie wohnte.
Später, als sie draußen eine Zigarette rauchte, nahm sie sich vor, an einem der nächsten Tage mit ihr zu sprechen. Sie würden zusammen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen. Maria würde ihr von ihren Kindern erzählen. Sie sind schon erwachsen, würde sie vielleicht sagen. Die Tochter habe ein Kind, aber die Ehe sei auseinandergegangen. Sie sei eine gute Mutter, habe es aber nicht leicht. Maren stellte sich die Familie vor. Den Sohn, der Handwerker war und alle Schäden im Haus reparierte. Ein altes Haus am Stadtrand. Bestimmt hatte Maria einen kleinen Garten, in dem sie Gemüse anpflanzte. In Marens Vorstellung saß die Tochter mit Maria in der Küche, das Kind auf dem Schoß der Großmutter. Oder Marias Mann ging mit dem Kind spazieren, damit sich Frau und Tochter etwas erholen konnten.
Es war so einfach, über andere nachzudenken, sich vorzustellen, wie sie lebten, was sie sagten. Einfacher, als sich über das eigene Leben Gedanken zu machen. Schließlich waren es immer dieselben Fragen, die sie sich stellte. Was kann ich tun? Wie geht es weiter? Wie soll mein Leben, meine Zukunft sein?
Sie aß einen Teller Suppe, tunkte Brotstücke hinein. Es schmeckte gut. Danach ging sie in ihr Zimmer, legte sich aufs Bett, stand aber gleich wieder auf. Es war kalt. Sie hatte vergessen, das Fenster zu schließen, machte es zu. Am liebsten wäre sie wieder ins Freie gegangen. Doch es regnete. Außerdem war sie müde. Sie könnte jemanden besuchen. Aber wen? Zu ihren Mitschülerinnen hatte sie schon lange jeden Kontakt verloren, war auch mit kaum jemandem richtig befreundet gewesen. Manchmal hatte sie sich verliebt, hatte mit dem einen oder anderen Sex gehabt. Mehr nicht. Ihre Verliebtheit hatte nie lange angehalten, sie fand die jungen Männer ungeschickt. Die meisten wussten nicht, wohin mit ihren Händen, waren entweder zu hastig oder zu zögerlich, rochen nach Schweiß oder billigen Düften, die den Schweißgeruch überdecken sollten. Der einzige, in den sie mehr als ein paar Wochen verliebt gewesen war, war Max. Vielleicht sollte sie ihn anrufen? Sie öffnete die Kontaktliste auf ihrem Mobiltelefon, suchte seinen Namen. Dann fiel ihr ein, dass sie die Nummer kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag gelöscht hatte.
Sie machte den Kühlschrank auf. Sah eine Flasche Champagner, die bereits geöffnet war. Ihre Mutter trank, wenn sie abends nach Hause kam, gern ein Glas Sekt. Sie sagte immer »ein Gläschen«, aber in Wahrheit wurden es dann zwei, drei Gläser und zum Abschluss noch Rotwein oder ein Cocktail, den Robert für sie mixte.
Maren schenkte sich Saft ein, ging wieder auf die Terrasse, setzte sich auf einen der Loungesessel im überdachten Bereich. Sie dachte an die Frau, die sich vor ein paar Wochen, an dem Tag, an dem sie nach Hause gekommen war, das Leben genommen hatte. Später hatte sie einen Bericht darüber in der Zeitung gelesen. Eine Frau in ihrem Alter war vor einen Güterzug gesprungen. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die junge Frau war sofort tot gewesen, der Zug hatte ihren Körper ein Stück mitgeschleift. Es gab Hinweise auf psychische Probleme. Reisende und Bahnangestellte, die den Vorgang beobachtet hatten, waren befragt worden. Eine Statistik gab Aufschluss über alle Suizide der vergangenen zehn Jahre, eingeteilt in Todesarten, Alters- und Geschlechtsangaben. Die Frau, die auf dem Bahnsteig geschrien hatte, war die Mutter der jungen Frau. Sie habe die Tat nicht verhindern können. Ihre Tochter habe ruhig gewirkt, bevor sie gesprungen sei.
Inzwischen hatte der Regen aufgehört. Über dem Westufer des Sees lichtete sich der Himmel. Maren blickte über die Dächer der Häuser weiter unten am Hang, sah die Wohnblocks am Stadtrand, das alte, elfstöckige Hochhaus, das weit über die anderen hinausragte. Sie mochte die Balkone mit den hellblauen Brüstungen, die vielen Fenster, hinter denen sich hin und wieder etwas bewegte. In manchen Wohnungen brannte Licht.
Seitdem sie wieder zu Hause war, hatte sie sich um alle möglichen Jobs beworben. Sie suchte Arbeit, wollte unabhängig sein, aber bisher hatte nichts geklappt. Zurück im Haus, sah sie auf dem Frühstückstisch die Zeitung liegen, schlug die Seite mit den Stellenangeboten auf. Eine Mitarbeiterin für das Aufsichtsteam der Kunsthalle wurde gesucht. Sie las, welche Voraussetzungen die Bewerberinnen mitbringen sollten, und musste lachen. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Grundkenntnisse in französischer Sprache erwünscht, gepflegtes Erscheinungsbild, freundliches Auftreten, kommunikative Fähigkeiten, Bereitschaft für Abend- und Wochenenddienste. Warum nicht? Sie stellte sich vor, wie sie stundenlang auf einem Stuhl sitzen würde, um die Besucher davon abzuhalten, etwas zu berühren. Hin und wieder würde jemand etwas fragen. Wo die Toiletten seien? Wie die Audiogeräte funktionierten? Maren hatte einige Ausstellungen in der Kunsthalle besucht. Sie kannte die hohen, fensterlosen Räume, in die durch die milchige Glasfassade weiches, gebrochenes Licht fiel. Sie hatte die Aufsichtspersonen gesehen – meist waren es junge Mädchen oder ältere Frauen, hin und wieder ein junger Mann, ein Student. Bei ihrem letzten Besuch hatte sie sich auf eine der Lederbänke gesetzt und gewartet, bis alle Besucher das Stockwerk verlassen hatten. Es hatte nicht lange gedauert, bis die nächsten kamen, doch ein paar Minuten war sie allein gewesen. Allein mit den Kunstwerken und einer auf ihrem Platz sitzenden Frau, die Maren nicht zu beachten schien, der aber vermutlich keine ihrer Bewegungen entging.
Pablos Bellen riss sie aus ihren Gedanken. Es klingelte. Sie lief die Treppe hinunter, öffnete die Haustür. Ein Paket wurde abgegeben. Ein Paket für ihre Mutter. Kleidungsstücke oder Schuhe. Vera legte Wert darauf, gut angezogen zu sein. Pablo drängte sich an ihr vorbei, beschnüffelte den Zusteller. Es war ein junger Mann, der Maren anlächelte und keine Angst vor Hunden zu haben schien. Maren unterschrieb, wollte dem Mann ein Trinkgeld geben, aber er war schon weg. Ciao, hatte er noch gerufen, die Autotür zugeknallt. Der Motor heulte auf, als er ein Stück zurück setzte, dann den Gang einlegte und die steile Straße hinunterfuhr.
Sie schaute dem Lieferwagen noch eine Weile nach, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. Vielleicht sollte sie Paketzustellerin werden? Den Menschen Päckchen bringen, in denen sich Waren befanden, die sie sehnsüchtig erwarteten, dringend benötigten, bei Nichtgefallen wieder zurückschickten. Sie ging in ihr Zimmer, startete ihren Laptop und verschickte per Mail eine Bewerbung an die Kunsthalle. Es war schnell erledigt. Sie beschrieb sich selbst als kunst interessiert, flexibel, was die Arbeitszeit betraf, und hob ihre guten Englisch- und Französischkenntnisse hervor. Ihre Sprachferien in England und Frankreich während ihrer Schulzeit erwähnte sie nicht. Es wäre ihr wie Angeberei vorgekommen. Schließlich ging es um einen Job, bei dem man nur herumsaß.