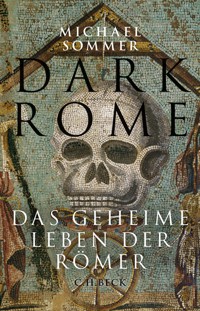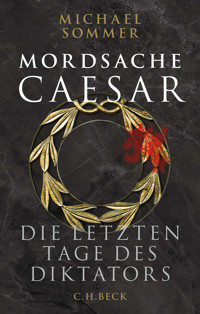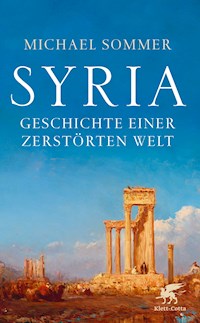22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1200 Jahre Antike – eine goldene Zeit voller Weisheit, Schönheit, Tugend? Fehlanzeige! Stattdessen munteres Morden der Griechen und Römer vom Olymp bis zum Forum. Mit diesem herrlich respektlosen Buch führen uns Michael Sommer und Stefan von der Lahr raus aus der historischen Komfortzone und rein in eine Geschichte von Menschen, denen Sie besser nicht im Dunkeln begegnen …
Wer sich heute am Anblick der Akropolis in Athen oder der betörenden Fresken von Pompeji erfreut, übersieht leicht die breite Blutspur, die Griechen und Römer durch die Geschichte gezogen haben. Zwar grüßen aus der Vergangenheit edel klingende Namen wie Achill oder Romulus, Perikles oder Alexander, Caesar oder Augustus. Doch das Geschäft dieser und vieler anderer Herren war nicht zuletzt das Morden im Großen – im Krieg – und im Kleinen – an politischen Gegnern, ja sogar an Freunden, wenn sie sich gar zu eigensinnig verhielten. Aber, aber … hat man damals nicht die Demokratie erfunden und eine Republik gegründet? Wer glaubt, dass Demokraten und Republikaner keine blutigen Eroberer sein konnten, die freiheitsliebende Bevölkerungen ganzer Städte und Landschaften erwürgten oder versklavten, der irrt. Höchste Zeit für eine andere Geschichte der Antike! Von der Eroberung Trojas bis zum Fall Roms: Michael Sommer und Stefan von der Lahr erzählen uns die ganze verdammte Wahrheit, faktentreu, farbecht und ohne Tabus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Michael Sommer Stefan von der Lahr
DIE VERDAMMT BLUTIGE GESCHICHTE DER ANTIKE
ohne den ganzen langweiligen Kram
Mit Illustrationen von Lukas Wossagk
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Karten
Vorwort
Warnhinweis
1: Der Trojanische Krieg –
◆
In grauer Vorzeit
◆
2: Die Abenteuer des Odysseus –
◆
8. und 7. Jahrhundert v. Chr.
◆
3: Könige und Tyrannen –
◆
7. und 6. Jahrhundert v. Chr.
◆
Nicht an einem Tag
Woher nehmen und nicht stehlen?
Wer kann, wird Tyrann
Noch eine Tyrannendämmerung
4: Eine Demokratie und eine Republik –
◆
Um 500 v. Chr.
◆
Kleisthenes und Isagoras – oder High Noon in Athen
Der Plan
Zwischenfrage
Wessen Republik?
5: Unglücklich das Land, das Helden nötig hat –
◆
1. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
◆
Die Phalanx
Kroisos und der Ionische Aufstand
Herr, denke an die Athener!
Marathon
Kriegsvorbereitungen
Die Schlachten an den Thermopylen und am Kap Artemision
Der Fall von Athen und die Seeschlacht bei Salamis
Plataiai, Mykale und das Ende vom Lied
Heldinnen und Helden
6: Winterschlaf der Kultur –
◆
478–431 v. Chr.
◆
Sparta
Athen
Angst
7: Der Peloponnesische Krieg –
◆
431–404 v. Chr.
◆
Versuche nicht den falschen Gott der Schlachten!
Der Archidamische Krieg
Das grausige Schicksal der Insel Melos und die Sizilien-Expedition
Der Dekeleische Krieg
8: Dichter und Denker, Richter und Henker –
◆
Ein Rückblick auf das 5. Jahrhundert v. Chr. in Griechenland
◆
Aischylos und die Perserkriege
Das Echo auf die Tyrannis bei Sophokles
Der Frauenversteher Euripides
Sokrates – der Gerechteste unter den Menschen
9: Nach dem Krieg ist vor dem Krieg –
◆
404–321 v. Chr.
◆
Im Schatten des persischen Großkönigs
Noch mehr römische Helden
Das kaudinische Joch
10: Die Anfänge der makedonischen Hegemonie –
◆
400–336 v. Chr.
◆
Wer hat den Längsten?
Die Braut trug schwarz
11: Alexander der Große –
◆
336–323 v. Chr.
◆
Der Lehrer Aristoteles
Der Alexanderzug oder Mission impossible
Die Schlacht am Granikos 334
Die Schlacht bei Issos 333
Grüß Gott! Alexander und das Ammonsorakel
Es kann nur einen geben – die Schlacht bei Gaugamela 331
Sieger und Säufer
Alexanders Entfremdung von den Makedonen
Welteroberer und Massenmörder
Tod in Babylon
12: Blut fordert Blut –
◆
323–264 v. Chr.
◆
Mörderischer Ringelreihn um die Thronfolge
Das Ende der Freiheit in Athen und ihre Wiedergeburt im Geiste der Philosophie
Der Anfang vom Ende für die Makedonen
Pyrrhossiege
13: Der Vater aller Dinge –
◆
264–146 v. Chr.
◆
Bis zur Erschöpfung
Krieg ohne Gnade
Niemals ein Freund
Plötzlich Weltmacht
Der letzte König
Karthago muss zerstört werden
14: Herren der Welt –
◆
146–62 v. Chr.
◆
Senatorenland in Bauernhand
Marsch auf Rom
Republik aus den Fugen
Der verhinderte Staatsstreich
15: Die Republik dankt ab –
◆
62 v. Chr. – 14 n. Chr.
◆
Der blaublütige Volkstribun
Ganz Gallien?
Iden des März
Ciceros letzte Tage
Pax Augusta
Imperium sine fine
16: Debile Despoten? –
◆
14–96 n. Chr.
◆
Glanz und Elend der Imperatoren
Kabale und Hiebe
Flavische Kriege, flavische Spiele
17: Im Zenit –
◆
96–235 n. Chr.
◆
Reich der unbegrenzten Möglichkeiten
Seid einig
18: Zeitenwende –
◆
235–337 n. Chr.
◆
Überrumpelt
Wo Gefahr ist …
… wächst das Rettende auch
19: Ende einer Welt –
◆
337 n. Chr. bis zum bitteren Ende
◆
Christen und Antichristen
Goten gegen Rom
Schiffbruch
Schluss
Anhang
Dank
Anmerkungen
Motto
Vorwort
1 Der Trojanische Krieg
2 Die Abenteuer des Odysseus
3 Könige und Tyrannen
4 Eine Demokratie und eine Republik
5 Unglücklich das Land, das Helden nötig hat
6 Winterschlaf der Kultur
7 Der Peloponnesische Krieg
8 Dichter und Denker, Richter und Henker
9 Nach dem Krieg ist vor dem Krieg
10 Die Anfänge der makedonischen Hegemonie
11 Alexander der Große
12 Blut fordert Blut
13 Der Vater aller Dinge
14 Herren der Welt
15 Die Republik dankt ab
16 Debile Despoten?
17 Im Zenit
18 Zeitenwende
19 Ende einer Welt
Schluss
Quellen
Leseempfehlungen
Allgemein
1 Der Trojanische Krieg
2 Die Abenteuer des Odysseus
3 Könige und Tyrannen
4 Eine Demokratie und eine Republik
5 Unglücklich das Land, das Helden nötig hat
6 Winterschlaf der Kultur
7 Der Peloponnesische Krieg
8 Dichter und Denker, Richter und Henker
9 Nach dem Krieg ist vor dem Krieg
10 Die Anfänge der makedonischen Hegemonie
11 Alexander der Große
12 Blut fordert Blut
13 Der Vater aller Dinge
14 Herren der Welt
15 Die Republik dankt ab
16 Debile Despoten?
17 Im Zenit
18 Zeitenwende
19 Ende einer Welt
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Karten
Wenn man dies alles – den ganzen Krieg oder auch das ganze Leben nur als eine Scene im Teaterder «Unendlichkeit» auffaßt, ist vieles leichter zu ertragen[1]
Max Beckmann
Vorwort
«Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. (…) Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde.»[1]
In diesem Sinne: Ein herzliches Willkommen allen Leserinnen und Lesern dieses Buches! Mit den nach Martin Luther zitierten Sätzen entlässt der alttestamentarische Gott den Kain in die Welt – jenen biblisch verbrieften ersten Mörder der Menschheitsgeschichte. Er hatte seinen Bruder Abel aus Eifersucht erschlagen, weil dessen Opfergabe dem Herrn des Himmels wohlgefälliger war als die eigene. Gleichgültig, wie viele Jahrtausende seit damals vergangen sind: Bis in unsere Tage entdecken die Menschen jeder neuen Generation das Kainsmal auf der eigenen Stirn. Mit diesem Zeichen hat Gott nach seinem Fluch nämlich den Mörder gezeichnet,[2] und kein Besuch im Internet, keine Zeitung und keine Nachrichtensendung lässt uns vergessen, dass wir die Kinder Kains und der Tradition unseres Ahnherrn treu geblieben sind.
Dass wir uns als Autoren auf ein so düsteres Thema eingelassen und ein Buch über die verdammt blutige Geschichte der Antike geschrieben haben, geht allerdings auf einen gänzlich unblutigen, vielmehr sehr gemütlichen Abend bei einem Italiener zurück. Unsere Gespräche kreisten um Gott und die Welt im Allgemeinen und die Antike im Besonderen. Letzteres war wenig verwunderlich, da der eine sein Geld als Professor für Alte Geschichte in Oldenburg, der andere das seine als Lektor für Altertumswissenschaft in München verdiente.
Wir waren uns einig, dass die Antike alles andere war als die Komfortzone der Geschichte. Viele ihrer Akteure – von Achill bis Alexander dem Großen, von Perikles bis Augustus und von Caesar bis Alarich – waren ganz gewiss keine Sunnyboys einer scheinbar harmlos-fernen Vergangenheit. Doch wäre es möglich, diese ganze Epoche allein unter dem Blickwinkel einer gewalttätigen, ja mörderischen Zeit zu erschließen? Würde man nicht zu viel beiseitelassen müssen, und würde das nicht ganz schnell zu einer eher drögen, vielleicht gar moralinsauren Darstellung, dargeboten mit erhobenem Zeigefinger? Wer sollte sich solch eine Lektüre antun?
Aber falls man es anders aufziehen wollte: Wäre es überhaupt erlaubt, einen «leichten Ton» zu wählen? Immerhin hätte man über eine unabsehbare Reihe von Kriegen zu sprechen, über das Elend der Sklaverei und zahllose Opfer. Solange es sich um Phasen der Geschichte handelte, die von Mythen und Legenden umrankt sind, in denen Götter, Helden und Monster auftreten, mochte ein etwas kräftigerer Humor ja angehen. Doch sobald man sich auf historisch festerem Grund bewegte, sobald es um reale Schicksale und wirkliche Tote ging, müsste man einen anderen Ton wählen, ohne in den üblichen Sachbuch-Sound zu verfallen.
Aber mal angenommen, man könnte dieses Problem in den Griff bekommen, blieb immer noch die Herausforderung, so ein Projekt gemeinsam anzugehen. Zwar war uns klar, dass der eine von uns vorrangig über griechische und der andere über römische Themen schreiben würde – wobei diese in der Antike reichlich artifizielle Grenze im Laufe der Jahrhunderte ohnehin verschwimmt. Trotzdem: Da würden doch zwei Menschen mit ganz verschiedenen Biographien ans Werk gehen, mit unterschiedlichen Temperamenten, Einschätzungen und subjektiven Wertungen historischer Vorgänge und Phänomene. Könnte das trotz allem ein lesbares, brauchbares Buch werden?
Ein paar Monate nach jenem launigen, vielleicht etwas zu langen Abend waren ein paar ermutigende Kapitel von der Isar an die Hunte und in die entgegengesetzte Richtung verschifft. So haben wir beschlossen, es einmal zu versuchen. Ob es uns gelungen ist, müssen unsere Leserinnen und Leser entscheiden.
In Erinnerung an die wunderbare Truppe Monty Python, die unsere Kindheit und Jugend so unendlich viel lustiger gemacht hat, wollen wir also auf den folgenden Seiten eine neue Darstellung all dessen wagen, womit Generationen von Schülerinnen und Schülern an humanistischen Bildungsanstalten eingepinselt worden sind: NEIN, edle Einfalt und stille Größe waren keine Werte des antiken Griechenlands![3] NEIN, Athens blutrünstige Demokraten möchte man gewiss nicht als Vorbilder für unsere Tage gelten lassen. Und nochmals NEIN: Unser Publikum würde sich im Rom des Augustus garantiert nicht wohlfühlen, das vielleicht aus Marmor war – aber der war so blutverschmiert, dass man unter der Kruste kaum noch den Stein erkennen konnte. Versuchen wir also mal, dem Pathos, mit dem die Geschichte der Griechen und Römer versehen wurde, ein wenig die Luft herauszulassen!
Warnhinweis
Dieses Buch kann Spuren von Gewalt, sexuelle Inhalte, Schimpfwörter und politische Unkorrektheiten aller Art enthalten, ist dafür aber garantiert zucker- und kalorienfrei. Es darf nicht in die Hände von Kindern oder Besucherinnen und Besuchern humanistischer Gymnasien gelangen. Die Lektüre kann verstörend wirken. Zu weiteren Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihre Ärztin, Ihren Arzt, in Ihrer Apotheke oder wo Sie wollen.
Michael Sommer und Stefan von der LahrOldenburg und München, im Frühjahr 2025
1
Der Trojanische Krieg
◆ In grauer Vorzeit ◆
Also, der ganze Ärger fing damit an, dass der Trojanerprinz Paris nach Sparta fuhr. Troja – oder Ilios, wie man das Kaff an der Nordwestküste Kleinasiens auch noch nannte – war ödeste Provinz. Und weil es dort sonst keine Attraktionen gab, langweilte man jeden Fremden, der sich in die Gegend verirrte, indem man ihm die alte Stadtmauer zeigte. Die hatten angeblich zwei Götter, Apollon und Poseidon, erbaut. So was war typisch für die alten Griechen: Wenn keiner mehr was Genaues wusste, aber man trotzdem ordentlich Eindruck machen wollte, erklärte man mit solchen Geschichten die Welt. Das nennt man dann Mythos.
Als Befestigungsanlage war die Mauer gar nicht schlecht und hielt den Trojanern Räuber und Piraten vom Hals. Aber junge Leute wollen eben auch mal was anderes sehen als pralle Steinklötze. Kein Wunder, dass Paris die Idee gefiel, für seinen Vater Priamos in diplomatischer Mission nach Griechenland zu segeln. Mit seiner Frau Oinone, der Bergnymphe, die er kennengelernt hatte, als er noch Schafe im Hochland Phrygiens hütete, lief es nicht mehr so richtig. Außerdem freute er sich darauf, ein paar Wochen seine Schwester Kassandra nicht hören zu müssen, die allen Leuten auf die Nerven ging, weil sie dauernd Katastrophen vorhersagte, die dann blöderweise auch noch eintraten.
Aber was Diplomaten einfach nicht machen sollten, ist, die Frau des Gastgebers abzuschleppen – und exakt das machte Paris, kaum dass er in Sparta eingetroffen war. Er ging zu König Menelaos, um von Priamos zu grüßen und ein paar alte Geschichten aufzuwärmen. Genau in dem Moment musste Helena kommen und fragen, was Menelaos zum Abendessen wolle. «Gastmahl, wie immer», raunzte der. Mit anderen Worten, Helena erging es in Sparta nicht besser als Paris in Troja – sie langweilte sich zu Tode. Ihr Mann war König und hatte dementsprechend wenig zu tun. So saß er jeden Abend mit seinen alten Kumpels zusammen und begoss sich die Nase. Dabei zupfte ein Sänger die Leier und erzählte, wie Menelaos und die anderen früher die Jungs aus der Nachbarschaft verprügelt hatten – eine super Unterhaltung für eine gutaussehende junge Frau.
Während Helena also bei Menelaos meistens Kopfschmerzen hatte, hat es zwischen ihr und Paris gleich gefunkt. Sie hat hinter einer Säule auf ihn gewartet, und er hat ihr das gesagt, was ein junger Mann in so einer Situation eben so sagt: Die Liebesgöttin Aphrodite habe ihm prophezeit, er werde mal die schönste Frau der Welt heiraten, na ja, und Helena sei einfach das Schönste, was er je gesehen habe. Da hat sich Helena noch einmal kurz zu ihrem Mene umgedreht, der gerade wieder mit glasigem Blick auf das griechische Heldentum anstieß. Verglichen mit dem war Paris eine echte Sahneschnitte. Also beide rauf auf sein Schiff, und ab ging’s nach Troja.
Als Menelaos wieder nüchtern und Paris und Helena aus den Federn waren, war das Boot längst nicht mehr einzuholen. König hin, Gastmähler her – niemand lässt sich gern die Frau ausspannen und tut so, als wär nichts. Und weil die anderen griechischen Könige ein genauso abwechslungsreiches Leben führten wie Menelaos und außerdem dessen Bruder Agamemnon – der König von Mykene und unter den Griechen so eine Art Oberpate – Lust hatte, mal wieder einen Zug durch die Gemeinde zu machen, war es kein großes Kunststück, ein Heer zusammenzutrommeln. Den Frauen sagten sie, was sie ihnen immer sagten: Sie müssten die Ehre eines Freundes wiederherstellen und den Bruch der Gastfreundschaft rächen. Die Königinnen winkten ihnen pflichtschuldig hinterher und begannen, sich die Zeit zu vertreiben. Klytaimnestra beispielsweise, die Frau des Agamemnon, wartete kaum, bis der Alte hinter der nächsten Wegbiegung verschwunden war, und ließ dann ihren Geliebten Aigisth wissen, dass sie jetzt jahrelang sturmfreie Bude hätte.
Ein paar Tage später erreichte die griechische Flotte die Küste vor Troja. Man zog erst mal vor die Mauer, fand sie ziemlich hoch, und keiner spürte den letzten Ehrgeiz, sie jetzt gleich zu stürmen und dabei Kopf und Kragen zu riskieren. Deshalb amüsierte man sich lieber mit ein paar Dörfern in der Nachbarschaft und richtete es sich im Schiffslager gemütlich ein. Agamemnon hatte noch nie die Finger bei sich behalten können, und prompt musste er bei einem ihrer Raubzüge ausgerechnet die Tochter eines Apollon-Priesters entführen. Der wandte sich an seinen Chef: «Guck mal, was diese Ausländer mit meiner Tochter machen! Tu was, wenn du willst, dass deine Opferfeuer rauchen!» Was ein richtiger Gott ist, der fackelt in so einer Situation nicht lange. Also schickte Apollon die Pest ins Griechenlager, wo sie jetzt starben wie die Fliegen. Allen war klar, dass Agamemnon der Spielverderber war, dabei hatte er ihnen doch versprochen, dass man nach Troja fahren würde, um Spaß zu haben. Deshalb hieß es schnell: «Komm, rück die Braut raus, und gut is’!» So blieb dem Oberanführer nichts anderes übrig, als das Mädchen gehen zu lassen.
Doch mit seinem miesen Charakter konnte er es nicht ertragen, dass er jetzt den Kürzeren gezogen hatte. Besonders ärgerte ihn, dass dieser Muskelprotz Achill, der vor Kraft und Selbstbewusstsein kaum noch laufen konnte, so eine hübsche Sklavin namens Briseis aus der Beute der letzten Tage erhalten hatte. Agamemnon pochte auf sein Recht als Oberboss und nahm ihm, dem besten Kämpfer im griechischen Heer, einfach das Mädchen weg. Der raste vor Zorn und hatte schon die Hand am Schwert, um diese Pestbeule Agamemnon aufzustechen. Da schritt die Göttin Athene ein und flüsterte ihrem Schützling ins Ohr: «Lass stecken und mach mal Pause! Den Rest übernehme ich.»
Genau diese Geschichte erzählt der blinde Sänger Homer, der dichtende Gyrosspieß, in seiner Ilias: den Zorn des Helden Achill, mit allen seinen Folgen. Er braucht dafür über 15.500 Verse – aber keine Sorge, das geht auch kürzer.
Als Achill also verstimmt war und das Kämpfen sein ließ, hat’s den Griechen richtig nass reingeregnet. Bis dahin hatte man mal hier und mal da gegen ein paar Trojaner gekämpft, und die Verluste hatten sich dabei ziemlich in Grenzen gehalten. Nun ging’s auf beiden Seiten übel zur Sache. Mal hören, wie die Schilderungen bei Homer so klingen? Also: Dem einen Kämpfer durchbohrte der Speer des Gegners die Stirn, und die eherne Spitze drang in seinen Schädel, bis das Todesdunkel seine Augen umhüllte.[1] Gleich darauf traf einen anderen eine Lanze in die Brust, rechts neben der Warze, und fuhr ihm gerade durch die Schulter.[2] Dem dritten durchschlug die Waffe die eine Schläfe, und die eiserne Spitze kam durch die andere wieder heraus.[3] Wieder ein anderer Krieger wurde im Rücken getroffen, sank nieder, und im Sterben rutschten seine Eingeweide aus dem Leib zur Erde.[4] Richtig eklig wurde es, wenn ein Angreifer sich so in seine Mordlust hineinsteigerte, dass er – gerade wie ein Löwe eine Kuh reißt – seinen Gegner packte, ihm den Nacken brach und dann das Blut und die Eingeweide ausschlürfte.[5] Besonders geübte Speerschleuderer trafen den Schädel des Feindes zwischen Kiefer und Ohr – dann stieß der Speer die Zähne raus und schnitt dem armen Kerl durch die Zunge.[6]
Von oben ging das Töten übrigens auch, wenn Göttin Athene die Lanze gerade auf die Nase lenkte, von wo aus sie die weißen Zähne durchbohrte und dem Getroffenen die Zunge von der Wurzel abschnitt, bis sie an der Kinnspitze wieder rauskam.[7] Da war es doch schon richtig barmherzig, wenn einem das Unheil derart ins Genick fuhr, dass der letzte Wirbel und die beiden Sehnen durchtrennt wurden und der Kopf vor dem Torso zu Boden fiel.[8] Oder wenn einem das Haupt abgeschlagen wurde und der Täter es einem Ball gleich zurückwarf ins Gedränge.[9] Hingegen gar nicht schön anzusehen war, wenn einem Verlierer im Zweikampf der Kopf unter dem einen Ohr so abgeschlagen wurde, dass nur noch die Haut hielt und der Schädel seitlich runterhing.[10] Ebenso wenig möchte man das Schicksal desjenigen teilen, den eine Lanze in den Schenkel traf, wo der dickste Muskel des Menschen sitzt, und dem rings um die Spitze der Lanze die Sehnen rissen.[11] Oder das Unglück dessen, dem ein Speer in den Oberarm fuhr und das Fleisch aus den Muskeln schnitt und den Knochen völlig zertrümmerte.[12]
Und wem das immer noch nicht grausig genug ist, dem sei gesagt, dass es vor Troja auch noch einen gab, dem ein vom Feind geschleuderter spitziger Stein in die Stirn fuhr, schimmernd weiß und gezackt – und es zerriss ihm beide Brauen und den Knochen des Schädels, und «es fielen hinab in den Staub ihm die Augen/dicht vor die Füße».[13] Einen anderen wieder traf der Gegner mit dem Erze am Mund, und die eherne Lanze bohrte sich durch und fuhr unter dem Hirne hervor. «Den weißlichen Schädel zerspaltend,/schlug sie die Zähne heraus, und beide Augen erfüllte/strömendes Blut. Er spie aus offenem Mund und Nüstern/röchelnd hervor, dann umfing ihn die düstere Wolke des Todes.»[14]
Was für die Griechen so fröhlich begonnen hatte, wurde also eine ziemlich zähe und blutige Angelegenheit. Denn man kam einfach nicht über diese blöde Mauer. Und hinter der Mauer? Da machten die Trojaner dem Paris natürlich Vorwürfe, in was für eine Geschichte er sie hineingezogen hatte, bloß weil er … Aber trotzdem wollte man gegenüber diesen Angebern von der anderen Seite der Ägäis nicht einfach klein beigeben. Deswegen schien es allen am besten, wenn in einem Zweikampf Menelaos und Paris die Sache unter sich ausmachten. Sieger sucht Braut!
Schön gedacht. Und so kam es zum Zweikampf. Manches an Paris mag stattlich gewesen sein, aber als großer Krieger ging er wegen dieses Duells nun wirklich nicht in die Geschichte ein. Und außerdem hatte er einen richtig schlechten Tag erwischt. Als Menelaos daher schon wie der sichere Sieger aussah, kam Aphrodite, die Schönheitsgöttin – und was machte sie? Sie rettete ihren Schützling mit Hilfe einer Wolke und legte ihn Helena wieder ins Bett. Ergebnis: Die Griechen waren sauer, die Trojaner waren sauer, Helena war auch sauer – aber nicht so richtig, weil sie andere Qualitäten ihres Paris auch weiterhin zu schätzen wusste.
Und vergessen wir nicht, dass es noch einen gab, der sauer war: Achill, der schmollend in seinem Zelt saß und nicht mehr mitmachte, weil ihm dieser hundsäugige Agamemnon seine Briseis geklaut hatte. Dieser Ein-Mann-Streik hatte die Griechen zwischendurch hart an den Rand einer Niederlage gebracht. Denn die Trojaner hatten nicht nur Weiberhelden, sondern auch einen ganz besonderen Kriegshelden, und das war der untadelige Prinz Hektor. Wenn irgendwann mal König Priamos in den Hades, in die Unterwelt, fahren sollte, dann würde Hektor Herrscher von Troja. Hektor fand seinen Bruder blöde, und er fand diesen ganzen Krieg blöde. Aber er machte das, was man von einem ordentlichen Prinzen erwartete, der mal König werden wollte – er erfüllte seine Pflicht, und zwar richtig gut. Eines Tages, während die Griechen auf Achill verzichten mussten, schaffte er es, mit seinen Trojanern bis ans Schiffslager der Feinde vorzudringen und dort Feuer zu legen.
Hektor hatte also einen ziemlichen Lauf. Doch während Achill alles schnuppe war, konnte sein Freund Patroklos das Elend nicht länger mit ansehen. Er erbat sich von Achill dessen hochberühmte Rüstung, um die Trojaner zu erschrecken und sie zu vertreiben. Die fühlten sich den Griechen nämlich an sich ziemlich ebenbürtig, wenn nur dieser verdammte Schlagetot Achill nicht gewesen wäre. Patroklos nervte so lange, bis Achill nachgab, ihm aber verbot, mit der Rüstung wirklich in den Kampf einzugreifen: Nur mal gucken lassen, nicht anfassen! Patroklos war ein sympathischer Typ und ein richtig guter Freund – doch er war nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er sagte «Ja», dachte sich aber nachher draußen im Felde: «Also, wenn ich schon mal hier bin …» Und dann geriet er ausgerechnet an Hektor. Lampe aus.
Das musste ja so kommen. Jetzt war Achill stinksauer. Agamemnon, das alte Weichei, erkannte die Gunst der Stunde und sagte: «Ej, Achill, tut mir ehrlich leid, die Sache mit deiner Briseis. Kannst sie wiederhaben. Zwischen uns beiden ist nichts gelaufen.» Und Achill: «Passt schon. Wo is’ Hektor?» Hektor guckte von der Mauer und sagte zu seiner Frau Andromache: «Ich bin dann mal weg.» Sein kleiner Sohn Astyanax hatte ihn ohnehin immer nur mit dem blöden Kriegerhelm gesehen und war völlig verängstigt. Der hätte später bestimmt ein schräges Männerbild entwickelt, wenn er so lange gelebt hätte.
Achill wartete also in seinem Kampfwagen vor der Mauer, und Hektor kam in seinem aus der Stadt gefahren. Die beiden drehten erst mal ein paar Runden – aber es war klar: Dafür waren sie nicht hergekommen. Also runter vom Wagen und rein in den Zweikampf. Aber was heißt da Zweikampf? Die Göttin Athena – die falsche Schlange – trickste Hektor aus, indem sie sich für dessen Kriegskameraden Deiphobos ausgab und so tat, als wolle sie ihm gegen Achill helfen. Dann ging’s los: Achill schleudert seinen Speer, trifft aber nicht. Danach wirft Hektor, aber seine Lanze prallt am Schild des Gegners ab. Der falsche Deiphobos hat inzwischen Achill dessen Speer wiedergegeben, doch als Hektor von seinem vermeintlichen Kameraden seinen zweiten Speer will … April, April. Den Rest kann man sich denken. Achill war seinen Frust los, nachdem er Hektor erledigt hatte, und als Ausdruck seiner wiedergewonnenen Lebensfreude band er dessen Leiche an seinen Wagen und drehte ein paar Runden um Troja. Schließlich gab er noch eine Riesenparty für den toten Patroklos mit Festspielen und Menschenopfer und allem Drum und Dran.
Aber er ahnte wohl schon, dass er selbst nicht ungeschoren aus der Geschichte rauskommen würde. Und so passierte es dann auch: Paris konnte nicht nur gut mit Frauen, sondern war auch ein ganz passabler Bogenschütze. Als er gerade mal wieder aus dem Schlafzimmer kam und über die Mauer guckte, sieht er, wie Achill, das Vieh,[15] schon wieder gegen Troja kämpft. Er denkt sich: «Kill Achill», schnappt sich einen Bogen und trifft doch tatsächlich die einzige Stelle, wo Achill verwundbar ist – seine Ferse. Okay, Apollon hat dem Pfeil den letzten Spin gegeben, aber die Idee war immerhin von Paris!
Lange konnte sich der Prinz allerdings auch nicht an seinem Meisterschuss freuen, weil die Griechen in Philoktet ebenfalls einen Meisterschützen hatten, der auch noch einen Wunderbogen besaß. Er hatte ein paar Jahre ungestört auf der Insel Lemnos mit Pfeil und Bogen üben können. Dort hatten ihn die Griechen ausgesetzt, weil er dauernd rumstöhnte, nachdem ihn eine Schlange gebissen hatte. Sie hatten ihn dann wieder abgeholt, als klar war, dass sie Troja nicht ohne den Bogen des Philoktet erobern könnten. Philoktet war beim Wiedersehen noch etwas verschnupft wegen seiner unfreiwilligen Auszeit, aber letztlich doch froh, dass man ihn wieder eingesammelt hatte. Deshalb nutzte er auch gleich die erste Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen, und traf mit zwei vergifteten Pfeilen den Paris. Der schleppte sich ein letztes Mal zu seiner Ex Oinone in die Berge, wo er sie für Helena hatte sitzen lassen, und fragte, ob sie ihn vielleicht mit einem Gegengift kurieren wolle. Aber die Nymphe war emotional eher kleinteilig und meinte: «Verreck, du Aas!» Gesagt, getan.
Die Sache vor Troja zog sich und zog sich, und kein Grieche hatte mehr Lust, auch nur einen Tag länger als nötig vor dieser dämlichen Mauer rumzuhängen. Das war die große Stunde von Odysseus, dem König von Ithaka. Ithaka war etwa so spannend wie der Mond von hinten, und keiner wusste, weshalb ausgerechnet diese verschlafene Insel im Westen Griechenlands einen derart trickreichen Denker hervorgebracht hatte. Wie Odysseus nun an einem stürmischen Tag vor dem Griechenlager saß und aufs Meer schaute, wo eine hohe Welle nach der anderen auf die Küste zulief, verstand er mit einem Mal, weshalb man immer von den «Rossen des Poseidon» sprach – die hohen Wellen erinnerten mit ihren runden Schaumkronen eben an Pferde, die dann ja wohl dem Meeresgott gehören mussten. Und in dem Moment machte es «Klick» in seinem Kopf: Wenn man dem Poseidon ein Opfer brachte, um für eine gute Heimfahrt zu bitten, dann könnte dieses Opfer doch die Gestalt eines hölzernen Pferdes haben. So ein gewaltiges Teil, das man einfach am Strand zurücklassen würde. Wenn sich dann morgens die Trojaner den Schlaf aus den Augen rieben, sähen sie verwundert, dass kein Grieche mehr da war. Alle weg, nur das Holzpferd stünde einsam am Strand. Sie würden ein paar Späher aus der Stadt schicken – und dann, nach zehn Jahren Belagerung, kämen alle Trojaner an die Küste gelaufen und wären begeistert darüber, dass diese verfluchte Geschichte endlich vorbei wäre und die Griechen sich bei Nacht und Nebel davongemacht hätten. Das Pferd würden die Trojaner als Symbol ihres Sieges in die Stadt ziehen und bis ans Ende aller Tage verehren. Im Freudenlärm – und das war der Trick – würde keiner merken, dass das Pferd ein sehr lebendiges Innenleben hätte, nämlich eine Eliteeinheit griechischer Krieger. Die würden die Nacht abwarten und dann, wenn alle Trojaner vom Feiern erschöpft in den Schlaf gesunken wären, rauskommen, um die anderen Griechen in die Stadt zu lassen. Die nämlich wären nur um die nächste Landzunge herumgesegelt, um in der Nacht heimlich, still und leise zurückzukommen und auf ihr Sondereinsatzkommando zu warten.
Eine bessere Idee hatte bei den Griechen gerade keiner. Und bei den Trojanern? Klar, dass Kassandra kreischend durch Troja lief und keifte, man solle unter keinen Umständen das Pferd hereinholen. Aber die Prinzessin galt als komplett durchgeknallt, seit sie mal die Chance gehabt hatte, Apollon zu heiraten, aber fand, dass der Gott nicht ihr Typ war. Also hörte schon längst niemand mehr auf sie. Trotzdem hätte alles noch schiefgehen können für die Griechen, weil auch dem Poseidon-Priester Laokoon die Sache nicht geheuer war. Die Trojaner zögerten einen Augenblick. Doch nun hatte Athena diese vermaledeite Trojageschichte endgültig satt und schickte zwei Riesenschlangen, die Laokoon und seine beiden Söhne einfach auffraßen. «Recht so!», dachten die Trojaner: «Nun haben wir endlich alles überstanden und wollen den Göttern danken, und da kommt der daher und stänkert rum. Kein Wunder, dass die Götter ihn und sein Geschlecht vom Erdboden vertilgen.»
So kann man sich irren. Am andern Morgen sah man nur noch Trümmer rauchen, wo sich am Tag zuvor Troja erhoben hatte. Aber weil die Geschichte so schön war und die Reste dieser Mauer wie ein Denkmal in der Gegend rumstanden, hat man sie sich ewig weitererzählt und bis auf den heutigen Tag noch hunderterlei neue Geschichten aus dieser einen herausgesponnen.
2
Die Abenteuer des Odysseus
◆ 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. ◆
Mit der Ilias hatte Homer einen Megaerfolg gelandet, der in der Antike 1000 Jahre lang rauf und runter gelesen und deklamiert wurde. Aber ein Hit bleibt selten allein. Dabei wissen wir gar nicht, wer dieser Homer war, ja nicht einmal, wo genau er herkam. Seine Verse bekamen ihren letzten Schliff wohl erst im 6. Jahrhundert v. Chr., und zwar in Athen zu Zeiten des Tyrannen Peisistratos, den wir später noch kennenlernen werden.
So ein Riesenerfolg wie die Ilias reizte natürlich die ganze Zunft der Dichter, und einer von denen – nennen wir ihn der Einfachheit halber ebenfalls Homer, weil alle ihn so nennen, obwohl er mit dem Dichter der Ilias ganz sicher nicht identisch war – hatte eine super Idee: Da gab’s doch noch diese Geschichten, wie die griechischen Helden aus Troja wieder nach Hause fuhren, und vor allem die vielen Stories, die sich um die Heimkehr des Cleverle aus Ithaka, dieses Odysseus, rankten. Daraus konnte man doch noch so einen Pageturner wie die Ilias machen. Der müsste ja sogar noch viel spannender werden, vor allem, wenn man all das reinpackte, was sich getan hatte, seit die Ilias entstanden war!
Tatsächlich hatte sich eine Menge getan: Man war buchstäblich weltläufig geworden. In der Zeit vom 8. bis 6. Jahrhundert waren nämlich viele griechische Städte und Städtchen überbevölkert und litten unter inneren Konflikten. Der Effekt war, dass allerorten Teile der Bevölkerung aufbrachen, um anderswo ihr Glück zu suchen. Man nennt diese Jahrhunderte der griechischen Geschichte daher auch die Zeit der großen Kolonisation. An deren Ende saßen die Griechen – wie der Philosoph Platon (428/27–348/47) schreibt[1] – ums Mittelmeer wie Ameisen oder Frösche um einen Teich. Von über 80 Städten gingen Koloniegründungen aus, fast 200 solcher Neusiedlungen sind bekannt. Die Siedlungsgebiete waren nicht zuletzt Sizilien und Süditalien, die Westküste Kleinasiens, aber auch der Schwarzmeerraum. Selbst auf der Iberischen Halbinsel ließen sich Griechen nieder, und noch im fernen Ägypten der Pharaonen entstand mit Naukratis eine wichtige griechische Handelsniederlassung.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen, weil er manche Abenteuer selbst erlebt und von vielen anderen gehört hat. Genau das ist die Würze der Geschichten von Odysseus. Wenn man genau hinschaut, erscheint er als Krieger, Bauer, Pirat, Räuber, Händler – kurz gesagt: als ein in seiner Vielfältigkeit ganz moderner Mann mit einem ausgeprägten unternehmerischen Geist. Den brauchte damals auch jeder, der Erfolg haben wollte. Zur Lebenswelt des Odysseus gehören der Misthaufen vor seinem Bauernhof[2] und die Hirten genauso wie die hoch aufragenden Mauern einer Burg und eine sich entwickelnde städtische Kultur – und selbstverständlich immer noch die Wildnis der grauen Vorzeit samt allen darin lauernden Gefahren.
Wer als Dichter so einen Stoff spannend erzählen konnte, trat damit bei wohlhabenden Herren auf. Die luden gern wandernde Sänger ein, für einige Zeit an ihren Höfen einzukehren und ihnen und ihren Freunden abends am Feuer die Zeit zu vertreiben. Wer dort sang, war gut beraten, die Vorfahren des Gastgebers in seine Geschichten einzuweben, damit sich die Zuhörer in diesen Gesängen wiedererkannten. Auch durfte die Welt, von der erzählt wurde, bei allem exotischen Reiz nie ganz auf die bekannte Lebenswirklichkeit verzichten, damit die Hörer sie in ihrer Phantasie noch wiedererkennen und weiterdenken konnten. Wer sich auf diese publikumsnahe Performance verstand, konnte reich beschenkt weiterwandern. Gemünztes Geld bekam er damals allerdings noch keines – das kam erst um die Mitte des 7. Jahrhunderts in Kleinasien bei den Lydern auf und setzte sich dann ab der Mitte des 6. Jahrhunderts nach und nach auch auf dem griechischen Festland durch.
12.110 Verse hat der Dichter der Odyssee ebenjenem Odysseus spendiert, der mit schuld daran war, dass Troja abgefackelt wurde. Feiner Lohn! Dabei geht es einzig und allein um seine Irrfahrten, die sprichwörtlich geworden sind. Doch obwohl der große Krieg vorbei war, fließt auch in diesen Geschichten jede Menge Blut.
Wenn man sagt, man sei um acht Uhr zu Hause, und kommt um elf, gibt’s Ärger. Kommt man erst am andern Morgen um sieben, sind alle erleichtert, dass einem nichts passiert ist, und man bekommt einen Kaffee. So hat der listenreiche Odysseus, König von Ithaka, eigentlich ganz nachvollziehbar gehandelt: Da hatten er und die anderen Griechen sich zehn Jahre abgerackert im Krieg gegen die Trojaner – und danach hatte er einfach keine Lust, gleich heimzugehen. Also, dachten er und seine Leute: Lasst uns noch ein paar Tage ausspannen! Penelope und Telemach – so hießen seine Frau und sein Sohn – würden sich morgen auch noch freuen, wenn er zurück nach Ithaka käme. Dass dieser spontane Betriebsausflug ein bisschen aus dem Ruder laufen würde, konnte Odysseus ja nicht ahnen. Aber der Reihe nach …
Als Erstes schauten sie bei den Kikonen vorbei. Mit den Männern machten sie nicht viel Federlesens, die Wertsachen aber wollten sie mitnehmen. Doch weil es schon spät war, haben sie sich, wie Urlauber am Ballermann, am Strand noch ’ne Runde Rauschtrank gegeben. Und da … sind sie eben müde geworden und eingeschlafen, und guck an, als sie wach wurden, hatten die überlebenden Kikonen die Jungs aus der Nachbarschaft gerufen. Spielverderber! So ging’s dann atemlos durch die Nacht, und ein paar von den Griechen haben fortan die Olivenbäume von unten gezählt. Wer noch laufen konnte, hat die Boote ins Wasser gezogen und ist abgehauen.
Nun scheint über dem Mittelmeer auch nicht immer die Sonne. Das Wetter war damals ein paar Tage dermaßen lausig, dass Odysseus und seine Jungs froh waren, als sie schließlich bei den Lotophagen vor Anker gehen konnten. Das war eine Kifferkolonie. Womit die sich im Einzelnen weggeknallt haben, wissen wir nicht (Freund Peder aus Ostfriesland sagte in solchen Situationen immer: «Hauptsache, es knackt inne Birne»). Jedenfalls haben sich die Leute von Odysseus zusammen mit den echt netten Lotophagen – wörtlich: den Lotosfressern – dermaßen bedröhnt, dass sie keine Lust mehr hatten auf felsige Griecheninseln, wo’s höchstens mal ’nen Feierabendschoppen gab. Eher wollten sie Brüder im Geiste von Helge Schneider werden: «Sommer, Sonne, Kaktus … never, never go to work, lieber holiday on the beach.» Odysseus hatte also alle Hände voll zu tun, seine Mannschaft wieder an Bord zu bringen.
Und da mit ihnen in dieser Stimmung sowieso nicht viel anzufangen war, hat er ihnen vorgelesen, was in seinem antiken Reiseführer Homer über die Kyklopeninsel stand: «Keiner rührt eine Hand zum Pflanzen und Pflügen; sie stellen/alles anheim den unsterblichen Göttern. Es wächst ja auch alles/ganz ohne Saat und Pflug, der Weizen, die Gerste, die Reben./Die aber spenden den Wein aus riesigen Trauben.»[3] Das klang doch wie aus einem TUI-Katalog für Aussteiger. Also nichts wie hin, und so ging der Oberanimateur Odysseus, der insgesamt für die Unterhaltung von zwölf Schiffen verantwortlich war, mit allen seinen Leuten bei den Kyklopen vor Anker. Am andern Morgen machten sie eine Ziegensafari, und ab dem Nachmittag gab’s dann Gyros mit Rauschtrank. So lässt sich’s leben.
Odysseus wollte die Insel aber noch ein bisschen genauer anschauen, auch um mal Kontakt mit den Einheimischen zu bekommen. Also nahm er zwölf seiner Leute mit und dazu einen Schlauch (so ’ne Art Ziegenlederbeutel) voll kräftigem Rotwein. Er fand auch ziemlich schnell ein lauschiges Plätzchen mit Grotte, Lorbeer, Schafen, Ziegen und Kleinvieh, kleinen Pferchen (alles öko mit Boden- und Freilandhaltung), Käse luftgetrocknet, Eimern und Näpfen mit Molke. Aber keiner daheim. Da machten sie es sich in der Grotte gemütlich, langten kräftig zu und warteten auf den Hausherrn.
Was sie nicht wussten: Der war ein Kyklop namens Polyphem, groß gewachsen und eher so der herbe Typ – rustikales Äußeres, nur ein Auge in der Mitte der Stirn. Tatsächlich hat er den Griechen einen ziemlichen Schrecken eingejagt, als er dann endlich kam, so dass sie sich erst mal in die Ecken der Höhle verdrückten. Da dachte Odysseus aber noch, dass er nur ein bisschen Smalltalk machen müsse und die Situation schon in den Griff bekommen würde. Er erzählte dem Höhlenbesitzer, wo sie gerade herkamen, und ließ durchblicken, dass sie als Reisende auf eine freundliche Behandlung durch den Gastgeber hofften, weil das doch der oberste Gott Zeus so angeordnet habe. Man soll aber in der Fremde den Leuten nicht sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Der Kyklop war jedenfalls verschnupft: Von Göttern halte man in der Gegend schon mal gar nichts. Und hast du nicht gesehen, greift der sich zwei Gefährten des Odysseus, haut sie mal kurz gegen den Felsen und frisst sie auf. Das hätte man jetzt auch nicht erwartet von so ’nem Öko – von wegen Veggie-Day und so …
Abhauen war jedenfalls nicht, weil Polyphem einen Stein als Haustür hatte, den man selbst mit 22 Wagen nicht hätte wegbewegen können;[4] er aber rollte ihn lässig allein vor den Eingang. Da guckten die Griechen ganz schön kariert aus der Wäsche – «Patsche Hilfsausdruck», wie Wolf Haas sagen würde. Und die Stimmung wurde auch nicht besser, als der Kyklop am anderen Morgen nochmal zwei Reisegefährten des Odysseus verspeiste und sich dann aus der Höhle machte – aber nicht, ohne sie mit dem Stein zu verschließen. Odysseus musste sich jetzt schon was einfallen lassen, wenn er vor seiner Mannschaft nicht ganz dumm dastehen wollte. Da sah er irgendwo einen Olivenstamm rumliegen, den er anspitzte und in die Glut des Feuers schob, das in der Höhle loderte. Abends kehrte dann der fröhliche Landmann von der Arbeit nach Hause zurück und freute sich auf sein leckeres Nachtmahl. Odysseus wusste, dass er ihm das nicht würde ausreden können. Aber nach verzehrtem Doppel-Griechen-Wopper bot er ihm lecker Wein an, den er ja noch in Reserve hatte. Polyphem spülte damit die Reste seines Imbisses runter und war danach reif fürs Schaffell. Als er schlief, zog Odysseus den gut durchgeglühten Olivenstamm aus dem Feuer, und gemeinsam mit ein paar Gefährten rammte er ihn dem Kyklopen in das einzige Auge. Es gab dann ein ziemliches Durcheinander, aber erwischt hat der Griechenfresser danach keinen mehr.
Nur, aus der Höhle raus waren sie damit noch immer nicht. Aber weil klar war, dass der Hausherr am nächsten Morgen seine Tiere wieder auf die Weide lassen musste, band Odysseus die Gefährten unter ein paar Schafe und Widder. So konnte der Kyklop sie nicht entdecken, auch wenn er sich für dieses bleibende Andenken, das sie ihm verpasst hatten, gern erkenntlich gezeigt hätte. Odysseus selbst klammerte sich bei dem stärksten Widder von unten ins Fell, und obwohl Polyphem gerade zu diesem kräftigen Tierchen ein besonders inniges Verhältnis hatte,[5] konnte er den Übeltäter nicht erwischen. Er rollte stattdessen den Stein zur Seite und entließ alle seine Schafe und Ziegen ins Freie, nicht ahnend, dass er seine Peiniger gleich mit rausließ.
Die alle ab ans Wasser, rauf aufs Boot und wieder rein ins Meer. Als sie ein Stückchen gerudert waren, konnte es Odysseus, der eitle Gockel, nicht lassen, den Kyklopen zu verspotten und ihm auch noch zuzurufen, wer ihm das alles angetan hatte. Das hätte er nicht machen sollen. Polyphem war nämlich immer noch pikiert und warf ein paar ordentliche Felsbrocken in die Richtung, aus der die Stimme kam. Auch wenn er das Schiff nicht traf, wusste er jetzt doch, dass Odysseus der Schuldige war. Das erzählte die alte Petze auch gleich ihrem Vater. Hätte Odysseus mal besser die Klappe gehalten! Der Vater war nämlich der Erderschütterer und Meeresgott Poseidon. Sein Polyphem war zwar nie so das herzigste Kind gewesen, aber durch die Aktion mit dem Olivenpfahl war er nun auch nicht hübscher geworden. Also war Poseidon fortan richtig sauer auf Odysseus und hat keine Gelegenheit mehr ausgelassen, ihn auf dem Meer rumzuschubsen.
Als Odysseus und die Überlebenden mit den anderen wieder zusammen waren, haben sie erst mal ein paar Schafe und auch den fetten Widder des Polyphem gegrillt und reichlich Wein auf den überstandenen Schrecken getrunken. So gemütlich wie da wurde es später nicht mehr oft auf ihrer Reise. Als Nächstes erreichten sie das Ufer, wo Aiolos, der Windgott, wohnte. Der war sehr nett zu ihnen, bewirtete sie freundlich und bändigte für den Odysseus die Winde so, dass er sie in einem Sack aus Rinderhaut mitnehmen konnte. Auf diese Weise hätte eigentlich nichts mehr schiefgehen sollen mit der Heimreise. Die Ithakesier waren auch praktisch schon zu Hause, da dachten Odysseus’ Gefährten, Aiolos habe dem Chef irgendwelche Schätze aus Gold und Silber in den Sack getan. Als Odysseus schlief, banden sie ihn deshalb auf. Nur mal gucken – aber denkste! Die Winde stürzten daraus hervor, rasten als Sturmgebraus zurück zur Insel des Aiolos – und rissen die Boote des Odysseus mit sich. Als sie dann wieder Aiolos trafen, war der komplett vergrätzt, dass man so mit seinem Geschenk umgegangen und Odysseus offenbar den Göttern verhasst war. Da konnte und wollte er auch nicht mehr helfen und jagte ihn und seine Männer weg.
Die nächste Insel, die sie ansteuerten, war von Laistrygonen bewohnt; die waren etwa so gastfreundlich wie der Kyklop, so dass sie machten, dass sie weiterkamen. Allmählich war die Reisegruppe des Odysseus ganz schön geschrumpft. Deswegen waren sie beim nächsten Landgang schon vorsichtiger. Der Spähtrupp fand einen Palast, wo eine gutaussehende Dame den Webstuhl bediente – also das machte, was man von einer ordentlichen griechischen Hausfrau erwarten durfte. Wie sie da webte, sang sie auch noch mit schöner Stimme, war allerdings umlagert von einer richtigen Menagerie von Löwen und Wölfen, die aber alle ganz friedlich waren. Trotzdem dachten sich die Griechen: «Rufen wir lieber mal die Hausherrin heraus, ehe wir uns des Viehzeugs erwehren müssen.» Madame kam prompt, war total nett und bat sie herein. Ihr Haus war geschmackvoll eingerichtet, und sie bat sie zu Tisch.
Nur einer war nicht mit reingekommen, sondern schaute sich aus der Ferne an, wie sich das entwickeln würde. Tja, und was er sah, ließ ihm die Haare zu Berge stehen: Die gastfreundliche Frau war nämlich die Zauberin Kirke. Wahrscheinlich hatte sie mal schlechte Erfahrungen gemacht und dachte sich: «Männer sind Schweine – dann kann ich ihnen ja auch gleich ein wesensgemäßes Äußeres verpassen.» Tat’s, verwandelte die Späher in Säue, schuf so eine schöne Einheit von Inhalt und Form und sperrte sie in einen Schweinestall. Der eine, der nur zugeguckt hatte, hätte danach wohl kein entspanntes Verhältnis zu Frauen mehr entwickeln können, aber für die paar Wochen, die ihm noch blieben, kam’s auch nicht mehr drauf an. Jedenfalls lief er zurück zu Odysseus und erzählte ihm, was passiert war. Der macht sich auf zum Haus der Zauberin und trifft – Hermes! Damals traf man Götter an jeder Ecke … Dieser Hermes war hauptberuflich Götterbote (und zugleich noch der Gott der Händler und Diebe – eine sehr sinnfällige Kombination). Er erklärte Odysseus genau, worauf er achten und was er machen sollte, wenn er Kirke begegnete, und er gab ihm auch noch ein Zauberkraut namens Moly mit, das gegen Kirkes Gifte helfen sollte.
Was das damals für ein Kraut war, wissen wir nicht, aber egal, das Zeug wirkte. Als Kirke die gleichen Tricks bei Odysseus versuchte, guckte der nur wie der Terminator, zog sein Schwert und sagte so was wie «Hasta la vista, Baby». Da wurde Kirke ganz handzahm. Er solle das alles nicht so eng sehen, und klar bekomme er seine Gefährten wieder und außerdem alles, was weitgereiste Männer sonst noch so an Entspannung brauchen. Also alles fein. Die Leute von Odysseus erhielten ihr adrettes Äußeres wieder, und die Männer, die bei den Booten geblieben waren, kamen auch zum Haus der Kirke, und dann machten alle ein paar Monate Party.
Als sie schließlich abreisen wollten, fiel der junge Elpenor, von Natur aus eher ungeschickt, vom Vordach von Kirkes Lodge und brach sich den Hals. So richtig vermisst hat ihn offenbar zuerst keiner, zumindest war Odysseus ziemlich überrascht, als er ihn ein paar Tage später bei einem Besuch in der Unterwelt wiedertraf. Wie Odysseus in den Hades kam? Also, Kirke sagte, wenn er schon unbedingt abreisen wolle, solle er da mal vorbeischauen, weil der tote Seher Teiresias ihm noch ein paar Tipps mit den angesagtesten Locations für seine Rückreise geben könne.
So total gern hat schon damals keiner im Hades vorbeigeschaut, aber wenn’s denn sein musste … So fuhr Odysseus mit seinen Leuten, wohin Kirke sie schickte, und wie gesagt, da kam auch Elpenor aus der Grube. Von wegen Wiedersehen unter Freunden! Der flehte Odysseus an, wieder zurück zu Kirkes Insel zu fahren und ihn ordentlich zu bestatten. Die Freude über diese Ehrenrunde hielt sich bei Odysseus in Grenzen. Aber an sich lohnte sich die Reise zum Totenorakel schon, weil er tatsächlich einen wichtigen Hinweis von Teiresias erhielt: Sie sollten unter keinen Umständen, wenn sie an der Insel Thrinakia des Sonnengottes Helios vorbeikämen, ein Barbecue mit dessen Rindern veranstalten. Wenn sie sich daran halten würden, hätten sie die Chance, dass zumindest ein Teil der Reisegruppe wieder heil nach Hause käme. Odysseus sagte «Alles klar», schaute sich noch ein bisschen um, und dann sah er auf einmal unter den Schatten der Verstorbenen seine Mutter, die vor Sorge und Kummer um ihn gestorben war. Sie erzählte ihm, dass es zu Hause auf Ithaka nicht so gut aussehe, weil sein Vater sich völlig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen habe, während die Frau des Odysseus, Penelope, sich schier zu Tode gräme um den vermissten Mann. Nur sein Sohn Telemach entwickele sich ganz gut. Also: höchste Zeit, dass der Herr des Hauses wieder heimkehrte.
Nachdem Odysseus und seine Männer bald darauf, wie versprochen, den Elpenor ordentlich bestattet und sich damit als anständige Menschen erwiesen hatten, fuhren sie weiter und begegneten den Sirenen. Das waren wunderschön singende Frauengestalten, bei denen die Seeleute so hingerissen waren, dass sie den Verstand verloren und Schiffbruch erlitten – also eine Art antike Frühform der Loreley am Rhein. Odysseus, neugierig, wie er war, ließ sich von den Gefährten stramm an den Mast binden, um zu hören, was diese Sirenen wohl singen. Die anderen stopften sich Wachs in die Ohren, um es eben NICHT zu hören, sondern ungefährdet weiterfahren zu können. Leider erfahren wir nicht, was die Sirenen gesungen haben, sonst könnten die Deutschen bei denen mal eine Anleihe machen, um endlich aus dem Keller beim Eurovision Song Contest rauszukommen.
Dann ging es weiter durch Skylla und Charybdis – eine Engstelle im Meer, wo links wie rechts todbringende Monster, Klippen und Strudel lauerten. Tatsächlich angelte sich Skylla sechs Gefährten aus dem Boot des Odysseus und verspeiste sie, wie Polyphem es gediegener nicht hätte machen können.
Die nächste Insel war Thrinakia. Da wollte Odysseus genau nicht landen, weil das eben das Eiland des Sonnengottes Helios mit den leckeren weißen Rindern war. Odysseus kannte seine Mitreisenden: Wenn die was sahen, was man grillen konnte, waren sie nicht zu halten. Aber sie nervten ihn so lange, bis er nachgab, und dann saßen sie 30 Tage wegen ungünstiger Winde auf Thrinakia fest. Zwar hatte Odysseus vorgebaut und die anderen heilige Eide schwören lassen, dass sie die Rinder nicht anrühren würden. Aber schließlich kam der Hunger … und einer hat die anderen überredet, während Odysseus schlief. Als der Reisegruppenleiter wieder wach wurde, war alles schon zu spät. Der Sonnengott Helios war so was von wütend! Er hat sich bei Vater Zeus beschwert und gedroht, er werde in den Hades hinabsteigen und fortan den Toten scheinen. Keine Sonnenenergie mehr im Olymp? Kam ja gar nicht in Frage. Was also machte Zeus? Er ließ die störenden Winde ruhen, wartete, bis Odysseus und seine Leute wieder auf dem Meer waren, kein Land weit und breit, und dann gab’s einen satten Orkan. Wie es Teiresias geweissagt hatte – alle gingen unter, nur Odysseus überlebte.
Als das Grauen ein Ende hatte, war er mutterseelenallein und im elendesten Zustand, den man sich vorstellen kann. Aber schließlich wurde er, auf einem Schiffskiel reitend, ans Ufer der Insel Ogygia geworfen, wo die Nymphe Kalypso wohnte. Die hatte sich gerade ein bisschen zurechtgemacht. Jedenfalls rühmt Homer den Sitz ihrer Frisur – Kalypso mit den schönen Flechten. Und weil Odysseus bei Frauen immer gut ankam, nahm sie ihn freundlich auf, liebte und hegte ihn und stellte ihm ewige Jugend und Unsterblichkeit in Aussicht. Was man eben so sagt, wenn man schon länger keinen Herrenbesuch mehr gehabt hat, wie uns Homer wissen lässt. Tatsächlich blieb Odysseus bei Kalypso volle sieben Jahre. Auch wenn er am Schluss heulte, dass er endlich wieder heim zu seiner Penelope wolle, kann einem doch niemand erzählen, dass er auf Ogygia emotional sieben Jahre total im Defizit gewesen sein soll! Undankbar – so sind die Männer eben! (Kirke hatte schon recht …)
Aber weil er schließlich gar so seufzte und drängelte mit dem Heimkommen, schickte Zeus den Hermes zur Nymphe und ließ ihr ausrichten, sie habe sich jetzt lange genug mit Odysseus vergnügt und solle ihn mal wieder ziehen lassen. Weil man gegen den Willen des obersten olympischen Gottes sowieso keinen Widerspruch einlegen konnte, schimpfte Kalypso eine Weile rum, ließ dann aber den Odysseus ein Floß bauen und in See stechen.
Poseidon, immer noch grätig wegen Polyphem, hat Odysseus diese Floßfahrt ganz schön verhagelt. Am Ende lag der mal wieder schiffbrüchig an einem Ufer, und zwar diesmal bei den Phaiaken. Total nette Leute – hilfsbereit, gastfreundlich und wahre Virtuosen der Seefahrt. Ihr König Alkinoos lud Odysseus ein, mit ihm und seinen Freunden in der großen Halle zu Abend zu essen. Um ein bisschen die Stimmung anzuheizen, ließ Alkinoos einen Sänger kommen, der was aus dem Trojanischen Krieg vortrug. Da zog sich Odysseus ein Tuch über den Kopf und fing an zu heulen. Alkinoos merkte, dass irgendwas mit dem Fremden nicht stimmte, und ließ ihn all das erzählen, was passiert war, bis es ihn an die Küste der Phaiaken verschlagen hatte. Der König hatte ein gutes Herz, und so bereitete er ihm eine schöne Heimkehr zu Schiff.
Am Ufer seiner Heimatinsel Ithaka legten die Phaiaken den schlafenden Odysseus am Strand ab, umgeben mit vielen Geschenken des Alkinoos, und fuhren wieder nach Hause. Poseidon war über diesen Shuttle-Service übrigens dermaßen verärgert, weil er dem Odysseus nun doch nicht noch mehr antun konnte, dass er die Phaiaken seinen ganzen Umut spüren ließ. Seit damals hat man von ihnen nie mehr was gehört.
Als Odysseus wach wurde, kam auch schon die Göttin Athene des Wegs, wenn auch verkleidet. (Wie gesagt: Götter traf man damals dauernd.) Ein paar Begrüßungsfloskeln später wusste Odysseus, dass er tatsächlich wieder zu Hause auf Ithaka war. Aber er hat bei dieser Gelegenheit auch erfahren, dass das nun überhaupt nicht bedeutete, dass der ganze Stress vorbei war: Zwar war sein Sohn Telemach inzwischen ein ansehnlicher und tapferer junger Mann. Aber er konnte sich nicht allein gegen die Übermacht der Jeunesse dorée wehren, die Odysseus’ Palast belagerte. Diese Typen versuchten, Penelope – die Frau des Odysseus – dazu zu bewegen, die vermeintlichen Fakten zu akzeptieren. Sollte heißen: ‹Odysseus ist tot, und du heiratest einen der strahlenden jungen Adligen, die bei dir Schlange stehen!› Um den Druck auf sie zu erhöhen, hatten die Freier sich im Palast des Odysseus eingenistet, wo sie sich mit den Mägden vergnügten und die Vorratskammern leerfraßen. Und wäre das Gut des Odysseus nicht so riesig gewesen, hätten sie dieses Haus schon längst ruiniert gehabt.
Odysseus war von all dem nicht sonderlich erbaut und schlich sich als Bettler verkleidet in seinen eigenen Palast. Dort sah er ein paar Tage dem Treiben der ungeladenen Gäste zu und erwarb sich – soweit das möglich war – ihre Gunst. Nach und nach gab er sich auch ein paar Altvertrauten zu erkennen – Telemach, seinen treuen Hirten, nicht aber Penelope.
Und dann zog der Tag der Rache herauf. Penelope verkündete den Freiern – wie es ihr nach einem Traum und dem Zuspruch des Bettlers am besten schien –, dass sie den zum Manne nehmen würde, dem es gelänge, den alten Bogen des Odysseus zu spannen und mit einem Pfeil durch die Ringe von zwölf hintereinander aufgestellten Äxten zu schießen. Zuerst gab es Verwunderung und Murren, dann aber ließen sich die Freier auf den seltsamen Wettkampf ein. Unterdessen versperrten die Getreuen des Odysseus alle Fluchtwege, schafften die Waffen der Freier weg und bewaffneten sich selbst. Als ein Freier nach dem anderen an der gestellten Aufgabe scheiterte, bat Odysseus, es auch einmal versuchen zu dürfen. Zuerst wurde er beschimpft und zurechtgewiesen, dann aber reichte man ihm endlich den Bogen. Er verstand ihn zu spannen und schoss sicher durch alle Axtringe hindurch.
Im nächsten Moment gab sich Odysseus den Freiern zu erkennen, und es war klar, dass er ein paar Verbündete im Saal hatte, die mit ihm nun ein grausames Blutgericht begannen. – Irgendwann schaute Odysseus sich um, ob noch einer der Freier am Leben wäre: «Aber nun sah er sie alle im Staub und im Blute da liegen,/hingeworfen in Menge wie Fische. Wie draußen vom grauen/Meer Fischer sie holen in enggeflochtenen Netzen,/dann am Strand in der Bucht auf den Sand sie schütten, die alle/gern in das Wogen der Salzflut wiederum kämen; vergeblich!»[6]
Anschließend übte Odysseus blutige Rache am ungetreuen Gesinde des Hauses. Erst dann begab er sich zu seiner Frau, die von dem Getümmel im Palast nichts mitbekommen hatte, weil sie schlafen gegangen war, als das Bogenschießen begann. Erst konnte sie nicht glauben, dass ihr Mann wieder zurück sein sollte. Aber als er ihr erklärte, wie er einst aus einem gewaltigen Olivenbaum ihr Ehebett gezimmert hatte, war sie vollends überzeugt, dass wirklich ihr Odysseus zurückgekommen war. Damit die beiden nun ihre Nacht der Nächte in vollen Zügen genießen konnten, wurde ein spezielles Arrangement mit der Nacht und der Morgenröte getroffen, so dass ihnen viel, viel Zeit dafür blieb … Dann aber mussten sie raus aus den Federn. Es war klar, dass noch nicht alle Gefahren überstanden waren, weil die Verwandten der erschlagenen Freier auf Rache sannen.
Als die beiden Gruppen aufeinandertrafen, tat den entscheidenden Wurf der Vater des Odysseus, Laertes. Er spaltete nämlich den Helm des heranstürmenden Eupeithes, Vater des übelsten Freiers, und durchbohrte dessen Schädel. Doch ehe noch größeres Unheil geschah, schritt die Göttin Athene ein und sprach ein Machtwort: «Gut is’! Genug is’!» Alle bekamen einen Mordsschrecken, als sie sie schreien hörten, und rannten davon. Um zu bekräftigen, dass nun wirklich Schluss war mit dem Krieg, ließ Vater Zeus es donnern und blitzen. Dann erklärte Athene auch Odysseus nochmal, dass seine Geschichte jetzt zu Ende sei und er aufhören solle zu kämpfen, wenn er nicht richtig Ärger mit dem Göttervater bekommen wolle. Odysseus war ganz froh über diese Ansage. Am Ende beschworen alle den Frieden, mit dem auf Ithaka wieder geordnete Zustände einkehren konnten und die Zeit der Abenteuer vorbei war. Andernorts fingen die Abenteuer hingegen gerade erst an …
3
Könige und Tyrannen
◆ 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. ◆
Nicht an einem Tag
Blutig und legendenumrankt war auch die Frühzeit Roms. Schon seine Anfänge zierte eine fette Blutspur. Die legendären Zwillinge, Romulus und Remus, hatten den Kampf gewonnen. Sie hatten den Usurpator Amulius, der sich die Herrschaft über Alba Longa unter den Nagel gerissen hatte, besiegt und ihren Großvater Numitor, den rechtmäßigen König, wieder auf den Thron gehievt. Und der dankbare Opa hatte sich königlich revanchiert. Jetzt also durften Romulus und Remus ihre eigene Stadt gründen, just an der Stelle, wo man sie vor vielen Jahren als Babys ausgesetzt und wo dann eine Wölfin sie gesäugt hatte. Man schreibt den 21. April 753 v. Chr.[1]
Eine Stadt gründen, das ist einfacher gesagt als getan. Schließlich wurde Rom nicht an einem Tag erbaut. Aber nicht nur an öffentlichen und privaten Bauwerken mangelt es, als Romulus und Remus an diesem schönen Frühlingstag das Terrain erkunden, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. Der Ort ist günstig, denn ganz in der Nähe liegt die Tiberfurt, und hier verbindet eine viel befahrene Handelsstraße Nord- und Süditalien. Doch wer soll die Stadt bevölkern? Die Zwillinge haben ja viele Freunde, aber die sind einfache Hirten wie sie selbst. Vor allem aber fehlen Frauen. Wenn die Stadt auf Dauer überleben soll, muss man dafür sorgen, dass auch die Damenwelt am Tiber heimisch wird.
Die allerwichtigste Frage aber ist: Wer darf die Stadt gründen? Die Brüder sind schließlich zu zweit, doch jede vernünftige Stadt hat nur einen Gründer, héros ktístes, wie die Griechen das nennen. Keiner möchte zurückstecken, jeder möchte Gründer sein. Also tun sie das, was die Bewohner Latiums von ihren etruskischen Nachbarn gelernt haben: Sie beobachten die Vögel und blicken mit ihrer Hilfe in die Zukunft. Remus stellt sich auf einen Hügel und schaut in die Ferne. Zu seiner Freude sieht er sechs Geier! Kaum vorstellbar, dass der Bruder das toppen kann. Doch kurze Zeit später schreit Romulus laut auf. Denn aufgepasst: Auch er steht auf einem Hügel und behauptet doch glatt, an ihm seien zwölf Geier vorbeigeflogen.[2]
Dumm gelaufen! Das Orakel lässt intriganterweise mehrere Interpretationen zu: Romulus hat doppelt so viele Geier gesehen wie Remus – der aber wurde zuerst der komischen Vögel ansichtig. Wer hat also die Nase vorn? Es kommt, wie es kommen muss: Die Zwillinge greifen zu rustikalen Mitteln, um die Entscheidung doch noch zu erzwingen. Nach zünftigem, lange unentschiedenem Faustkampf liegt Remus blutüberströmt am Boden: Tod durch Schädel-Hirn-Trauma.
Eine andere Version der Geschichte dreht an dieser Stelle noch eine interessante Schleife. Nach dieser Fassung können sich die Brüder schließlich doch noch einigen, wer die Stadt gründen darf. Remus zieht den Kürzeren und sieht schmollend zu, wie sein Bruder mit dem Hakenpflug eine Furche zieht. Das ist erst einmal die Stadtmauer: Drinnen ist Rom, die Stadt des Romulus, draußen ist Feindesland. Etwas Solideres kann man ja noch bauen, sobald man die Mittel dazu hat. Alles zu seiner Zeit. Nachdem er den Pflug einmal im Kreis geführt hat, besieht sich Romulus sein Werk: Gar nicht mal so schlecht! Der Anfang ist gemacht.[3]
Remus aber steht feixend daneben. Das soll eine Stadt sein? Das wollen wir doch mal sehen. Er nimmt ein paar Meter Anlauf und springt mit einem Satz über die Furche. Da steigt in Romulus unbändige Wut auf. «Mein Bruder ist mein Feind», denkt er. So wie Kain in der Bibel, der seinen Bruder Abel tötete, und noch ein paar andere berühmte Brüdermörder. Vor ihm steht der grinsende Remus. Und Romulus schlägt zu. Immer wieder schlägt er drauf, bis die Gegenwehr des Bruders erlahmt. Schließlich liegt Remus tot vor ihm auf dem Boden. Blut rinnt in die Ackerfurche, die Romulus gezogen hat und die seine Stadt begrenzen wird.