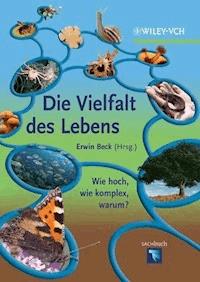
Die Vielfalt des Lebens E-Book
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Seit der Konvention der Vereinten Nationen im Jahre 1992 zum Schutz der biologischen Vielfalt, dem sog. Rio-Abkommen, ist Biodiversität weltweit zu einem Begriff für ein hohes Gut der Menschheit geworden, das es zu bewahren gilt. Inzwischen ist klar geworden, dass (fast) alles, was in einem Ökosystem abläuft, von seinen Organismen bewerkstelligt wird, und dass die Vielfalt dieser Organismengemeinschaften die Leistungen und die Stabilität der Land- und Meeresökosysteme bedingt. Viele dieser Leistungen nutzt der Mensch, ohne sie könnte er nicht leben. Von uns oft nicht bemerkt, wirkt die Biodiversität unaufhörlich in unser tägliches Leben hinein. Prof. Erwin Beck, Vorsitzender der Senatskommission für Biodiversitätsforschung in der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat dieses Lesebuch herausgegeben, das dem Leser nicht nur die ungeheure Vielfalt des Lebens auf der Erde näherbringt, sondern auch in einer gut verständlichen Sprache die Prinzipien und die Bedeutung der Biodiversität für das Leben auf der Erde aufzeigt. Moderne Methoden der Entdeckung und Erfassung der Vielfalt der Organismen, ihr Werden und Vergehen, ihre Verteilung über Land und Meere werden ebenso angesprochen wie die Mechanismen der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Organismen und des Überlebens in extremen Lebensräumen. Darüber hinaus widmet sich das Werk dem komplexen und keineswegs immer negativen Zusammenspiel von menschlichen Einflüssen und Biodiversität, und es diskutiert die verschiedenen Ansätze, um dieses Zusammenspiel zum Nutzen von Natur und Mensch zu verbessern. Alle Kapitel wurden von prominenten Experten geschrieben und von der Wissenschaftsjournalistin Claudia von See aufgearbeitet und in eine gut lesbare Buchform gebracht. Auf Grund seiner Bedeutung wird das Buch als eine der ganz wenigen Publikationen Deutschlands von allen wichtigen Wissenschaftsinstitutionen und Forschungsförderern unterstützt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zum Geleit: Ein Reiseführer in die „Vielfalt des Lebens“
Teil I Biologische Vielfalt entdecken
1 Eine Einführung in Fragen zur biologischen Vielfalt
Neuland in der Erforschung der biologischen Vielfalt
Das Ausmaß der biologischen Vielfalt
Die Entstehung der biologischen Vielfalt
Die funktionelle Bedeutung der biologischen Vielfalt
Nutzung der biologischen Vielfalt
Rückgang der biologischen Vielfalt, Gegenmaßnahmen und Handlungsmöglichkeiten
Vielfalt fasziniert
Literatur
2 Citizen Science – ohne Liebhaber geht es nicht
Was müssen erfolgreiche Projekte leisten?
Evolution MegaLab: Bürger erforschen Schnecken und Klimaveränderungen
Europaweite evolutionäre Veränderungen
Tagfalter-Monitoring Deutschland
Wöchentliche Schmetterlingszählung
Masseneinwanderung des Distelfalters
Können Monitoring-Daten Klimaveränderungen abbilden?
Die Zukunft der Hobbyforschung
Literatur
3 Pfeilwürmer – durchsichtige Jäger im Plankton der Meere
Strukturen und Funktionen
Systematik
Biologische Vielfalt erkunden
Die Vielfalt der Pfeilwürmer
Danksagung
Literatur
4 Wind, Wasser und Wirbellose im Atlantischen Ozean
Die Quelle ist ein Strom
Aus der Tiefe entspringt der Reichtum
Die Vielfalt der Meere – Faszination Wirbellose
Literatur
Teil II Ein weißer Fleck auf der Landkarte des Lebens: Mikroorganismen
5 Mikroorganismen: die unbekannte Mehrheit
Die Entdeckung neuer Ufer
Unsere eingeschränkte Sicht auf die Vielfalt der Mikroorganismen
Phylogenetische und physiologische Diversität der Bakterien
Die Pilze
Sind Pilze Mikroorganismen?
Wie vielfältig sind die Pilze?
Literatur
6 Vielfalt der marinen Mikroorganismen
Im offenen Ozean
Im dunklen Meer
Extreme Standorte – Lebensraum für Archaeen
Ohne Sauerstoff – in der Tiefe der Ostsee und des Schwarzen Meeres
Das Wattenmeer
Höhere Lebewesen als Lebensraum
Biogeografie von Mikroorganismen: Nischen und Speziesbildung
Ausblick
Literatur
Teil III Biodiversität verstehen: A Die Entstehung der Biodiversität
7 Artbildung am Beispiel der Enziangewächse
Inseln als evolutionäre Laboratorien – das Beispiel Ixanthus
Der Einfluss der Eiszeiten und des Bodens – die Glockenenziane
Hybridisierung und Veränderung der Chromosomenzahl: das Beispiel Centaurium
Zurück in die Tropen – die Beispiele Gentianella und Halenia
Auch geologische Langzeitprozesse spielen eine Rolle bei der Artbildung – das Beispiel Potalia
Evolution mit dem Menschen – die Blütezeit von Gentianella
Arten sterben aus – der Lungenenzian, die Kehrseite der Diversifizierung
Triebkräfte der Evolution – eine Zusammenfassung
Literatur
8 Entstehung und Erhaltung von Biodiversität in den (Sub)Tropen
Verstehen durch Erfassen, Dokumentieren und Benennen
Evolution und wichtige Faktoren
Beitrag zur Erhaltung von Biodiversität
Danksagung
Literatur
9 Tropische Sonnenstrahlfische als Modellsystem
Die Maliliseen Sulawesis
Die Sonnenstrahlfische des Matanosees
Adaptive Radiation
Artbildung in Sympatrie?
Welche Rolle spielt die Farbe?
Literatur
10 Korallenriffe im kalten Wasser des Nordatlantiks
Kalt- und Warmwasserkorallen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Lophelia pertusa: Von der Kolonie zum Riff
Wie viele Arten leben im Lophelia-Riff?
Biologische Interaktionen in einem Lophelia-Riff
Ökologische Funktion von Lophelia-Riffen
Menschliche Einflüsse auf Kaltwasserriffe
Plastikmüll in den tiefen Riffen
Ozeanversauerung – eine Bedrohung für die Kaltwasserkorallenriffe?
Literatur
Teil III Biodiversität verstehen: B Die Funktion der biologischen Vielfalt
11 Künstliche Systeme als Modell
Ökosystemfunktionen und Ökosystemdienstleistungen
Gradientenanalyse oder Biodiversitätsexperimente?
Die Entwicklung der Biodiversitätsexperimente
Ergebnisse der Biodiversitätsexperimente
Ausblick
Literatur
12 Neue Erkenntnisse zu einem ökologischen Paradigma
Ist Stabilität immer „gut“?
Unter welchen Bedingungen kann Artenvielfalt ein Ökosystem stabilisieren?
Lebensgemeinschaften verkraften Störungen – bis zu einem gewissen Grad
Die Erforschung von Stabilität geht weit über das Erfassen von Arten hinaus
Die räumliche Versicherung: Ein neuer Aspekt der ökologischen Forschung
Literatur
13 Biodiversität der Binnengewässer
Zentren der biologischen Vielfalt
Neuartige Lebensgemeinschaften
Ökosystemleistungen
Gefährdete Paradiese
Management- und Schutzstrategien
14 Wie Blumen sprechen: das Ölblume-Ölbiene-Bestäubungssystem
Das Ölblume-Ölbiene-Bestäubungssystem
Wie finden die Ölbienen die Ölblumen?
Welche Duftstoffe gibt die Pflanze ab?
Literatur
Teil IV Biodiversität extremer Habitate
15 Biologische Krusten als Pioniere
Was sind extreme Habitate?
Leben zwischen Trockenheit und Überflutung
Oberflächennahes Mikroklima
Verglasung als Austrocknungsschutz
Felsoberflächen
Bodenkrusten
Literatur
16 Leben im und unter dem Eis
Arktische und antarktische Lebensräume im Kurzprofil
Leben im Eis – von Eisalgen, Meereis-Bakterien und ihren Räubern
Leben vom Eis – Schlüsselorganismus Krill
Leben unterm Eis – Vielfalt des antarktischen Meeresbodens
Leben mit Eis – Langzeitbeobachtungen in der Arktis
Fazit
Literatur
Teil V Biologische Vielfalt nutzen
17 Biologische Vielfalt mit der Landwirtschaft
Landwirtschaft erhöhte zunächst sogar die Artenvielfalt
Agrarlandschaftsentwicklung aus Sicht der Biodiversität
Sichten auf den Schutz von Biodiversität
Die Bedeutung der Struktur von Agrarlandschaften für die Biodiversität
Landwirtschaftliche Nutzungssysteme und Biodiversität
Einfluss der Kulturpflanzenarten und der Fruchtfolgen
Verbesserung der Qualität von Ackerflächen als Lebensräume
Schaffung zusätzlicher Lebensräume in Ackerflächen
Konsequenzen für einen produktionsintegrierten Naturschutz
Schlussfolgerungen
Literatur
18 Die Renaturierung von Graslandbeständen als komplexes System
So viele Arten auf kargem Boden?
Vom Menschen geschaffen, vom Menschen erhalten
Stark gefährdet
Renaturierung
Renaturierungserfolge bis jetzt: Was kann man erreichen?
Das Verhältnis zwischen der Artenvielfalt und dem Funktionieren eines Ökosystems
Graslandrenaturierung: Diversitäts- und Prioritätseffekte nutzen
Graslandrenaturierung auf marginalem Land – relatives Neuland in der Forschung
Positive Effekte der Vielfalt zeitgerecht nutzen
Wirtschaftliche und ökologische Vorteile bei der Renaturierung von artenreichen Wiesen
Danksagung
Literatur
Teil VI Biodiversität in der Krise
19 Biologische Invasionen – Gefahr im Verzug?
Zur Entwicklung der Invasionsbiologie
Wesentliche Begriffe der Invasionsbiologie
Biologische Invasionen als globales Phänomen
Ursachen der Invasionen
Die Stufen des Invasionsprozesses
Welche Lebensräume sind besonders von Invasionsarten betroffen?
Konsequenzen von biologischen Invasionen
Globaler Wandel und biologische Invasionen
Was können und sollten wir tun? – Management von Invasionen
Literatur
20 Was Muscheln und Seesterne über den Zustand der heimischen Meere erzählen
Der Salzgradient als natürlicher Stressor
Besonderheiten der Bodengemeinschaften in der deutschen Ostsee
Der Mensch als zusätzlicher Stressfaktor
Die Auswirkungen auf die Wirbellosen
Die Umsetzung in der Bewertung
Wie ist denn nun der Zustand der Ostsee?
Literatur
21 Biodiversität braucht Raum
Ursachen und Triebkräfte für den Biodiversitätsverlust
Biologische Vielfalt und Raumplanung in Deutschland – die gesetzlichen Grundlagen
Defizite der raumplanerischen Instrumente zum Schutz der Biodiversität
Wie kann die Raumplanung besser zum Biodiversitätsschutz beitragen?
Konkrete Handlungsempfehlungen
Fazit
Literatur
22 Biodiversitätsforschung und politisches Handeln
Beispiele für die enge Beziehung zwischen ökologischen und politischen Biodiversitätsfragen
UN-Umweltabkommen und internationale Biodiversitätsziele
Politische Gutachten und die Ökonomisierung von Biodiversität
Waldschutz durch Klimaschutz
ABS – Gerechtigkeitsaspekte
Das Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung in Deutschland
Schlussbemerkung
Literatur
Index
Autorenverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Rothe, P., Storch, V., See, C. v. (Hrsg.)
Lebensspuren im Gestein
Ausflüge in die Erdgeschichte Mitteleuropas
in Vorbereitung
ISBN: 978-3-527-32766-9
Lingenhöhl, D.
Vogelwelt im Wandel
Trends und Perspektiven
2010
ISBN: 978-3-527-32712-6
Gottschalk, G.
Welt der Bakterien
Die unsichtbaren Beherrscher unseres Planeten
2009
ISBN: 978-3-527-32520-7
Herausgeber
Prof. Dr. Dr. h. c. Erwin Beck
Universität Bayreuth
Bayreuther Zentrum für Ökologie und
Umweltforschung
Universitätsstr. 30
95447 Bayreuth
Titelbild
Ganz oben: Guzmania musaica, eine Zisternenbromelie, Bild: Georg Zizka; Im Uhrzeigersinn: Die Schenkelbiene Macropis fulvipes, Bild: Dötterl; Rhodococcus erythropolis DSM 43066, Bild: DSMZ; Schwarzmündige Bänderschnecke (Cepaea nemoralis), Bild: Al Greer; Chondromyces apiculatus DSM 14605, Bild: Hans Reichenbach; Europäischer Stör (Acipenser sturio), Bild: R. Gros. Baum, Bild: summer day©Alessia, Fotolia.com; Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Bild: Monika Feiling; Fische, Bild: Stachelmakrelen©aqua4, Fotolia.com; Pilze, Bild: Monica Feiling; Trägerkrabbe (Paromola cuvieri), Bild: MARUM, Universität Bremen; in der Mitte oben: Verrucomicrobium spinosum DSM 4136, Bild: Manfred Rohde, HZI, Braunschweig.
1. Auflage 2013
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN: 978-3-527-33212-0
ePDF ISBN: 978-3-527-66555-6
ePub ISBN: 978-3-527-66556-3
mobi ISBN: 978-3-527-66557-0
Umschlaggestaltung Adam-Design, Weinheim
Satz TypoDesign Hecker GmbH, Leimen
Redaktion Claudia von See, Mannheim
Herstellung Claudia Zschernitz, Weinheim
Erwin Beck hat Biologie, Chemie und Geografie studiert und mit einer Arbeit in der Pflanzensystematik promoviert. Anschließend wechselte er in die Pflanzenphysiologie und leitete von 1975 bis 2006 den Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie an der Universität Bayreuth. Aufgrund seiner breiten Expertise in den Pflanzenwissenschaften war er als Biologe in verschiedenen Gremien der deutschen und internationalen Wissenschaft tätig und leitet derzeit die Senatskommission für Biodiversitätsforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Vorwort
Kennen und Kennenlernen ist die eine Seite der Beschäftigung mit der biologischen Vielfalt, die Gründe für ihr Entstehen und Vergehen eine andere, ihre Bedeutung für die Ökosysteme und für die Menschen wieder eine andere – und so gibt es eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Aspekten des Phänomens, das diesem Buch seinen Titel gegeben hat: die „Vielfalt des Lebens“. Trotz atemberaubender Dokumentarberichte über Landschaften, Vegetation und Tierleben in Fernsehen, Videos und Magazinen und trotz Biologieunterricht an den Schulen ist die Bedeutung der Biodiversität noch wenig ins Bewusstsein vieler Zeitgenossen eingedrungen, geschweige denn wird ihre Erhaltung als prioritäre gesellschaftliche Aufgabe akzeptiert. In Deutschland, seit kurzem Sitz des Weltbiodiversitätsrats, nimmt sich die „Allianz der Wissenschaftsorganisationen“1 in besonderer Weise der Biodiversitätswissenschaft an. Sie hat die in ihren Institutionen tätigen Experten gebeten, interessante Aspekte der Biodiversität aus wissenschaftlicher, planerischer und politischer Sicht in anschaulicher Weise für eine interessierte Leserschaft aufzubereiten.
Ein langer Weg: Biodiversitätsschutz per Gesetz
Anlass zum Entstehen dieses Buches ist ein wichtiger Jahrestag: Vor zwanzig Jahren, am 5. Juni 1992, hat die Völkergemeinschaft einen großen Schritt für die Erhaltung der Vielfalt der Organismen auf der Erde getan. Mit der „Convention on Biological Diversity“ (CBD), der nach dem Veranstaltungsort benannten „Rio (de Janeiro)-Konvention“ zur Biodiversität, bekam eine Domäne der Biologie eine politische Dimension, die für viele forschende und praktizierende Biologen eine besondere Herausforderung bedeutete. Vor allem traf sie die Taxonomen, Systematiker, Ökosystem- und Global-Change-Forscher, die Bioprospektierer (die beileibe nicht alle Biopiraten waren und sind), aber auch die im Naturschutz Tätigen, deren Engagement sich nun mit der globalen Politik arrangieren muss. Deutschland ist ebenso wie 192 weitere Länder einer der Vertragsstaaten der CBD und muss die Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenz in deutsches Recht umsetzen (Gesetz zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 30. August 1993, BGBl.II Nr. 32, S. 1741ff). Die weit über die Tätigkeit von Biologen hinausreichenden Regelungen sind in der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ aus dem Jahr 2008 niedergelegt, die sage und schreibe rund 330 konkrete Ziele und 430 Maßnahmen zu Naturschutz und nachhaltiger Nutzung der Biodiversität in Deutschland ausweist. Viele dieser „Aktionsfelder“ regeln das Handeln von Behörden, der Industrie und der Wissenschaft und betreffen die Bürgerinnen und Bürger eher indirekt. Andere aber betreffen sie direkt und erfordern einen gewissen biologischen Sachverstand. Hier liegt das Ziel des vorliegenden Buches; um dieses deutlich zu machen, sei kurz aus der „Nationalen Strategie“ zitiert. Unter der Überschrift „Konkrete Visionen“ steht unter anderem das Kapitel „Gesellschaftliches Bewusstsein“. Hier heißt es „Biologische Vielfalt erfreut sich in Deutschland einer hohen Wertschätzung als wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität und ist Voraussetzung für ein gesundes und erfülltes Leben. Dies drückt sich im alltäglichen, eigenverantwortlichen Handeln aus. Ziel ist es, dass im Jahre 2015 für mindestens 75% der Bevölkerung die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu den prioritären gesellschaftlichen Aufgaben zählt.“
Wurde diese Zielvorgabe damals zu weit gesteckt? Vermutlich schon, aber das liegt nicht am Ziel, sondern an der Jahreszahl. Setzen wir einmal in Gedanken „biologische Vielfalt“ mit dem Begriff „Natur“ gleich: Aus unserer Erfahrung vertrauen wir darauf, dass die „Natur“ vieles reguliert, vieles heilt, womit sie der Mensch notgedrungen, aus Gründen des Lebensstandards und des Profits belastet. Pflanzen reinigen die Luft, Fließgewässer reinigen sich selbst, solange die in ihnen lebenden Organismen nicht vergiftet werden. Wir genießen die Schönheit der Natur und finden es selbstverständlich, in der Natur reine Luft zu atmen und sauberes Wasser in unseren Seen (und Fließgewässern) vorzufinden; wir wollen die Natur erhalten, aber doch möglichst ohne weitere Kosten. Ob das möglich ist, hängt auch davon ab, dass wir selbst etwas mehr von der „Natur“ wissen und unser Handeln so gut es eben geht, damit abstimmen. Viele Ansätze dazu werden „von oben“ verordnet, z. B. die Behandlung der Abfälle und der Abwässer, die Reduzierung des Ausstoßes von „Treibhausgasen“, die Nutzung erneuerbarer Energien usw. Es sind keine geringen Kosten, die der Einzelne direkt oder indirekt zu tragen hat. Dazu kommen Vorschriften für den Umgang mit Agrarflächen und die Ausweisung von Schutzgebieten, die potenzielle Wirtschaftsflächen schmälern. Auch wenn wir diese Maßnahmen im Prinzip positiv bewerten, „gefühlt“ und de facto sind sie drastische Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit und erzeugen dadurch Unbehagen. Ein besseres Verständnis der Vorgänge in der „Natur“ würde dieses Unbehagen lindern und die Bereitschaft zur Unterstützung der Natur erhöhen.
Artenvielfalt: Lastenverteilung auf viele Schultern
Die ökologische Wissenschaft betrachtet unsere Lebensräume als „Ökosysteme“, die aus natürlichen sowie (in den meisten Fällen) vom Menschen geschaffenen Bauelementen bestehen, die miteinander in irgendeine Wechselwirkung oder Aktion treten: Solche Wechselwirkungen können für uns Menschen als Komponenten und Nutzer der Ökosysteme positiv sein (wir sprechen dann von den Dienstleistungen des Ökosystems: Beispiele sind die Wechselwirkung „Blumen – Bienen – Honig“ oder die Nahrungsketten, auf denen die erwähnte Selbstreinigung der Fließgewässer beruht), sie können ebenso aber auch nachteilig für uns sein, denn die Natur unterscheidet nicht zwischen „gut“ und „schlecht“ für den Menschen. An fast allen Vorgängen, die sich im Ökosystem abspielen, sind Organismen beteiligt. Man spricht von ökosystemaren Stoffumsetzungen und Energieflüssen. Der größte Teil der Energie, die in ein Ökosystem hineinfließt, wird zusammen mit dem Kohlenstoffdioxid der Luft zur Photosynthese der Pflanzen, also zur Stoffproduktion, genutzt. Davon leben dann wieder die Pflanzenfresser, die Blütenbestäuber und letztlich auch die Bodenorganismen, die die abgestorbenen Pflanzenteile wieder „mineralisieren“ und so in den Kreislauf zurückführen. Zum nachhaltigen Funktionieren eines Ökosystems gehören also die es bewohnenden Organismen. Je stärker das Ökosystem vom Menschen genutzt wird, umso wichtiger ist die Lastenverteilung seiner Funktionsträger auf viele Schultern, sprich Arten von Organismen. Nachhaltige Nutzung setzt also Organismenvielfalt voraus. Zumindest in diesem Sinne betrifft die CBD alle Menschen. So hieß auch das Motto der letzten Vertragsstaatenkonferenz der CBD im Jahre 2010 „Mit der Natur in Einklang leben“.
Kulturelle Dienstleistungen der Natur
Wenn oben davon die Rede war, dass wir Natur schön finden, so hat auch das etwas mit Wissen zu tun: Je mehr wir darüber wissen, in welcher Form uns die Natur begegnet, umso beglückender ist in der Regel auch diese Begegnung. Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts hat die Natur viel ursprünglich Bedrohliches verloren, eben weil wir heute mehr über sie wissen, „Bedrohliches“ von Raubtieren bis hin zu bestimmten Infektionskrankheiten eliminiert haben und so ihre Schönheit mit allen Sinnen in uns aufnehmen können.
Das Millennium Ecosystem Assessment der Vereinten Nationen ist eine umfassende Beurteilung des Zustands und der Perspektiven der Ökosysteme der Erde, an der weltweit über 1300 Wissenschaftler gearbeitet haben und die 2005 veröffentlicht wurde. Sie hat 24 Millionen US-Dollar gekostet. In dem Werk wird diese persönliche Beziehung zur Natur als die kulturelle Dienstleistung des Ökosystems bezeichnet, in der Ästhetik, Spiritualität, Bildung und Erholung das Wohlbefinden des Menschen fördern. Auch die kulturelle Dienstleistung des Ökosystems wird zum großen Teil von seinen Lebewesen erbracht, der Vegetation, dem Heer der Pilze, dem Tierleben, den Mikroorganismen – je vielfältiger diese Elemente sind, umso höher ist auch der kulturelle Wert des jeweiligen Ökosystems.
Mit dem Hinweis auf die Dienstleistungen der Ökosysteme wie die Selbstreinigung oder das Honigsammeln habe ich nur zwei Beispiele herausgegriffen, die zeigen sollen, warum Biodiversität Vielfalt des Lebens bedeutet und warum es im Sinne der Nationalen Strategie enorm wichtig ist, uns mit der biologischen Vielfalt zu befassen, um sie zu erhalten. Wir sprechen heute vom sechsten großen Massensterben, das möglicherweise das größte Artensterben in der Geschichte unserer Erde werden könnte. Ob wir es an- oder aufhalten können, ist zweifelhaft, solange sich die Ökosystemkomponente „Mensch“ weiter in rasanter Weise vermehrt. Leider können wir dieses Massensterben nicht richtig einschätzen, weil wir nach neuen Hochrechnungen noch nicht einmal 10% der Arten kennen, die mit uns zusammen die Erde bewohnen. In dieser Situation ist der Gedanke wenig tröstlich, dass wir nicht wissen, was wir möglicherweise gerade verlieren, weil wir die Arten, ihre Lebensweisen und ihren potenziellen Nutzen für die Menschen nicht kennen.
In diesem Jahr 2012 begehen wir den 20. Geburtstag der CBD feierlich auf der internationalen Bühne in Rio de Janeiro. Das vorliegende Werk „Vielfalt des Lebens“, das einen Überblick über die Vielschichtigkeit des schlichten Begriffs „Biodiversität“ gibt, soll ein Beitrag der deutschen Wissenschaft zu diesem Jubiläum sein.
Ein Buch mit über 20 Kapiteln und noch viel mehr Autoren schreibt sich nicht von alleine, sondern erfordert ein gehöriges Maß an Idealismus von allen Seiten, den Verfassern ebenso wie dem Verlag. Für ihr großes und nicht eben selbstverständliches Engagement, welches das Verantwortungsbewusstsein der Biologen gegenüber der Öffentlichkeit belegt, sei allen Autoren sehr herzlich gedankt. Ganz besonderer Dank gilt der Redakteurin vom Wiley-Verlag, Claudia von See, die sich mit Begeisterung an dieses Werk gemacht und es in unermüdlichem Einsatz in die nun vorliegende attraktive Form gebracht hat. Großer Dank gebührt schließlich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die den Plan der deutschen Lebenswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen, ein Buch über die Biodiversität für die Öffentlichkeit herauszubringen, aufgegriffen und ideell und finanziell gefördert hat.
Bayreuth, im April 2012
Erwin Beck
1 Hier vertreten durch die Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, die Max-Planck-Gesellschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft; dazu kommt ein Beitrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Wolfgang Nellen ist seit 2011 Präsident des VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland e.V.). Als Inhaber des Lehrstuhls für Genetik an der Universität Kassel gehört sein Forschungsinteresse der Epigenetik und der Steuerung der Genexpression durch kleine regulatorische RNA-Moleküle. Er ist Initiator des Schülerlabors „ScienceBridge e.V.“, das er seit 1997 leitet.
Zum Geleit: Ein Reiseführer in die „Vielfalt des Lebens“
Kommen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Biodiversität! Dieses Buch begleitet Sie als Reiseführer zu Hotspots biologischer Vielfalt, in wenig erforschtes wissenschaftliches Terrain und in extreme Habitate. Die Autoren berichten aus erster Hand über die Faszination biologischer Vielfalt und über aktuelle Forschungsergebnisse. Von den kleinsten Mikrobengemeinschaften bis hin zur Biodiversität der großflächigen Polargebiete werden dabei zentrale Forschungsfragen beleuchtet: Wie entsteht biologische Vielfalt? Welche Funktionen hat sie? Wie kann man sie nutzen? Welche aktuellen Entwicklungen gilt es in Zeiten von Klimawandel und zunehmenden Landnutzungskonflikten zu berücksichtigen?
„Biodiversität“ hat immer eine räumliche und eine zeitliche Dimension und verändert sich daher ständig. Dies gilt für alle Ebenen biologischer Vielfalt (Gene, Arten, Ökosysteme). Um Arten oder Lebensräume in einem „erwünschten“ Zustand zu erhalten oder in einen solchen zu bringen, greift der Mensch ein. Er bevorzugt einzelne Merkmale, Arten und Biotope, während er andere benachteiligt. Durch selektive Zucht und Kultivierungsmethoden entstand und entsteht Neues, das den Pool der Gen-, Arten- und Lebensraumvielfalt bereichert. Andere Maßnahmen, zum Beispiel unangemessene Landbewirtschaftungsformen, führen zu einer Verarmung der biologischen Vielfalt.
Verschiedene Studien zeigen die Verknüpfung von biologischer und kultureller Vielfalt. Kulturelle Ausdrucksweisen und Techniken werden durch die biologische Vielfalt, deren Entwicklung und die von ihr zur Verfügung gestellten Serviceleistungen beeinflusst. Die UNESCO weist beispielsweise darauf hin, dass biologische Vielfalt traditionell oft kleinräumig erfahren und spezifisch in Sprache gefasst wird. Mehr als 80% der Regionen, die eine große biologische Vielfalt aufweisen, gehören zugleich zu den Regionen mit der größten Anzahl an Sprachen.
Damit kommt der biologischen Vielfalt eine besondere Bedeutung für eine zukunftsfähige Entwicklung zu. Katrin Vohland und Mitautoren fragen daher nicht zu Unrecht „Welcher Lebensstil ist anzustreben? Beim Naturschutz geht es nicht um rein nutzungsbezogene Argumente, sondern auch um das gute Leben, um Glück“.
Umfassende Ansätze sind gefragt
Eine Grundvoraussetzung, um Biodiversität erhalten und schonend nutzen zu können, ist die Bestandsaufnahme der real vorhandenen Vielfalt und der Beobachtung ihrer Veränderung in der Zeit. Darüber hinaus sind fächerübergeifende Ansätze für die Erforschung der Biodiversität erforderlich. Die grundlegende Bestandsaufnahme der vorhandenen Biodiversität und die Beobachtung ihrer Variabilität ist eine Kernaufgabe der Biowissenschaftler. Etwa 30.000 von ihnen haben sich im Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO e.V.) zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten und um Öffentlichkeit und Entscheidungsträger zu informieren.
Herausforderungen für Biologen
Eine wichtige Frage für unseren Verband lautet: Sind wir Biowissenschaftler wirklich optimal aufgestellt, um das Zukunftsthema Biodiversität zu bearbeiten? Ja und nein: Ja, weil wir in den vergangenen Jahren Methoden und Werkzeuge entwickelt haben, die uns neue, tiefere und umfassendere Einblicke ermöglichen. Nein, weil es trotz mancher Förderprogramme noch immer schwierig ist, dieses komplexe Forschungsgebiet langfristig abzusichern. Der Wandel auf allen Ebenen der biologischen Vielfalt lässt sich oft nur durch Langzeitstudien untersuchen. Strebt man ein auch nur annähernd repräsentatives Beobachtungsnetz an, so dürfte die Infrastruktur dabei das geringere Problem darstellen. Entscheidend sind vielmehr die Köpfe „dahinter“. Wir brauchen Biodiversitätsexperten, die die einzelnen Arten, ihre Ansprüche und ihr Verhalten umfassend kennen und die gesammelten Daten kompetent auswerten und interpretieren können. Um dies zu erreichen, bedarf es zweierlei: Zum einen einer gut fundierten taxonomischen und ökologischen Ausbildung an den Universitäten und zum anderen einer zuverlässigen beruflichen Perspektive für junge Biodiversitätsforscher. Leider haben sich die Rahmenbedingungen beispielsweise durch Umwidmungen von Lehrstühlen und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in den vergangenen Jahren eher verschlechtert. Der VBIO fordert daher unter anderem die Einrichtung von Stiftungsprofessuren für die taxonomische Forschung (www.taxonomie-initiative.de).
Weiterbildung ausbauen
Gerade der umfassende, interdisziplinäre Ansatz der Biodiversitätsforschung benötigt eine breite Expertise auf mehreren Spezialgebieten der Biowissenschaften. Wissenschaftler werden sich ständig fortbilden müssen, um mit neuen Methoden und Konzepten arbeiten zu können. Dafür müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden und vor allem darf akkumuliertes Wissen nicht in zeitweiligen „Förderengpässen“ verloren gehen. Selbstverständlich leisten auch exzellente Ehrenamtliche einen großen Beitrag zur Biodiversitätsforschung. Für manche schwer zu beobachtende Artengruppen wird es aber immer wieder schwierig werden, ausreichend „ehrenamtliche Experten“ zu gewinnen. Daher müssen Weiterbildungsangebote im Bereich der Artenkenntnis und der Naturbeobachtung ausgebaut werden. Möglichst viele Engagierte sollten so Gelegenheit erhalten, ihre Beobachtungsgabe, Artenkenntnis und Verständnis für wissenschaftliche Herangehensweisen zu schulen.
Verständnis fördern
Auch dieser Ansatz wird nur die ohnehin Interessierten erreichen. In der breiten Öffentlichkeit fehlt es vielfach selbst an grundlegenden Kenntnissen über biologische Vielfalt. Der Begriff „Biodiversität“ ist sperrig und erklärungsbedürftig. Die Veränderung der biologischen Vielfalt ist oft nur bei genauerem Hinsehen oder nur für Experten sichtbar. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im Jahr 2009 nur 22% der Befragten ausreichende Kenntnisse über biologische Vielfalt und ein entsprechendes Bewusstsein hatten und die Thematik zu den wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben zählten (die sie ja zweifellos ist). Dieser Wert soll gemäß der „Nationalen Biodiversitätsstrategie“ bis 2012 auf mindestens 75% steigen. Da ist noch viel zu tun!
Faszination vermitteln
Es ist daher gerade uns Biowissenschaftlern (und dem VBIO) ein besonderes Anliegen, umfassend und verständlich über biologische Vielfalt, ihre Erforschung und ihre Bedeutung zu informieren (siehe auch www.vbio.de/informationen/wissenschaft_gesellschaft/thema_biodiversitaet). Dabei muss auch die Faszination deutlich werden, die uns dieser spannende Forschungsgegenstand immer wieder beschert. Das Buch „Die Vielfalt des Lebens“ trägt in besonders gelungener Weise zu diesem Ziel bei. Gut verständliche Übersichtsartikel, informative Exkurse und spannende Berichte direkt aus der Biodiversitätsforschung garantieren eine anregende Lektüre. „Die Vielfalt des Lebens“ ist ein „Reiseführer“, mit dem Interessierte die biologische Vielfalt (neu) entdecken können und der bei Neueinsteigern Interesse wecken kann. Ich möchte die Lektüre dieses Buches einem breiten Publikum, insbesondere aber jungen Leuten und Multiplikatoren aus Bildung, Forschung, Verwaltung und Planung ans Herz legen, damit dieses Forschungsgebiet, das für unsere Zukunft von immenser Bedeutung ist, den Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, den es unbedingt braucht.
Kassel, im Mai 2012
Wolfgang Nellen
Teil I
Biologische Vielfalt entdecken
Die faszinierende und dynamische Vielfalt von a) Genen, b) Arten, c) Lebensgemeinschaften und d) Ökosystemen bildet unsere Lebensgrundlage. Bilder: a) Fotolia © Vit Kovalcik, b) Fotolia © Martina Marschall, c) Fotolia © Gennadiy Poznyakov, d) Fotolia © Jeanette Dietl.
1
Faszination, Bedeutung, Zustand und Zukunft unserer Lebensgrundlage:
Eine Einführung in Fragen zur biologischen Vielfalt
Markus Fischer
Die Erde beherbergt eine faszinierende und dynamische Vielfalt von Genen, Individuen, Populationen, Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosystemen, die im Lauf der Jahrmilliarden entstanden ist. Während diese Vielfalt schon immer ethische und ästhetische Wertschätzung erfuhr, werden ihr immenser ökologischer und ökonomischer Wert erst jetzt erkannt. Faszinierend und wertvoll ist also die biologische Vielfalt – doch auch stark unter Druck. Änderungen der Landnutzung, Klimawandel und biologische Invasionen setzen ihr zu. Wie wird es weitergehen? Die damit verbundenen Forschungsfragen werden in diesem Buch durch interessante Beispiele illustriert.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























