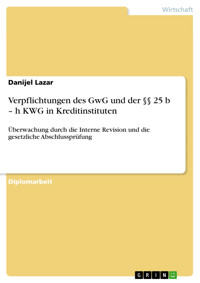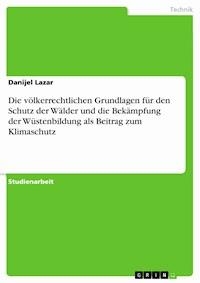
Die völkerrechtlichen Grundlagen für den Schutz der Wälder und die Bekämpfung der Wüstenbildung als Beitrag zum Klimaschutz E-Book
Danijel Lazar
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Umweltwissenschaften, Note: 2,7, Universität Siegen, Veranstaltung: Seminar zum Umwelt- und Energiewirtschaftsrecht, Sprache: Deutsch, Abstract: Unsere Welt ist bedeckt von beinahe vier Milliarden Hektar Wald, was 30 Prozent der gesamten Landmasse entspricht. Zwischen den Jahren 1990 und 2005 sank die Zahl um 3 %, was einen durchschnittlichen jährlichen Verlust von 0,2 Prozent bedeutet. Laut OECD Prognosen droht bis zum Jahr 2030 ein weiterer Rückgang der Naturwaldflächen von bis zu 13 Prozent. Die Gründe der Entwaldung sind vielschichtig; der Hauptgrund liegt in der wachsenden Weltbevölkerung und der damit verbundenen gestiegenen Nachfrage nach Holz. Unter Entwaldung versteht man, im Umkehrschluss zur Definition der Aufforstung des IPCC, die durch den Menschen direkt verursachte Veränderung der Nutzung einer Bodenfläche durch Wald zur anderweitigen Nutzung. Wälder sind auf Grund ihrer vielfältigen Funktionen, z.B. für den Schutz der Böden und des Grundwassers, als CO2-Speicher, als Lebensgrundlage oder als erneuerbare Rohstoffquelle ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensgrundlage der Erde. Auf Grund dessen muss es eines der dringendsten Ziele der globalen Umwelt- und Klimapolitik sein, die Entwaldung zu stoppen und die Wälder wieder aufzuforsten. Das nachfolgende Kapitel zeigt die völkerrechtlichen Grund-lagen der Staatengemeinschaften gegen die Entwaldung bzw. für den Schutz der Wälder auf. Da es bisher an einem internationalen rechtsverbindlichen Instrument, wie einer Waldkonvention, fehlt, wird lediglich auf die wichtigsten völkerrechtliche Verträge, Beschlüsse und Resolutionen internationaler Organisationen sowie auf regionale Initiativen und Programme eingegangen. Diese werden dabei chronologisch nach ihrem Abschlussdatum dargestellt. Am 02.02.1971 wurde in Ramsar, Iran, das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung geschlossen. Es stellt das erste internationale Übereinkommen dar, welches bestimmte Ökosysteme auf globaler Ebene schützt. Dies geschieht allerdings nur indirekt durch Art. 1, wonach sich unter den Begriff Feuchtgebiet auch einige Waldökosysteme wie die Mangrovenwälder subsumieren lassen. Aktuell (Stand: Mai 2009) haben 159 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet, wodurch 1847 Feuchtgebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 181 Mio. Hektar geschützt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 1
1. Teil: Einleitung
Abschmelzende Polkappen, zunehmende Wirbelstürme, Re-kordhitze1. Seitdem unumstritten ist, dass die globale Erderwärmung Realität ist, hat das Thema des Klimaschutzes an Bedeutung gewonnen. Auf unzähligen Gipfeltreffen von Regierungsvertretern werden Maßnahmen diskutiert wie die Klimakatastrophe noch abzuwenden bzw. zu mildern ist. Dabei wurden vor allem im Rahmen von Treffen der Vereinten Nationen unzählige völkerrechtliche Konventionen unterzeichnet, welche dem Klimaschutz dienen sollen. Die Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen wird letztlich über die Zukunft des globalen Klimas entscheiden2.
Gegenstand dieser Arbeit sind die völkerrechtlichen Grundlagen für den Schutz der Wälder und die Bekämpfung der Wüstenbildung als Beitrag zum Klimaschutz. Die Arbeit beginnt dabei mit einigen Begriffsbestimmungen, welche zum Verständnis des nachfolgenden Teils notwendig sind. Nachfolgend wird im 2. Teil der Arbeit auf die völkerrechtlichen Grundlagen für den Schutz der Wälder eingegangen. Hierbei wird zunächst definiert was man unter Entwaldung versteht und was ihre Ursachen sind um anschließend die völkerrechtlichen Grundlagen zum Schutz der Wälder darzustellen. Dabei wird gezeigt, dass es an internationalen verbindlichen Instrumenten zum Schutz der Wälder mangelt. Im 3. Teil der Arbeit wird schließlich auf die völkerrechtlichen Grundlagen der Bekämpfung der Wüstenbildung (Desertifikation) eingegangen, wobei wiederum zunächst Wüstenbildung definiert wird sowie deren Ursachen und Folgen dargestellt werden um nachfolgend auf die völkerrechtlichen Grundlagen zu ihrer Bekämpfung einzugehen. Hierbei wird gezeigt, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
1Günther,Klimawandel und Resilience Management, S. 1.
2<http://www.umweltberatung.at/start.asp?ID=8757>, abgerufen am 01.07.2009.