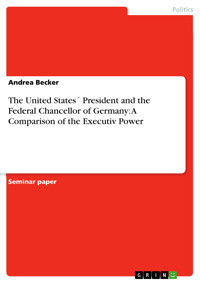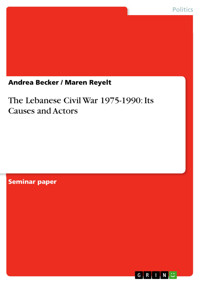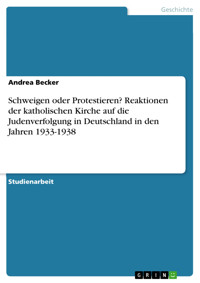6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Pianistin Margret hat mit dem Leben schon abgeschlossen und sieht ihrem nahen Tod gelassen entgegen. Doch anstatt zu sterben, erwacht sie wieder aus dem Koma und sieht in einen Spiegel. Das Gesicht kennt sie, es ist nicht ihr eigenes. Und es bleibt nicht bei diesem einen entsetzlichen Moment. Gefangen in einem anderen Körper beginnt Margret ein neues Leben, in dem sie nicht nur mit dem Verlust ihrer eigenen Identität, sondern auch mit den dunklen Geheimnissen ihres Mannes konfrontiert wird. Was ist der Preis für ein zweites Leben? Ein Psychothriller über die Abgründe menschlicher Besessenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Die Vollendete
Psychothriller
von Andrea Becker
Impressum
© 2024 Andrea Becker info@ becker-books.com
Titel des Buches: Die Vollendete
Autorin: Andrea Becker
Erscheinungsdatum: Juli 2024
Kontakt:[email protected]
Am Holderstauden 12, 61352 Bad Homburg
Lektorat: Christiane Geldmacher, www. textsyndikat.de
Cover: Andrea Becker
Bilder: 123rf
Urheberrecht: © 2024 Andrea Becker. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Ebook ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung, öffentlichen Zugänglichmachung oder anderen Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors.
Haftungsausschluss: Die Inhalte dieses Ebooks wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen in diesem Ebook entstehen.
Alle Personen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten rein zufällig.
Kapitel 1
Margret sah in den Spiegel und fing an zu zittern. Karl streichelte lächelnd ihre Hand. „Alles ist gut, meine Liebe. Du wirst dich daran gewöhnen. Hauptsache ist doch, dass du lebst.“ Seine näselnde Stimme drang kaum zu ihr durch.
Er nahm ihr vorsichtig den Handspiegel ab, den sie ihm nur widerstrebend überließ.
Sie kannte das Gesicht, das sie gesehen hatte. Es war nicht ihr Eigenes.
Ein halbes Jahr zuvor
Der Ton verklang, doch sie versuchte, so lang es ging, ihn festzuhalten, denn es war ihr Letzter. Der letzte Ton, den sie in der Öffentlichkeit auf einem Flügel spielen würde. Noch war sie ganz bei sich und ihrer Musik, da erscholl donnernder Applaus. Margret sah auf und wandte sich den Menschen zu, die sie feierten. „Danke“, flüsterte sie und legte die Hände aneinander. Das Publikum erhob sich von den Plätzen und jubelte ihr zu. Fast zweieinhalbtausend waren in den großen Saal der ausverkauften Alten Oper gekommen, um sie ein letztes Mal live zu hören und zu sehen. Kameras waren auf sie gerichtet, die das Ereignis übertrugen und ein Dutzend Fotografen knieten und standen vor der Bühne, um den Moment festzuhalten. Ein Regen roter Rosenblätter schwebte auf sie nieder, während sie aufstand und sich verbeugte. Sie schwitzte im Licht der heißen Bühnenscheinwerfer unter der Perücke, die den inzwischen kahlen Kopf bedeckte, bemühte sich um ein strahlendes Lächeln, was ihr schwerfiel, da die Schmerzen nach dem Sitzen zu heftig waren. Medikamente vor diesem Konzert waren für sie nicht in Frage gekommen.
Sie hatte ein letztes Mal ihr Bestes geben wollen, alles noch einmal hautnah erleben, den Geruch nach Staub und trockenem Holz, das Murmeln der Mitarbeiter hinter der Bühne. Sie wollte dieses Kribbeln auf der Haut spüren in den Sekunden, bevor sie hinaus trat in den Schein der hellen Lampen. Dieser Moment, in dem sie so klein und verloren in dem riesigen Saal vor all den Menschen stand, den kurzen Anflug von lähmender Angst zu versagen aushalten und ihn vorbei ziehen zu lassen. Und dann alles geben, um die Musik zu feiern. Das war ihr Leben gewesen, über fünfzig Jahre lang, seit sie, das einstige Wunderkind, das erste Mal in der Grundschule vor großem Publikum Klavier gespielt hatte.
Jetzt sah sie neben der Begeisterung Trauer in den Gesichtern der vorderen beiden Reihen, wo ihre Eltern und engste Freunde saßen, in der Mitte ihr Mann Karl. Nicht mehr lange, und er würde mehr Zeit für seine Geliebte haben.
Adelina, ihre Managerin, kam tränenüberströmt zu ihr und fiel ihr um den Hals. „Bitte bleib“, schluchzte sie. „Geh nicht, es wird bestimmt wieder besser.“
Margret drückte sie kurz an sich und küsste sie auf die Wange. Dann sah sie ihr in die Augen und schüttelte den Kopf. „Es war gut, was wir hatten. Danke für alles.“ Sie drehte sich wieder dem Publikum zu, verbeugte sich an Adelinas Hand und schritt unter dem anhaltenden Applaus hinter die Bühne. Dort ließ sie sich auf einen Stuhl fallen und nahm zwei Tabletten, die den ärgsten Schmerz endlich ausschalten würden.
Denn noch war der Abend nicht vorbei. Nach einer kurzen Pause verließ sie den Raum hinter den Kulissen und trat unbemerkt von den hinausströmenden Gästen in den Flur vor den Künstlergarderoben.
„Komm hier rein.“ Adelina, die schon auf sie gewartet hatte, zog sie mit sich in einen der kleinen Säle, öffnete die Tür und schob sie hinein. Dort empfing sie ihre engsten Mitarbeiter, Kollegen und Freunde. Was hatte sie nicht alles mit ihnen erlebt, an Glück und Dramen, Intrigen und Erfolgen. Diese Menschen jeden Alters, Herkunft und Temperaments hatten ihr so viel bedeutet, war sie doch für die meisten eine Vertraute gewesen, die aufmerksam zuhörte und darauf geachtet hatte, nie ungefragt Rat zu geben.
Am Rand saßen ihre Eltern, ihre Mutter strahlend und mit feuchten Augen, ihr Vater mit zusammengepressten Lippen, nickte ihr zu. Sie hielten sich an den Händen und wirkten verloren unter den jüngeren, agilen Menschen, die um sie herumliefen.
Etwas abseits stand ihre beste Freundin Patricia, genannt Patte. Sie kaute so nachdrücklich ein Kaugummi, als ob es sich wehren würde, und musterte die Leute um sich herum. Sie trug den schwarzen kurzen Rock, den sie meistens im Café anhatte, wenn sie dort bediente, und eine dunkelgraue Bluse wie zu einer Beerdigung, aber mit einer Kette um den Hals, die aussah, als wäre sie aus silbernem Stacheldraht gefertigt. Margret hatte ihr diese geschenkt, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Damals hatte sie noch gut zu ihr gepasst, inzwischen hatte Patte alles daran gesetzt, dass sie nicht mehr passte. Und doch trug sie sie heute.
Der Raum war mit bunten Sommerblumen dekoriert, auf den zusammengeschobenen Tischen stand ein kleines Buffet, daneben Getränke wie zu einer Geburtstags-Party.
„Du warst phantastisch, Liebes.“ Ihr Mann Karl kam auf sie zu und nahm sie kurz vorsichtig in den Arm.
Beifall erklang. Der Dirigent des Abends, ein alter Freund aus Studienzeiten, gab ihr mit einer Verbeugung ein Glas Sekt und prostete ihr zu. „Auf die größte Künstlerin, die diese Hallen je gesehen haben.“ Er leerte es auf einen Zug und ließ sich ein weiteres reichen. Margret senkte verlegen lächelnd den Blick und setzte an zu widersprechen, doch alle anderen hoben ihre Gläser und tranken. Sie hielt ihnen ihres entgegen, tauschte es aber gegen Wasser und schluckte erneut eine Tablette, die den noch immer tobenden Schmerz im Unterleib ausschalten sollte.
„Alles, alles Gute, gnä‘ Frau. Ich muss mich leider schon verabschieden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Sie bald genesen und zurück auf die Bühne kommen werden.“ näselte ihr Dr. Magnus Herbst ins Ohr, Manager des Hauses, verbeugte sich und küsste ihre Hand. Die anderen Gäste warteten darauf, dass sie die mehrstöckige Torte in Form eines runden Podestes mit einem schwarzen glänzenden Flügel anschnitt.
Entschlossen ergriff sie das Messer, schnitt zwei Stücke heraus und reichte sie ihren Eltern.
Es gab noch mehr Blumen, Sekt und Abschiedstränen, Anekdoten und Geschenke.
Umringt von Kollegen und mit Patte an ihrer Seite, die sie zu sich gezogen hatte, war sie abgelenkt. Doch schon bald fehlte ihr die Kraft und sie verließ das Gebäude durch den Bühneneingang mit ihrem Mann, der sie nach Hause fuhr, nachdem sie sich zum Schluss von Patte verabschiedet hatte, die sie gar nicht mehr loslassen wollte.
Schweigend saß sie im Auto, die Stirn an das kühle Fenster gelehnt und weinte hemmungslos.
Kapitel 2
Nur sechs Wochen später hätte kaum einer der Gäste sie wiedererkannt.
„Karl, ich will in ein Hospiz. Du hast doch so viel Arbeit und dort wird man für mich sorgen und auf meinem letzten Weg begleiten.“ Margret saß in einem Pflegebett, das Rückenteil hochgestellt und gestützt von einem dicken, weichen Federkissen in ihrem eigenen abgedunkelten Schlafzimmer. Tiefe Schatten lagen unter den grauen Augen, in denen die Lebensfunken einer nach dem anderen verloschen. Sie trug jetzt ein lose gebundenes Kopftuch aus dunkelblauer Seide und wärmte ihre Finger an einer Tasse Minz-Tee, die vor ihr auf einem Tablett stand.
Aber Karl schüttelte nur den Kopf. „Nein, meine Liebe, das können wir auch alles hier zu Hause haben. Du brauchst eine vertraute Umgebung und nicht irgendwelche Betschwestern. Du hast mich, und wenn es dir schlechter geht, verlege ich dich zu mir ins Institut, wo du alles bekommst, was du benötigst. Mach dir keine Sorgen. Ach ja, ich habe hier eine neue Patientenverfügung vorbereitet. Könntest du sie bitte unterschreiben?“
Er drückte ihr einen Stift in die magere Hand, schob die Tasse beiseite und legte einen Bogen Papier vor sie.
Sie hatte keine Kraft mehr, ihrem Mann zu widersprechen. Sie unterschrieb und sank seufzend zurück in ihr Kissen. Er tat es ja nur aus Liebe zu ihr, das wusste sie. Der Gedanke brachte sie zum Lächeln. Aus Liebe. Was hatten sie nur alles aus Liebe getan? Als sie sich kennenlernten, lebte er im Priesterseminar und war auf dem direkten Weg, ein wunderbarer Seelsorger zu werden, wie diese kaputte Welt ihn jetzt brauchte. Gebildet und mitfühlend, fest verankert in seinem Glauben und seiner Zuneigung zu seinen Mitmenschen. Und dann kam sie. Was hatten die Nonnen damals gesagt? Sie solle keine Berufung zerstören.
Sie hatte es sich nicht leicht gemacht, erst als Karl ihr signalisierte, dass er etwas für sie empfand, das über reine Nächstenliebe weit hinausging, konnte sie sich nicht mehr von ihm abwenden. Sie wurden ein Paar und er verließ das Kloster. Für sie. Aus Liebe. Gegen den Rat seiner Familie, seiner Lehrer und seiner Freunde.
Karl fing wieder von vorne an. Er studierte Medizin, wurde ein hoch angesehener Wissenschaftler auf dem Gebiet der Gehirnchirurgie und der Entwicklung künstlicher Intelligenz, welche die doch sehr diffizile Arbeit mit dem Skalpell wesentlich präziser ausführte, als eine menschliche Hand es jemals vermocht hätte.
Aber alles hat seinen Preis. Margret war davon überzeugt, dass Gottes Strafe für sie der Krebs war, der ihre Knochen und Organe zerfraß. Er ließ sich nicht so einfach einen Sohn der Kirche wegnehmen. Und schon gar keinen so fähigen und charismatischen wie Karl.
Der lachte nur über ihre Theorie, aber sie blieb dabei. Und es störte sie nicht. Sie hatte ihren Frieden mit ihrem bevorstehenden Tod gemacht. 25 erfüllte Jahre an seiner Seite waren es ihr wert. Denn Karl hatte sie so geliebt, wie sie es sich immer gewünscht hatte.
Sie war ein Star gewesen, eine Konzertpianistin, wie es sie nur einmal in einem Jahrhundert gab. Sie wurde gefeiert und bejubelt. Aber sie machte sich nichts vor, man feierte nicht sie, sondern ihre Kunst. Der Rest von ihr wurde nicht wahrgenommen, höchstens verwöhnt und gepflegt, damit der musikalische Teil sein Bestes geben konnte.
Ein Mensch, der ganz geliebt wird, kann allein sein, weil er sich der Liebe sicher ist, die ihn ausfüllt. Ein Künstler wird vom Publikum nur für das verehrt was er leistet, egal, wieviel das von ihm ausmacht. Und wenn der Moment des Gebens vorbei ist, das Feiern der Leistung, ist er allein und fühlt die Leere in sich, die nicht wenige zum Absturz bringt.
Karl hatte diese Leere gefüllt und sie das Abebben des Applauses leicht ertragen lassen, da er alle Seiten an ihr kannte und liebte.
Jetzt wünschte sie sich nur noch, in Frieden einzuschlafen und in einem Jenseits aufzuwachen, das hoffentlich mehr für sie bereithielt als das Fegefeuer.
Wenige Tage später hatte sich ihr Zustand so verschlechtert, dass ihr jede Bewegung unerträgliche Schmerzen bereitete, ihre Gelenke waren so geschwollen, dass die Haut spannte wie ein Luftballon. Sie wünschte sich an einen anderen Ort, dachte zurück an ihr letztes Konzert, an die vielen Menschen, die ihr zugejubelt hatten, an die Musik. Mit der Fernbedienung, die in ihrer kraftlosen Hand lag, schaltete sie die Stereoanlage ein und lauschte Bachs Orgelkonzert, das ihr wie ein erstes Versprechen auf die himmlischen Klänge schien, die sie hoffentlich bald hören würde. Ihre Finger zuckten, während sie einige Passagen in Gedanken mitspielte.
Karl gab ihr ein höher dosiertes Morphium-Pflaster, das den Wirkstoff kontinuierlich abgab und sie dämmerte dahin, ohne ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen. Endlich.
Sie hatte sich kurz nach dem Konzert auch von ihrer Familie verabschiedet, als sie es noch mit klarem Kopf konnte und darum gebeten, danach nicht mehr besucht zu werden. Damit sie sie in Erinnerung behielten, wie sie stark genug war, zu lächeln und sie nicht geschwächt und leidend sahen. Nur ihre Freundin Patte wollte dieser Bitte nicht nachkommen, musste sich dann aber geschlagen geben.
Patte war erst vor zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden und Margret hatte sich um sie gekümmert, um alles, was ihr überlasteter Bewährungshelfer nicht leisten konnte. Bei einem Konzert im Frauengefängnis hatten sie sich kennengelernt und gleich einen Draht zueinandergefunden, obwohl sie so unterschiedlich waren, wie zwei Menschen nur sein konnten.
Nach ihrer Entlassung hatte Margret Patte motiviert, einen Beruf zu erlernen, hatte ihr in einem Umfeld eine Bleibe beschafft, das bürgerlicher war als eine Schrebergartensiedlung, und die Wohnung mit aufgearbeiteten Möbeln eingerichtet. Am Anfang war es beinahe ein Vollzeitjob für beide, Patte im Alltag zu begleiten und jede Kleinigkeit ihres Verhaltens zu hinterfragen, jeden Satz, Wortwahl, Bewegungen und Assoziationen neu zu trainieren. Aber es war Pattes eigener Wunsch, den sie mit eisernem Willen verfolgte. Sie wollte ein komplett neuer Mensch werden, ihren Tag strukturieren, den Jargon der Straße ablegen und nicht mehr mit geballten Fäusten durchs Leben gehen. Sogar mit Messer und Gabel essen, eine Serviette benutzen und eine gerade Körperhaltung musste sie mühsam erlernen. Margret schenkte ihr neue Zähne, da ihre durch Vernachlässigung seit Kindesbeinen und spätere Drogenexperimente verwüstet waren.
Und Patte? Patte war ihr zutiefst dankbar. Sie wollte raus aus ihrem alten Umfeld, sie ertrug es nicht mehr in der schmuddeligen Aussichtslosigkeit des Frankfurter Hauptbahnhofs zu leben, wo jeder noch so geniale Coup früher oder später doch wieder im Knast endete.
Der entscheidende Auslöser aber war eine Zellengenossin namens Edna gewesen, die knapp 20 Jahre älter war als sie. Sie saß zum vierten Mal ein, ihre beiden Kinder hatte das Jugendamt in Obhut, sie selbst war im Rollstuhl, da sie von einem Gangmitglied angeschossen worden war, während ihr Partner vor ihren Augen getötet wurde. Kurz vor ihrer Entlassung schnitt sie sich nachts die Pulsadern auf und war tot, als Patte morgens wach wurde und den Geruch des Blutes wahrnahm, in dem Edna lag.
Patte wollte so sein wie die Menschen in den Vorabendserien. Das waren ihre Vorbilder, die sie akribisch studierte und imitierte. Das Leben von Margret, die in ihren Augen alles hatte, was man sich nur wünschen konnte: eine Villa mit Garten, einen erfolgreichen Mann, der ihr Blumen schenkte, und Schmuck, einen Beruf, der ihr Bewunderung einbrachte, gerne auch Interviews für Zeitschriften und Fernsehsendungen.
Margret hatte immer wieder versucht sie davon zu überzeugen ihre Erwartungen nicht zu hoch zu stecken, doch sie ließ sich nicht beirren und nun hoffte Margret, dass sie nicht rückfällig würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Patte musste jetzt ihren Weg allein weiter gehen. Seit Beginn ihrer Krankheit hatten sie nach und nach die Rollen getauscht und so war eine echte Freundschaft entstanden. Patte hatte sich um sie gekümmert, hatte ihr zugehört, sie mit ihrem Pragmatismus aus so manchem Tief geholt. Sie hatte keine Angst über den Tod zu sprechen, wie andere Menschen, die sich seit der Diagnose von ihr entfernt hatten, da sie den schleichenden Verfall nicht ertragen konnten. Sie war an ihrer Seite geblieben, bis sie sich voneinander verabschiedet hatten.
Es war Margrets eigene Idee gewesen, dass alle sie so in Erinnerung behalten sollten, wie sie selbst es noch beeinflussen konnte und nicht als hilflose Hülle, die ihre Körperfunktionen nicht mehr im Griff hatte. So durfte sie niemand sehen.
Kapitel 3
Aufgestützt auf das Fußende des Pflegebettes betrachtete Karl seine bewusstlose Frau. Viel war nicht mehr von ihr übrig: von der zierlichen, mädchenhaften Schönheit, die bis vor ein paar Jahren aussah wie Schneewittchen aus dem Märchenbuch. Jetzt war sie zu einem dürren Ast abgemagert. Ihre Knochen überspannte gelbliche Haut, mit grotesk geschwollenen Gelenken und tief in den Höhlen liegenden Augen. Das Tuch, das den haarlosen Kopf verbarg, war leicht verrutscht. Alt sah sie aus, älter, als sie sowieso schon war. Aber in ihrem Inneren war sie immer noch jung, war sie immer noch die gleiche. Ihren Mut, ihr Lachen und ihre bedingungslose Liebe zu ihm hatte der Krebs nicht zerstören können. Er lächelte und streichelte die Bettdecke über ihren Füßen. Dann wandte er sich ab und griff zum Telefon. „Kevin? Ja, es ist soweit. Ich will sie ins Institut verlegen. Bitte kommen Sie vorbei.“
Minuten später stand ein junger Pfleger vor der ebenerdigen Tür der Villa und schob eine fahrbare Liege hinein. Vorsichtig, als ob er Angst hätte, sie zu zerbrechen, griff er unter sie und hob zusammen mit Karl die federleichte Gestalt aus dem Bett.
„Können Sie noch was für sie tun, Chef?“
Karl schüttelte den Kopf. „Nein, mit ihrem Gehirn ist alles in Ordnung, das andere kann ich nicht beeinflussen.“
Schweigend fuhren sie zu dem stadtteilgroßen Klinikgelände, wo in einem kleinen einzeln stehenden Gebäude das Zentrum für Gehirnchirurgie lag, das Karl schon vor Jahren gegründet hatte. Es war weltberühmt für die bahnbrechenden Erfolge in der Behandlung von Hirn- und Wirbelsäulenschäden nach Unfällen. Kevin fuhr langsam, vor allem in den Kurven.
„Geben Sie Gas, sie merkt das nicht. Ich will sie heute noch auf Station haben“, sagte Karl unwirsch.
Margret stöhnte leise, als er und Kevin sie auf das frisch bezogene Bett in dem großen Einzelzimmer hoben. Der Pfleger zuckte zusammen und sie wäre beinahe seinen Händen entglitten.
„Passen Sie doch auf! Verschwinden Sie! Sagen Sie Schwester Irmgard, sie soll kommen und einen Katheter und eine Magensonde legen.“ Karl sah besorgt zu seiner Frau. Er zog das Morphin-Pflaster ab, stattdessen hängte er sie über den Zugang in ihrer Hand an einen Tropf.
Die Tür des Zimmers öffnete sich erneut und Karl fuhr mit einem bissigen „Was ist jetzt schon wieder?“ herum, sah dann aber einen Mann im Arztkittel eintreten.
Er war ein paar Jahre jünger als er, hatte schütteres helles Haar, das an Pampasgras erinnerte und schmale farblose Lippen. Um seine dünnen Beine schlackerten braune Cordhosen, von denen Karl vermutet hätte, dass sie selbst im Secondhand Laden eine Rarität gewesen wären.
„Ach, Pfeiffer! Wie geht es unserer Patientin? Wie haben Sie sie genannt? Klara? Hat sich irgendetwas verändert?“ Karl drehte sich wieder zu seiner Frau.
„Unverändert, obwohl ihre Vitalfunktionen immer schwerer aufrecht zu erhalten sind. Angehörige wurden übrigens noch nicht gefunden“, raunte der Arzt verschwörerisch und lächelte, als er Margret anschaute. „Wie geht es ihr? Schläft sie?“
Karl schüttelte den Kopf. „Nein es ist zu Ende. Sie erhält jetzt transdermales Buprenorphin und wird wohl nicht mehr wach werden.“
Doktor Pfeiffer schluckte und das Lächeln erstarb auf seinem schmalen Gesicht.
„Doch so schnell. Wie unendlich traurig. Und Sie bleiben bei Ihrem Vorhaben? Das war wirklich der Wille Ihrer Frau?“ Seine Stimme klang etwas heiser.
Zitternd strich er sich eine helle Locke aus der Stirn und schob die goldumrandete Brille nach oben, beides rutschte, wie immer, wieder zurück.
„Natürlich war es das! Glauben Sie, ich würde eine solche Entscheidung ohne sie treffen? Dort in der Schublade liegt ihre unterschriebene Einverständniserklärung. Und jetzt lassen Sie mich mit ihr allein. Morgen bereiten wir den Eingriff vor, aber diese letzte Nacht soll sie in Ruhe verbringen.“
Zögernd verließ Pfeiffer das Zimmer, offensichtlich zum weiteren Gespräch aufgelegt, aber Karl folgte ihm bis vor die Tür.
„Gibt es noch etwas, worüber Sie jetzt unbedingt mit mir sprechen wollten?“
„Unbedingt nicht, nur wegen der letzten Messungen.“
Obwohl er leicht gebeugt wie über einem OP-Tisch stand, war er nicht klein genug, um mit Karl auf Augenhöhe zu sein, er sah immer ein wenig auf ihn herab.
„Schön, das hat Zeit bis morgen, dann machen Sie Schluss für heute. Ich werde mich noch um den Bürokram kümmern. Gute Nacht.“ Damit ließ der Professor seinen ehemaligen Doktoranden stehen und eilte den Flur hinunter in sein Büro.
Kaum hatte er die Tür zu dem hellen Raum mit dem rötlichen Holzboden hinter sich geschlossen, atmete er durch. Sein Reich, sein Refugium, größer als so manches Wohnzimmer, geschmackvoll eingerichtet mit nur wenigen Möbeln bekannter Designer und Künstler. Den meisten Platz nahm eine dunkelgraue Couch mit zwei passenden Sesseln ein, auf denen schon viele Tränen vergossen worden waren, aus Angst, Verzweiflung und schließlich Erleichterung. Der Blick hinaus auf den Parkplatz und das Sandsteingebäude der Forensik wurde von seidenen Gardinen verschleiert. Hier fand sich alles, was ihn ausmachte, seine Auszeichnungen, seine Diplome, Geschenke und Briefe von dankbaren Patienten, denen er ein selbstständiges Leben voller Bewegung geschenkt hatte.
Morgen würde sich zeigen, ob es eine Steigerung gäbe. Morgen war es soweit, sein Lebensziel, sein Lebenssinn würden seinen Höhepunkt erreichen. Wenn alles gut ging. Wenn nicht, wäre er aber schon einen erheblichen Schritt weiter und die Fachwelt würde gespannt warten, was er an Ergebnissen präsentierte. Mit fahrigen Bewegungen ordnete er an seinem Schreibtisch mit der schweren Glasplatte einige herumliegende Papiere. Darauf legte er einen über 3000 Jahre alten Schädel mit Trepanationsöffnung, daneben seinen Autoschlüssel, den er wie ein Schmuckstück immer sichtbar drapierte, wenn er ihn nicht in der Hand hielt.
Sein Besuch, den er erwartete, würde dafür keinen Blick haben.
Wichtiger war, dass die Couch frei, die türkisen Kissen aufgeschüttelt und der Weißwein kalt war. Schnell stellte er Gläser bereit, als er durch das geöffnete Fenster ein tintenblaues BMW-Cabrio sah, das auf den Parkplatz hinter dem Klinikgebäude einbog. Drei Monatsgehälter hatte es ihn gekostet. Zufrieden bemerkte er eine Gruppe Studenten, die dem Wagen bewundernd hinterherschaute.
Ein Blick in den Spiegel seines kleinen Badezimmers zeigte einen lückenlosen Drei-Tage-Bart, er verpasste seiner etwas biederen Frisur mit ein bisschen Wasser einen Hauch Wildheit und öffnete den oberen Hemdknopf. Kurz gewährte er sich ein paar Sekunden, um den Anblick seines tiefgründigen Lächelns und einen Blick aus grauen Augen zu inspizieren, der nur selten seine Wirkung auf die Frauen verfehlte.
Dann stand sie vor der Tür. Sophie. Wie eine 25 Jahre jüngere Version von Margret, nur zusätzlich von der Natur gesegnet mit einem gebärfreudigen Becken und rundem Gesäß, denen ein begnadeter Kollege die passenden Brüste hinzugefügt hatte. Ihre Augen, Wangen und Lippen würden in absehbarer Zeit einer Korrektur bedürfen, aber noch bildeten sie ein ansprechendes, sinnliches Ensemble. Was nach dem heutigen Abend kam, war nicht mehr sein Problem.
Sophie saß mit offenem Mund neben ihm auf dem Sofa, mit geröteten Wangen, zerzaust. Ein Tropfen Sperma lief ihr Kinn herab. „Du verlässt mich? Echt jetzt? Das sagst du mir jetzt?“
Als die Erkenntnis zu ihr durchgesickert war und sie Karls Miene entnahm, dass er es ernst meinte, holte sie aus und versuchte, ihn ins Gesicht zu schlagen. „Du ... du Schwein!“
Er war schnell an das Ende des bequemen Sofas zurückgewichen. Sie nahm ihr Glas und warf es ihm vor die Brust, dann sprang sie auf, sein Glas folgte, während sie ihre Bluse anzog und kaum die Knöpfe schließen konnte vor Wut. Dabei schrie sie ihn unentwegt an. „Sie ist fast tot, ich hab ein Jahr darauf gewartet, dass sie endlich stirbt!“
Er konnte gerade eben der Flasche ausweichen, die einen gelblichen Fleck auf der glatten weißen Wand hinter ihm hinterließ, als sie klirrend zerbrach.
„So hör doch, Sophie, es ist nicht deine Schuld. Ich bin noch nicht bereit für eine neue Beziehung, für etwas Ernsthaftes. Ich muss erst Margrets Tod verarbeiten. Du hast jemand Besseres verdient.“
Jetzt stürzte sie sich auf den Schreibtisch und umklammerte den 3000 Jahre alten Schädel, ohne zu bemerken, was sie in der Hand hielt. Ein unersetzbares Stück, ein Vermögen wert, sollte eigentlich in einem Museum stehen. Unschlüssig stand er hinter dem Sofa, mit offenem Hemd, baumelndem Gemächt und angespannter Muskulatur.
Sie holte langsam aus, fixierte ihn. „Jetzt plötzlich? War ich dir nur zum Vögeln gut genug? Willst du nicht, dass deine Freunde und Kollegen erfahren, dass du deine todkranke Frau betrogen hast? Willst du es abstreiten? Sag schon! Sag, dass ich nicht gut genug bin, dass du dich schämst. Los! Sag es!“
„Sophie, Liebling, bitte. Lass uns Freunde bleiben“, flehte er und ließ den Schädel nicht aus den Augen, während er hinter den Möbeln hin und her lief, um kein Ziel abzugeben.
Sie war erstaunlich nah an der Wahrheit, doch das konnte er nicht zugeben. Aber sein Image würde leiden, wenn sein Umfeld von einer Geliebten erfahren würde, mit der er den beliebten Star internationaler Bühnen betrogen hatte. Unverzeihlich.
Mit einem Sprung, der dem eines Baseball-Profis würdig gewesen wäre, hechtete er über das Sofa und fing den kostbaren Schädel auf, als dieser ihre Hand verlassen hatte. Dabei stieß er sie um. Mit dem Hinterkopf knallte sie gegen die Kante seines Schreibtisches.
Schwer atmend stand Karl vor ihr und starrte sie entsetzt an. Unter ihrem Kopf bildete sich eine Blutlache, die allmählich größer wurde.
„Sophie? Liebling? Das war nicht so gemeint, Sophie? Das wollte ich nicht. Lass uns reden, ja?“
Er trat näher, sah aber sofort, dass sie nicht bei Bewusstsein war. Das Blut floss weiter, sie schien noch zu leben. Ihr Kopf stand in einem unnatürlichen Winkel zu den Schultern, fast wie bei dem Gemälde von Klimt, auf dem eine Frau in goldenem Kleid geküsst wurde.
Eine kurze Untersuchung reichte aus, um zu sehen, dass die Verletzung sehr ernst war. Nicht so ernst, als dass er es nicht hätte richten können, doch soweit er wusste, niemand sonst. Ihr Genick war gebrochen, tragisch, aber nicht unbedingt ein Todesurteil. Bei jedem anderen Arzt würde sie vom Hals ab gelähmt bleiben, aber nicht bei Karl. Trotzdem zögerte er. Er betrachtete nachdenklich ihren kurvigen Körper, ihre feinen Gesichtszüge, die keinen Schaden genommen hatten. Er könnte sie jetzt sofort in den OP bringen und mithilfe der von ihm entwickelten Roboter und Künstlichen Intelligenz operieren. Dann würde sie wieder geheilt und leben.
Aber sie würde ihn anzeigen können und sie würde ihre Beziehung publik machen und seinen Ruf schädigen. Andererseits machte es einen schlechten Eindruck, wenn er sie hier in seinem Zimmer sterben ließ. Vielleicht könnte er sie irgendwo hinbringen? Auch keine gute Idee. Egal wohin er sie brächte und wie geschickt er einen Unfall inszenierte, er würde seine DNA in und an ihr niemals so restlos entfernen können, dass er nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden würde. Zumal sicherlich einige Leute bezeugen konnten, dass sie kurz zuvor bei ihm gewesen war.
Ratlos strich er sich über den Bart. Eine andere Idee reifte in ihm heran. Eine abwegige Idee, undenkbar eigentlich. Unmöglich.
Er verließ sein Zimmer und holte eine fahrbare Liege. Es war nicht leicht, sie darauf zu heben, schließlich wog sie doch einiges mehr als Margret und ihr schlaffer Körper glitt ihm immer wieder aus den Armen. Aber dann hatte er sie dort, wo er sie haben wollte.
Ihre Augenlider fingen an zu flattern, sie stöhnte leise, schlug die Augen auf. Karl schob sie schnell aus dem Zimmer und den Gang entlang zum Bettenaufzug.
„Alles gut, meine Liebe alles gut.“ Er keuchte vor Anstrengung und versuchte, ihr Wimmern zu ignorieren.
Sie fuhren in den OP im Keller, hinter der unscheinbaren Brandschutztür, die immer abgeschlossen war, zu der niemand außer ihm und Pfeiffer einen Schlüssel hatte.
Der Raum roch streng nach Desinfektionsmitteln und war voller Maschinen und Computer. Von der Decke hingen Greifarme über zwei verchromten Tischen mit erhöhtem Rand, die flachen Schalen ähnelten, in der die Patienten vollkommen bewegungslos fixiert werden konnten. Er zog die weinende Sophie in eine der Schalen, wobei er ihrem verletzten Hals besondere Aufmerksamkeit schenkte, schloss sie an diverse lebenserhaltende Systeme und verließ den Raum.
„Karl!“, schrie sie ihm hinterher.
Die Nacht würde bahnbrechend werden, ein Game-Changer, ein Triumph der Wissenschaft und die Erfüllung seines Daseins.
Kapitel 4
Als Margret erneut zu sich kam, sah sie in der Dunkelheit nur Schemen. War sie Wochen, Tage oder Monate durch einen kühlen Wald gelaufen? Sie spürte noch die weichen Tannennadeln unter ihren bloßen Füßen und hatte den Duft des Harzes in der Nase. Es war grün gewesen, unendliches Grün, über ihr an wenigen Stellen durchbrochen vom tiefen Blau des Himmels. Vogelgezwitscher und klassische Musik waren zu hören gewesen. Wenn sie müde geworden war, war sie weiter geglitten, immer weiter. Manchmal war sie Wanderern, Förstern oder Waldarbeitern begegnet. Schwerelos war sie an ihnen vorbeigeschwebt, hatte sie angelächelt und gewinkt. Sie hatten zwar mit ihr gesprochen, aber sie hatte sie nicht verstehen können, da die Vögel gesungen hatten und in diesen Momenten lauter wurden.
Sie hatte es geschafft. Keine Schmerzen mehr, keine unvollkommene Welt um sie herum. Sie lächelte leise. Kein weißes Licht, in das sie gegangen war, auch kein bärtiger Petrus, der auf einer Wolke stehend sie vor der Himmelstür abfing.
Dann wurde der Wald dunkler. Immer wieder verschwanden die Bäume. Musik schwebte durch die Dunkelheit, Vivaldi. Nicht ihr Lieblingskomponist, aber wer würde schon das himmlische Orchester kritisieren, sie war schließlich neu hier. Ein Kichern schob sich ihre Kehle hoch, die rau und trocken war. Sie hatte Durst. Man hatte Durst, wenn man tot war? Das war ihr neu. Sie wollte umkehren und zurück in ihren Wald. Dort hatte sie nichts gespürt außer Leichtigkeit und Freiheit.
„Hallo, Liebes.“ Karls Stimme drang zu ihr durch.
Karl war nicht tot, wie kam seine Stimme hierher, an diesen friedlichen Ort? Warum tat ihr der Hals weh? Panik ballte sich in ihrem Bauch zusammen, zu einem harten Klumpen, der sich ihre wunde Kehle hochschob und ihr die Luft nahm. Ihre Hände tasteten, bewegten sich fahrig über das glatte Laken, bis sie an ihrer Seite herunterrutschten, sich an den Nähten der Decke verkrallten und kraftlos daran zogen. Sie war nicht tot, sie hatte es nicht geschafft. Ein stechender Kopfschmerz bohrte sich hinter ihrer Stirn in ihren Schädel, wurde stärker, schriller, glühend.
Margret kniff die Augen zusammen und tastete nach ihrem Kopf. Ein krächzender Laut kam aus ihrem Mund. Zurück, sie wollte zurück, weg von hier, weg von Karl, weg vom Schmerz. Wo waren ihre duftenden Bäume? Hier roch es nach Desinfektionsmittel, die Schwerkraft presste sie auf das Bett, es war zu warm, viel zu warm. Jede Bewegung kostete sie Kraft wie ein Versuch, sich aus einem Sumpf zu befreien.
„Sch sch sch … ganz ruhig. Du bist noch schwach. Willst du etwas trinken?“
Karls Stimme war viel zu laut, obwohl er fast flüsterte. Margret nickte und drehte dann mühsam ihren Kopf zu ihm. Sie konnte Umrisse erkennen. Sie lag in einem Zimmer, das nicht ihr Schlafzimmer war, in einem fremden Bett mit einem Gitter an den Seiten.
Karl beugte sich über sie und hielt ihr eine Schnabeltasse mit lauwarmer Flüssigkeit an den Mund. Schon von dem Geruch wurde ihr übel, trotzdem trank sie einen Schluck, um ihren Hals anzufeuchten.
Nach einigen Anläufen gelang es ihr, Worte zu formen. „Was ist passiert?“, krächzte sie.
Eine Erinnerung an einen Spiegel durchzuckte sie, ein sehr schlechter Traum. „Wo ist der Wald?“ Ihre Stimme klang fremd in ihren Ohren.
„Du warst nicht im Wald, Liebes, du lagst einige Wochen im künstlichen Koma. Hast du etwas Schönes geträumt?“ Karl lächelte sie an.
Margret schüttelte vorsichtig den Kopf. „Kein Traum. Ich war im Wald.“
Sie versuchte, immer wieder zu schlucken und trank erneut den Tee. Zimt dachte sie. Sie hasste Zimt.
„Ja, das passiert nach einem Koma oft. Die Patienten halten ihren Traum für Realität, an die sie sich erinnern, als ob es wirklich geschehen wäre. Ich schick dir einen Spezialisten, der dir hilft, das zu verarbeiten. Aber du lebst, Margret, ist das nicht großartig? Du lebst! Du bist gesund!“
Margret sah sein strahlendes Gesicht über sich schweben, wie einen Luftballon und überlegte, wie sie es zum Platzen bringen könnte und ob sie dann in den Wald zurückkehren durfte.
„Wie?“, fragte sie nur, dabei drängten sich eine Million weitere Fragen in ihrem schmerzenden Kopf.
Wieder blitzte die nur schwer zu fassende Erinnerung auf. An den Spiegel, an das Bild einer Frau ohne Haare. Sie war sich sicher, die Person erkannt zu haben. Es war Karls Geliebte.
Er wusste nicht, dass sie sie kannte, sie schon zusammen bemerkt hatte. Er hatte sich stets bemüht, sie vor ihr verborgen zu halten. War sie deshalb verärgert gewesen? Oder enttäuscht? Nein, ihre Zeit war ja nur noch begrenzt und dass ein Mann wie er nicht lang allein bleiben würde, war ihr klar. Aber warum hatte sie sie im Spiegel gesehen? Es war zwecklos, Träume deuten zu wollen, sie ergaben nur selten einen Sinn. Trotzdem.
„Spiegel“, krächzte sie.
Der schüttelte nur lächelnd den Kopf. „Nicht alles auf einmal, Liebes. Schlaf noch ein bisschen, ruh dich aus. Du wirst eine Zeit brauchen, wieder ins Leben zu kommen.“
Aber er irrte sich. Schon am folgenden Tag konnte sie sich aufsetzen und bestand darauf, dass er Licht ins Zimmer ließ. Sie kam sich fremd in ihrem Körper vor und wollte etwas sehen. Ihre Haut fühlte sich merkwürdig an, glatt und weich. Mit ihren Brüsten stimmte was nicht, sie waren viel zu groß, geschwollen, als ob Tumore darin wüchsen. Sie war nicht gesund, der Krebs war noch da. Unter ihren tastenden Händen und in dem wenigen Licht erschien es ihr, als ob sie eine Fremde anfassen würde.
Karl zog einen kleinen Reflexhammer aus der Kitteltasche und klopfte auf ihre Ellenbogen und Knie, die zuckend reagierten. Diese Ergebnisse trug er in ein Tablet ein, dass auf ihrem Beistelltisch lag, dann legte er es wieder beiseite, setzte sich an ihr Bett und räusperte sich. „Mein Engel, ich muss dir etwas erklären. Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe und ich wollte dich auf keinen Fall verlieren. Das kannst du dir ja sicher vorstellen.“
Fahrig wickelte er sich einen Zipfel ihrer Bettdecke um den Finger. „Ich hab all mein Wissen und die neueste Technik dazu verwendet, dich zu retten, wenn auch nicht … wie soll ich sagen? Nicht ganz. Also, ich meine, ich habe dein … dein, also ich habe dein Gehirn sozusagen …“
Er sah sie nicht an, sondern widmete sich konzentriert seinen eingewickelten Fingern.
„Karl! Sag mir, was los ist!“ Trotz der Halsschmerzen klang ihre Stimme fest und bestimmt. Ihre Stimme klang falsch in ihren Ohren, viel zu hoch. Mit einem Ruck zog sie die Decke zu sich.
Karl rieb sich die malträtierten Finger. „Ich habe dein Gehirn in einen anderen Körper transplantiert. Ist das nicht wunderbar? Das gab es noch nie! Margret, du bist die Erste! Eine wissenschaftliche Sensation! Und es funktioniert!“ Er strahlte sie an, als ob er ihr ein Geschenk gemacht hätte.
Margret Wangen glühten und ihr wurde schwindelig. Der Alptraum! Er war kein Traum gewesen, in ihren Brüsten wuchsen keine Tumore, sie war gefangen in einem neuen Körper, in einem Körper, der jemand anderem gehörte.
Unfähig etwas zu sagen, knetete sie ihre Hände und Arme, rieb über ihr Gesicht. Sie befühlte vorsichtig die frische Narbe, die um ihren geschorenen Kopf verlief, auf dem bereits die Haare wieder wuchsen, die sich wie das Fell eines kurzhaarigen Hundes anfühlten.
Karl schaltete das Licht über ihrem Bett an, suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen von Freude und klopfte ihr sanft und aufmunternd auf die Schulter.
„Das kann nicht sein. Warum, Karl, warum? Ich wollte doch sterben. Das durftest du nicht.“ Tränen liefen ihr über die Wangen.
„Nicht weinen, Liebes, alles wird gut. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, das versteh ich. Morgen wirst du dich freuen, wieder den Himmel zu sehen und bald wieder Klavier spielen zu können. Hast du noch Kopfschmerzen? Dann geb ich dir was dagegen.“ Er beugte sich zu ihr und wollte ihr einen Kuss auf die Wange geben, aber sie wehrte ihn mit einer entschiedenen Handbewegung ab.
„Geh, lass mich allein. Und mach das Licht aus.“
Verständnisvoll nickend beugte er sich über sie und knipste die Lampe aus, dann drehte er sich um, warf ihr eine Kusshand von der Tür zu und schloss sie leise hinter sich.
Margret lag schwer atmend in der wohltuenden Dunkelheit. Sie schloss die brennenden Augen, wagte nicht mehr, ihren Körper zu berühren voller Scheu vor dem, was sie schon längst wusste. Sie war ein Monster, ein Zombie. Plötzlich überwältigte sie eine panische Angst, Angst vor sich selbst, vor dem, was sie war. Schweiß rann ihr das Gesicht hinunter und in die Augen. Ihr eigener Schweiß? In wessen Augen? Ihr Hals war wie zugeschnürt und ein schweres Gewicht lastete auf ihrer Brust, nahm ihr den Atem. Schwindel drückte sie auf das Bett, Übelkeit stieg in ihr hoch. Mit letzter Kraft fand ihre tastende Hand den Notfallknopf am Bett und drückte zu.
Eine Pflegerin kam herein, rannte sofort wieder raus und rief nach Karl. Ein Rauschen in den Ohren wie von einer Flutwelle am Meer und Flimmern im Blick verhinderten, dass sie sah, was er als nächstes tat. Was es auch war, es ließ sie wieder in einen tiefen Schlaf sinken.
Ihr Frühstück bestand aus einem faden Brei und lauwarmem Tee, was sie nicht von ihren Gedanken ablenken konnte. In ihr schrie und tobte es, Fragen, Wut und Verzweiflung versuchten abwechselnd in ihr Bewusstsein einzudringen, die Vorherrschaft zu übernehmen und sich Luft zu verschaffen. „Unmöglich!“, schrie ihre innere Stimme immer wieder. „Du bist tot! Du träumst!“ Aber eine andere Stimme flüsterte: „Es ist wahr. Du lebst. Du bist sie.“
Karl kam gleichzeitig mit einem leisen Klopfen ins Zimmer, im Arm eine Kristallvase mit kleinen roten Rosen und Schleierkraut, einem zaghaften Lächeln auf dem Gesicht.
„Geht es dir heute besser, Liebes?“
Ohne auf seine Frage einzugehen, sah sie ihn an. „Wo ist sie?“
„Wen meinst du?“
„Sophie. Das ist doch Sophies Körper, in dem ich bin, oder? Wo ist Sophie?“
Karl stellte die Blumen ab, setzte sich auf den Stuhl neben das Bett. Die Ellenbogen auf die Matratze gestützt, ließ er seine Stirn auf die gefalteten, feingliedrigen Hände sinken.
„Ist sie tot? An meiner Stelle? Du hast sie ermordet, damit ich leben kann?“
So hatte er sich dieses Gespräch nicht vorgestellt. Wer konnte schon ahnen, dass sie von der Gespielin wusste? Aber sollte ihre Dankbarkeit nicht überwiegen? Er verstand sie nicht.
„Du lebst, Margret, das ist alles, was zählt. Du lebst weiter.“
„Ich? Ich bin doch nicht mein Gehirn! Mein Gehirn lebt, aber mein Körper, meine Seele, mein altes Leben. Das ist doch alles fort! Meine Seele …“ Ihre Stimme wurde immer leiser.
„Niemand weiß, was eine Seele ist, und wo sie sitzt. Du bist dir deiner bewusst, also wird sie schon mitgekommen sein.“
Aber Margret schüttelte langsam den Kopf. „Meine Seele war das, was mich zusammenhielt, was mein Leben ausmachte, Körper und Geist verband und nach meinem Tod weiterleben wird. Meine Gefühle und Gedanken kommen doch nicht nur aus dem Kopf!“
„Ach, Liebling. Denk lieber an deine Zukunft, an unsere Zukunft, was noch alles kommen wird. Du hast wieder eine Zukunft! Unter einem anderen Namen. Wir müssen das geheim halten, was passiert ist, das kannst du dir ja denken, oder?“
„Was für eine Zukunft? Wie stellst du dir das vor? Soll ich jetzt Sophies Leben leben mit ihrer Familie? Ich habe keine Freunde mehr, keine Familie. Sie würden mich nicht mehr erkennen. Was glauben sie eigentlich, wo ich bin?“
Diese neue Stimme klang nervtötend schrill und auf ihrer Stirn fühlte sie eine senkrechte Falte, die sie irritiert betastete. Hastig zog sie die Hand wieder weg, schloss die Augen und versuchte zu verstehen, welche Tragweite das Geschehene hatte.
Karl lehnte sich zurück, sah auf seine Schuhspitzen und murmelte: „Wir haben dich beerdigt.“
„Ihr habt mich beerdigt. In einen Sarg gelegt, in ein Loch hinabgelassen und mit Erde bedeckt.“
„Ich meine, wir haben deinen Körper beerdigt.“
Margret schloss die Augen und fragte leise: „Wir? Wer war denn dabei?“
„Es war ein großes Begräbnis. Du warst, ich meine, du bist eine bedeutende Künstlerin. Also deine Eltern, sogar deine Schwester ist aus der Schweiz angereist, unsere Freunde, deine Kollegen, viele aus der Musikbranche, obwohl die Feier nur im allerengsten Rahmen stattfinden sollte. Das war schon ergreifend, muss ich sagen.“ Als ihm auffiel, was er von sich gab, verstummte er.
„Alle waren da. Und alle, die da waren, kann ich nie mehr treffen. Sie haben endgültig Abschied von mir genommen. Alle, die mir etwas bedeutet haben, alle, denen ich etwas bedeutet habe. Ich bin nur noch eine medizinische Sensation und du ein Mörder. Was macht dich eigentlich so sicher, dass ich niemandem verrate, was du getan hast?“ Sie sah ihn herausfordernd an.
Bevor er antworten konnte, klopfte es und eine junge Pflegekraft in weißer Hose und hellblauem Oberteil kam herein. Als sie ihren Chef sah, stoppte sie kurz und strahlte ihn voller Bewunderung an.
„Darf ich, Herr Professor?“
„Natürlich.“
Schweigend sah er zu, wie sie Margrets Blutdruck und Fieber maß, und die Werte eintrug, ihr ein Schälchen mit Tabletten und ein Glas Wasser reichte und das Kissen aufschüttelte. Dabei klopfte er mit dem Reflexhammer auf den Daumennagel seiner zur Faust geballten freien Hand, eine unbewusste Geste, die ihn schon seit Studienzeiten begleitete.
Ohne die Anspannung im Raum zu bemerken, plauderte die Krankenschwester in einem fort. „Geht es Ihnen schon besser, Frau Kaminski? Ist es nicht ein Wunder, was unser Professor vollbracht hat? Ohne ihn wären Sie gelähmt. Können Sie sich denn inzwischen an den Sturz erinnern?“
Bei dem Namen zuckte Margret erst zusammen, dann schüttelte sie den Kopf.
„Kein Wunder, Sie Arme. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Aber es ist gut gegangen. Spüren Sie ihre Beine? Ja? Das haben Sie alles ihm zu verdanken. Bald werden Sie wieder tanzen können. So, jetzt nehmen wir die Tabletten und später bringe ich Ihnen ein Schälchen Brühe. Erstaunlich, wie schnell Sie sich erholen, aber Sie sind ja auch noch jung. Da geht das ratzfatz.“
Margret murmelte einen Dank und die Schwester verschwand.
Als ob sie nicht unterbrochen worden wären, schlug Karl mit beiden Händen auf seine Schenkel und stand wieder auf. „Hast du das gehört? Ich hatte ehrlich gesagt auch von dir mit etwas mehr Dankbarkeit und Anerkennung meiner Leistung gerechnet. Schließlich hab ich das alles nur aus Liebe zu dir gemacht. So bahnbrechend die Ergebnisse auch sein mögen, ich kann nichts davon veröffentlichen! Denn ja, juristisch korrekt war es womöglich nicht, wenn man es genau nimmt. Aber bitte, verrate mich doch. Ich kann dich nicht daran hindern.“ Jetzt klang er eingeschnappt.
Ärgerlich schnippte er gegen den Schlauch ihrer Transfusion.
„Ach, Karl, das hab ich doch gar nicht gesagt. Ich will nur eins wissen: War sie tot? Hast du mich in ihren toten Körper gesteckt oder lebte sie noch?“
„Das spielt doch keine Rolle ...“
„Hat! Sie! Noch! Gelebt!“ Sie legte so viel Nachdruck in ihre Stimme, wie ihr Hals es zuließ.
„Nein, sie war tot.“ Er sah sie nicht an.
„Du lügst. Ich sehe, wenn du lügst. Sie hat noch gelebt!“
„Sie war so gut wie tot, sie war nicht mehr bei Bewusstsein!“, schrie er.
„Sie hat gelebt“, flüsterte Margret. Sie war müde und wollte ihn loswerden.
Aber er ließ sich nicht mehr bremsen und sprach weiter. „Angenommen, jemand glaubt dir, was unwahrscheinlich ist, schließlich sieht jeder, dass Sophie lebt, und die todkranke Margret war aufgebahrt und wurde begraben. Mal angenommen, was dann? Vermutlich komme ich ins Gefängnis. Was glaubst du, was aus dir wird? Denkst du, du kannst in dein altes Leben zurück? Weitermachen, als wenn nichts passiert wäre, nur mit einem neuen Körper? Einem neuen Gesicht?“
Erregt lief er vor ihrem Bett hin und her und räumte Pillenschälchen und eine Tasse von einem Platz zum anderen und wieder zurück. „Vergiss das ganz schnell. Selbst einem ... einem Alien würde man mehr Ruhe gönnen als dir. Fachleute aus aller Welt würde dich untersuchen wollen. Mein Erfolg wäre dann öffentlich, auch wenn ich ihn nicht in Freiheit erlebe, aber will ich das? Nein! Ich will dich und das Leben mit dir zurück.“
Er blieb stehen und stützte sich auf das Fußende des Pflegebettes. „Weißt du, was manche bezahlen würden, um an deiner Stelle zu sein? Sie würden alles dafür geben. Das, was du bist, ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit.“
Margret drehte den Kopf zur Seite und schloss die Augen. Das Gespräch strengte sie an. Karl strengte sie an. Nach nur wenigen Minuten hörte sie, wie er das Zimmer verließ.
Ihre Schwester war zu ihrer Beerdigung gekommen. Sie hatte sie seit ihrer Hochzeit, bei der sie es ablehnte, die Trauzeugin sein, nicht mehr gesehen, nichts mehr von ihr gehört. Sie war der ungeplante Nachkömmling, als Margret schon zehn und ein kleiner Bühnenstar war. Für ihre Mutter brach damals die Welt zusammen, da sie befürchtete, sich nicht mehr ausreichend um ihre Älteste kümmern zu können. Ihre Schwester Katrin, die kein Wunderkind, sondern immer im Weg war, die nur Betriebswirtschaft studierte und die eine Bankerin wurde, wanderte aus und brach den Kontakt mit den Eltern ab. Was diese erschreckend wenig störte.
Margret fiel in einen leichten Dämmerschlaf und träumte vom Wald.
Kapitel 5
Margret arbeitete verbissen daran, sich zu erholen und die Gewalt über ihre Sinne zu erlangen. Der Geruchsinn setzte gelegentlich aus, lieferte ihr manchmal falsche Signale. Dann schmeckte das Steak nach Vanille und die Äpfel nach Pappe. Auch ihr Tastsinn ließ sie von Zeit zu Zeit im Stich, und es fühlte sich unerträglich an, zu sitzen oder einen Stoff auf der Haut zu haben. Schon nach wenigen Tagen bestand sie darauf, nach Hause verlegt zu werden. Der Krankenhausablauf, das ständige Lächeln der Pfleger und dass man sie mit Sophies Namen ansprach, war ihr unerträglich.
Mit der fadenscheinigen Geschichte, dass ihre Amnesie ihr nicht erlaubte, allein zu leben und Karl ihr aus reiner Menschenfreundlichkeit ein Zimmer bei sich zu Hause anbot und so auch die Einsamkeit nach dem Tod seiner Frau besser verkraftete, begründete er vor den Kollegen und dem Klinikpersonal, dass Margret bei ihm einzog.
Stundenlang fuhr sie dort auf ihrem Trainingsrad, hörte dabei Musik und versuchte, sich völlig auf die Übungen zu konzentrieren. Das Laufen bereitete ihr ebenfalls Probleme, da sie manchmal die Gewalt über ihre Beine verlor und plötzlich stürzte. Doch alle anderen Fähigkeiten kamen nach und nach wieder.
Karl hatte ihr eine Pflegerin engagiert, die sie sofort wieder entlassen hatte. Sie war lieber allein und froh, wenn ihr Mann morgens zur Arbeit fuhr
Dann saß sie an dem weißen Küchentisch ihrer großen Landhausküche, schrieb sich Listen mit Aufgaben, die zu erledigen waren und erwischte sich dabei, wie sie den Milchkaffee genoss. Sofort schoss ihr die Röte ins Gesicht. Das durfte nicht sein. Sie durfte diese gestohlenen Tage nicht genießen, sie gehörten ihr nicht. Sie existierte, mehr nicht.
Entschlossen stand sie auf und kippte den Rest aus ihrer Tasse in den Ausguss. Stattdessen schenkte sie sich ein Glas Wasser ein und ging damit ins Wohnzimmer, das ebenfalls im noblen Landhausstil eingerichtet war: Pinienholzmöbel und ausladende Sessel und Sofas, bespannt mit rustikalen Leinenstoffen, standen verteilt in dem geräumigen Zimmer.
Hier hatte sie früher schon mal für enge Freunde kleine Konzerte gegeben auf dem polierten Konzertflügel, der den Raum beherrschte. Langsam ließ sie sich auf den Hocker gleiten und starrte die Tasten an. Nur einmal hatte sie versucht zu spielen, aber die Finger gehorchten ihr nicht. Seitdem spielte sie alle Stücke, die sie hörte, auf dem Tisch, dem Sofa, ihrem Bein mit.
Nachdenklich ließ sie einen Daumen über die Tonleiter gleiten, ohne sie anzuschlagen. Die Finger ihres neuen Körpers waren etwas kürzer und längst nicht so beweglich wie ihre eigenen.
Ein plötzlicher Schwindel erfasste sie und im Reflex hielt sie sich an der Klaviatur fest. Die lauten Töne ließen fast ihr Herz stehen bleiben. Zu schnell stand sie auf, schwankte ein wenig und hangelte sich dann an dem Bücherregal mit Karls Fachliteratur entlang zu ihrem Lieblingssessel. Von hier aus überblickte sie die Terrasse mit den geflammt gebrannten Terracotta-Fliesen und dem gepflegten Garten. So blühend und lebendig, für sie aber inzwischen ohne Bedeutung. Was sollte sie nur mit diesem Leben anfangen?
Bisher hatte sie Karls Drängen, eine neue Schichtaufnahme ihres Gehirns zu erstellen, nicht nachgegeben. Sie wollte nicht mehr Teil seines Experimentes sein und für seine Dokumentation zur Verfügung stehen.
Auch seinen Reaktionstests verweigerte sie sich vehement.
Er war ein Mörder. Sophie hatte gelebt, als er sie operierte. Sie verstand nicht im Ansatz, wie das Verfahren genau funktionierte, aber wenn der Blutkreislauf erstmal still stand, war er nicht mit einem neuen Gehirn wieder in Gang zu bringen. Das Herz schlug die ganze Zeit weiter.
Mithilfe eines Physiotherapeuten baute sie Muskeln auf und trainierte anschließend allein in ihrem Zimmer weiter, bis sie ihr vor Erschöpfung übel wurde. Niemand wurde ein Weltstar am Klavier, der nicht so ausdauernd übte, bis der eigene Körper dem angestrebten Ziel nicht mehr im Weg stand.
Die Spiegel im Haus hatte sie schon bei ihrem erneuten Einzug vor drei Wochen abgehängt, bis auf einen in einem der Bäder, auf den Karl bestand. Dieses Bad mied sie von diesem Zeitpunkt an. Wenn sie sich in einer Fensterscheibe spiegelte, war es aber trotzdem wie ein Schlag in die Magengrube und warf sie für Stunden in tiefste Depressionen.
Grübelnd saß sie auf dem Sofa und starrte hinaus in den Sonnenschein. Dabei spielte sie Beethoven auf der Sofalehne, denn selbst an das Gefühl, das weiche Kinn auf die Hand zu stützen, hatte sie sich nicht gewöhnt.
Es musste weitergehen oder sie würde diesem Leben ein Ende setzen. Und weitergehen konnte nur heißen, dass Karl nicht davonkommen durfte. Das Dumme war nur, dass eine Anzeige ihn zum Genie verklären und sie zum Objekt reduzieren würde. Denn was er geschafft hatte, war bahnbrechend.
Für einen Ausweg aus diesem Dilemma fehlte ihr jegliche Idee.
Aber erstmal musste sie duschen, auch wenn sie es hasste. Mit ihrer Strategie, sich im Dunkeln auszuziehen und einen Waschlappen zu verwenden, scheiterte sie immer wieder an den Schwindelgefühlen und gefährlichen Stürzen, da sie nicht rechtzeitig einen Halt fand. Aber Sophies Körper war ihr zuwider, sie ekelte sich davor, das fremde Gesäß abzuwischen, die kleine operierte Nase zu putzen und vor zerkautem Essen in dem Mund, der Karl geküsst hatte, als sie schon längst todkrank war. Sie wollte diese Hülle nicht pflegen, nicht akzeptieren. Es war ihr auch egal, wenn sie sich stieß und dabei Schrammen und blaue Flecken davontrug.
Seufzend tappte sie ins spiegellose Bad, wusch sich notdürftig und zog sich im Schlafzimmer ein weites Kleid an. Ein Punkt weniger auf ihrer To-Do-Liste für diesen Tag. Erst gestern Abend hatte sie sich mit Karl gestritten, der immer ungeduldiger wurde, sie wieder mit in seine Klinik nehmen und ausgiebig untersuchen wollte. Wie eine Laborratte.
Außerdem war da noch ein anderes Problem: Sophies Familie. Schon im Krankenhaus hatten sie sie besuchen wollen. Solang sie im Koma lag, hatte Karl das zugelassen. Er hatte für sie und das Personal der Klinik eine Geschichte erfunden, dass sie als Fremde gekommen sei, auf der Treppe ausgerutscht und gestürzt sei. Daraufhin habe er sie so schnell wie möglich operiert. Durch die umfassende Technisierung sei das zum Glück machbar, er habe alles getan, um bleibende Schäden zu vermeiden, aber eine Amnesie nicht verhindern können. Sophie könne sich an ihre Familie nicht erinnern. An nichts vor dem Unfall.
Nach ihrem Aufwachen hielt er Margret von der Familie fern, so gut es ging, angeblich, um sie nicht zu sehr aufzuregen. Was er ihnen erzählt hatte, warum sie jetzt bei ihm lebte und nicht, wie es dem Wunsch der Mutter entsprach, bei ihrer Familie, war Margret ein Rätsel. Es kümmerte sie aber auch nicht, da sie Sophies Angehörigen nicht in die Augen sehen konnte. Einmal war es den Eltern gelungen, in ihr Zimmer in der Klinik zu kommen. Eine kräftige, gepflegte Frau mit kurzen grauen Haaren, dahinter ein durchtrainierter, braungebrannter, älterer Mann. Sie konnte den Blick in den Augen der fremden Frau nicht vergessen, der in ihrem Gesicht eine Spur des Wiedererkennens suchte und dabei unablässig voller Liebe lächelte und ihre Hand streichelte. Die Umarmung des Mannes, der sich als ihr Vater bezeichnete, ließ sie steif zu, wobei sie tiefe Scham empfand.
Als die Putzhilfe kam und das Radio einschaltete, nahm sie ihre Tasse Tee mit auf die Terrasse und setzte sich im Bademantel in einen der Korbsessel. Ohne Musik war ihr Leben leer. Jetzt ein Buch zu lesen oder den Fernseher einzuschalten, kam ihr absurd vor. Sie brauchte nichts weniger als Zeitvertreib, die Nachrichten waren ihr völlig egal. Aber sie war einsam, sie wünschte sich jemanden, mit dem sie ihre Gedanken teilen konnte, und das war nicht Karl. Was würde passieren, wenn sie sich ihren Eltern anvertraute? Ihr Vater würde die Nerven verlieren und die Polizei benachrichtigen. Ein braver Beamter, der sein Leben lang nicht mal eine Strafe für eine Geschwindigkeitsübertretung bekommen hatte, würde so eine Tat nicht hinnehmen. Und ihre Mutter? Angeblich war sie an ihrem Tod fast zerbrochen. Was, wenn die verlorene Tochter wieder auftauchte? Was, wenn ihr Gehirn den Organismus abstieß und sie erneut starb? Das durfte sie ihren Eltern nicht antun. Die beiden waren über achtzig und weder mental noch körperlich belastbar.
Seufzend beobachtete sie zwei Bienen, die unverdrossen in die Petunienblüten krabbelten und staubig wieder herauskamen, um die nächste in Angriff zu nehmen. Der Duft der Blüten wurde am Abend so intensiv, dass sie nicht draußen sitzen konnte, ohne heftige Kopfschmerzen zu bekommen. Aber sie nahm ihn wieder wahr.
Freunde? Weggefährten? Sie schrieb eine neue Liste. Wem konnte sie so weit vertrauen? Bei wem war sie sicher, dass derjenige mit dieser sensationellen Geschichte nicht an die Öffentlichkeit ginge. Das Wichtigste war, dass sie selbst es weiterhin in der Hand hatte, was mit ihrem Leben passierte. Adelina? Ihre Managerin war ihr zutiefst verbunden. Aber der Kitt ihrer Beziehung war die Musik gewesen, das Business. Wie bei allen anderen. Sie strich sämtliche Namen wieder durch, außer einem: Patte.
Patte war eine Chance. Aus der anfänglichen Betreuung und Begleitung nach dem Gefängnis war eine Freundschaft entstanden wie zu einer jüngeren Schwester oder Tochter, die auf Augenhöhe herangewachsen war. Ihr traute sie zu, mit dem Geschehen fertig zu werden. Sie würde die Medizintechnik nicht hinterfragen, die Sensation nicht bewundern. Diese zumindest nicht über sie als Menschen stellen. Der Mord an Sophie würde sie vermutlich nicht sonderlich schockieren. Es wäre nicht der Erste, mit dem sie konfrontiert würde. Sie unterstrich den Namen mehrmals.
Laut Karl hatte Patte ihr Tod zwar schwer mitgenommen, aber sie hatte sich wieder gefangen und besuchte weiter die Abendschule. Tagsüber bediente sie im Café Pumpkin auf der Zeil.
Kapitel 6
Margret bestellte sich ein Taxi und ließ sich in die Innenstadt bringen. Schweigend saß sie auf dem Beifahrersitz, zuerst überrascht, dann genervt von den anzüglichen Blicken des Fahrers und gab keine Antworten auf seine Fragen nach ihrem Namen und ob sie vergeben sei.
Früher als beabsichtigt stieg sie aus dem nach Rauch stinkenden Fahrzeug, gab demonstrativ wenig Trinkgeld und schritt dann über den Goetheplatz hin zu den Geschäften und Lokalen. Einige Burgerrestaurants waren ihr neu, schon vor ihrem Tod war sie lange nicht hergekommen.
Der Alten Oper drehte sie demonstrativ den Rücken zu, sie hätte den Anblick nicht ertragen, die Erinnerungen an die Menschen, an ihr altes Leben, das dort so wunderbar gewesen war. Der Ort so nah, dass sie in Minuten dort gewesen wäre und das Leben weiter weg als der Himmel.
Eigentlich wollte sie sich Zeit nehmen und langsam flanieren, doch sie verfiel immer wieder in einen flotten Schritt, war doch ihr altes Leben geprägt gewesen von einem vollen Kalender mit Proben, Terminen und Verabredungen gewesen. Aber zwei Straßenmusiker mit Klarinette und Geige zauberten ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie ließ sich auf einer Bank im Schatten nieder und hörte ihnen einige Minuten zu. In ihrer Jackentasche spielten ihre Finger die bekannten Melodien mit und sie gab ihnen ein paar Münzen.
Aber ihre Anspannung trieb sie weiter und sie näherte sich dem Reiffenstein-Platz, der von alten Bäumen beschattet wurde. Dahinter überragten die Türme der Banken alles, was noch vom alten Stadtkern übrig war oder wieder aufgebaut worden war. Auf der Zeil vor ihr saßen auf Bänken und Mauern Obdachlose und Banker, Jugendliche und alte Menschen aus allen Ländern der Welt, Punks mit Hunden, Prediger und Luftballonverkäufer. Das war es, was Frankfurt ausmachte, diese Mischung, die Internationalität, die sie immer geliebt hatte. Heute fühlte sie sich fremd, als ob sie an einem Ort wäre, an dem sie nicht sein durfte. Seufzend riss sie sich zusammen und bog in die kleine Seitenstraße, an der der Platz lag.
Wie die sprichwörtliche Katze um den heißen Brei umkreiste sie den schmalen Bereich, wo ein Café seine leuchtend orangen Tische und Stühle arrangiert hatte. Eine lebhafte Mischung aus Frauen mit Kinderwagen, plappernden Schülern und Rentnern, die von einer Vielzahl von Einkaufstüten umgeben waren, hatte sich dort niedergelassen.
Die entspannte und unbekümmerte Atmosphäre stand in scharfem Kontrast zu Margrets innerer Unruhe, während sie ein wenig abseits wartete und nach dem Servicepersonal Ausschau hielt. Denn hier arbeitete Patte.
Kurze Zeit später sah sie sie aus der offenen Tür eilen, mit einem Tablett beladen mit Kuchen und Getränken. Voller Konzentration presste sie die Lippen aufeinander, um die schwankenden Colaflaschen nicht umzuwerfen. Ihr Gang in den flachen Ballerinas wirkte wie ein Balanceakt auf nassen Flusskieseln. Margret wusste, dass sie bis vor ein paar Monaten nie etwas anderes als Turnschuhe getragen hatte. Aber die passten jetzt nicht mehr ins Leben. Sie warteten in den Tiefen ihres Kleiderschranks darauf, entsorgt zu werden. Eines Tages, wenn Patte sich von ihnen trennen konnte.
Zaghaft setzte sie sich an einen freien Tisch, an dem eine Kollegin von Patte bediente und sie die frühere Freundin unbemerkt beobachten konnte. Sie war routiniert, benötigte keinen Zettel, um sich die Bestellungen zu merken, nahm bei jedem Gang leeres Geschirr mit. Doch Margret erkannte das falsche Lächeln, das einen Tick zu spät einsetzte, und die Bewegungen, die sie vor dem Spiegel geübt hatte. Die immer noch ein bisschen hölzern wirkten.
Als Patte eine Pause einlegte, sich setzte und geziert die Beine ineinander verschränkt zur Seite lehnte, musste sie beinahe lachen. Das war neu, vermutlich von einer Vorabendserie abgeschaut. Allerdings um Längen besser als der breitbeinige Sitz mit den auf den Schenkeln abgestützten Ellenbogen. Es sah aus, als ob ihre Gelenke dafür nicht ausgelegt wären. Margret bekam schon vom Zusehen Wadenkrämpfe.
Patte entspannte sich für einen Moment, sah auf ihr Handy und knabberte an den Fingernägeln, der Rücken wurde immer runder und ein Blusenärmel rutschte hoch, wodurch das Tattoo eines hochfliegenden Vogels zu sehen war. Aber sobald neue Gäste kamen, glitt sie in die antrainierte Rolle zurück, straffte sich, lächelte eisern und zog die Ärmel wieder über die kräftigen Handgelenke.
Margret bewunderte sie, ihren immensen Willen, mit dem sie sich von ihrer Vergangenheit löste und neuen Halt in der Gesellschaft suchte. Wie einsam musste sie immer noch sein, was das Fernbleiben von den alten vertrauten Verbindungen um einiges schwerer machte.
Margret würde sie treffen. Ob sie sich dabei zu erkennen gab oder versuchen würde, sich neu mit ihr anzufreunden war erstmal egal. Sie vermisste sie schmerzlich. Pattes Schulbildung war lückenhaft, aber ihr gesunder Menschenverstand und ihre Intuition so ausgeprägt, wie sie es bei keinem anderen Menschen erlebt hatte.
Kapitel 7
Patte ging durch die schmale Feuerschutztür hinaus auf das Flachdach. Vor Jahren war sie ins eins der Büros in der Etage darunter eingebrochen, seitdem wusste sie, dass sich die meisten Schlösser in diesem Hochhaus mit üblichen Dietrichen öffnen ließen.
Vorsichtig überquerte sie das wellige Bitumen, ohne auf die wulstigen glänzenden Kanten der Flicken zu treten. Vor ihr lag die Stadt in der Abendsonne und Wärme stieg zu ihr auf, während ein kühler Wind vom Taunus zu ihr herüberwehte.