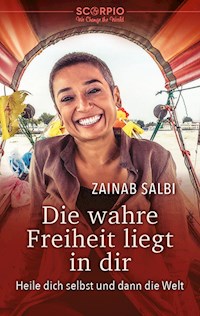
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als Tochter von Saddam Husseins Privatpilot erlebt Zainab Salbi als Jugendliche hautnah mit, was Diktatur bedeutet. Auf Drängen ihrer Mutter heiratet sie mit 19, emigriert in die USA und macht sich als Menschenrechtsaktivistin einen Namen. Doch während sie sich weltweit für Frauen in Kriegsgebieten einsetzt, gerät ihr eigenes Leben aus den Fugen, als sie erkennt, dass sich ihre eigenen Schatten nicht von selbst auflösen. In diesem Buch erzählt sie die fesselnde Geschichte ihres Heilungswegs: »Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Das ist der Weg zur Freiheit.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZAINAB SALBI
Die wahre Freiheit liegt in dir
Heile dich selbst und dann die Welt
Aus dem Englischen von Ulla Rahn-Huber
Die US-amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Freedom is an inside job: owning our darkness and our light to heal ourselves and the world« bei Sounds True, Inc.
Published by arrangement with Sounds True and by the agency of Agence Schweiger.
1. eBook-Ausgabe 2022
© 2018 Zainab Salbi
© 2019 der deutschsprachigen Originalausgabe »Freedom is an inside job«
Scorpio, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München
Logoentwurf: Hauptmann und Kompanie, Zürich
Umschlaggestaltung: Danai Afrati, München
Autorenfoto © Nick Hernandez
Lektorat: Katharina Lisson, München
Satz: Margarita Maiseyeva, Donaueschingen
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-481-5
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Für meinen Baba, der mich zu lieben lehrte,und für A. B., der mich zu leben lehrte
Inhalt
Das singende Mädchen
Einleitung
1 – Unsere Geschichte erzählen
2 – Zur eigenen Wahrheit stehen
3 – Unseren Erfolg würdigen
4 – Wiedergutmachung leisten
5 – Zu unserer dunklen Seite stehen
6 – Zuerst uns selbst verzeihen
7 – Die Kontrolle abgeben
8 – Freiheit kommt von innen
Epilog – Plädoyer für einen neuen Menschen
Fragen zum Nachdenken
Dank
Über die Autorin
Das singende Mädchen
Es war einmal ein Mädchen in einem grünen Kleid. Von aller Welt vergessen, lag es an Händen und Füßen gefesselt im Bauch eines Schiffs. Zwischen Hunderten von anderen Sklaven. Sie waren schon sehr, sehr lange in Gefangenschaft und im dämmrigen Licht unter Deck war nicht zu erkennen, ob sie tot waren oder noch lebten. Ihre Leiber waren von Staub bedeckt.
Eines Tages kam eine Maus und fing an, an den Fesseln des Mädchens zu nagen. Es erwachte, und als es sich streckte, rissen die Stricke, denn sie waren in der langen Zeit mürbe geworden.
Das Mädchen erhob sich, und als es umherblickte, merkte es, dass die anderen alle im Schlaf gestorben waren. Der Schiffsbauch war vom Geruch des Todes erfüllt. Wie es sich fürchtete, ganz allein in dieser Dunkelheit! Es fing leise zu singen an. Das Lied kannte keine Worte, nur einen einzigen Klang – den Klang seines Lebens. Und wie sich die Melodie herauszuschälen begann und seine Stimme fester wurde, legte sich seine Angst, und das Mädchen fühlte sich nicht mehr so allein. Wie von magischen Kräften emporgehoben, stieg sein Körper auf, höher und höher, bis er schließlich in eine andere Realität gelangte.
In dieser neuen Welt fand sich das Mädchen auf einer geschäftigen Straße inmitten einer Großstadt wieder. Überall waren Leute, die von einem Ort zum anderen eilten. Hupende Autos rasten vorbei. Nichts und niemand war ihm vertraut. Es konnte nur eins tun – weiter das Lied seines Lebens singen.
Die Stimme des Mädchens war so schön, dass die Passanten stehen blieben, um ihm zuzuhören. Mehr und mehr Menschen wurden auf es aufmerksam, und bald war das Kind in aller Munde. Man pfiff seine Melodien nach und war ihm auf den Fersen, wann immer es in einer Stadt erschien. Niemand wusste, wer es war, und so nannte man es »das singende Mädchen«. Es wurde immer bekannter. Ein ständig wachsendes Publikum wollte es hören.
Eines Tages kamen Leute zu dem Mädchen und bauten eine tönerne Statue, die innen hohl war. Sie steckten das Mädchen hinein, sodass sie es singen hören konnten, wann immer sie wollten. Am Anfang ließ es sich darauf ein, aber schon bald erkannte es, dass es sich im Inneren der Statue genauso fühlte wie damals, als es gefesselt im Schiffsbauch lag. Beides waren Formen von Versklavung. Das Mädchen versuchte nicht, irgendjemandem zu gefallen; es sang einfach das Lied seines Lebens, und darum war sein Klang so berührend. In der dunklen Statue zu bleiben, hieße zu ersticken.
Also beschloss das Mädchen, sich zu befreien. Es sang und sang das Lied seines Lebens, und so wurde es abermals in eine fremde Realität transportiert, die wiederum ganz anders war als die belebte Großstadt.
Auf dieser dritten Ebene begegnete es einer Frau, die in ein schwarzes Gewand gehüllt war. Sie trug einen schwarzen Schleier, und ihr Gesicht war hinter einer schwarzen Maske verborgen. Sie rührte in einer Suppe, die auf offenem Feuer in einem großen Kessel brodelte. Als das Mädchen näher kam, sprach die Frau die folgenden geheimnisvollen Worte:
»Du musst das Böse akzeptieren.«
Erschrocken wich das singende Mädchen zurück. Das Böse akzeptieren? Das konnte es nicht! Das war zu viel verlangt! Aber sobald es auf Abstand ging, hörte die Frau auf, in der Suppe zu rühren. Neugierig, wie das Mädchen war, kam es doch wieder näher.
Nochmals sagte die Frau mit der schwarzen Maske: »Du musst das Böse akzeptieren.«
Und erneut wich das Mädchen angstvoll zurück. Es konnte das Böse nicht akzeptieren. Doch jedes Mal, wenn es einen Schritt zurückmachte, hörte die Frau mit der schwarzen Maske auf zu rühren. Alles stand plötzlich still.
Das Süppchen, das die Frau da kochte, würde wohl niemals fertig werden, wenn das Mädchen das Böse nicht akzeptierte. Schließlich siegte seine Neugier. Es wollte wissen, was geschehen würde, wenn die Frau weiterrührte. So trat es abermals näher, und als es zum dritten Mal gebeten wurde, das Böse zu akzeptieren, nickte es. Sogleich begann die Zeremonie. Die Suppe fing heftig zu brodeln an, und die Frau rührte kräftiger. Dann sagte sie: »Nun musst du eine von den weißen Masken wählen, die an der Wand hinter dir hängen.«
Das Mädchen schaute sie sich alle an – eine ganze Wand voller Masken, doch es mochte keine einzige davon. Es wandte sich der Frau zu und deutete auf ihr Gesicht: »Deine Maske will ich haben!«
»Um meine Maske hat mich noch nie jemand gebeten«, antwortete die Frau erstaunt. »Aber hier, setze sie auf!«
Kaum hatte das singende Mädchen die Maske aufgesetzt, trat das Böse auf den Plan. Es war weder Mann noch Frau – ein gesichtsloses Wesen in anthrazitgrauem Gewand. Es reichte dem Mädchen die Hand. Zögernd griff es danach und ließ sich wegführen. Die Frau blieb alleine zurück.
Das Böse und das Mädchen gingen den weiten Weg ins Land des Bösen. Ein riesiges, düsteres Feld voller Menschen tat sich vor ihnen auf. Manche lagen auf dem Boden, andere standen, und alle waren mit Spinnweben bedeckt. Mit schreckgeweiteten Augen betrachtete das Mädchen dieses furchtbare Bild. Diese Menschen hatten sich in ihr Dasein gefügt – sie schienen für immer im Land des Bösen gefangen.
»Siehst du all diese Leute?«, fragte das Böse. »Sie sind hier, weil sie irgendetwas getan haben, wofür sie sich schämen. Sie haben gestohlen oder gelogen. Manche haben sich sexueller Verfehlungen schuldig gemacht. Es ist die Scham, die sie hierhertreibt.«
»Was sie nicht wissen«, fuhr das Böse fort: »Sie haben die Wahl. Ich halte sie hier nicht mit Gewalt fest. Im Gegenteil. Jeder von ihnen kann einfach aufstehen und diesen Ort verlassen. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, zu ihrer Tat zu stehen und darüber zu reden. Dann dürfen sie gehen. Jeder ist dazu in der Lage. Aber wenn ihre Scham und Angst stärker sind als ihr Wille, sich dieser Aufgabe zu stellen, tun sie es nicht. Dann ringen sie sich nicht durch, sich zu befreien.«
Da erkannte das Mädchen, wie wichtig es war, das Böse zu akzeptieren und diesen Ort gesehen zu haben. Es musste begreifen, warum manche Menschen auf ewig im Land des Bösen gefangen bleiben. Es sind Scham und Angst, durch die wir uns in diesen klebrigen Spinnweben verfangen, dachte es. Es ist nicht das Böse an sich.
Das Böse wollte dem Mädchen noch etwas zeigen, und so gingen sie weiter. Sie betraten ein Gebäude und durchschritten darin viele riesige Türen und durchquerten Raum um Raum. Schließlich gelangten sie in ein kleines Zimmer, in dessen Mitte eine Truhe stand. Das Böse öffnete sie und schloss die Schatulle auf, die sich darin befand. Und in dieser war wiederum eine weitere, kleinere Schatulle. Das Böse schloss auch diese auf und alle anderen, stets ein wenig kleineren, bis es schließlich die kleinste Schatulle in Händen hielt. Das Böse öffnete sie vorsichtig. Darin war ein Herz. Es war das Herz des Bösen, das es dort seit langer, langer Zeit vor aller Welt weggeschlossen hatte. Dem Mädchen aber zeigte das Böse sein Herz.
»Nur wer das echte Lied seines Lebens singt, darf dieses Herz besitzen«, sagte das Böse und hielt dem Mädchen das Herz hin. »Bitte nimm es mit. Du darfst dieses Land verlassen.«
Das Mädchen betrachtete das Herz und erkannte, dass es ein ganz normales schlagendes Herz war – weder gut noch schlecht. Das Mädchen nahm es mit beiden Händen und schluckte es hinunter. Nun hatte es Mut.
Um das Land des Bösen zu verlassen, musste das singende Mädchen eine Seilbrücke überqueren und sich ganz alleine einen Weg durch einen Sumpfwald bahnen. Die Brücke bestand aus morschen, halb zerbrochenen Brettern und losen Seilen, die sie kaum noch zusammenhielten. Der dunkle Wald auf der anderen Seite wirkte geheimnisvoll und bedrohlich. Das singende Mädchen war wie gelähmt vor Angst. Es wusste nicht, was es tun sollte.
Da fiel ihm wieder ein, was ihm geholfen hatte, sich aus dem Schiff zu befreien – das Lied seines Lebens. Es fing an, aus voller Kehle zu singen, und wie es sich dem Klang hingab, stieg ein Gefühl von Glück in ihm auf. Seine Melodien und seine Stimme brachten ihm Freude, und die verlieh ihm den Willen, die Brücke zu überqueren. Sie half ihm, den dunklen Wald furchtlos zu durchschreiten. Es sang immer weiter. Es führte sich vor Augen, dass es seine eigene Entscheidung war, sich zu seiner Angst und Scham zu bekennen. Es lag an ihm selbst, in die Freiheit zu gelangen. Das Glücksgefühl brachte seine Ängste zum Schwinden, und sein Mut wuchs.
Das Mädchen sang, bis es ein letztes Mal auf eine andere Realitätsebene gelangte. Hier war die Welt von hellem Blau erfüllt. Die Menschen bewegten sich frei und tanzten vor Glück. Sie lachten, sangen, spielten, redeten und drückten sich offen, frei und unbeschwert aus. Das Mädchen lächelte. Wie es das Land der Freiheit vor sich liegen sah, erkannte es, dass das Herz des Bösen – das Herz, das sie verschluckt hatte – hier zum ersten Mal in den Genuss von Schönheit, Freude und Freiheit kommen würde, nachdem es ewig und drei Tage in einer Schatulle weggeschlossen war.
Mit diesem Gedanken trat es in die Freiheit ein.
Einleitung
Wir leben in einer Zeit voller Schatten. Weltweit steigt all das Hässliche aus den Kellern auf, das wir dort lange Zeit unter Verschluss gehalten hatten. Länder, Gemeinschaften und Individuen sind in Extreme gespalten: links und rechts, reich und arm, Einheimische und Fremde, Muslime und Christen, Herrscher und Rebellen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Männer und Frauen, jeder von uns mit ganz verschiedenen Standpunkten, die scheinbar nie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Das schafft Panik und Verwirrung.
Als im Irak gebürtige Amerikanerin muslimischen Glaubens, die den größten Teil ihres Lebens in den Dienst von überwiegend weiblichen Kriegsopfern gestellt hat, habe ich Instabilität und Unruhen erlebt, bin Diktatoren und Politikern von Weltrang begegnet, habe mich vor den Kugeln von Scharfschützen in Deckung gebracht und für Gerechtigkeit gekämpft. Ich habe versucht, mit meiner humanitären Arbeit in Kriegszonen manche der Ungerechtigkeiten in dieser Welt zurechtzurücken; und später auch mit meinen Medienprojekten, in denen ich über die Kämpfe und Siege von Menschen rings um den Globus berichtete – von der Kampagne zur Anerkennung des dritten Geschlechts in Indien etwa; von den Ehefrauen von IS-Kämpfern im Irak oder den jungen amerikanischen Musliminnen, die sich entschlossen, das Kopftuch zu tragen. Ich habe hautnah erfahren, was Konflikt, Kampf und Zwietracht bedeuten. Ich habe gelernt, dass wir, wenn wir uns von Angst und Wut leiten lassen, irgendwann selbst zu den Aggressoren werden, die wir doch eigentlich bekämpfen. Wir werden zu dem, was wir hassen.
Gerade in unserer heutigen Zeit ist es wichtig, uns das klarzumachen. Überall auf der Welt zeigen wir ängstlich und wütend mit dem Finger auf vermeintliche Feinde und Aggressoren ringsum. Angst und Verunsicherung lassen uns nach dem »anderen« suchen, den es zu konfrontieren gilt. Ich bin eine Reisende zwischen den Welten von West und Ost, den USA und dem Mittleren Osten, und ich sehe allerorten die erhobenen Zeigefinger, die auf andere gerichtet sind. Im Mittleren Osten höre ich, dass Amerika an allem schuld ist. All die Zerstörung, die Revolutionen, die Unterdrückung, ja selbst der IS sind ein Produkt der Arroganz und des Machtmissbrauchs der USA. Ironischerweise bekomme ich das Gleiche in umgekehrter Richtung zu hören: Aus amerikanischer Sicht wurzelt der ganze Terrorismus, die Instabilität, die Angst und der Massenexodus von Menschen in der Verkommenheit und Korruption der »anderen« dort drüben – an jenen weit entfernten, gottverlassenen Orten.
In der Tat gibt es viele, auf die wir mit dem Finger zeigen könnten – auf die Leute, die für Trump oder den Brexit gestimmt haben oder für die Referenden in Katalonien oder Kurdistan. Wir könnten auf die Massen von syrischen Migranten deuten oder den destabilisierenden Einfluss Russlands. Oder wir bleiben in unserem eigenen Umfeld und richten ihn auf die Leute, die andere religiöse Praktiken pflegen, die Chefs, die uns in unserer Karriere blockieren, oder Familienmitglieder, die uns übel wollen.
Wir könnten. Aber in diesem Buch geht es nicht darum, wie wir in unsere Lage gekommen sind oder wer die Schuld daran trägt. Es stellt die Frage nach dem »Was nun?«. Jetzt, wo wir gegenseitig mit anklagenden Fingern aufeinander zeigen – welche Wege führen uns aus dieser Situation heraus?
Jedes Leben, jeder Ort, jede Kultur, jeder einzelne Mensch trägt Gutes, Böses und Hässliches in sich. Wir alle haben eine Geschichte, und die ist in der Regel komplex. Wann immer wir irgendjemanden dämonisieren oder idealisieren, ziehen wir uns selbst aus dem Gesamtbild heraus und vereinfachen die Situation auf grobe Weise. Wir tun es, wenn wir denken, alle afghanischen Männer seien Unterdrücker und alle Kanadier Friedensstifter; alle Konservativen seien engstirnig und hartherzig und alle Demokraten weltoffen und einfühlsam. Wir tun es, wenn wir männliche Chefs generell für Chauvinisten halten, während wir weibliche Chefs als Rollenvorbilder feiern. Verallgemeinerungen wie diese mögen praktisch sein, und in manchen mag sogar ein Körnchen Wahrheit stecken, aber wirklich ins Schwarze treffen sie nie. Bei jeder Dämonisierung oder Idealisierung vergessen wir, dass auch wir selbst Gutes, Böses und Hässliches in uns tragen. Wir übersehen, dass wir alle eine Geschichte haben; und aus unserer Geschichte heraus treffen wir sämtliche Entscheidungen im Leben.
Wir müssen nach anderen Möglichkeiten suchen, um mit unserer Panik und Verunsicherung umzugehen. Die Zeit ist reif dafür. Es reicht nicht, darüber zu reden, was in unserer Welt schiefläuft. Es gilt, einen Weg zu finden, um über alle Gräben hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Westen wünschen sich viele, Helden im eigenen Kinofilm zu sein. Wir wollen auf der Seite der Guten stehen und den Mächtigen die Wahrheit ins Gesicht sagen wie Wonder Woman oder Spider Man. Gewiss eine noble Haltung, bloß haben wir dabei nicht immer das ganze Bild im Blick. Wir begreifen nicht, was für die andere Seite auf dem Spiel steht. Und bestimmt ahnen wir nicht, welche Rolle wir in dem Ganzen spielen. Inwieweit haben wir selbst als gute Menschen, als unschuldige, mitfühlende Menschen, zu dieser besorgniserregenden Spaltung und diesem Aufruhr beigetragen?
Wir müssen lernen, neu über diese kaputte Zeit nachzudenken. Was uns fehlt, ist eine andere Sprache, um mit denen ins Gespräch zu kommen, die wir als »die anderen« betrachten – die nicht so sind wie wir und deren Tun sich uns nur schwer erschließt. Wir müssen unseren Wunsch, Gutes zu tun, in die richtigen Bahnen lenken und das Beste aus ihm machen. Denn solange wir nicht wissen, was es heißt, in den kleinen Alltagsdingen heldenhaft zu sein, in Ehe und Familie, im Beruf und im gesellschaftlichen Miteinander, in der Art und Weise, wie wir zu vergangenen Taten stehen und uns für unsere aktuellen Werte engagieren – solange wir das nicht wissen, wird aus uns niemals einer dieser großen Helden werden, von denen wir alle träumen. Wenn wir uns darauf beschränken, von den großen Geschichten und furchtbaren Traumata dort draußen in der weiten Welt zu reden, ist es leicht, uns vor den eigenen Geschichten und Schatten zu verstecken, die in unserem Inneren lauern. Mit vorschnellen Reaktionen und Selbstgerechtigkeit schaffen wir jedoch nur noch mehr Spaltung, Aufruhr, Wut und Hass. Wir selbst werden zur polarisierenden Kraft. Wenn wir unseren Finger vorwurfsvoll auf andere richten, gebären wir selbst unsere Feinde.
Echte Veränderungen beginnen damit, zu unseren eigenen Erfahrungen zu stehen. Das bedeutet, das Gute, Böse und Hässliche in uns anzunehmen – und auch das, was uns innere Schönheit verleiht. Es heißt, die ganze Komplexität unserer Emotionen und Träume anzunehmen – mitsamt der unangenehmen Gefühle, die unsere Fehltritte und unglücklichen Momente in uns auslösen. Es erfordert, bewusst und achtsam zu handeln, denn nur dann intellektualisieren wir unser Leben nicht. Nur dann agieren wir nicht aus der einfältigen Begrenztheit, über die Dinge bloß nachzudenken oder auf sie zu reagieren, sondern sprechen aus der Tiefe unseres wohlvertrauten Selbst. Die Weisheit des gelebten Lebens wird zu unserem Fundament. Wir lassen uns nicht mehr von anderen manipulieren, die danach trachten, an unseren Schatten anzudocken, die zu konfrontieren wir nicht wagen.
Darüber zu reden, was mir selbst und anderen das Leben schwer macht, versetzt mich manchmal durchaus in Angst, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, mir selbst, Ihnen und der Welt, in der wir leben, authentisch zu begegnen. Es ist ein Weg nach innen, eine Heldenreise, ein Transformationsprozess. Ich will Sie nicht belügen: Der Weg ist steinig. Doch es lohnt sich, ihn zu gehen, denn am Ende winkt die Freiheit – für uns selbst in unserem eigenen Leben und für unser Engagement zum Wohl der Allgemeinheit.
Das ist die innere Haltung, mit der ich Sie in diesem Buch an meinen persönlichen Geschichten und Erlebnissen ebenso teilhaben lasse wie an den Erfahrungen vieler anderer, die ihrer innersten Wahrheit auch Auge in Auge begegnet sind. Mit meiner Ehrlichkeit hoffe ich, all jenen ein Licht zu sein, die sich berufen fühlen, selbst diesen Weg zu gehen. Was bringt es, sich über äußere Werte auszutauschen, solange wir die inneren nicht begriffen haben?
Was ich an Gutem, Bösem und Hässlichem in mir trage, dämmerte mir zum ersten Mal beim Schreiben meiner 2006 erschienenen biografischen Erinnerungen Between Two Worlds: Escape from Tyranny: Growing Up in the Shadow of Saddam. (auf Deutsch: Zwischen zwei Welten: die Jahre bei Saddam und meine Flucht aus der Tyrannei, Hoffmann und Campe, 2016). Die Dinge, die ich dort preisgegeben habe, empfand ich als so schmerzlich, dass ich sie mir über weite Strecken meines Erwachsenenlebens nicht einmal selbst eingestanden hatte. Als ich aufwachte und anfing, das Lied meines Lebens zu singen, konnte ich nicht länger die Augen vor dem verschließen, was in mir selbst kaputtgegangen war. Ich sträubte mich, mir anzuschauen, welche meiner Träume und Ideale gescheitert und welche Verhaltensweisen und Einstellungen fehlgeleitet waren. Ich wollte mich nicht mit Situationen konfrontieren, in die ich ohne mein Zutun geraten war. Damals diese Biografie zu schreiben war nicht einfach, wie ich in Kapitel 1 noch schildern werde, aber es war unerlässlich. Es brachte mir ein so wunderbares Gefühl von Freiheit, dass ich beschloss, mein gesamtes Leben auf die gleiche Weise unter die Lupe zu nehmen.
Ich durchlief einen Bewusstwerdungsprozess, in dem ich das Unwahre in meinem Leben Schicht um Schicht abzutragen begann. Es geschah nicht über Nacht, und manchmal war es schmerzhaft, wie Sie lesen werden – schmerzhaft, meinen gutmütigen, liebevollen Ehemann zu verlassen, als unsere Ehe zerbrach; schmerzhaft, mich aus Women for Women International zurückzuziehen – der Organisation, die ich selbst gegründet hatte und mit der ich in den 20 Jahren ihres Bestehens Hunderttausende von Frauen weltweit unterstützte; und schmerzhaft, mir die peinliche Wahrheit einzugestehen, dass auch ich arrogant sein kann. Zunächst schockierte und deprimierte es mich, mir mein inneres »Alter Ego« anzuschauen. Es dauerte einige Zeit, bis ich erkannte, dass dies ein wichtiger Weckruf war.
Während ich beim Niederschreiben meiner Biografie ein Geheimnis nach dem anderen lüftete und mir der Ängste bewusst wurde, die damit verbunden waren, lernte ich, auf den Prozess der allmählichen, schichtenweisen Annäherung an meine eigene Wahrheit zu vertrauen. So tat sich ungeahntes Neuland vor mir auf. Ich erfuhr, was es heißt, wirklich glücklich zu sein. Ich stieß zu meiner inneren Schönheit vor und entdeckte, dass sie schon immer da gewesen war. Ich konfrontierte mich mit meinen Ängsten und merkte, dass ich selbst für Menschen Mitgefühl entwickeln konnte, vor denen es mir graute. Ich, die ich mich stets als Kämpferin verstanden hatte, entdeckte, welche Schönheit und Kraft in der Hingabe steckt.
Solange wir uns nicht die Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, uns nach innen zu wenden, uns unsere Vergangenheit bewusst zu machen und allem, was gut und hässlich ist in uns, ins Gesicht zu sehen, spielen wir bloß eine Rolle. Wenn wir nicht das Lied unseres Lebens singen, werden wir wütend, selbstgerecht, gemein oder aggressiv. Das ist der Punkt, an dem wir uns in verdrehten Halbwahrheiten oder waschechten Lügen verlieren.
Auf meiner inneren Reise ist mir klar geworden, dass wir nach-haken müssen, um für unsere eigenen Werte einzustehen und nach ihnen zu leben – nicht nach dem, was uns von anderen vorgegeben wird. Wir müssen unseren Schatten kennen und um unsere dunklen Seiten wissen. Wir müssen die tiefere Dimension unserer Wahrheit erkennen, in der wir nicht länger mit dem Finger auf andere zeigen. Nur hier sind unser Reden und Handeln im Einklang. Nur hier können wir uns mit den dunklen Seiten unseres momentanen Lebens konfrontieren und uns ehrlich und ohne Hintergedanken fragen: »Warum passiert das jetzt?« Haben wir unsere eigenen Licht- und Schattenanteile erst einmal besser integriert, verändert sich die Tonlage unseres Protests. Aus harschem Gebell, das die einen begeistert, aber andere verprellt, wird ein wohlformulierter Appell, der eine deutlich größere Menge von Menschen erreicht.
Im Prozess des Erwachens schlagen wir eine Brücke zu unserer Authentizität und treten in einen ehrlicheren Dialog mit uns selbst und anderen. Auf einmal sehen wir unsere Schatten und unser Licht, unsere Dämonen und unsere Schönheit. Wir können glaubhaft und mit Integrität über die größeren Themen reden. Dieses innere Erwachen lässt uns zu einem ehrlicheren Miteinander finden – mit denen, die uns besonders nahestehen, aber auch mit Leuten, über deren Leben wir uns womöglich nie große Gedanken gemacht haben. Wir fangen an, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Erst wenn wir den »anderen« in uns selbst erkennen, können wir den »anderen« auch in diesen Menschen erkennen – in den amerikanischen »Hinterwäldlern«, den französischen »Arabern«, den islamischen »Fundamentalisten« – in jedem von uns. Ab da beginnen wir, die Kluft zwischen uns und ihnen zu überbrücken, zu den vielen »anderen« dort draußen und unserem inneren »anderen«, mit dem wir tagtäglich leben.
Ein wahrer Held ist ein normaler Mensch, der das Schwert der Wahrheit zu halten und sich in seiner ganzen eigenen Wahrheit zu zeigen vermag, mit all ihren guten, bösen und hässlichen Seiten. Er trifft seine Entscheidungen aus diesem Verständnis heraus. Als Helden sind wir nicht von Angst und Wut getrieben, sondern schreiten mit Integrität, Liebe und Weitblick voran.
Gelingt es uns, in uns zu gehen und unserer Wahrheit ins Gesicht zu sehen – der ganzen Wahrheit –, bringen wir vielleicht auch den Mut und die Glaubwürdigkeit auf, unseren Blick nach außen zu wenden und in dieser Welt zu einer Kraft des Wandels zu werden. Wir begreifen plötzlich unsere eigene Rolle in der von uns erschaffenen Welt, und dann setzen wir uns für etwas ein, statt bloß gegen etwas zu kämpfen. Und aus unserer kollektiven Integrität und unseren gemeinsamen Werten entsteht zwangsläufig der ersehnte Wandel.
Jeder von uns hat alles, was nötig ist, um zu beginnen. Es ist ganz einfach, denn wir brauchen nur eins – uns selbst.
Alles fängt mit uns selbst an.
1
Unsere Geschichte erzählen
Nur wenn wir die Wahrheit aussprechen, kann echte Heilung geschehen.
Die längste Zeit meines Lebens war die Dynamik von »wir« gegen »die anderen« die Basis meiner Weltanschauung. Ich dachte in Begriffen von gut und böse, gerecht und ungerecht, Freiheit und Unterdrückung. Die Amerikaner, denen ich in meiner Wahlheimat USA begegnete, hielt ich für frei und selbstbewusst, die Iraker daheim nahm ich als Opfer von Unterdrückung wahr. Amerika empfand ich als Land der Freiheit, während mir der Irak – das Land, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin – verglichen damit bedrückend eng erschien wie ein Gefängnis.
In dem Maße aber, wie sich mein Lebensmittelpunkt mehr und mehr vom Irak in die USA verlagerte und ich im Rahmen meiner Arbeit ständig neue, vom Krieg zerrüttete Länder rings um den Globus kennenlernte, begriff ich allmählich, dass es das Gute, Böse und Hässliche überall gibt. Leid und Schmerz gingen nicht nur von autoritären Herrschern oder prügelnden Ehemännern aus, sie entsprangen auch den Worten und Taten selbsterklärter erleuchteter Amerikaner, die sich als spirituelle, weltoffene Menschen begriffen, die nach persönlichem Wachstum strebten. Die Erkenntnis, dass es in dieser unserer Welt doch keine Utopien gibt, ließ mich aus allen Wolken fallen.
Ich hatte mich geirrt in meiner Art und Weise, das Konzept von »wir« zu romantisieren und das »der anderen« zu dämonisieren. Ich war davon ausgegangen, dass eine Kultur und Lebensweise der anderen überlegen sei, doch damit lag ich falsch. Dies zu begreifen öffnete mir die Tür zu weiteren Erkenntnissen. Möglicherweise hatte ich ungeachtet meines Wunschs, Menschen zu helfen und sie nicht zu verraten, trotzdem den einen oder anderen verletzt. Ich war die Personifikation der selbstlosen Aktivistin, die ihr Leben in den Dienst der Armen und Kriegsopfer stellt. Was auch immer ich tat, ich tat es für sie. Aber mir dämmerte allmählich, dass das, was ich für gut gehalten hatte, ganz so perfekt nicht war – und das schloss meine eigene Person mit ein. Ich war vom Bösen nicht unbeleckt. Auch ich hatte eine Schattenseite.
Wer wir auch sind und wo wir auch herkommen mögen – wir alle haben unsere Geschichte. Sie erzählt von unseren guten Seiten und unserem Leid, unseren Privilegien und Mittäterschaften, unserem Licht und unserem Schatten und vielem anderen mehr. Sie hat ihre ganz eigene Melodie und Harmonie, ihren Rhythmus und Takt. Die meisten von uns erzählen nicht ihre ganze Wahrheit, sondern nur den guten Teil. Ich weiß das aus eigener Erfahrung!
Erst in der Begegnung mit Nabintu, einer Kongolesin Anfang fünfzig, wurde mir klar, dass auch ich eine Geschichte hatte, die es wert war, mit einem breiteren Publikum geteilt zu werden. Ich hatte gedacht, ich würde ihr helfen, nachdem ihr Leben durch einen grauenhaften Milizenangriff komplett zerstört worden war. In Wirklichkeit aber war sie es, die mir ein Stück Weisheit mit auf den Weg gab, das mein Leben verändern sollte.
Als ich Nabintu 2003 in der Demokratischen Republik Kongo kennenlernte, war ich 34 und arbeitete seit über einem Jahrzehnt mit Kriegsopfern. Ich befand mich auf einem Erkundungstrip, um zu entscheiden, ob wir uns mit Women for Women International, der Organisation, die ich 1993 in den USA gegründet hatte, in diesem Land humanitär engagieren wollten. Neben unserem Angebot von finanzieller Soforthilfe für die weiblichen Kriegsüberlebenden war es mir stets wichtig, mir von Betroffenen ihre Einzelschicksale schildern zu lassen. Diese Frauen mussten gehört werden! Außerdem wollte ich unseren Unterstützern daheim erzählen können, was sie erlebt hatten. Das Wissen um die entsetzliche Lebensrealität von Frauen wie Nabintu trug nun mal dazu bei, die Spendenbereitschaft für weibliche Kriegsüberlebende weltweit zu erhöhen. Unser Plan war, diesen Frauen irgendwann eine Schul- und Berufsausbildung zu ermöglichen.
Als ich Nabintu traf, hatte ich bereits Tausende von ähnlichen Geschichten gehört – von Frauen, die in Bosnien in Vergewaltigungslagern gefangen gehalten worden waren, dem Genozid in Ruanda noch eben entkommen konnten oder denen die Taliban in Afghanistan jegliche Ausbildung oder anderen Grundrechte verweigert hatten. Unzählige Frauen hatten mir geschildert, was sie alles auf sich genommen hatten, um ihre Familien durchzubringen, satt zu bekommen und zusammenzuhalten. Die von Frauen erlittenen Traumata werden in der Kriegshilfe nur allzu oft übersehen, und wir wollten eine Möglichkeit finden, Nabintu ebenso zu helfen wie vielen anderen Frauen vor ihr.
Was Nabintu widerfahren war, mochte noch so furchtbar sein, sie war mit ihrem Schicksal nicht allein. Alles hatte damit angefangen, dass eine Gruppe rücksichtsloser Rebellen ihr Dorf überfiel. Als sie die Männer kommen sah, versteckte sie sich unter ihrem Bett. Sie fanden sie trotzdem. Ihre drei Töchter im Alter von neun, 21 und 22 Jahren ebenso. Die Männer zwangen sie, sich auf den Boden zu legen, die Arme zur Seite zu strecken und die Beine zu spreizen. Sie konnten es kaum abwarten, bis sie an der Reihe waren, sich über sie herzumachen. Sie vergewaltigten sie alle. Ihre Töchter waren von so vielen Männern umringt, dass sie zu zählen aufhörte. Schließlich befahlen sie Nabintus Sohn, seiner Mutter selbst die Beine zu spreizen und sie festzuhalten, während sie sie vergewaltigten. Danach sollte er sich an seiner eigenen Mutter vergehen. Als er sich weigerte, schossen sie ihm in den Fuß.
Die Gewalt der Rebellen hatte damit noch kein Ende. Sie verwüsteten Nabintus bescheidene Bleibe, nahmen mit, was sie brauchen konnten, und verbrannten alles Übrige – das Haus, die Kleidung, noch das letzte bisschen Geschirr und Mobiliar. Sie ließen Nabintu und ihre Töchter nackt zurück. Nachbarn, die den Angriff überlebt hatten, eilten herbei und gaben jeder von ihnen ein Tuch, um sich darin einzuhüllen. Wir begegneten uns kurze Zeit später. Nabintu war aus Angst vor einem weiteren Angriff aus ihrem Dorf geflüchtet. Sie hatte noch dasselbe Tuch am Leib, das sie an jenem grauenhaften Tag von ihren Nachbarn bekommen hatte. Es war das einzige Kleidungsstück, das sie besaß. Schuhe hatte sie sich aus Teilen zusammengebastelt, die sie auf den Müllhaufen rings um ihre neue Bleibe fand.
Ungeachtet der Vielzahl von Gräueltaten, von denen ich im Laufe der Jahre erfahren habe, bin ich doch immer wieder schockiert über das Maß an Grausamkeit, zu dem Menschen fähig sind. Obwohl ich mich immer bemüht habe, vor den Frauen, mit denen ich sprach, meine Tränen zurückzuhalten, habe ich nie aufgehört zu weinen. Sollte das jemals geschehen, würde ich mir große Sorgen machen.
Als Nabintu am Ende ihrer Schilderung angelangt war, suchte sie meinen Blick. »Außer Ihnen habe ich das alles noch keinem erzählt.«
Ich holte tief Luft. »Nabintu, ich bin Geschichtenerzählerin. Ich erzähle der ganzen Welt von Schicksalen wie dem deinen, um die Leute um Unterstützung zu bitten und darauf aufmerksam zu machen, was mit Frauen in Kriegsgebieten wie in der Demokratischen Republik Kongo geschieht. Willst du, dass ich das, was du mir erzählt hast, für mich behalte?« Ich musste ehrlich zu ihr sein. Die Spendenmittel, die ich mit ihrer Geschichte würde eintreiben können, würden nicht ausschließlich ihr zufließen. Einen Teil davon würde sie bekommen, der Rest käme vielen anderen Frauen in ähnlicher Lage zugute.
Sie lächelte. »Wenn ich der ganzen Welt erzählen könnte, was mir passiert ist, um anderen Frauen das gleiche Schicksal zu ersparen, würde ich es tun. Aber ich kann es nicht. Du kannst es! Geh und erzähl es allen da draußen in der Welt! Nur nicht meinen neuen Nachbarn.«
Es kommt im Leben gelegentlich vor, dass uns ein Stück Weisheit wie ein Pfeil mitten ins Herz trifft. Für mich war das ein solcher Moment. Nabintu konnte weder lesen noch schreiben; sie war arm, hatte ihr Zuhause verloren und Schreckliches erlebt. Und doch hatte sie einen klaren Blick dafür, welcher Zusammenhang zwischen dem Erlebnis einer einzelnen Frau und dem kollektiven Schicksal von Frauen besteht. Würde eine das Schweigen brechen, so begriff sie, konnte sie damit womöglich andere vor dem bewahren, was sie selbst durchlitten hatte. Würde die Welt über die Geschehnisse Bescheid wissen, könnte sie eingreifen und den Gräueltaten ein Ende bereiten, die Millionen Menschen das Leben kosteten und Hunderttausende von Frauen und Mädchen zu Vergewaltigungsopfern machten.
Ich umarmte Nabintu und versprach ihr, ihre Geschichte zu erzählen. Ich redete mit meinen Mitarbeitern, um für sie die Soforthilfe zu organisieren, die sie brauchte, um sich wieder eine Existenz aufzubauen. Dann machte ich mich auf den Weg. Vor mir lag eine fünfstündige Fahrt über die nahe gelegene Grenze nach Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, wo mich weitere Besprechungen und Befragungen erwarteten. Kaum saß ich im Wagen, fing ich an zu weinen. Meine Tränen galten nicht nur Nabintu und dem, was sie hatte durchmachen müssen, sie waren auch Ausdruck meiner eigenen Scham.
Nabintu hatte den Mut, der mir fehlte. Sie hatte alles verloren, aber ihre Stimme war ihr geblieben, und die wollte sie nutzen. Ich nicht. Ich hielt mich fein zurück und tat so, als gäbe es nichts zu sagen. Mein Job war, andere Frauen dazu zu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen und ihr Schicksal öffentlich zu machen. Das Risiko, meine eigene Geschichte ans Licht zu bringen, hatte ich nie eingehen wollen. Wie oft hatte ich mir gesagt: Ich habe nichts zu erzählen.
Wie viele gut ausgebildete Aktivistinnen aus dem linken Lager bezog auch ich leidenschaftlich Position für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, die ich für weniger privilegiert hielt als mich selbst. Ich war in einer Familie der gehobenen Mittelklasse aufgewachsen, war in der Welt herumgekommen, hatte eine Schulbildung genossen und ein Studium absolviert und lebte in relativer Sicherheit. In meiner Vorstellung war das, was ich oder meine Familie im Irak erlebt hatten selbst in der Zeit nach Saddam Husseins Machtergreifung nicht so schlimm oder extrem gewesen wie das, was diese Frauen durchgemacht hatten – diese Frauen, die nicht nur arm waren, sondern auch ein unvorstellbares Maß an Gewalt erlebt hatten. Mein materieller Wohlstand lieferte mir einen ausgezeichneten Vorwand, mit meiner Geschichte hinter dem Berg zu halten: Jemand wie ich hatte kein besonderes Schicksal! Hinter dieser Fassade aber schämte ich mich, manche Dinge auszusprechen, die ich erlebt hatte. Wie konnte ich mich als Frauenrechtlerin für andere starkmachen, wenn ich selbst in einer arrangierten Ehe gelebt hatte, vergewaltigt worden war und am eigenen Leib die Ängste und Verunsicherung erfahren hatte, die das Leben einer Heranwachsenden in einer Diktatur mit sich bringt?
Ob aus Unwissenheit oder Selbstgerechtigkeit, ich predigte Selbstbestimmung, als hätte ich als Frau bereits meine eigene Kraft gefunden. Aber dem war längst nicht so! Ich verlangte von Frauen wie Nabintu, etwas zu tun, das ich selbst zu tun nicht bereit war. Ich forderte von ihnen, der ganzen Welt von ihrem Schicksal zu berichten – ungeachtet ihrer Angst vor Verurteilung und davor, von ihren Familien oder ihrer Gemeinschaft verstoßen zu werden, mit allen damit einhergehenden realen Gefahren. Mir fehlte jegliches Gefühl dafür, was sie dabei riskierten.
Meine eigenen Erlebnisse zu verschweigen und als unbedeutend abzutun bedeutete in Wirklichkeit, einen Graben zwischen »uns« und »den anderen« auszuheben, der es mir erlaubte, auf Distanz zu genau den Frauen zu gehen, in deren Dienst ich mich hatte stellen wollen. Wie viele andere wohlmeinende Menschenrechtler trat ich unbewusst als Retterin auf. Die Frauen, mit denen ich arbeitete, gerieten dadurch automatisch in die Rolle von hilflosen Opfern, die der Rettung bedurften. Mein Anspruch auf eigenes Leid blieb dabei ebenso auf der Strecke wie der Anspruch dieser Frauen auf Weisheit. Meine Weltsicht basierte auf zwei getrennten Paradigmen, was mich davor bewahrte, je zu meiner eigenen Wahrheit stehen zu müssen.
Als ich endlich im Hotel in Kigali eincheckte, war ich vollkommen erledigt von der ganzen Grübelei und den vielen Tränen, die ich vergossen hatte. Im Kopf aber war ich absolut klar. Ich wusste, dass ich zwei Möglichkeiten hatte: weiter zu schweigen und meine humanitäre Arbeit aufzugeben oder mein Schweigen zu brechen und mein Engagement für Women for Women International fortzuführen. Es war keine einfache Entscheidung. Meine Geschichte zu erzählen würde bedeuten, das Gesetz des Schweigens zu brechen, dem mich zu unterwerfen ich von Kindesbeinen an gelernt hatte – als Mädchen und Mitglied einer Familie, die Saddam Hussein persönlich gekannt hatte. Es bedeutete, meine schmutzige Wäsche vor aller Augen auszubreiten und die Sicherheit und den Ruf meiner Familie aufs Spiel zu setzen. Und außerdem hieß es, mich mit meinem ganzen unterdrückten Schmerz, meiner Angst und Scham zu konfrontieren.
Dennoch konnte ich in meiner Arbeit mit Frauen nicht mehr authentisch auftreten, solange ich auf meinem Schweigen beharrte. So beschloss ich, ein Buch zu schreiben und der Welt meine Erlebnisse zu schildern. Ich mochte mich nicht länger verstecken. Es würde nicht einfach sein. Was mir bevorstand, war ein Weg der Angst und der Demut. Nabintus Worte wiesen mir die Richtung: Würde ich die Wahrheit sagen, müssten sich andere Frauen mit ihrem Schicksal womöglich nicht mehr so allein fühlen, sodass auch sie ungeachtet dessen, was sie erlitten hatten, ihren eigenen Weg in die Freiheit gehen konnten. Noch ahnte ich nicht, wie schwer es mir fallen würde, mein Schweigen zu brechen. Aber ich wusste auch nicht, wie lohnenswert es sein würde.
Ich heiße Zainab Salbi. Ich bin das erste Kind meiner Eltern und in Bagdad, Irak, zur Welt gekommen. Nach ihren Worten habe ich ihnen Glück gebracht, denn ein Jahr nach meiner Geburt bauten sie ein Haus.
In diesem Haus – einem zweistöckigen Einfamilienhaus der Mittelklasse im Al-Mansour-Viertel, ruhig gelegen in einem Eukalyptushain am Ende einer wenig befahrenen Sackgasse – verlebte ich meine glücklichen ersten Kindheitsjahre. Mein Vater war Pilot, und darum reisten wir viel. Meine Mutter, Lehrerin von Beruf, liebte alles Schöne, und so waren wir in unserem Zuhause von Möbeln, Gemälden und Teppichen aus aller Welt umgeben. Sie hatte ein besonderes Faible für Silberwaren und bemaltes Porzellan. Ich erinnere mich noch, wie begeistert sie von unserem thailändischen Esstisch mit seinen detaillierten Schnitzereien von Dörfern, Bergen und Flüssen war.
Während meine Mutter mit der Einrichtung unseres Hauses beschäftigt war, kümmerte sich mein Vater um den Garten, um seine Geranien und Rosen und die vielen Obstbäume – Feigen, Birnen und Orangen. Der Garten war beinahe wie eine zweite Tochter für ihn. Wie hätte ich ahnen können, dass es diese ganze Pracht und Fülle eines Tages nicht mehr geben würde?
Unser Zuhause wurde zum Symbol für das Schicksal des ganzen Irak. 1973 gerieten meine Eltern in den Zirkel von Saddam Hussein, dem damaligen Vizepräsidenten unseres Landes. In einem sorgfältig geplanten Auftritt stieß er als Überraschungsgast zu einer Bootsparty auf dem Tigris und mischte sich unter die jungen Paare der urbanen Gesellschaft, die eingeladen waren. Auch meine Eltern waren dort. Nach diesem Abend war nichts mehr, wie es vorher war. Es führte kein Weg daran vorbei: Jedes Paar musste sich entscheiden, ob es das Freundschaftsangebot von Saddam annehmen oder ablehnen wollte, wohl wissend, dass sich ihr Leben, wie diese Entscheidung auch ausfallen mochte, auf immer verändern würde. Es abzulehnen hieße, ihr eigenes Leben und das Leben sämtlicher noch so entfernter Verwandter aufs Spiel zu setzen. Meine Eltern ergriffen die Hand, die Saddam ihnen reichte. Sie bewahrten darüber vor mir und meinen jüngeren Brüdern Stillschweigen, bis uns Saddam eines Nachmittags nach seinem Amtsantritt als Präsident zu Hause einen offiziellen Besuch abstattete. Damit machte er unsere Freundschaft öffentlich, nicht nur für unsere Familie und die Nachbarn, sondern für das ganze Land. Unsere Verbindung mit ihm war besiegelt.
Kurze Zeit später ernannte Saddam Hussein meinen Vater zu seinem Privatpiloten und Chef der irakischen zivilen Luftfahrtbehörde. Von diesem Zeitpunkt an veränderte sich unser Alltag total. Wir wurden zur Familie von Saddam Husseins Piloten. Wir lebten im Haus von Saddam Husseins Piloten, in der Straße, die zum Haus von Saddam Husseins Piloten führte. Unser Haus wurde überwacht, unser gesellschaftliches Leben auf unsere Beziehung zu Saddam und das von ihm gewählte Umfeld reduziert. Ich als Jugendliche und meine zwei jüngeren Brüder waren in unserer Freiheit extrem beschnitten. Wir hatten uns stets perfekt zu benehmen, durften nie öffentlich über unser Verhältnis zu Saddam reden und mussten immer lachen, wenn er lachte, und weinen, wenn er weinte.
Unser Leben kreiste um unsere Freundschaft zu ihm. Wie alle anderen Familien in seinem Umfeld lebten wir in ständiger Angst, die wir jedoch hinter künstlichem Lächeln verbargen; wir gaben vor, unsere Beziehung zu ihm uneingeschränkt zu genießen und keine eigene Meinung zu haben; wir taten so, als hätte er immer recht, und mochten die von ihm begangenen Gräueltaten noch so furchtbar sein – etwa, als er Tausende von Kurden mit Giftgas töten oder ganze Schiitenstädte mit Bulldozern niederwalzen ließ, um eine politische Rechnung zu begleichen. Meine Familie hatte keine politischen Ambitionen und stellte darum keine Bedrohung für Saddam dar. Unsere Aufgabe war, ihn zu unterhalten und mit ihm über die diversen Aspekte des modernen urbanen Lebens zu plaudern, von Essen über Mode bis hin zur Musik. Wir waren seine Hofnarren.
Ich begriff, dass sich unser Leben verändert hatte, noch bevor ich die Gründe verstand. Der Garten, in dem meine Eltern in den 1970er-Jahren viele Partys gefeiert hatten, blieb in den Achtzigern still. Er war nicht mehr vom ausgelassenen Gelächter meiner Mutter erfüllt, sondern von ihrem Weinen. Sie trug Plastikstühle mitten in den Garten unter den Kakibaum, den Vater dort gepflanzt hatte, stellte das Radio laut und tauschte tuschelnd und unter Tränen Geheimnisse mit ihren Freundinnen aus. Es sollte sehr lange dauern, bis ich begriff, worum es eigentlich ging.
In dieser Zeit drückte mir meine Mutter immer wieder Bücher in die Hand, die meine Unabhängigkeit als Mensch und Frau stärken sollten. Ich las Alex Haleys Roman Roots: The Saga of an American Family (auf Deutsch: Wurzeln, Fischer TB 1977) ebenso wie auf Arabisch erschienene feministische Werke, etwa eins mit dem Titel Ich bin frei





























