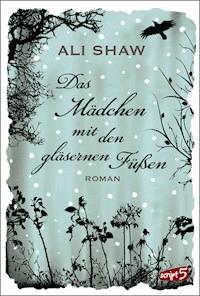Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Gestalt stürzte sich auf sie. Die restlichen Tiere standen erschrocken und regungslos da. Wir wollten alle retten. Alle oder niemand. Träume, Träume Träume! Hilde wird langsam verrückt. Nicht nur, dass ihre Träume von dem grauen Kaninchen etwas unheimlich sind, ihr Freund Flecki behauptet nun auch noch, Hilde hätte die seltene Gabe eines großen Helden aller Kaninchen geerbt! Doch viel mehr beschäftigt sie die Nachricht, dass Tiere von Tierquälern entführt wurden und nun leiden müssen, wenn sie überhaupt noch leben. Aber wie diese Tatsachen zusammenhängen, könnte sich Hilde nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matilda Hölscher wurde 2010 geboren. Seit sie bereits im Kindergarten lesen gelernt hatte, liest sie viel und gerne. 2021 entdeckte sie ihre Liebe zum Schreiben und veröffentlichte 2023 mit 12 Jahren ihr erstes Buch „Die wahre Kraft der Träume“. Sie lebt mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihren zwei Kaninchen in einem Dorf. Sie findet, dass in ihrem Haus durchaus noch mehr Tiere Platz hätten. ;-)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Flecki
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Kapitel: Hilde
Kapitel: Luis
Epilog
1. Kapitel Luis
Es war Freitag, der 6. November. Frühmorgens kamen meine Besitzer Mama und Maus ins Zimmer und gingen zu meiner Freundin Schlappi. Mama hatte fast kurze, braune Haare, eine blaue Jeans und einen hellblauen, dicken Pullover an. Maus, ihre Tochter, hatte braune, mittellange Haare, die ihr bis zur Schulter reichten. An diesem Morgen trug sie auch eine tiefblaue Jeans und einen blauen Pulli, allerdings war es ein dunkelblauer. Sie streichelten Schlappi über den Rücken, sodass sie sich genüsslich räkelte und ihre Pfoten ausstreckte. Ich hoppelte zu meiner Partnerin und verlangte auch nach einer Streicheleinheit.
Jetzt müsst ihr wissen, dass Schlappi und ich Kaninchen waren. Schlappi war die Ältere. Sie hatte braunes Fell, doch an Nase, Stirn, Pfoten und Bauch war es weiß.
Außerdem zierte ihren Hals ein großer weißer Fellkragen, was allerdings viele Kaninchen hatten. Sie hatte weiße Schlappohren und war das verschmusteste Kaninchen, das ich kannte.
Ich war von Nase bis Schwanzspitze grau. Ich besaß eine coole Löwenmähne, die auch einem Rockstar gehören könnte, und war, im Vergleich zu Schlappi, eher klein geraten.
Meine Ohren waren auch keine Schlappohren, sondern kurze, kleine Ohren, komplett in grau. Im linken Ohr hatte ich eine Tätowierung: ein K. Dieser Buchstabe stand vermutlich für „Kaninchen“, und das war ich ja eindeutig. Mama, Maus, Mausebär und Papa, also quasi alle meine Möhrchengeber, sagten immer, die hätte ich bekommen, weil ich so gerne Männchen machte, und deshalb könnte man mich mit einem Erdmännchen verwechseln. Das stimmte natürlich nicht, keine Frage!
Ich hoppelte jedenfalls zu den dreien und forderte eine Streicheleinheit ein, da ich auch sehr verschmust war. Maus streichelte mir einmal kurz über den Rücken, was mir aber nicht genügte. Ich machte Männchen an ihr, um ihr zu zeigen, dass ich auch noch hier war.
Sie ignorierte mich einfach und redete leise auf Schlappi ein: „Alles gut Maus. Dir passiert nichts. Du bist so ein liebes Kaninchen.“ Immer wenn sie so etwas sagte, hieß es, dass eben nicht „alles gut“ war, nein, es hieß, dass sie sich Sorgen um uns machte, dass sie Angst hatte. Kurz drehte ich mich um, mein Magen knurrte und ich überlegte, ob es jetzt wichtiger war, Schlappi zu beobachten, mir endlich meine Kuschelrunde abzuholen, oder etwas zu futtern.
Plötzlich hallte ein gellender Schrei durch den Raum. Panisch sah ich mich um, und kam zu dem Schluss, dass der Warnschrei von Schlappi kam. Mama hatte sie hochgehoben, wie ein Greifvogel seine Beute. Sie trug Schlappi in eine Transportbox. Meine beste und einzige Freundin schaute mich aus dunklen, tieftraurigen Augen an.
Danach wurde die Transportbox mitsamt dem Kaninchen weggetragen, aus meinem Blickfeld hinaus.
Entsetzt schaute ich an den Ort in meinem Gehege, an dem Schlappi bis vor kurzer Zeit gelegen war. Der Ort war ihr Lieblingsplatz.
Er lag an der Wand, bei den Kratzsteinen. Die Kratzsteine waren weiße Steine mit vielen kleinen Löchern, ungefähr ein halbes Kaninchen breit mal ein großes liegendes Kaninchen lang und eine Pfote hoch. Ich wollte mich nicht an Schlappis Platz legen, weil ich Angst hatte, ihr wunderbar frischer Geruch könnte dann mit meinem überdeckt werden. Also legte ich mich nicht hin, sondern hoppelte an das große Tor, ein weißes Tor, dass mit einem Drahtnetz überdeckt worden war, damit wir uns nicht durchquetschen konnten. Ich knabberte an dem Draht, was eine schreckliche Angewohnheit von mir war, wenn ich gerne in den Vorraum würde. Der war eine coole Abwechslung für unser Gehege. Darin wurde Futter gelagert, und wenn die Tür zum Haus meiner Menschen offen war, ging ich auch gerne da rein. Wir wohnten nämlich in einem Anbau, der mit einer Tür zum Haus der Menschen verbunden war.
Aber dieses Mal wollte ich nicht in den Vorraum, auch nicht ins Menschenhaus. Ich wollte meinen Futtergebern, die Schlappi mitgenommen hatten, hinterherhoppeln und Schlappi retten. Aber dieses blöde Gitter ließ sich nie durchknabbern. Nach einer Weile gab ich auf und legte mich traurig und enttäuscht in meine Lieblingsecke, direkt neben dem Käfig. Ich bereute es schon sehr, dass ich mich kurz zuvor noch mit Schlappi gestritten hatte.
Ich wollte einschlafen und erst wieder aufwachen, wenn Schlappi wieder da war, damit wir kuscheln und endlich wieder zusammen sein konnten. Ich wollte aufwachen, aus einem Alptraum, und mir dann von Schlappi sagen lassen, dass alles nur ein Traum und sie nie weggewesen war. Ich wollte einfach, dass Schlappi sich wieder an meiner Seite befand und wir das Leben gemeinsam durchhoppeln konnten. Das war in diesem Moment mein einziger Wunsch.
Mein einziger und größter Wunsch.
Ich hätte gerne geweint, wie ich es manchmal bei Menschen sehe, aber Kaninchen können so etwas nicht. Ich fühlte mich so alleine, wie noch nie. Und ich war schon oft alleine.
Das erste Mal, als ich alleine war, war ich ein halbes Jahr alt. Ich war in einem Käfig, mit einer großen, neongelben Schleife und hatte eine Höllenangst. Über mir war ein großer grüner Baum, ein Ungeheuer, mit Nadeln, mit goldenen, roten und orangenen Kugeln die geheimnisvoll und triumphierend zu mir hinunter glitzerten. Kurz darauf wurde mein Käfig von einem kleinen Jungen hochgehoben und angestarrt. Er war vielleicht drei Jahre alt, jung für einen Menschen, er war beinahe noch ein Baby. Er hatte schwarze, kurze Haare und schmutzig blau-graue Augen. Sein grauer Pulli hatte viel zu lange Ärmel und seine Hose war nicht vorhanden: er hatte nur eine Windel an. Einen Moment starrte er mich entsetzt an.
Kurz darauf füllten sich seine Augen mit Tränen und sein Gesicht verzerrte sich wütend. Er schrie, während er meinen Käfig heftig schüttelte und fast zu Boden warf: „Mama, ich will ein Hund, kein dummes ‚Kaninschen‘!“ Seine Mutter schlug sich mit der flachen Hand an den Kopf. Schließlich meinte sie:„Ja, natürlich! Wie konnte ich das nur vergessen?! Gleich morgen gehen wir auf das große Weizenfeld, und bringen ihn dorthin. Dort kann er ein so wundervolles Leben in der Natur führen. Direkt danach bestellen wir dir im Internet einen tollen Hund, so wie du es dir gewünscht hast!“ Damals wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Die ganze Nacht konnte ich kein Auge zu machen, vor lauter Angst. Ich überlegte die ganze Zeit, was wohl ein glückliches Leben in der Natur bedeutete, doch ich war mir sicher, dass es nichts Gutes verhieß. Es war sehr dunkel und ich war immer noch in dem Käfig unter dem Baum mit den vielen Kugeln. Die Menschen waren sich zu schade, die Schleife abzumachen, die ganze Nacht baumelte sie über meinem Käfig und wartete auf den besten Moment, über mich herzufallen, wie ein Monster über seine Beute. Neongelb, eine Warnfarbe, genau wie rot. Wenn sie in der Natur vorkam, dann bedeutete das immer Gefahr.
Am nächsten Morgen kamen die Menschen wieder zu dem Baum und hoben meinen Käfig hoch. Der Boden wackelte sehr und ich fiel geradewegs wieder hin, obwohl ich doch erst aufgestanden war. Jetzt hatte ich mir auch noch die Pfote verrenkt. Und das, obwohl mir doch eh schon alles von der schlaflosen Nacht im Käfig wehtat, in der ich alle meine Glieder verrenken musste, um mich überhaupt einigermaßen gemütlich hinzulegen, was in diesem Käfig sowieso schon unmöglich war.
Der Käfig war viel zu klein, man konnte glauben, es sollte eine Transportbox für einen Hamster sein, nicht für ein Kaninchen.
Außerdem war es ziemlich ironisch, sich ungemütlich hinzulegen, um gemütlich liegen zu können.
Als ich eine gute Minute getragen wurde, kamen wir zu einem knallpinken Auto. Noch so eine komische Farbe. Als ich mich aufzurichten versuchte, landete ich schmerzhaft auf meinem Bauch. Der kleine Junge lachte. „Nochmal!“ Ich hatte aber keine Lust auf „nochmal“, erst recht nicht, wenn dieser kleine Furz es mir befahl. Also gab ich mir alle Mühe, dem Drang zu widerstehen und nicht wieder aufzustehen und zu sehen, wo die Familie mich hinbringen wollte. Ich hatte keine Lust noch einmal hinzufallen, und dem kleinen, furchtbaren Jungen eine Freude zu machen. Sie hoben mich in das Auto. Es ruckelte wieder sehr, jedoch beherrschte ich mich, nicht aufzustehen, um zu schauen was passierte. Ich überlegte wieder, wo diese schrecklichen Menschen mich hinbringen wollten. Ich wurde in den Kofferraum gehoben, und die Menschen stiegen ins Auto um loszufahren.
Die Fahrt wurde sehr ungemütlich, da ich ja im Kofferraum in meinem Käfig war. Das bedeutete, dass die Menschen keine Möglichkeit hatten, um mich anzuschnallen, was sie wahrscheinlich so oder so nicht getan hätten. Die ganze Fahrt über rutschte mein kleiner Käfig hin und her und ich fiel immer wieder gegen die eisernen Gitterstäbe.
Nach den längsten 20 Minuten meines Lebens kamen wir an dem Feld, was die Menschen erwähnt hatten, an. Es war riesig und mit Schnee bedeckt. Dieser glitzerte gefährlich, als ob anstatt Schnee tausende Glassplitter auf der Wiese liegen würden, und mir mit einem bösen Grinsen entgegen funkelten. Ein „glückliches Leben in der Natur“, wie die Menschen es genannt hatten, würde ich hier garantiert nicht führen können.
Ich hatte wieder eine ziehende Angst, die mich in der Magengrube traf, genau diese Angst, die mich die ganze Nacht geplagt hatte.
Ein Kaninchen sollte so etwas schreckliches nicht erleben müssen, vor allem nicht ein so junges, wie ich es war. Ich war schließlich noch sehr, sehr jung. Doch trotz meines Alters, das die meisten wohl unterschätzten, sagte mir mein Instinkt, dass diese Lage sehr gefährlich war. Die Frau, die anscheinend die Mutter des kleinen Jungen, der so tyrannisch war, stellte meinen Käfig auf dem schneebedeckten Gras ab. Sie öffnete ihn. Ich war sehr überrascht und wollte aus dem Gefängnis, aus der Hölle, in die Freiheit hoppeln, der Sonne entgegen, doch meine Instinkte sagten mir, dass das keine Idee war, die ich umsetzen sollte.
Ich hörte auf meinen Instinkt, auch wenn ich nicht wusste, warum, und verkroch mich in ganz hinten in meinem Käfig, machte mich ganz klein.
Doch plötzlich packte mich eine große Hand und zerrte mich unsanft aus dem Käfig. Sie schubste mich in den kalten Schnee.
Anschließend sah ich zitternd zu, wie die Menschen in ihr warmes Haus fuhren, um dem kleinen Jungen seinen Hund zu kaufen.
Ich war alleine. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, dass es sehr, sehr kalt war. Wenn ich nicht schnell einen warmen Ort fand, würde ich erfrieren.
Ich hoppelte so schnell ich konnte, auf der Suche nach einem warmen Platz.
Ich wusste nicht, wie lange ich hoppelte, doch es musste sehr lange sein, mehrere Stunden.
Ich hoffte so sehr auf einen warmen Ort, dass ich einen wichtigen Punkt vergaß. Es war Winter. Ich brauchte Futter. Und im Winter Futter zu finden, war nicht gerade das Einfachste was man sich vorstellen konnte.
Mindestens genau so schwer war es, nicht von anderen hungrigen Tieren gefressen zu werden, denn Fleischfresser hatten auch im Winter keine Probleme damit, Tiere zu töten und zu fressen. Ich konnte nur hoffen, dass mich kein Feind entdeckte, denn ich glaubte kaum, dass ich genug Kraft hätte ihm zu entwischen.
Nach einer Zeit hörte ich ein seltsames Geräusch. Erschrocken sah ich mich um, doch ich konnte nichts entdecken. Plötzlich hörte ich noch ein Knacken. Als ob ein großes Tier auf einen Ast trat. Ich verfiel in Panik. Was wenn es ein Raubtier war? Ich hatte zu große Angst, um mich zu bewegen. Ich war noch ein sehr junges Kaninchen, hatte keinerlei Lebenserfahrung. Also wusste ich nicht, ob es ein gefährliches oder ein harmloses Tier wie zum Beispiel ein Eichhörnchen war. Ich wusste noch nicht einmal, ob ich meinen Ohren trauen konnte oder ob ich mich verhört hatte, denn ich war schon so verfroren, dass ich meine Pfoten nicht mehr spürte. Weshalb sollten also meine Ohren nicht knacken, weil sie eingefroren waren? Das konnte doch gut sein. Hoffte ich. Doch als ich mich umdrehte, sah ich, dass ich mich wohl nicht geirrt hatte.
Hinter mir stand ein großer Rotfuchs. Er fletschte die Zähne. Knurren schallte über das offene Feld. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich dachte, ich müsste viel zu jung sterben, ohne jemals richtig gelebt zu haben. Ich hatte solche Angst, dass ich mich nicht nur vor Kälte nicht rühren konnte.
Der Fuchs stand jetzt genau über mir, jede Sekunde würde er mich zerfleischen. Ich spürte sein Bein, das meinen Rücken streifte.
Oder war das sein Maul? Würde er mich nun fressen? Einer seiner Zähne streifte meinen Kopf und ich spürte einen brennenden Schmerz und ein wenig Blut, dass über mein Gesicht rann.
Doch auf einmal hörte ich menschliche Stimmen und ein klatschen. „Hey, lass das arme Kaninchen in Ruhe!“ Dadurch gewann ich eine, höchstens zwei Sekunden. Ich erkannte meine Chance und hoppelte in Windeseile in den angrenzenden Wald. Doch wie gefährlich das war, ahnte ich noch lange nicht.
Erstmal zählte nur, dass ich dem Fuchs entkam. Meine Wunde brannte doch das war unwichtig. Es zählte nur, zu entkommen, zu fliehen.
Ich dachte, ich hätte ihn abgehängt, als er plötzlich vor mir stand. Wieder knurrte er.
Dieses Mal nur noch lauter. Er war eindeutig wütend. Das sah man ihm an. Schaum quoll aus seinem Maul und tropfte auf mich, in meine Wunde. Doch meine geringste Sorge war im Moment, dass sich meine Wunde entzündete, denn gleich würde sich sein Maul zu meinem Körper senken, um ihn zu durchbohren.
Schon wieder hingen seine blendend weißen Zähne direkt über mir, so nah, dass ich sehen konnte, wie scharf und spitz diese waren.
Dieses Mal, da war ich mir sicher, würde mir kein Mensch zur Hilfe eilen, also musste ich selbst handeln.
Ich nahm all meinen Mut zusammen, sammelte meine Kraft in den Hinterbeinen und sprang dem Fuchs direkt an die Schnauze.
Das war, sollte man meinen, nicht besonders schlau, da sein Maul ja offen war, doch in diesem Moment rettete es mir das Leben, auch wenn ich einige blutige Kratzer von seinem Gebiss abbekam.
Als ich bei der Schnauze des Fuchses war, riss ich mein winziges Mäulchen auf, und auch wenn meine Zähne noch lange nicht so spitz waren wie die des Fuchses, reichte es doch aus um den Fuchs an der Schnauze bluten zu lassen. In meinem Maul schmeckte es ekelhaft nach Blut, doch das musste ich vorerst ignorieren, denn noch war die Gefahr nicht gebannt. Mit meinem Sprung hatte ich nicht viel ausgerichtet, der Fuchs war nun nur noch gefährlicher, denn ich hatte ihn noch wütender gemacht, als er eh schon war.
Ich sammelte noch einmal meine Kraft in den Hinterbeinen, doch dieses Mal sprang ich ihn nicht an. Für den Fuchs völlig unerwartet spurtete ich los. Er stand wenige Sekunden verdutzt da, bevor er mir hinterher hechtete.
Doch diese Sekunden hatten mir gereicht, um einen Vorsprung zu gewinnen. Ich schlug Harken, damit ich den Fuchs noch mehr verwirren würde. Ich lief zwischen Bäumen hin und her, gab mir so viel Mühe wie möglich, um dem Tier zu entwischen. Doch plötzlich stand er wieder vor mir. Ich hatte keine Zeit. Überhaupt keine. Keine Zeit zum Nachdenken. Ich musste instinktiv handeln.
Blitzschnell drehte ich mich um. Ich hoffte, dass der Fuchs wieder verwirrt sein würde, doch es war hoffnungslos. Ich rannte los, der Fuchs war mir dicht auf den Fersen. Ich hatte zwar eine bessere Chance, da ich klein und wendig war, doch der Fuchs hatte Jagderfahrung. Ich hatte keine Erfahrung darin, vor einem wilden Tier davonzurennen.
Ich sprang durch einen kleinen Zwischenraum, der sich zwischen zwei Bäumen auftat. Er war für den Fuchs zu klein, er müsste außen rum laufen. Doch… So weit kam es nicht.
Der Fuchs hatte inzwischen sein volles Tempo erreicht, er konnte weder zur Seite laufen, noch bremsen. Er raste in voller Geschwindigkeit auf die Astgabel zu. Im nächsten Moment knallte er dagegen, winselte, und flüchtete.
Vor mir, einem Kaninchen. Na ja, eher vor einer Astgabel. Ich konnte nicht fassen, dass ich es geschafft hatte, dass ich einem Fuchs entkommen war. Doch das schlechte Gewissen nagte an mir. Der Fuchs wollte auch nur Futter. Ohne würde auch er sterben. Ich versuchte, es zu unterdrücken. Noch immer schmeckte ich das Blut in meinem kleinen Maul, und ich suchte schnell Wasser. Meine Laune war jetzt deutlich gestiegen. Ich war zweimal einem Fuchs entkommen, an einem Tag. Schon fast glücklich hüpfte ich im Wald herum.
Nach kurzer Zeit fand ich eine Pfütze, die nicht gefroren war. Ich dachte, heute wäre mein Glückstag. Ich vergaß, was mir die Familie angetan hatte, ich vergaß, wie knapp ich dem Tod entronnen war, es zählte nur, dass ich lebte, doch als ich aus der Pfütze trank, verflog meine gute Laune schlagartig.
Das Wasser war eisig kalt! Es fühlte sich an, als hätte ich einen Eisklumpen verschluckt.
Sofort musste ich husten. Der Blutgeschmack war zwar verschwunden, dafür war jetzt meine Kehle gefroren. Wenn ich hätte wählen dürfen, hätte ich lieber das Blut genommen, obwohl das auch echt ekelhaft war.
Die Kälte breitete sich in meinem Körper aus und ich spürte, wie ich langsam aber sicher unterkühlte. Mir fiel wieder mein Vorhaben, einen warmen Platz zu suchen, ein. Wieder wurde mir schmerzlich bewusst, dass mir nur ein paar Stunden blieben, auch wenn ich den Fuchs besiegt hatte. Diese Stunden würden entscheiden, ob ich leben oder sterben würde.
Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich konnte nur hoffen, dass ich diesen gewann.
Denn sonst… Darüber wollte ich mir lieber nicht zu lange den Kopf zerbrechen, sonst verlor ich noch sämtliche Hoffnung.
Vielleicht konnte ich mich ja etwas länger am Leben erhalten, wenn ich mich so viel wie möglich bewegte. Das traf sich gut, denn ich wusste ja nicht, wie weit der nächste warme Ort entfernt war, aber ich musste mich beeilen. Panik kochte in mir hoch. Ich ermahnte mich ruhig zu bleiben, aber es gelang mir nicht. Ich musste einige Minuten verweilen, bis ich mich wieder gesammelt und mir wenigstens halbwegs eingeredet hatte, dass alles gut werden würde, dass doch immer alles gut wurde. Mit diesem Gedanken machte ich mich auf die Suche.
Ich suchte sehr lange nach einem geschützten und warmen Ort. Es dauerte, bis ich mich endlich schlafen legte, auch wenn ich wusste, wie gefährlich das war. Wenn ich nachts unterkühlte, würde ich morgens nicht mehr aufwachen. Doch ich musste das Risiko eingehen, ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte keinen weiteren Schritt machen, als ich endlich einen Platz fand, bei dem ich schlafen konnte, so müde war ich.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich, dass ich Glück gehabt hatte, nicht von einem Feind gefressen worden zu sein, zum Beispiel einer Eule. Schließlich hatte ich nicht mehr die Kraft gehabt, einen Bau zu buddeln. Ich wusste zwar, wie das ging, aber gebaut hatte ich so oder so noch keinen. Ich konnte also von Glück reden, nicht als Mitternachtssnack einer hungrigen Eule geendet zu sein.
Ich wachte noch im Morgengrauen auf, es war fast noch dunkel. Jedoch machte ich mich direkt auf den Weg, ich wollte schließlich nicht, dass ich doch noch gefressen wurde, nachdem ich diese Nacht überstanden hatte.
Es war nicht minder kalt als am Vortag, im Gegenteil. Es war sogar noch kälter. Das konnte zwar auch an der frühen Uhrzeit liegen, aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht so war. Das bedeutete, dass die Zeit einen weiteren Schlag gegen mich gesetzt hatte. Mir blieb nun noch weniger Zeit. Ich musste ein neues Zuhause finden und zwar schnell. Ich hoppelte ohne Ziel Stunden in diesen Wald hinein. Immer wachsam, dass nichts passieren würde, doch als ich mich schon etwas entspannt hatte, und unachtsamer wurde, schlug das Schicksal zu.
Ich hörte ein gruseliges, lautes Fauchen, das auf keinem Fall einem Fuchs gehörte. Ich blickte mich um. Sehen konnte ich nicht, was mich da anfauchte. Ich war mir aber sicher, dass es mich anfauchte, denn ich fühlte mich beobachtet. Die Augen eines Tieres lagen auf mir. Ich hoppelte weiter, mit dem stechenden Blick eines Feindes im Rücken. Ich wusste, dass es sich nur um Minuten handeln konnte, bis das Tier angreifen würde. Wieder einmal, wie auch bei dem Treffen mit dem Fuchs, hatte ich Todesangst, doch ich beherrschte mich. Ich tat so, als ob ich nicht wüsste, dass etwas mir folgte, und musste nur noch wachsamer sein.
Das Tier blieb länger versteckt, als ich dachte, deshalb war ich doch überrascht, als es angriff. Der Überraschungsmoment, den eigentlich ich haben wollte, gehörte nun dem Marder.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)