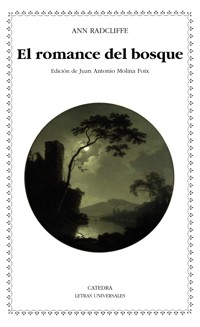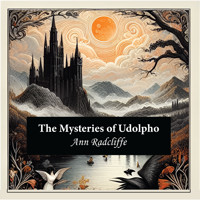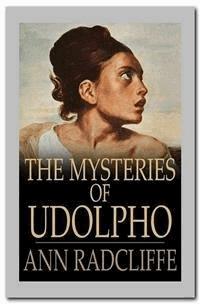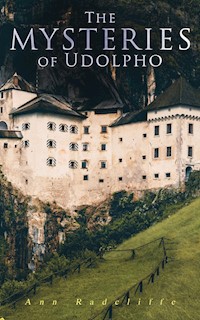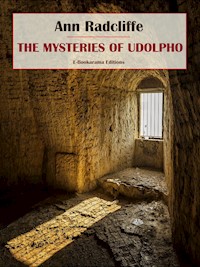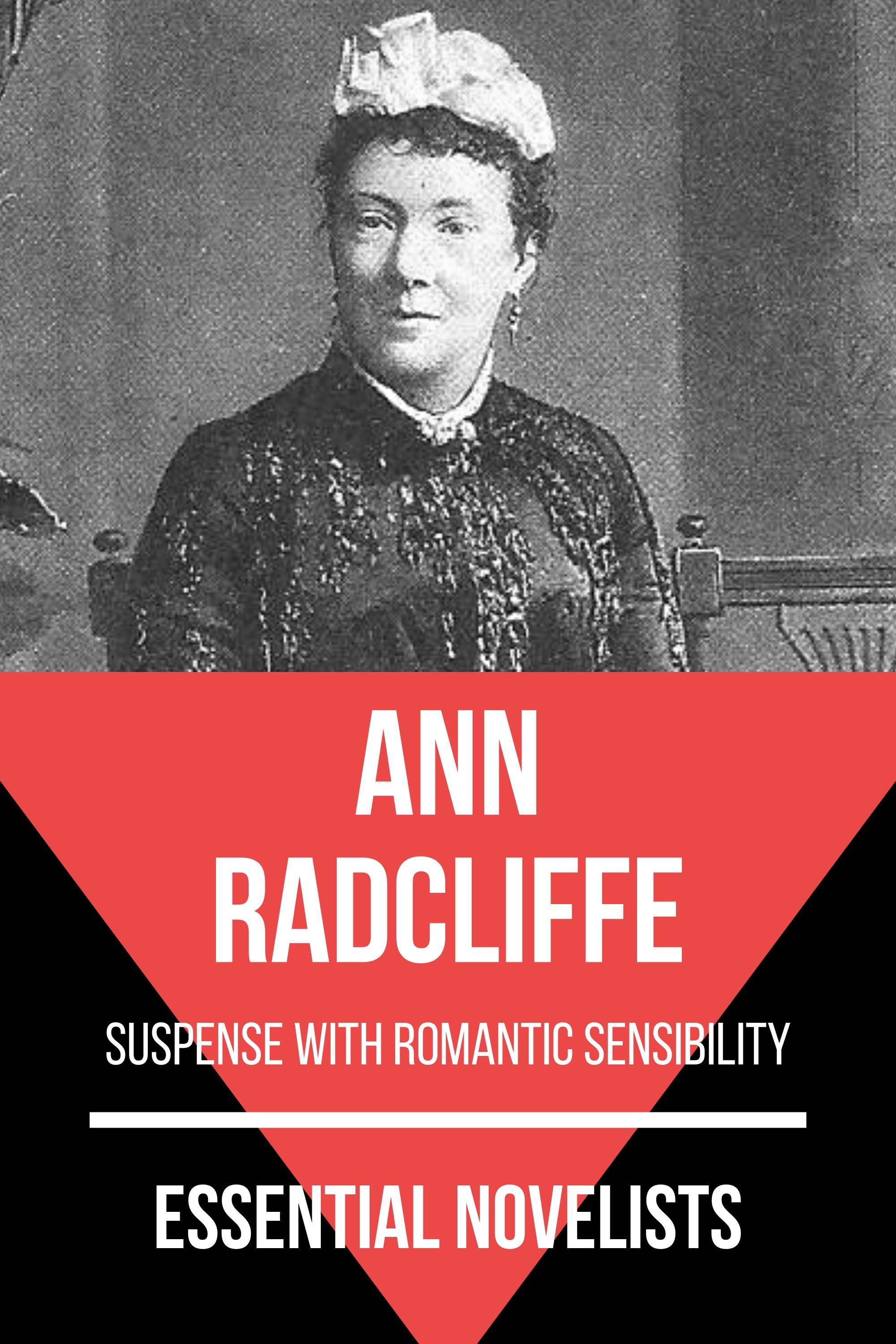Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Band 3 der ersten deutschsprachigen Ann-Radcliffe-Gesamtausgabe, herausgegeben von Maria Weber. Die junge Waise Adeline gelangt auf mysteriösen Wegen in die Obhut Pierre de la Mottes, eines verarmten Adligen, der sich mit seiner Familie auf der Flucht vor dem langen Arm des Gesetzes befindet. In einer abgelegenen, verfallenen Abtei inmitten eines düsteren Waldes finden die Flüchtenden eine provisorische Unterkunft. Doch die Ruhe währt nicht lange: Der Marquis de Montalt, der Besitzer der Abtei, erscheint mit seinem Gefolge auf der Bildfläche. Während Adeline bald ahnt, dass in den Mauern der Abtei einst ein schreckliches Verbrechen verübt wurde, verstrickt sich ihr vermeintlicher Wohltäter immer mehr in die perfiden Pläne des grausamen Marquis ... Ann Radcliffes Meisterwerk "The Romance of the Forest", erstmals im Jahre 1791 erschienen und später von ihrer zeitgenössischen Kollegin Jane Austen in "Northanger Abbey" satirisiert, ist der Inbegriff der Gothic Romance und etablierte ihren Ruf als Schriftstellerin. Erste vollständige deutsche Ausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eh‘ die Fledermaus
Geendet ihren klösterlichen Flug,
Eh‘, auf den Ruf der dunklen Hekate,
Der hornbeschwingte Käfer, schläfrig summend,
Die nächt‘ge Schlummerglocke hat geläutet,
Ist eine Tat gescheh‘n furchtbarer Art.
Shakespeare, Macbeth
ZUR BEACHTUNG.
Es ist angemessen zu erwähnen, daß einige der kleinen Gedichte, die in den folgenden Seiten eingefügt wurden, mit Erlaubnis der Autorin im Gazetteer erschienen sind.
WIDMUNG
AN IHRE GNADEN,
die HERZOGIN von LEEDS.
Gnädige Frau,
ICH BIN zu dankbar für die Ehre, daß es mir erlaubt ist, zu sagen, daß diese Arbeit die Billigung Euer Gnaden hat, als daß ich die Gelegenheit, Sie anzusprechen, die mir jetzt angeboten wird, durch Rühmen mißbrauchen würde, welches anmaßend von mir anzutragen wäre, und welches das Vorrecht Euer Gnaden zu verachten ist.
Vielmehr will ich mich freuen, daß die Aufmerksamkeit, die in Sachen der Moral den folgenden Seiten gegeben wird, Sie dazu veranlaßt hat, die Schwäche meiner Bemühungen zu übersehen, um sie zu unterstützen; und daß der Name einer Dame, deren Tugenden ihren Rang ehren, so viel wie ihre Leistungen ihn schmücken, diese Arbeit für diejenigen billigt, die ansonsten die Neigung eines modernen Romans in Zweifel ziehen könnten.
Ich habe die Ehre,
Mit der respektvollsten Ehrerbietung,
Ihrer Gnaden sehr verpflichtete
und gehorsame
demütige Dienerin zu sein,
ANN RADCLIFFE
Inhaltsverzeichnis
Die Waldromanze: Erster Band.
1. Kapitel.
2. Kapitel.
3. Kapitel.
4. Kapitel.
5. Kapitel.
6. Kapitel.
7. Kapitel.
Die Waldromanze: Zweiter Band.
8. Kapitel.
9. Kapitel.
10. Kapitel.
11. Kapitel.
12. Kapitel.
13. Kapitel.
14. Kapitel.
Die Waldromanze: Dritter Band.
15. Kapitel.
16. Kapitel.
17. Kapitel.
18. Kapitel.
19. Kapitel.
20. Kapitel.
21. Kapitel.
22. Kapitel.
23. Kapitel.
24. Kapitel.
25. Kapitel.
26. Kapitel.
DIE
WALDROMANZE
Erster Band.
1. Kapitel.
Und ich bin einer,
So matt von Elend, so zerzaust vom Unglück,
Daß ich mein Leben setz auf jeden Wurf,
Es zu verbessern oder zu verlieren.
Shakespeare, Macbeth
„WENN einmal schnöder Eigennutz sich des Herzens bemächtigt, erfriert er die Quelle jedes warmen und edlen Gefühls; er ist gleichermaßen ein Gift für die Tugend und für den Geschmack am Schönen – diese verkehrt er, so wie er jenen vernichtet. Die Zeit mag kommen, mein Freund, wo der Tod die Bande der Habgier auflösen, und es der Gerechtigkeit vergönnt sein wird, wieder in ihre Rechte zu treten.“
Dies waren die Worte des Advokaten Nemours an Pierre de la Motte, als der letztere um Mitternacht in den Wagen stieg, der ihn von Paris, von seinen Gläubigern und der Verfolgung der Gesetze entfernen sollte. De la Motte dankte ihm für den letzten Beweis seiner Güte, für die Hilfe bei seiner Flucht, und sagte ihm, als der Wagen wegfuhr, noch ein letztes trauriges Lebewohl. Die Dunkelheit der Stunde und seine äußerst bedrängte Lage versenkten ihn in stummen Trübsinn.
Wer Guyot de Pitaval gelesen hat, den glaubwürdigsten jener Schriftsteller, welche uns die Verfahren im Pariser Parlament während des siebzehnten Jahrhunderts aufgezeichnet haben, wird sich gewiß der bemerkenswerten Geschichte zwischen Pierre de la Motte und dem Marquis Philippe de Montalt erinnern; und ihnen sei hiermit gesagt, daß die Person, die hier vorgestellt wird, eben dieser Pierre de la Motte ist.
Als Madame de la Motte sich aus dem Kutschenschlage lehnte, und einen letzten Blick auf die Mauern von Paris warf – Paris, der Schauplatz ihres vergangenen Glücks, der Wohnsitz so vieler Freunde, die ihrem Herzen teuer waren, wich die Kraft, welche sie bisher aufrecht gehalten hatte, der Gewalt der Trauer.
„Lebt alle wohl!“ seufzte sie. „Dieser Blick noch, und wir sind auf immer getrennt.“
Tränen folgten ihren Worten, sie sank zurück und überließ sich ihrer Wehmut. Die Erinnerung vergangener Zeiten drückte schwer auf ihr Herz. Noch vor wenigen Monaten war sie von Freunden umgeben, im Schoße des Überflusses und der Ehre. Nun wurde sie allem beraubt, eine elende Vertriebene aus ihrem Heimatort, ohne Zuhause, ohne Trost – fast ohne Hoffnung. Es war nicht ihr geringstes Leiden, daß sie Paris hatte verlassen müssen, ohne von ihrem einzigen Sohne Abschied zu nehmen, der sich bei seinem Regiment in Deutschland befand; ja, man hatte sie so eilig fortgetrieben, daß sie nicht einmal Zeit gehabt hätte, ihn von ihrer Abreise und der unglücklichen Veränderung der Lage seines Vaters zu benachrichtigen, wenn sie gewußt hätte, wo er im Quartier lag.
Pierre de la Motte stammte aus einem alten adeligen Geschlecht in Frankreich. Er war ein Mann, dessen Leidenschaften oft seine Vernunft überwältigten, und auf eine Zeitlang sein Gewissen betäubten; doch erlosch das Bild der Tugend, welches die Natur seinem Herzen eingeprägt hatte, nie ganz, wenngleich der vorübergehende Reiz des Lasters es gelegentlich verdunkelte. Mit etwas mehr Seelenstärke, um der Versuchung zu widerstehen, würde er ein achtbarer Mensch gewesen sein; so war er stets ein schwaches, und oft ein lasterhaftes Mitglied der Gesellschaft. Doch sein Geist war tätig und seine Phantasie lebhaft, was, von der Gewalt der Leidenschaft unterstützt, oft sein Urteil verblendete, und seine Grundsätze umwarf. Unstet in seinen Zielen, ohne festen Begriff von Tugend: mit einem Wort, seine Handlungen wurden mehr durch Gefühle, als durch Grundsätze bestimmt, und seine Tugend – so wie sie war – vermochte nie dem Druck der Gelegenheit zu widerstehen.
Er hatte sich in jungen Jahren mit Constance Valentia vermählt, einem liebreizenden Mädchen, das an ihrer Familie hing, und von ihr zärtlich geliebt wurde. Ihre Geburt war der seinigen gleich, ihr Vermögen größer, und ihre Verbindung wurde unter der Schirmherrschaft einer beifälligen und schmeichelnden Welt gefeiert. Ihr Herz hing an La Motte, in welchem sie eine Zeitlang einen liebevollen Gemahl fand; bald aber rissen die verführerischen Verlockungen von Paris ihn hin, und nach wenigen Jahren waren sein Vermögen und seine Liebe gleichermaßen im Strudel der Zerstreuungen verlorengegangen. Ein falscher Stolz hielt ihn davon ab, seinem Besten gemäß zu handeln und verhinderte einen ehrenvollen Rückzug, solange es noch in seiner Macht war. Seine angenommenen Gewohnheiten ketteten ihn an den Ort seiner bisherigen Vergnügungen, und er lebte auf großem Fuße fort, bis alle Mittel erschöpft waren. Endlich erwachte er aus seiner Betäubung, aber nur, um sich in neue Verirrungen zu stürzen, und Pläne zur Wiederherstellung seiner Finanzen zu versuchen, die ihn nur noch tiefer ins Verderben stürzten. Die Folgen eines Geschäftes, in welches er sich verwickelt hatte, trieben ihn jetzt mit dem kleinen Rest seines gescheiterten Vermögens in ein gefährliches und schmachvolles Exil.
Es war seine Absicht, in eine der südlichen Provinzen zu gehen, und an den Grenzen des Königreichs in einem entlegenen Dorfe eine Zuflucht zu suchen. Seine Familie bestand aus seiner Frau und zwei treuen Bediensteten, einem Mann und einer Frau, welche dem Schicksal ihrer Herrschaft folgten.
Die Nacht war dunkel und stürmisch, und etwa anderthalb Meilen von Paris, nachdem sie einige Zeit gefahren waren, hielt Peter, der die Stelle des Kutschers vertrat, auf einer wilden Heide, wo mehrere Wege sich kreuzten, an und sagte zu La Motte, daß er nicht wüßte, welchen Weg er einschlagen sollte. Der plötzliche Stillstand des Wagens weckte den letzteren aus seiner Versunkenheit, und erfüllte die ganze Gesellschaft mit Furcht vor Verfolgern. Er war nicht in der Lage, die notwendige Richtung zu weisen, und die tiefe Finsternis machte es gefährlich, ohne weiterzufahren. In dieser Angst sahen sie in einer Entfernung Licht, und nach vielem Zweifeln und Zaudern stieg La Motte aus und ging, in der Hoffnung, Hilfe zu erhalten, darauf zu. Er ging langsam vorwärts, weil er unbekannte Erdlöcher fürchtete. Das Licht ging von dem Fenster eines kleinen alten Hauses aus, das eine Viertelstunde von ihnen entfernt einsam auf der Heide stand.
Nachdem er die Türe erreicht hatte, blieb er einige Augenblicke stehen und lauschte ängstlich – er hörte kein Geräusch als das des Windes, der in hohlen Böen über die Einöde strich. Endlich wagte er anzuklopfen. und nachdem er eine Zeitlang gewartet hatte, während er undeutlich verschiedene Stimmen sich bereden hörte, erkundigte sich jemand, was er wollte? La Motte antwortete, er sei ein Reisender, der sich verirrt hätte, und gern den Weg nach der nächsten Stadt wüßte.
„Die liegt über drei Meilen von hier,“ sagte der Mann, „und der Weg ist äußerst schlecht, selbst wenn Sie ihn sehen könnten. Wenn Sie nichts weiter als ein Bett verlangen, so steht es Ihnen zu Diensten, und sie täten besser daran, hierzubleiben.“
Der heftige Sturmwind, der immer wütender auf La Motte eindrang, machte ihn dazu geneigt, den Versuch aufzugeben, vor Tagesanbruch weiterzufahren; indessen wünschte er doch den Mann, mit dem er sprach, zu sehen, ehe er seine Familie aus der Kutsche rief, und bat darum, eingelassen zu werden. Eine lange, hagere Gestalt mit einem Licht in der Hand öffnete die Türe und bat ihn herein. Er folgte dem Mann durch einen Gang in ein fast unmöbliertes Zimmer, wo in einer Ecke ein Bett auf der Erde ausgebreitet lag. Das öde, verfallene Aussehen dieses Gemachs erregte in La Motte einen unwillkürlichen Schauder, und er war im Begriff, wieder herauszugehen. als der Mann ihn zurückstieß und die Türe hinter sich verriegelte. Der Mut verließ ihn. doch machte er einen verzweifelten, obgleich vergeblichen Versuch, die Türe zu sprengen und rief laut um Hilfe. Er erhielt keine Antwort, hörte aber über sich Stimmen von Männern; und da er nicht daran zweifelte, daß sie sich über seine Beraubung und Ermordung berieten, überwältigte seine Angst beinahe alle Vernunft. Bei dem Schimmer des beinahe erloschenen Feuers bemerkte er ein Fenster, aber die Hoffnung, welche jetzt in ihm auflebte, verschwand sogleich, als er es mit starken eisernen Stäben verwahrt fand. Solche Vorkehrungen zur Sicherheit machten ihn bestürzt, und bestärkten seinen Verdacht. Allein, unbewaffnet, ohne auf Hilfe rechnen zu dürfen, sah er sich in der Gewalt von Menschen, deren Handwerk wahrscheinlich in Rauben und Morden bestand!
Nachdem er fruchtlos alle Möglichkeiten, zu entweichen, durchdacht hatte, bemühte er sich, das Geschehen mit Standhaftigkeit zu erwarten; aber La Motte konnte sich keiner solchen Tugend rühmen. Die Stimmen waren verstummt und eine Viertelstunde lang blieb alles still, bis er zwischen den Pausen des Windes das Schluchzen und Seufzen einer Frau zu vernehmen glaubte. Er horchte aufmerksam, und wurde in seiner Vermutung bestätigt: es waren nur zu deutlich Töne der Not. Bei dieser Gewißheit verließ ihn jedes Fünkchen übriggebliebenen Mutes, und ein schrecklicher Gedanke flog blitzschnell durch seinen Sinn. Es war wahrscheinlich, daß die Leute im Hause seine Kutsche entdeckt, sich des Dieners bemächtigt und Madame de la Motte hierher geschleppt hatten, um ungestört plündern zu können. Er schloß dies umso mehr aus der Stille, die eine Weile vor diesen Tönen im Hause herrschte. Oder vielleicht waren diese Menschen nicht Räuber, sondern Personen, an die sein Freund oder Diener ihn verraten, und die man bevollmächtigt hatte, ihn der Justiz auszuliefern. Doch wagte er kaum, die Redlichkeit seines Freundes anzuzweifeln, dem er das Geheimnis seiner Flucht und den Plan seiner Reise anvertraut, und der ihm den Wagen, worin er entfloh, verschafft hatte. „Nein, solche Niederträchtigkeit,“ rief La Motte, „kann sicherlich nicht in der menschlichen Natur, am wenigsten in Nemours‘ Herzen wohnen!“
Ein Geräusch im Gang zu seinem Zimmer unterbrach seinen Ausruf – es kam näher, die Türe wurde geöffnet, und der Mann, der La Motte eingelassen hatte, führte, oder schleppte vielmehr ein schönes Mädchen herein, das etwa achtzehn Jahre alt zu sein schien. Ihr Gesicht schwamm in Tränen, und sie schien unter äußerster Not zu leiden. Der Mann schloß die Türe ab und steckte den Schlüssel in die Tasche.
Dann ging er auf La Motte zu, der zuvor andere Leute in dem Gange bemerkt hatte, und setzte ihm eine Pistole auf die Brust: „Sie sind gänzlich in unserer Gewalt,“ sagte er, „keine Hilfe kann Sie erreichen. Wenn Sie Ihr Leben zu retten wünschen, so schwören Sie, dieses Mädchen an einen Ort zu bringen, wo sie mir nie wieder zu Gesicht kommen kann; oder stimmen Sie vielmehr zu, sie mit sich zu nehmen, denn Ihrem Eid würde ich nicht trauen, wohl aber kann ich dafür sorgen, daß Sie mich nie wieder finden. Antworten Sie geschwind, Sie haben keine Zeit zu verlieren.“
Er ergriff jetzt die zitternde Hand des Mädchens, das totenbleich vor Schrecken zurückbebte, und schob sie La Motte zu, dessen Erstaunen ihm die Sprache raubte. Sie fiel ihm zu Füßen, und flehte mit Augen, die in Tränen schwammen, um sein Mitleid. Bei aller seiner Erschütterung war es ihm doch unmöglich, die Schönheit und Not der Person, die vor ihm lag, mit Gleichgültigkeit zu betrachten. Ihre Jugend, ihre offenbare Unschuld, der ungekünstelte Ausdruck ihres Betragens, drang ihm an das Herz, und er wollte sprechen, als der Kerl, der sein verwundertes Schweigen für Unschlüssigkeit hielt, ihm zuvorkam. „Ich habe ein Pferd bereit, Sie fortzuschaffen,“ sagte er, „und will Sie selbst über die Heide bringen. Kommen Sie binnen einer Stunde zurück, so finden Sie den Tod; nach dieser Zeit aber steht es Ihnen frei, wieder hierherzukommen wenn Sie wollen.“
La Motte hob ohne zu antworten, das liebliche Mädchen vom Boden auf, und fühlte sich von seiner eigenen Besorgnis so sehr erleichtert, daß er sich bemüßigte, die ihrige zu stillen.
„Lassen Sie uns gehen,“ sagte der Mann, „und lassen Sie dieses Gewäsch. Sie können von Glück reden, daß Sie noch so davonkommen. Ich will gehen und das Pferd satteln.“
Diese letzten Worte schreckten La Motte auf und bestürzten ihn mit neuen Ängsten. Er fürchtete, seine Kutsche zu erwähnen, um nicht die Räuber zum Plündern zu reizen; und mit diesem Menschen fortzureiten, konnte noch schlimmere Folgen nach sich ziehen. Es ließ sich vermuten, daß Madame de la Motte aus Angst und Ungeduld nach Ihrem Gemahl zum Haus schicken lassen würde, wodurch dieselbe Gefahr entstehen würde. Und er müßte dann das zusätzliche Übel empfinden, sich von seiner Familie getrennt und der Gefahr ausgesetzt zu sehen, den Justizoffizieren in die Hände zu fallen, während er versuchte, sie wiederzuerlangen. Während diese Betrachtungen in stürmischer Schnelligkeit vor seinem Verstand vorüberzogen, hörte er ein neues Geräusch im Gang: es erfolgte ein Tumult und Handgemenge, und im selben Augenblicke erkannte er die Stimme seines Dieners, den Madame de la Motte ihm nachgeschickt hatte. Entschlossen, nunmehr zu enthüllen, was sich nicht länger verhehlen ließ, rief er laut, daß kein Pferd nötig sei, weil sein Wagen nicht weit von hier hielte und sie über die Heide bringen würde, und daß der Mann, dessen sie sich bemächtigt hätten, sein Diener wäre.
Der Kerl rief ihm durch die Türe zu, er möchte sich nur noch einen Augenblick gedulden, bald sollte er mehr von ihm hören. La Motte richtete nun seinen Blick auf seine unglückliche Gefährtin, die sich bleich und kraftlos an die Mauer lehnte. Ihre Züge von zartester Schönheit, hatten durch die Bedrängnis einen Ausdruck hinreißender Süße bekommen. Sie hatte
Augen,
Als wenn der blaue Himmel zitterte
Durch eine Wolke aus reinstem Weiß.
William Scott
Ein Gewand aus grauem Mohair mit kurzen geschlitzten Ärmeln zeigte ihren Wuchs, obgleich es sie nicht schmückte: es war vorn aufgerissen, und ein Teil ihrer Haare fiel unordentlich auf ihre Brust herab, während der dünne, eilends übergeworfene Schleier in ihrer Verwirrung nicht zurückgeschlagen war. Mit jedem Augenblicke, wo er sie betrachtete, erhöhte sich La Mottes Erstaunen und vermehrte sich sein warmes Interesse an ihr. Solche Schönheit und Eleganz im Kontrast mit der Trostlosigkeit des Hauses und den rohen Sitten seiner Bewohner schien ihm mehr wie ein Ausbund der Phantasie, als ein Ereignis aus dem wirklichen Leben. Er bemühte sich, sie zu trösten, und sein Mitleid war zu aufrichtig, um mißverstanden zu werden. Ihre Furcht löste sich allmählich in Dankbarkeit und Trauer auf. „Ach, mein Herr,“ sagte sie, „der Himmel hat Sie mir zur Rettung gesandt, und gewiß wird er Sie für Ihren Schutz belohnen. Ich habe keinen Freund in der Welt, wenn ich nicht in Ihnen einen finde.“
La Motte versicherte sie seines warmen Anteils, als er durch den Eintritt des Mannes unterbrochen wurde. Er verlangte zu seiner Familie gebracht zu werden.
„Alles zu seiner Zeit,“ erwiderte der letztere. „Ich habe für eine Person davon gesorgt, und werde es auch für Sie, so St. Peter es will. Seien Sie also getrost.“ Diese beruhigenden Worte erneuerten La Mottes Furcht, der nun inständig flehte, ihm zu sagen, ob seine Familie in Sicherheit wäre. „Oh! Was das betrifft, sicher genug, und Sie werden sogleich bei ihr sein, aber bringen Sie nicht die ganze Nacht mit Schwatzen zu. Erklären Sie sich, ob Sie gehen oder bleiben wollen, Sie kennen die Bedingungen.“ Sie verbanden nun La Motte und der jungen Dame, welche die Angst stumm machte, die Augen, setzten sie auf zwei Pferde, ein Mann hinter jedem, und sprengten sogleich im Galopp davon. Sie waren beinahe eine halbe Stunde auf diese Weise fortgeritten, als La Motte zu wissen verlangte, wohin es ginge. „Das werden Sie schon noch erfahren,“ hieß es, „seien Sie also friedlich!“
Da La Motte alles Fragen unnütz fand, schwieg er, bis die Pferde stehenblieben. Sein Führer rief: „Hallo!“, und nachdem in einiger Entfernung Stimmen geantwortet hatten, war nach wenigen Augenblicken das Rasseln von Wagenrädern zu hören, und gleich darauf die Stimme eines Mannes, der Peter anwies, welchen Weg er fahren sollte. Als der Wagen näherkam, rief La Motte, und erhielt, zu seiner unaussprechlichen Freude, Antwort von seiner Frau.
„Nun sind Sie über die Grenze der Heide, und können fahren, wohin Sie wollen,“ sagte der Mann; „wenn Sie binnen einer Stunde zurückkehren, werden Sie mit ein paar Kugeln begrüßt werden.“
Diese Warnung war höchst überflüssig für La Motte, den sie jetzt losbanden. Die junge Fremde seufzte tief, als sie in den Wagen stieg, und der Kerl, nachdem er Peter noch einige Anweisungen gegeben und noch mehr Drohungen ausgestoßen hatte, wartete, um ihn abfahren zu sehen. Man ließ sie nicht lange warten.
La Motte gab nun eine kurze Zusammenfassung dessen, was in dem Hause vorgefallen war, einschließlich eines Berichts, auf welche Weise man ihm die junge Fremde vorgestellt hatte. Während dieser Erzählung erregte ihr tiefes krampfhaftes Schluchzen immer wieder die Aufmerksamkeit seiner Frau, die sich nach und nach zum Mitleid gegen sie gestimmt fühlte, und sie zu beruhigen versuchte. Das unglückliche Mädchen beantwortete ihre Freundlichkeit mit aufrichtigen, einfachen Ausdrücken, und versank dann wieder in Tränen und Schweigen. Madame de la Motte verbot sich vorerst alle weiteren Fragen, die zur Entdeckung ihrer Bekanntschaften leiten, oder eine Erläuterung der letzten Begebenheit fordern konnten, welche ihren Gedanken einen neuen Gegenstand darbot, wodurch das Gefühl ihres eigenen Unglücks weniger stark auf ihre Seele drückte. Selbst La Mottes Kummer verschwand auf eine Weile. Er dachte über den letzten Vorfall nach, der ihm wie ein Traumgesicht vorkam, oder wie eine von den unwahrscheinlichen Dichtungen, wie sie manchmal in einem Roman dargestellt werden. Er konnte keine Wahrscheinlichkeit hineinbringen, noch ihn auf irgendeine Weise erklären. Die gegenwärtige Last, die man ihm aufgebürdet hatte, und die Gefahr der Unannehmlichkeiten, die ihm noch in Zukunft daraus erwachsen konnten, verursachten ihm einige Unzufriedenheit, doch wirkte Adelines Schönheit und ihre sichtliche Unschuld, zusammen mit den Regungen der Menschlichkeit, zu ihren Gunsten, und er beschloß, sie zu beschützen.
Der Aufruhr in Adelines Brust begann endlich sich zu legen. Schrecken milderte sich in Ängstlichkeit, und Verzweiflung in Kummer. Die sichtliche Teilnahme ihrer Gefährten, besonders von Madame de la Motte, tat ihrem Herzen wohl, und ermutigte sie, auf bessere Tage zu hoffen.
Düster und schweigend verstrich die Nacht, denn die Seelen der Reisenden waren zu sehr beschäftigt mit ihrem mancherlei Kummer, um Unterhaltung zuzulassen. Der so ängstlich ersehnte Morgen brach endlich an, und machte die Fremden einander näher bekannt. Adeline schöpfte Trost aus den Blicken der Madame de la Motte, die sie oft und aufmerksam ansah und dachte, selten ein so einnehmendes Gesicht, eine so schöne Figur gesehen zu haben. Das Schmachten des Kummers warf einen schwermütigen Reiz über ihre Züge, der unmittelbar zum Herzen drang, und aus ihrem blauen Augen sprach eine süße Reinheit, die einen klugen und liebenswürdigen Geist verriet.
La Motte sah nun ängstlich aus dem Kutschenfenster, um über ihre Lage zu urteilen und zu sehen, ob man ihn verfolgte. Die Dämmerung beschränkte seine Aussicht, aber er erblickte niemanden. Die Sonne färbte endlich die östlichen Wolken und die Gipfel der höchsten Berge, und stand bald darauf in vollem Glanze da. La Mottes Furcht ließ nach und Adelines Kummer milderte sich. Sie kamen auf einen Weg, den hohe Wälle begrenzten und der von Bäumen überschattet wurde, an deren Zweigen der Morgentau die ersten grünen Knospen des Frühlings beglänzte. Die frische Morgenluft belebte Adeline, deren Gefühl für alle Schönheiten der Natur aufs zarteste geöffnet war. Indem sie die blühende Üppigkeit der Wiese und das sanfte Grün der Bäume betrachtete, oder einen Blick auf die zwischen den sich öffnenden Wällen durchschimmernde abwechslungsreiche Landschaft erhaschen konnte, deren dichte Wälder in fernen blauen Gebirgen verschwanden, klopfte ihr Herz von aufwallender Freude. Neuheit erhöhte bei Adeline den Reiz der Natur; sie hatte selten die Größe einer weiten Aussicht, die Pracht eines ausgedehnten Horizonts – und nicht oft die malerischen Schönheiten einer unbegrenzten Landschaft gesehen. Ihre Seele hatte durch lange Bedrückung die elastische Kraft nicht verloren, welche dem Ungemach widersteht; sonst hätten sie, so empfänglich ihr Geschmack auch ursprünglich gewesen sein mag, die Schönheiten der Natur nicht mehr so leicht in, auch nur vorübergehender, Ruhe gewiegt.
Der Weg wand sich schließlich einen Hügel hinab, und La Motte, der wieder ängstlich aus dem Fenster sah, erblickte ein offenes Feld, durch welches sich der Weg, der von der Beobachtung gänzlich ungeschützt war, in fast gerader Linie erstreckte. Die Gefahr beunruhigte ihn, denn seine Flucht konnte ohne Mühe viele Meilen weit von den Bergen, die er jetzt hinabfuhr, verfolgt werden. Er erkundigte sich bei dem ersten Bauern, der ihnen begegnete, nach einem Wege zwischen den Bergen hin, hörte aber von keinem. La Motte versank nun wieder in seine vorige Angst. Madame bemühte sich, ungeachtet ihrer eigenen Befürchtungen, ihn aufzurichten, da sie aber ihre Bemühungen unwirksam fand, überließ sie sich ebenfalls der Betrachtung ihres Unglücks. Während sie weiterfuhren, sah La Motte oft nach der verlassenen Gegend zurück, und oft wähnte er, entfernte Verfolger zu hören.
Die Reisenden hielten an, um in einem Dorfe zu frühstücken, wo endlich Bäume den Weg überschatteten, und La Mottes Mut lebte wieder auf. Adeline schien nun ruhiger zu sein, und La Motte bat sie um eine Erläuterung der Szene, derer er in der vergangenen Nacht Zeuge gewesen war. Diese Frage erneuerte all ihren Schmerz, und sie bat ihn unter Tränen, sie vorerst mit allen Fragen über die Sache zu verschonen. La Motte bedrängte sie nicht weiter, bemerkte aber, daß sie fast den ganzen übrigen Tag in schwermütigem Nachdenken zubrachte. Sie fuhren jetzt zwischen den Hügeln, und waren folglich weniger in Gefahr, beobachtet zu werden; doch vermied La Motte sorgfältig alle großen Städte, und hielt nur so lange, als nötig war, um die Pferde zu erfrischen, in abgelegenen Dörfern. Zwei Stunden nach Mittag wand sich der Weg durch ein tiefes Tal, das von einem Bach durchflossen, und von Bäumen überschattet wurde. La Motte hieß Peter nach einem dicht bewachsenen Orte zu fahren, der zur Linken lag. Hier stieg er mit seiner Familie aus, und nachdem Peter ihren Mundvorrat auf dem Rasen ausgebreitet hatte, setzten sie sich und genossen ein Mahl, das unter anderen Umständen gewiß köstlich gewesen wäre. Adeline zwang sich zu lächeln, aber ihre kummervolle Mattigkeit wurde jetzt durch Unpäßlichkeit erhöht. Die heftige Seelenerschütterung und die körperliche Ermüdung, die sie in den letzten vierundzwanzig Stunden erlitten hatte, hatten ihre Kräfte erschöpft, und als La Motte sie wieder zum Wagen führte, zitterte sie am ganzen Körper vor Schwäche. Aber sie äußerte keine Klage, sondern bemühte sich vielmehr, soviel sie konnte, die Niedergeschlagenheit ihrer Reisegefährten zu zerstreuen.
Sie setzten die Reise den ganzen Tag über ohne Unfall oder Unterbrechung fort, und kamen ungefähr drei Stunden nach Sonnenuntergang in Monville an, einer kleinen Stadt, wo La Motte entschied, die Nacht zu verbringen. Ruhe war in der Tat der ganzen Gesellschaft notwendig, deren blasses und verhärmtes Aussehen, wie sie aus dem Wagen stiegen, nur zu offensichtlich war, um der Beobachtung der Wirtsleute zu entgehen. Sobald die Betten bereit waren, begab sich Adeline in ihre Kammer, wohin Madame de la Motte sie begleitete, welche aus Sorge um die schöne Fremde alle Anstrengungen unternahm, um sie zu beruhigen und zu trösten. Adeline weinte still und ergriff Madames Hand, um sie an ihren Busen zu drücken. Dies waren nicht bloß Tränen des Kummers – sie waren vermischt mit denen, welche aus dem dankbaren Herzen fließen, wenn es unerwartete Teilnahme findet. Madame de la Motte verstand sie. Nach einigen Augenblicken des Schweigens wiederholte sie ihre gütigen Zusicherungen und bat Adeline, ihrer Freundschaft zu vertrauen, doch sie vermied sorgfältig den Gegenstand zu berühren, der sie zuvor so sehr erschüttert hatte. Adeline fand endlich Worte, ihr Gefühl für diese Güte auszudrücken, und tat es auf so offene natürliche Art, daß Madame de la Motte ihr innigst gerührt gute Nacht sagte.
Ungeduldig, seine Reise fortzusetzen, stand La Motte am nächsten Morgen in aller Frühe auf. Alles war für seine Abreise vorbereitet, und das Frühstück hatte schon eine Weile gestanden, aber Adeline ließ sich nicht sehen. Madame de la Motte ging in ihr Zimmer und fand sie in unruhigem Schlummer. Ihr Atem war kurz und ungleichmäßig, sie fuhr oftmals auf oder seufzte, und manchmal stammelte sie unzusammenhängende Worte. Während Madame mit Besorgnis ihre matten Züge betrachtete, erwachte sie, sah auf, und reichte ihr die Hand, die von Fieberhitze brannte. Sie hatte eine unruhige Nacht gehabt, und als sie aufstehen wollte, schwindelte ihr Kopf, der unerträglich schmerzte, ihre Kräfte verließen sie, und sie sank zurück.
Madame war sehr beunruhigt; sie sah zugleich, daß es für Adeline unmöglich war, weiterzureisen, und daß eine Verzögerung verhängnisvoll für ihren Mann sein konnte. Sie ging zu ihm, und sein Unmut läßt sich besser denken als beschreiben. Er sah alle Unannehmlichkeit und Gefahr einer Verzögerung, und doch konnte er sich nicht so ganz von aller Menschlichkeit entblößen, Adeline der Pflege, oder vielmehr der Vernachlässigung, von Fremden zu überlassen. Er ließ sogleich einen Arzt holen, welcher erklärte, daß sie ein heftiges Fieber hätte, und ohne äußerste Gefahr nicht von der Stelle bewegt werden könnte. La Motte entschloß sich nunmehr, den Ausgang abzuwarten, und versuchte die Regungen der Angst zu unterdrücken, die ihn nur zu oft befielen. Indessen beachtete er alle Vorsichtsmaßregeln, die seine Lage zuließ, und brachte den größten Teil des Tages außerhalb des Dorfes an einem Orte zu, von wo aus er den Weg bis in einige Entfernung überblicken konnte. Durch die Krankheit eines Mädchens, das er nicht kannte, das ihm vielmehr aufgedrängt worden war, sich der höchsten Gefahr aussetzen zu müssen, war ein Unglück, welches mit Fassung zu ertragen, La Motte nicht Philosophie genug besaß.
Adelines Fieber stieg den ganzen Tag über, und abends, als der Arzt sich verabschiedete, sagte er zu La Motte, der Ausgang müßte sich bald entscheiden. La Motte hörte diese Nachricht mit echter Bekümmernis an. Adelines Schönheit und Unschuld hatten über die ungünstigen Umstände, welche sie ihm zuführten, gesiegt und er beschäftigte sich jetzt weniger mit der Last, die sie ihm in der Folge verursachen konnte, als mit der Hoffnung auf ihre Genesung.
Madame de la Motte wachte mit zärtlicher Sorge über sie, und sah mit Bewunderung ihr stilles Dulden und ihre sanfte Ergebung. Adeline belohnte sie reichlich, so unvermögend sie sich auch glaubte. „So jung ich auch bin,“ sagte sie, „und verlassen von denjenigen, auf deren Schutz ich berechtigt wäre, weiß ich doch keine Bekanntschaft, die mir das Leben so wünschenswert macht, als die, welche ich mit Ihnen zu knüpfen hoffe. Wenn ich genese, so wird mein Verhalten am besten von meiner Dankbarkeit für Ihre Güte zeugen. Worte sind nur schwache Beweise.“
Ihr sanftes Wesen nahm Madame de la Motte so sehr ein, daß sie die Krisis ihrer Krankheit mit einer Ängstlichkeit erwartete, welche alle anderen Angelegenheiten ausschloß. Adeline brachte eine sehr unruhige Nacht zu, und als der Arzt am nächsten Morgen erschien, erlaubte er, ihr alles zu geben, was sie nur verlangte, und beantwortete La Mottes Fragen mit einer Offenheit, die ihm nichts zu hoffen übrig ließ.
Indessen fiel seine Patientin, nachdem sie reichlich kühlende Tränke zu sich genommen hatte, in einen Schlaf, der mehrere Stunden anhielt, und so fest war, daß der Atem allein ihr Leben verriet. Sie erwachte frei von Fieber, und ohne alle Krankheit, außer einer Schwäche, die sie aber nach wenigen Tagen so gut überstanden hatte, daß sie mit La Motte nach B – fahren konnte, einem Dorfe, das außerhalb der Landstraße lag, die er zu verlassen für ratsam hielt. Dort verbrachten sie die Nacht, und setzten des Morgens in aller Frühe ihre Reise durch einen wüsten, waldigen Landesstrich fort. Gegen Mittag hielten sie in einem einsamen Dorfe, wo sie sich stärkten und sich Anweisungen geben ließen, um den großen Wald von Fontanville zu passieren, an dessen Grenzen sie sich jetzt befanden. La Motte wollte anfangs einen Führer nehmen, aber er fürchtete mehr Nachteil von der Entdeckung seines Weges, als er sich Nutzen von einem Geleitsmann in den Wildnissen dieses unbebauten Erdstrichs versprach.
La Motte gedachte nun nach Lyon zu gehen, wo er sich entweder in der Nachbarschaft verbergen, oder die Rhône hinauf nach Genf fahren wollte, wenn die Notlage seiner Verhältnisse es in der Folge erfordern sollte, Frankreich zu verlassen. Es war ungefähr zwölf Uhr mittags und er war begierig, vorwärtszukommen, um den Wald von Fontanville und die Stadt jenseits zu erreichen, bevor die Nacht heranbrach. Nachdem sie sich mit frischem Proviant versehen und die nötigen Richtungsanweisungen eingezogen hatten, die für die Straßen notwendig waren, machten sie sich wieder auf und gelangten bald in den Wald. Es war nun Ende April, und das Wetter ungewöhnlich schön. Die balsamische Frische der Luft, vom ersten reinen Duft der Kräuter erfüllt, und die milde Wärme der Sonne, deren Strahlen jeden Hauch der Natur belebten und jede Blüte des Frühlings öffneten, flößten Adeline neues Leben und Gesundheit ein. Mit der Luft, die sie einatmete, schienen ihre Kräfte wiederzukehren, und als ihre Augen auf den romantischen Lichtungen verweilten, welchen der Wald sich öffnete, füllte ihr Herz sich mit freudigem Entzücken; doch wenn sie ihren Blick von diesen Gegenständen ab, und Monsieur und Madame de la Motte zuwandte, deren zärtlicher Sorgfalt sie ihr Leben verdankte, und auf deren Blicken sie jetzt Wohlwollen und Freundlichkeit las, so glühte ihre Brust von süßen Regungen, und sie empfand eine Kraft der Dankbarkeit, die man erhaben nennen könnte.
Sie reisten den Tag über fort, ohne eine Hütte, oder nur ein menschliches Wesen zu sehen. Es war nahe vor Sonnenuntergang, der Wald schloß von allen Seiten die Aussicht ein, und La Motte begann zu fürchten, daß sein Diener den Weg verfehlt hätte. Der Weg, wenn man eine leichte Spur auf dem Grase überhaupt so nennen konnte, war mal von üppiger Vegetation überwuchert, mal von tiefen Schatten verdunkelt, und Peter hielt schließlich an, weil er des Weges ungewiß war. La Motte, der sich davor scheute, in einer so wilden und einsamen Gegend wie diesem Wald von der Nacht überfallen zu werden, und der sich sehr lebhaft vor Räubern fürchtete, befahl ihm, um jeden Preis weiterzufahren, und wenn er keine Spur fände, einen offeneren Teil des Waldes zu suchen. Mit diesem Befehl fuhr Peter wieder an, nachdem er aber eine Strecke zurückgelegt hatte, und sich noch immer von Waldlichtungen und schmalen Pfaden im Walde eingeschlossen sah, begann er daran zu zweifeln, daß er sich selbst befreien könnte und hielt an, um weitere Anweisungen zu erwarten. Die Sonne war jetzt untergegangen, aber als La Motte ängstlich aus dem Fenster sah, erblickte er bei dem hellen Schimmer des westlichen Horizonts einige dunkle Türme in kleiner Entfernung zwischen den Bäumen emporragen, und befahl Peter, darauf zuzufahren.
„Wenn sie zu einem Kloster gehören,“ sagte er, „können wir wahrscheinlich Aufnahme für die Nacht erhalten.“
Die Kutsche fuhr unter dem Schatten trübe herabhängenden Geästes dahin, durch welches die Abenddämmerung, welche noch die Luft färbte, eine Feierlichkeit verbreitete, die in den Herzen der Reisenden stillen Schauer erregte. Die Erwartung ließ sie schweigen. Die gegenwärtige Szene rief in Adeline die Erinnerung an die letzten schrecklichen Ereignisse wach, und ihre Seele nahm nur zu leicht die Ahnung neuen Unglücks an. La Motte stieg am Fuße eines grünen Hügels aus, wo die Bäume sich wieder dem Licht öffneten, und eine nähere, obgleich unvollkommene Sicht auf das Gebäude zuließen.
2. Kapitel.
Wie diese alten Türme und leeren Höfe
schrecken die entleibte Seele! Bis die Ahnung
Das Gesicht der Furcht trägt: und Furcht, halb bereit,
Hingabe zu werden, murmelt unbewußt
Eine Art geistlichen Gebetes.
Was für eine Art von Dasein ist dieser Zustand!
Horace Walpole, Mysterious Mother
ER ging näher heran und entdeckte die gotischen Überreste einer alten Abtei: sie stand auf einer Art Rasenfläche, die hohe Bäume beschatteten, welche ebenso alt wie das Gebäude zu sein schienen, und eine romantische Düsternis verbreiteten. Der größere Teil der Mauern schien in Ruinen zu verfallen, und die, welche der Zerstörung durch die Zeit widerstanden hatten, gaben den verfallenen Überresten ein noch schauerlicheres Aussehen. Die hohen Zinnen, dick von Efeu umschlungen, waren halb verwüstet und der Wohnsitz von Raubvögeln geworden. Gewaltige Fragmente des östlichen, fast ganz verfallenen Turmes lagen zerschmettert im hohen Grase, das langsam in der Brise wehte.
Die Distel schüttelte ihren einsamen Kopf, das Moos pfiff dem Wind entgegen.
Ossian, Carthon
Ein reich mit Schnitzereien verziertes gotisches Tor, das zum Hauptflügel des Gebäudes führte, jetzt aber mit Strauchwerk verwachsen war, war noch unversehrt. Über dem großen, prächtigen Portal dieses Tors stieg ein Fenster von derselben Bauart empor, dessen Spitzbögen noch Fragmente bemalten Glases enthielten, einst der Stolz mönchischer Hingabe. La Motte, der es für möglich hielt, daß sich noch ein menschliches Wesen hier aufhalten könnte, trat zum Tor und hob einen schweren Klopfer an. Der hohle Schall lief durch den leeren Platz. Er wartete einige Minuten und zwang dann das Tor zurück, das schwer mit Eisen beschlagen war und mit schrecklichem Getöse in seinen Angeln knarrte.
Er trat in einen Ort, der die Kapelle der Abtei gewesen zu sein schien, wo einst die Hymne der Andacht emporstieg, und die Träne der Buße vergossen wurde. Töne, welche nur die Phantasie wieder hervorrufen konnte – Tränen der Reue, die schon längst zum Schicksal wurden. La Motte hielt einen Augenblick inne; er fühlte einen gewissen Schauder, einen Zustand zwischen Staunen und Ehrfurcht! Er überblickte den weiten Raum, und indem er die verfallenen Ruinen betrachtete, trug die Phantasie ihn in verflossene Zeiten zurück.
„Und diese Mauern,“ sagte er, „in denen einstmals Aberglaube lauerte und Entbehrung ein irdisches Fegefeuer vorwegnahm, zittern jetzt über den Gebeinen der sterblichen Wesen, welche sie einst erbauten!“
Die zunehmende Dunkelheit erinnerte La Motte, daß er keine Zeit zu verlieren hatte, doch Neugier drängte ihn zur weiteren Erforschung und er gehorchte ihrem Antriebe. – Als er über das zerbrochene Pflaster ging, hallten seine Schritte durch das Gebäude wieder, und schienen gleich den mystischen Tönen der Toten dem frevelhaften Sterblichen Vorwürfe zu machen, der ihr Gebiet zu betreten wagte.
Aus dieser Kapelle trat er in das Hauptschiff der großen Kirche, in welcher ein Fenster, unbeschädigter als die übrigen, einen weiten Ausblick auf den Wald öffnete, und die reiche Färbung des Abends zeigte, die unmerklich in das erhabene Grau der höheren Luft hinwegschmolz. Dunkle Berge, deren Umrisse deutlich im lebhaften Schimmer des Horizonts hervorragten, schlossen die Aussicht. Mehrere Pfeiler, die einst die Decke unterstützten, standen noch als stolze Denkmäler sinkender Größe, und schienen bei jedem Windstoß zwischen den herabgefallenen Bruchstücken, die vor ihnen lagen, zu nicken. La Motte seufzte. Der Vergleich zwischen ihm und dem allmählichen Verfall, wovon diese Säulen zeugten, war nur zu offensichtlich und bewegend. „Noch wenige Jahre,“ sprach er, „und ich werde sein, wie die Sterblichen, auf deren Überreste ich jetzt blicke, und ich mag ebenso wie sie zum Stoff des Nachdenkens für eine künftige Generation dienen, die ebenfalls nur kurze Zeit über dem Gegenstande ihrer Betrachtung hinwanken wird, ehe auch sie in den Staub sinkt.“
Er riß sich von diesem Ort los, und ging durch die Kreuzgänge, bis eine Tür, die mit einem hohen Teile des Gebäudes zusammenhing, seine Neugierde anzog. Er öffnete sie und nahm, quer vor einer Treppe vorbei, noch eine Türe wahr; – aber teils durch Furcht, teils durch die Überlegung, wie sehr seine Abwesenheit seine Familie verwundern mußte, zurückgehalten, kehrte er mit hastigen Schritten zu seinem Wagen zurück, und warf sich vor, einige kostbare Augenblicke der Dämmerung unnütz verschwendet und keine Informationen gewonnen zu haben.
Einige kurze Antworten auf die Fragen seiner Frau, und ein allgemeiner Befehl an Peter, sorgsam weiterzufahren und sich nach einem Wege umzusehen war alles, was seine Ängstlichkeit ihm zu äußern erlaubte. Die Schatten der Nacht fielen dicht herab und machten es, durch die Dunkelheit des Waldes vertieft, bald gefährlich, den Weg weiter zu befahren. Peter hielt, doch La Motte, der fest auf seinem ersten Entschlusse beharrte, befahl ihm weiterzufahren. Peter wagte es, zu protestieren, Madame de la Motte bat, doch La Motte rügte, befahl – und bereute schließlich zu spät; denn das hintere Wagenrad ging über den Stumpf eines alten Baums, den Peter bei der Dunkelheit nicht hatte sehen können, und der Wagen fiel im selben Augenblick um.
Die Gesellschaft geriet, wie man sich denken kann, in äußersten Schrecken, doch es war niemand wesentlich verletzt, und sobald sie sich aus ihrer gefährlichen Lage befreit hatten, bemühten sich La Motte und Peter, den Wagen wieder aufzurichten. Jetzt erst sahen sie das ganze Ausmaß ihres Unglücks, denn das Wagenrad war gebrochen. Ihr Schrecken war verständlicherweise groß, denn die Kutsche konnte ebensowenig weiterfahren, als ihnen eine Zuflucht vor dem kalten Nachttau gewähren, weil es unmöglich war, sie in eine aufrechte Lage zu bringen. Nach einigen Augenblicken der Stille schlug La Motte vor, zu den Ruinen, von denen sie nicht weit entfernt waren, zurückzukehren, und die Nacht in dem bewohnbarsten Teile des Gebäudes zuzubringen. Sobald der Morgen anbräche, sollte Peter eines der Kutschpferde nehmen, und einen Weg und eine Stadt suchen, von wo aus Hilfe für die Reparatur des Wagens beschafft werden könnte. Madame de la Motte widersetzte sich diesem Vorschlag. Sie schauderte bei der Vorstellung, so viele Stunden im Finstern an einem so verlassenen Orte wie dem Kloster zuzubringen. Entsetzen, welches sie weder zu untersuchen noch zu bekämpfen sich Mühe gab, überwältigte sie, und sie sagte ihrem Manne, daß sie lieber über Nacht dem ungesunden Tau ausgesetzt bleiben, als sich den verlassenen Ruinen anvertrauen wollte. La Motte hatte anfangs die selbe Abneigung gefühlt, wieder dahin zurückzukehren; nachdem er aber seine eigenen Gefühle überwunden hatte, beschloß er, sich nicht denen seiner Frau zu ergeben.
Die Pferde wurden ausgespannt, und die Gesellschaft machte sich nach dem Gebäude auf. Peter, der ihnen folgte, schlug Feuer an, und sie betraten die Ruinen unter Erleuchtung von Ästen, die er zusammengesucht hatte. Der Schimmer, der nur auf einige Teile des Gebäudes fiel, schien die Verödung nur noch schauerlicher zu machen, während die Dunkelheit der größeren Teile des Gebäudes das Feierliche erhöhte, und die Phantasie mit Schrekkensbildern erfüllte. Adeline, die bis jetzt geschwiegen hatte, stieß einen Ausruf der Furcht und Bewunderung aus. Ein nicht unangenehmer Schauder erregte ihre Brust und füllte ihre Seele. Tränen traten in ihre Augen – sie wünschte und fürchtete weiterzugehen. Sie hing sich an La Mottes Arm und sah ihn mit einem unsicher fragenden Blicke an.
Er öffnete die Türe zum großen Saal und sie traten hinein: der weite Umfang verlor sich in der Dunkelheit. „Laßt uns hier bleiben,“ sagte Madame de la Motte, „ich mag nicht weitergehen.“ La Motte zeigte auf die eingefallene Decke und ging weiter, als ihn ein ungewöhnliches Geräusch neben ihm stutzig machte. Alle schwiegen – es war das Schweigen des Schreckens. Madame de la Motte sprach als erste: „Laßt uns diesen Ort verlassen; alles Ungemach ist der Empfindung, die mich hier niederdrückt, vorzuziehen. Laßt uns unverzüglich zurückgehen!“ Die Stille war eine Zeitlang ungestört geblieben, und La Motte, der sich seiner unwillkürlich verratenen Furcht schämte, hielt es jetzt für notwendig, einen Mut zu erkünsteln, den er nicht wirklich besaß. Er setzte daher der Angst seiner Frau Spott entgegen, und bestand darauf, weiterzugehen. Solcherart gezwungen, sich zu fügen, ging sie mit zitternden Schritten durch den Saal. Sie kamen an einen schmalen Durchgang, und da Peters Äste beinahe aufgebraucht waren, warteten sie hier, während er loszog, um mehr zu holen.
Das fast verlöschende Licht fiel schwach auf die Wände des Gangs und ließen die Winkel noch schrecklicher wirken. Mitten durch den Saal, dessen größere Hälfte im Schatten lag, verbreitete der schwache Strahl einen zitternden Schimmer, der die Lücke in der Decke zeigte, während viele unbekannte Gegenstände in der Dämmerung nur unvollkommen sichtbar waren. Adeline fragte La Motte lächelnd, ob er an Geister glaubte? Die Frage war etwas unzeitig, denn der jetzige Aufenthalt erfüllte ihn mit seinen Schrecknissen, und trotz aller Bemühung fühlte er, wie eine abergläubische Furcht sich in ihn stahl. Vielleicht stand er in diesem Augenblick auf der Asche der Toten. Wenn es jemals Geistern gestattet würde, die Erde wieder zu besuchen, so schien dies die Stunde und der Ort zu sein, der für ihre Erscheinung am besten geeignet war.
Da La Motte schwieg, sagte Adeline: „Wäre ich zum Aberglauben geneigt,“ – als die Wiederkehr des schon gehörten Geräusches sie unterbrach. Es ertönte entlang dem Gange, an dessen Eingang sie standen, und sank allmählich hinweg. Jedes Herz klopfte heftig, und sie horchten schweigend. Eine neue Besorgnis stieg in La Motte auf – dieses Geräusch konnte von Räubern herrühren, und er zögerte, ob es sicher wäre, weiterzugehen. Peter kam mit Licht; Madame weigerte sich, den Gang zu betreten; La Motte fühlte sich nicht sehr dazu geneigt; nur Peter, bei dem die Neugier stärker war als Furcht, bot bereitwillig seine Dienste an. La Motte ließ ihn, nach einigem Besinnen, gehen, und wartete am Eingang den Erfolg seiner Untersuchung ab. Das Ausmaß des Gangs entzog Peter bald seinem Blick, und der Wiederhall seiner Schritte verlor sich in einem Geräusch, das den Gang hinabtönte und immer schwächer und schwächer wurde, bis es sich zuletzt ganz verlor. La Motte rief Peter jetzt mit lauter Stimme, erhielt aber keine Antwort; endlich hörten sie in der Ferne einen Fußtritt, und bald darauf erschien Peter, atemlos, und bleich vor Entsetzen.
Sobald er nahe genug war, um von seinem Herrn gehört zu werden, rief er laut: „Einen Gefallen, Euer Gnaden, habe ich Ihnen getan, will ich meinen, aber es war ein harter Kampf. Es war nicht anders, als föchte ich mit dem Teufel.“
„Worüber sprichst du?“ fragte sein Herr.
„Am Ende war es nichts als Eulen und Krähen,“ fuhr Peter fort, „aber bei dem Licht flogen sie mir alle auf den Kopf, und machten ein so verteufeltes Spektakel mit ihren Flügeln, daß ich anfangs glaubte, ich hätte es mit einer Legion Teufel zu tun. Aber ich habe sie alle hinausgejagt, gnädiger Herr, und Sie haben nun nichts mehr zu befürchten.“
Den letzten Teil des Satzes, der einen Verdacht in Bezug auf seinen Mut zu enthalten schien, hätte La Motte entbehren können; um daher in einem gewissen Grade seinen Ruf wiederherzustellen, entschied er nun, durch den Gang zu gehen. Sie gingen jetzt mit schnellen Schritten voran, denn, wie Peter sagte, hatten sie „nichts zu befürchten.“
Der Gang führte auf einen großen freien Platz, an dessen einer Seite, über eine Reihe Kreuzgänge hin, der westliche Turm und ein hoher Teil des Gebäudes hervorragten, die andere Seite lag zum Walde hin offen. La Motte nahm seinen Weg nach einer Türe des Turms, der, wie er jetzt wahrnahm, derselbe war, durch welchen er das erstemal hereingekommen war. Aber er fand es beschwerlich, weiter vorzudringen, weil der Platz mit Brombeersträuchern und Nesseln verwachsen war, und Peters Licht nur einen unsicheren Schein verbreitete. Als er die Türe öffnete, erneuerte der traurige Anblick des Orts Madame de la Mottes Ängste und nötigte Adeline zu fragen, wohin sie gingen. Peter hielt das Licht in die Höhe, um ihnen die schmale Treppe zu zeigen, die sich den Turm hinaufwand; doch La Motte, der die zweite Tür entdeckte, schob die verrosteten Riegel zurück, und trat in ein geräumiges Zimmer, das nach seiner Anlage und Verfassung offensichtlich weit später erbaut war, als der andere Teil des Gebäudes. Obgleich trostlos und verlassen, war es doch sehr wenig von der Zeit in Mitleidenschaft gezogen worden: die Mauern waren feucht, aber nicht verfallen, und die Scheiben noch fest in den Fenstern.
Sie gingen durch eine Reihe Zimmer, die dem ersten glichen, und bezeugten ihre Verwunderung über das gegensätzliche Aussehen dieses Gebäudeteils zu den vermodernden Mauern, die sie hinter sich gelassen hatten. Diese Wohnräume führten zu einem gewundenen Gang, der durch schmale, hoch in die Wand gehauene Hohlräume Licht und Luft empfing, und den endlich eine mit Eisen beschlagene Türe schloß. Diese öffneten sie mit Mühe und traten in einen Raum mit einer Gewölbedecke. La Motte betrachtete ihn mit forschendem Auge und bemühte sich dahinterzukommen, warum er durch eine so starke Türe verwahrt war. Doch er sah wenig darin, das seine Neugier hätte befriedigen können. Das Zimmer schien in neueren Zeiten nach einem gotischen Plan erbaut worden zu sein. Adeline näherte sich einem großen Fenster, das eine Art von Nische bildete, und um eine Stufe höher war als der übrige Fußboden. Sie teilte La Motte ihre Beobachtung mit, daß der ganze Fußboden mit Mosaikarbeit eingelegt war, welches ihn zu der Bemerkung veranlaßte, daß dieses Zimmer nicht ganz im gotischen Geschmack gebaut sei. Er ging zu einer Türe auf der anderen Seite des Zimmers, und nachdem er sie geöffnet hatte, fand er sich in dem großen Saal, durch den er hereingekommen war.
Er sah jetzt, was die Dunkelheit zuvor verborgen hatte, eine Wendeltreppe, die zu einer Galerie über ihnen führte, und nach ihrer Beschaffenheit zu urteilen, mit dem neueren Teil des Gebäudes zugleich erbaut worden war, obgleich dies ebenfalls den gotischen Architekturstil beeinträchtigte. La Motte bezweifelte nicht, daß diese Treppe zu Zimmern führte, die den unteren gleich wären und war unschlüssig, ob er sie erforschen sollte. Doch die Bitten seiner Frau, die sehr ermüdet war, bewogen ihn dazu, alle weiteren Untersuchungen zu verschieben. Nach einigem Beratschlagen, in welchem Zimmer sie die Nacht zubringen wollten, beschlossen sie, wieder in das zurückzukehren, welches sich zum Turm hin öffnete.
Sie machten ein Feuer in einem Kamin, der wahrscheinlich seit vielen Jahren keine gastfreundliche Wärme erteilt hatte; Peter stellte ihnen den aus der Kutsche geholten Vorrat hin, und La Motte und seine Familie lagerten sich um das Feuer und genossen ein Mahl, das Hunger und Müdigkeit ihnen würzten. Ihre Furcht verwandelte sich allmählich in Zuversicht, denn sie sahen sich nunmehr in einem Aufenthalt, der einer menschlichen Wohnung glich, und hatten Muße, über ihre ersten Befürchtungen zu lachen. Aber immer, wenn ein Windstoß die Türe erschütterte, fuhr Adeline auf und sah sich furchtsam um. Sie sprachen und scherzten eine Weile fort, doch war ihre Fröhlichkeit, wenn nicht erkünstelt, so doch zumindest bloß vorübergehend; denn das Bewußtsein ihrer unangenehmen, höchst bedenklichen Lage drängte sich zu mächtig auf und versenkte jeden in Mattigkeit und nachdenkliches Schweigen. Adeline fühlte ihren verlassenen Zustand mit aller Macht; sie gedachte verwundert der Vergangenheit, und erwartete ängstlich die Zukunft. Sie befand sich in völliger Abhängigkeit von Fremden, an welche sie keinen anderen Anspruch hatte, als was allgemeine Menschenliebe der Not verwandter Geschöpfe gibt. Seufzer hoben ihre Brust, und oft drängte sich eine Träne in ihr Auge; aber sie drängte sie zurück, ehe sie auf ihrer Wange die Traurigkeit verriet, welche zu zeigen ihr undankbar schien.
La Motte brach endlich dieses nachdenkliche Schweigen, und gab Befehl, das Feuer für die Nacht aufzulegen und die Türe zu sichern. Diese Vorsicht schien selbst in dieser Einöde notwendig und wurde durch große Steine, die man gegen die Türe auftürmte, bewirkt; andere Mittel zur Befestigung waren nicht vorhanden. La Motte kam oft der Gedanke, daß dieses scheinbar verlassene Gebäude ein Zufluchtsort von Räubern sein könnte. Sie fanden hier Einsamkeit, sich zu verbergen; und einen wilden, weit umfassenden Wald, der ihren räuberischen Absichten förderlich sein, und in seinen Irrwegen diejenigen verwirren konnte, die kühn genug waren, sie hierhin zu verfolgen. Doch er verbarg diese Gedanken, um seinen Gefährten keine neue Unruhe zu bereiten. Peter mußte an der Türe wachen, und nachdem sie das Feuer so gut wie möglich geschürt hatten, legte sich die verlassene Gesellschaft ringsumher, und suchte im Schlaf ein kurzes Vergessen ihrer Sorgen.
Die Nacht verstrich ohne Störungen. Adeline schlief, aber unruhige Träume schwebten vor ihrer Phantasie und sie erwachte zu einer frühen Stunde. Die Erinnerung an ihren Kummer bemächtigte sich ihrer, und indem sie sich ihrem Druck ergab, flossen ihre Tränen reichlich. Um ihnen ungestörten Lauf zu lassen, trat sie in ein Fenster, das sich auf eine Öffnung des Waldes öffnete. Alles war düster und still, und sie stand eine Weile da und betrachtete die beschattete Gegend.
Der erste zarte Hauch des Morgens schimmerte am Rande des Horizonts und brach durch die Dunkelheit – so rein, so schön und so ätherisch! Der Himmel schien sich dem Blick zu öffnen. Die trüben Nebel rollten nach Westen zu, als die Färbungen des Lichts sich verstärkten, verdunkelten jene Gegend der Hemisphäre und hüllten die tiefere Landschaft ein, während im Osten die Farben heller wurden und einen zitternden Schimmer ringsum verbreiteten, bis ein rötlicher Schein, der jene Gegend des Himmels befeuerte, die aufsteigende Sonne ankündigte. Zuerst ging ein kleiner Streif mit unbeschreiblichem Glanz aus dem Horizont hervor, der sich schnell verbreitete und die Sonne in aller Strahlenpracht zeigte, wie sie das ganze Antlitz der Natur entschleierte, jede Farbe der Landschaft belebte, und die betaute Erde mit glitzerndem Licht bestäubte. Der leise, sanfte Gesang der Vögel, durch die Morgenstrahlen geweckt, unterbrach jetzt das Schweigen der Stunde; ihr zartes Trillern stieg allmählich, bis sie den Chor allgemeiner Fröhlichkeit anstimmten. Auch Adelines Herz füllte sich mit Dankbarkeit und Liebe.
Die Szene vor ihr besänftigte ihren Kummer und trug ihre Gedanken empor zu dem großen Urheber der Schöpfung. Unwillkürlich sprach sie ein Gebet: „Vater des Guten, der du diese Pracht schufest! Ich ergebe mich in deine Hände, mögest du mir während meines gegenwärtigen Kummers helfen, und mich vor künftigem Übel schützen.“
So auf die Liebe Gottes vertrauend, trocknete sie die Tränen von ihren Augen, und der süße Einklang ihres Gewissens und ihrer Besinnung belohnte ihre Zuversicht; ihre Seele fühlte sich befreit von den Empfindungen, die sie niederdrückten, und sie wurde ruhig und gefaßt.
La Motte erwachte bald darauf, und Peter schickte sich zur Ausführung seines Auftrags an. Indem er sein Pferd bestieg, sagte er zu seinem Herrn: „Nichts für ungut, Euer Gnaden, allein meinem Bedünken nach, täten wir gut daran, uns nicht weiter nach einer anderen Behausung umzusehen, bis bessere Zeiten kommen. Denn niemand wird daran denken, uns hier zu suchen, und wenn man diesen Ort bei Tageslicht sieht, so scheint er nicht so übel zu sein, als daß man ihn nicht mit ein wenig Aufbügeln komfortabel genug machen könnte.“
La Motte antwortete nicht, aber er dachte über Peters Worte nach. In den Stunden der Nacht, wo Sorgen ihn nicht schlafen ließen, war ihm derselbe Gedanke gekommen. Verbergung war seine einzige Sicherheit, und dieser Ort gewährte sie ihm. Die Trostlosigkeit des Ortes war ihm freilich zuwider, aber er hatte nur unter Übeln zu wählen – ein Wald mit Freiheit war kein schlechtes Zuhause für jemanden, der nur zu viel Ursache hatte, ein Gefängnis zu erwarten. Als er durch die Zimmer ging und ihren Zustand sorgfältiger untersuchte, fand er, daß sie leicht bewohnbar zu machen wären; und als er sie nun unter der Freundlichkeit des Morgens sah, wurde er in seinem Plan bestärkt. Er sann über die Mittel nach, ihn auszuführen, und es schien nicht viel im Wege zu stehen, außer der offensichtlichen Schwierigkeit, Lebensmittel zu bekommen.
Er eröffnete Madame de la Motte seinen Plan, die sich äußerst abgeneigt dagegen zeigte. Indessen pflegte La Motte sie selten um Rat zu fragen, ohne vorher bereits beschlossen zu haben, wie er verfahren wollte, und er hatte sich bereits vorgenommen, es auf Peters Bericht ankommen zu lassen. Wenn dieser eine Stadt in der Nachbarschaft des Waldes ausfindig machen könnte, wo man Vorräte und andere Notwendigkeiten würde beschaffen können, so wollte er sich nicht weiter nach einem Ruheort umsehen.
In der Zwischenzeit verbrachte er das ängstliche Intervall von Peters Abwesenheit damit, die Ruine zu untersuchen und in dem umliegenden Grundstück umherzugehen. Es war von romantischer Süße und die üppigen Wälder, von denen es umgeben war, schienen diesen Ort von der übrigen Welt abzuschirmen. Oft zeigte eine natürliche Aussicht einen Blick auf das Land, begrenzt von Bergen, die sich in die Ferne zurückzogen und im blauen Horizont verloren. Ein Bach, der gewunden und melodisch dahinströmte, wand sich zu den Füßen der Wiese, auf welcher die Abtei stand. Hier glitt er sanft zwischen den Schatten hin, tränkte die Blumen, die an seinen Ufern blühten und verbreitete taufeuchte Frische um sich herum; dort breitete er sich in größerer Fläche dem Tage entgegen und gab spiegelnd die waldige Szene und das Wild, das seine Wellen kostete, zurück. La Motte bemerkte allenthalben Wild im Überfluß, die Fasanen stoben kaum vor seiner Annäherung und die Rehe starrten ihm gleichmütig ins Gesicht, als er vorüberging. Sie kannten die Menschen nicht!
Als er wieder in die Abtei zurückkam, stieg La Motte die Treppe hinauf, die in den Turm führte. Ungefähr auf dem halben Weg nahm er eine Tür in der Mauer wahr. Sie gab seiner Hand ohne Widerstand nach, doch ein plötzliches Geräusch von innen, dem eine Staubwolke folgte, ließ ihn zurückfahren und die Türe zuziehen. Nach einigen Minuten öffnete er sie wieder, und entdeckte ein großes Zimmer des neueren Gebäudes. Fragmente von Tapeten hingen in Fetzen von den Wänden, die zum Aufenthalt von Raubvögeln geworden waren, deren plötzliche Flucht bei der Öffnung der Türe die Staubwolke hervorgebracht und das Geräusch erregt hatte. Die Fenster waren zerbrochen und beinahe ohne Glas, aber zu seiner Verwunderung sah er einige Überreste von Möbeln; Stühle, deren Stil und Zustand die Zeit ihrer Herkunft verriet, einen zerbrochenen Tisch und ein eisernes Kamingitter, das vom Rost fast ganz verzehrt war.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers befand sich eine Türe, die in ein anderes Zimmer führte, welches wie das erste gebaut, aber mit nicht ganz so zerlumptem Wandbehang ausgekleidet war. In einer Ecke befand sich eine kleine Bettstatt, und einige zerbrochene Stühle standen an der Wand. La Motte betrachtete diese Dinge mit Verwunderung und Neugier. „Es ist seltsam,“ sagte er, „daß diese Zimmer, und diese allein, die Spuren von Bewohnung verraten; vielleicht mag ein elender Wanderer, wie ich einer bin, hier Zuflucht vor einer verfolgenden Welt gesucht, und vielleicht die Last eines beschwerlichen Daseins hier niedergelegt haben – vielleicht bin ich auch nur seinen Fußspuren gefolgt, um meinen Staub mit dem seinigen zu vermischen!“
Er drehte sich schnell um und wollte das Zimmer verlassen, als er nahe beim Bett eine Tür wahrnahm. Sie führte in ein Kabinett, welches von einem schmalen Fenster Licht erhielt, und in demselben Zustand war, wie die anderen Zimmer, durch die er gegangen war, nur daß nicht einmal Überreste von Möbeln darin befindlich waren. Als er über den Boden ging, kam es ihm so vor, als ob eine Stelle des Fußbodens unter seinen Füßen schwankte; er untersuchte sie und fand eine Falltüre. Neugier trieb ihn an, weiterzuforschen, und mit einiger Mühe gelang es ihm, sie aufzuheben. Sie enthüllte eine Treppe, die sich in Dunkelheit verlor. La Motte stieg einige Stufen hinab, da er es aber nicht wagte, sich diesem Abgrunde anzuvertrauen, machte er die Türe wieder zu und verließ diese Zimmer voll Verwunderung, zu welchem Zwecke hier eine Treppe so heimlich angebracht sein möchte.
Die Treppenstufen im oberen Turm waren so sehr verfallen, daß er nicht hinaufzusteigen wagte. Er ging wieder in den Saal zurück und gelangte durch die Wendeltreppe, die er den Abend zuvor bemerkt hatte, in die Galerie, wo er eine Reihe Zimmer fand, die völlig unmöbliert waren, und die den unteren sehr glichen.
Er erneuerte mit Madame de la Motte sein voriges Gespräch über die Abtei, und sie bot alles auf, ihm sein Vorhaben auszureden. Zwar erkannte sie die Sicherheit dieses Orts an, meinte aber, es ließe sich wohl ein anderer finden, der zur Verbergung ebensogut geeignet, und zudem komfortabler wäre. Dies bezweifelte La Motte; außerdem war dieser Wald reich an Wild, welches ihm Speise und Zeitvertreib zugleich verschaffen konnte, ein Umstand, der bei dem geringen Bestand seiner Kasse nicht zu verachten war – mit einem Worte: er hatte sich diesen Plan so fest in den Kopf gesetzt, daß es sein bevorzugter geworden war. Adeline hörte mit stiller Angst dem Gespräch zu und wartete mit Ungeduld auf den Ausgang von Peters Bericht.
Der Morgen verstrich, aber Peter kam nicht zurück. Unsere einsame Gesellschaft machte sich über den Proviant her, den sie glücklicherweise mitgebracht hatte, und ging danach im Wald spazieren. Adeline, die nie etwas Gutes unbemerkt vorüberziehen ließ, nur weil es mit Übel begleitet war, vergaß eine Zeitlang die Trostlosigkeit der Abtei über der Schönheit der angrenzenden Landschaft. Die freundlichen Schattierungen labten ihr Herz, und die abwechslungsreichen Merkmale der Landschaft belebten ihre Phantasie. Sie glaubte beinahe, vergnügt hier leben zu können. Schon nahm sie einen gewissen Anteil an den Angelegenheiten ihrer Gefährten, und für Madame de la Motte empfand sie noch mehr: es war die warme Regung von Dankbarkeit und Zuneigung.
Der Nachmittag verstrich und sie kehrten wieder zur Abtei zurück. Peter war noch immer fort, und sie begannen nun, sich über seine Abwesenheit zu wundern und zu besorgen. Auch das Herannahen der Dunkelheit warf einen Schatten auf die Hoffnung der Wanderer; sie mußten noch eine Nacht unter ebenso elenden Umständen zubringen, und was noch schlimmer war, mit einem sehr spärlichen Vorrat an Lebensmitteln. Madame de la Motte verlor allen Mut und weinte bitterlich. Adelines Herz war ebenso beklommen, doch sie raffte ihre sinkenden Lebensgeister zusammen und gab einen ersten Beweis ihrer Güte, indem sie sich bemühte, ihre Freundin wieder aufzurichten.
La Motte wurde rastlos und ängstlich, und ging, indem er die Abtei verließ, allein den Weg, den Peter genommen hatte. Er war noch nicht weit gekommen, als er ihn zwischen den Bäumen wahrnahm, wie er sein Pferd führte. „Was bringst du an Nachrichten, Peter?“ rief ihm La Motte entgegen. Peter kam keuchend näher und sagte kein Wort, bis La Motte die Frage in einem mehr gebieterischen Ton wiederholte.
„Ach, Gott segne Sie, gnädiger Herr,“ sagte er, sobald er genug zu Atem gekommen war, um zu antworten, „ich bin froh, Sie zu sehen. Ich dachte schon, ich würde nie wieder zurückkommen. Ich habe das Unglück der ganzen Welt gehabt.“
„Nun, das kannst du nachher erzählen; jetzt laß mich nur hören, was du entdeckt hast.“
„Entdeckt!“ unterbrach ihn Peter. „Ja, ich bin entdeckt von einer Rache! Wenn Euer Gnaden meine Arme betrachten wollen, so werden Sie sehen, wie ich entdeckt bin.“
„Verfärbt, willst du wahrscheinlich sagen. Aber wie gerietest du in diesen Zustand?“
„Nun, das wollte ich Euer Gnaden eben erzählen. Sie wissen, daß ich von dem Engländer, der zuweilen mit seinem Herrn in unser Haus kam, ein wenig Boxen gelernt habe – “
„Ja, ja, sag mir nur, wo du gewesen bist.“
„Wahrhaftig, kaum weiß ich es selbst, Herr. Ich habe eine gehörige Abreibung bekommen, aber da es in Eurer Gnaden Angelegenheiten war, so muß ich es schon verschmerzen. Wenn ich aber jemals den Spitzbuben wieder treffe – “
„Deine erste Abreibung scheint dir so gut gefallen zu haben, daß du noch eine verlangst; und wenn du nicht ordentlicher sprechen willst, sollst du bald eine haben.“
Diese Drohung erschreckte Peter, und er bemühte sich, fortzufahren. „Als ich die alte Abtei verließ,“ sagte er, „folgte ich dem Wege, den Sie mir angewiesen hatten und wendete mich rechts nach jenem Hain von Bäumen, wo ich hierhin und dorthin sah, ob ich ein Haus, eine Hütte, oder nur einen Menschen erblicken könnte, aber nicht eine Menschenseele war zu sehen; und so schlenderte ich beinahe eine Stunde weit fort, bis ich endlich auf einen gebahnten Weg kam. „Oh! Oh!“ sagte ich; „Nun haben wir‘s. Wege können nicht ohne Füße gemacht werden.“ Doch ich hatte falsch gerechnet, denn ich konnte kein verteufeltes Bißchen von einem Menschen sehen, und nachdem ich den Weg eine ganze Weile mal in die eine, mal in die andere Richtung gegangen war, verlor ich meine Spur und mußte eine andere suchen.“
„Ist es dir denn gar nicht möglich, auf den Punkt zu kommen? Laß doch diese närrischen Einzelheiten weg, und sag nur, ob du erfolgreich warst.“