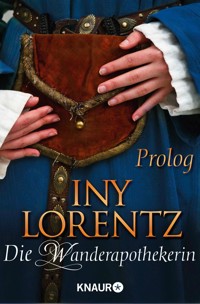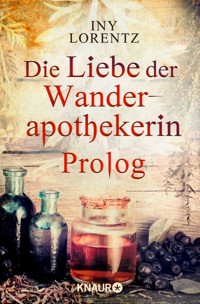9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderapothekerin-Serie
- Sprache: Deutsch
Eine junge mutige Heldin, eine Zeit des Aufbruchs und ein geheimer Schatz: Die faszinierende historische Romanreihe von Iny Lorentz, beheimatet im Thüringen des 18. Jahrhunderts Nach der erfolgreichen Wanderhure-Serie legen Spiegel-Bestseller-Autorenduo Iny Lorentz diese historische Roman-Reihe vor dem faszinierenden Hintergrund des Apothekenwesen im 18. Jahrhundert vor: Ein mutiges Mädchen, eine abenteuerliche Reise, ein mörderischer Feind – eine starke junge Frau muss ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und ist damit ihrer Zeit weit voraus. Thüringen im 18. Jahrhundert: Nachdem Klaras Vater und auch ihr Bruder – beides Wanderapotheker, die mit ihren Heilkräutern und Arzneien von Dorf zu Dorf ziehen – spurlos verschwinden, ist es an der jungen Frau, ihre Familie vor größter Not zu bewahren. Wie ihr Vater will auch Klara auf der Wanderschaft Heilkräuter und Arzneien verkaufen, was jedoch äußerst schwierig und voller Gefahren ist. Die größte Bedrohung kommt dabei aus der eigenen Familie: Ihr Onkel Alois ist hinter einem Schatz her, den ihr Vater angeblich versteckt hat. Obrigkeit und Kirche bezichtigen die junge Frau aufgrund ihres Heilkräuter-Wissens sogar der Hexerei. Klara steht jedoch nicht allein: Da ist ihre findige Freundin Martha, und dann gibt es noch Tobias, der sie insgeheim bewundert und liebt. Ein spannender historischer Roman vor der Kulisse des thüringischen Schwarzatal vergangener Zeiten, wo starke Frauen für ihre Berufung und auch ihre Liebe hart kämpfen mussten. »Iny Lorentz gelingt auch hier wieder ein historischer Roman mit süffigem Lesestoff. Ob Mittelalter oder Neuzeit – bei Iny Lorentz wird einfach jede Epoche zu ganz großem Kino.« Petra Historisches Wissen gepaart mit Spannung und guter Unterhaltung – Lesen Sie auch die anderen historischen Romane von Iny Lorentz! Alle Bände der Familiensaga um die Wanderapothekerin aus Thüringen: - Band 1: Die Wanderapothekerin - Band 2: Die Liebe der Wanderapothekerin - Band 3: Die Entführung der Wanderapothekerin - Band 4: Die Tochter der Wanderapothekerin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Wanderapothekerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Süddeutschland, 18. Jahrhundert:
Wanderapotheker ziehen aus Thüringen mit ihren Heilmitteln durch halb Europa. Zwei von ihnen haben vor vielen Jahren einen wertvollen Goldschatz gefunden. Während Martin seinen Anteil versteckt hat, ist seinem Bruder Alois nichts davon geblieben. Verzweifelt versucht er, Martin zur Herausgabe seines Anteils zu bewegen. Als dieser sich weigert, kommt es zu einem tödlichen Streit. Alois glaubt sich bereits am Ziel seiner Wünsche, doch er hat nicht mit dem erbitterten Widerstand seiner Nichte Klara gerechnet. Durch den Verlust des Vaters sieht Klara sich, ihre Mutter und ihre Geschwister in tiefste Armut stürzen. Um das zu verhindern, will sie nach Rudolstadt gehen, um Fürst Ludwig Friedrich um Hilfe anzuflehen. Sie muss dafür einen Weg wählen, auf dem bereits zwei junge Frauen spurlos verschwunden sind. Obwohl die Bewohner der Umgebung glauben, dass der Teufel seine Hand im Spiel hat, lässt Klara sich nicht beirren. Dies ist jedoch nur die erste von vielen Gefahren, denen sich die junge Frau stellen muss …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Die Thüringer Wanderapotheker
Danksagung
Personen
Prolog:
Teil 1: Ein beherztes Mädchen
Teil 2: Aufbruch
Teil 3: Hexenjagd
Teil 4: Gift
Teil 5: Gefährliche Wege
Teil 6: Der Schatz
Namen gesamt:
Glossar
Prolog
Kain und Abel
1.
Unter dem Schirmdach einer mächtigen Eiche hatten zwei Männer ein Lagerfeuer entzündet und wärmten sich daran. Beide trugen derbe Schuhe, graue Strümpfe, lederne Kniehosen und einen dunklen, bis zu den Waden reichenden Rock. Da sie diesen vorne offen stehen ließen, kamen darunter einfache Leinenblusen und blau gemusterte Halstücher zum Vorschein. Neben dem einen lag ein schwarzer Dreispitz auf dem Boden, neben dem anderen ein grauer Schlapphut. Beide Männer hatten die Lebensmitte schon überschritten, waren aber noch rüstig genug, um ihre schweren Traggestelle zu schultern und meilenweit zu tragen. Diese hatten sie ein paar Schritte entfernt abgestellt und mit Schnüren an Bäumen gesichert.
Während sie sich unterhielten, wickelte der Kleinere von ihnen einen Strang zähen Teiges um einen Stock und hielt ihn in die Flammen. Sein Begleiter schnitt etwas Pökelfleisch von einem größeren Stück ab und steckte es ebenfalls auf einen abgebrochenen Ast.
»Schau nicht so vorwurfsvoll, Martin! Das Fleisch habe ich von einer Bäuerin für etwas Pferdesalbe erhalten«, beantwortete dieser den fragenden Blick seines Begleiters.
»Es ist ein schönes, mageres Stück. Das gibt eine Bäuerin nicht für einen Klecks Salbe her, Alois«, antwortete Martin Schneidt mit leichtem Tadel in der Stimme.
Er erntete ein Lachen. »Weißt du, Bruder, man kann die Ehrlichkeit auch übertreiben. Wer mit dem Reff durch die Lande zieht, braucht Kraft. Die bekommt man nicht, wenn man tagtäglich nur ein wenig Mehl mit Wasser mengt und sich mit dieser Kost begnügt. Man muss auch mal ein Stück Schinken eintauschen und sich in der Schenke einen Krug Bier oder einen Becher Wein gönnen.«
Martin schüttelte missbilligend den Kopf. »Mein Brot besteht nicht nur aus Mehl und Wasser. Es ist etwas Fett darin und Kräuter, die es wohlschmeckend machen. Auch werde ich nicht auf einen Krug Bier verzichten. Morgen, wenn wir Gernsbach und damit das Ende unserer Strecke erreicht haben, werde ich mir sogar Wein schmecken lassen, samt dem guten Eintopf, den es bei Bolland gibt. So habe ich es jedes Jahr gehalten.«
Er prüfte, ob der um den Stock gewickelte Teig bereits durchgebacken war, und setzte seine Rede fort. »Ich bin froh, dass wir uns bereits heute begegnet sind, Alois, denn so wissen wir, dass wir beide unsere Strecken gut hinter uns gebracht haben. Letztes Jahr musste ich fast zwei Wochen lang auf dich warten und geriet schon in Sorge wegen der Franzosen. Deren Soldaten kommen immer wieder über den Rhein und verheeren ganze Landstriche. Ich fürchtete, du wärst ihnen in die Hände gefallen.«
»Ich bin auch froh, dass wir wieder zusammen sind«, erklärte Alois Schneidt. »Zu zweit lässt es sich doch besser wandern. Außerdem können wir endlich wieder miteinander reden. Deswegen hatte ich gehofft, dich noch vor unserem Ziel zu treffen, und bin in den letzten Tagen rascher ausgeschritten.«
Martin blickte seinen älteren Bruder verwundert an. »Du wolltest mich früher treffen? Aber warum denn? Du weißt doch, dass ich in Bollands Wirtshaus auf dich gewartet hätte.«
»Gewiss!«, antwortete Alois und sah sich nervös um. »Aber ich wollte mich mit dir unter vier Augen unterhalten und nicht dort, wo andere uns belauschen können.«
»Als wenn wir Geheimnisse hätten, die vor der Welt verborgen bleiben müssten!« Martin lachte und prüfte erneut sein Stockbrot. Nun war es durch, aber zu heiß, um sofort gegessen zu werden.
»Wir haben ein Geheimnis, Bruder! Solltest du das vergessen haben?«, fragte Alois mit gedämpfter Stimme.
»Ein Geheimnis? Nicht, dass ich wüsste.«
»Denk gut nach, Martin! Denke sehr gut nach! Es mag jetzt neunzehn Jahre her sein. Unser Vater war gerade gestorben, und wir hatten damals seine Strecke übernommen. Erinnerst du dich an das schlimme Unwetter und an den Schrecken, der uns überfiel, als der Sturm den Baum umwarf, unter dem wir Schutz suchen wollten?« Alois’ Stimme klang drängend, und er rückte näher an seinen Bruder heran.
Martin schüttelte es. »Oh ja! Daran erinnere ich mich nur zu gut.«
»Dann erinnerst du dich auch noch an den darauf folgenden Morgen und den goldenen Glanz zwischen den ausgerissenen Wurzeln des Baumes«, antwortete Alois erregt.
»Daran will ich lieber nicht denken«, flüsterte sein Bruder mit einer abwehrenden Handbewegung.
»Damals hast du mir geholfen, das Gold zu bergen, und du hattest auch nichts dagegen, es mit mir zu teilen. Jeder hat einen Beutel gefüllt, und die waren schließlich größer als ein Kinderkopf! Das Gold war so schwer, dass wir es kaum tragen konnten.« Alois’ Augen leuchteten bei der Erinnerung auf, und er legte einen Arm um die Schultern des Bruders.
Martin entzog sich ihm und bekreuzigte sich dreimal. »Es war ein Schatz des Teufels! Wir hätten ihn niemals anrühren dürfen.«
»Gold ist Gold, und es gehört weder dem Teufel noch Gott!«, antwortete Alois harsch. »Auf jeden Fall hat es damals uns gehört.«
»Wir hätten es niemals anrühren dürfen«, wiederholte Martin schaudernd. »Das Gold war verflucht! Das hast du doch selbst erlebt. Dein braves Weib kam nur wenige Tage, nachdem wir zu Hause angekommen waren, mit einem toten Kind nieder und starb kurz darauf. Im Winter hast du dir ein Bein gebrochen und konntest das Jahr darauf nicht losziehen …«
»Jetzt mach mal halblang!«, unterbrach Alois seinen Bruder. »Mein Weib wäre auch so gestorben, und ich hätte mir das Bein ebenso gebrochen. Nur das Gold hat mich davor bewahrt, betteln gehen zu müssen. Mich ärgert heute noch, dass mich der Lombarde, dem ich es verkauft habe, viel zu billig abgespeist hat. Doch das wird mir kein zweites Mal passieren.«
Martin lachte hart auf. »Es wird kein zweites Mal geben, Bruder! Oder glaubst du etwa, wir würden erneut auf solch einen Schatz stoßen? Vielleicht sogar unter den Wurzeln dieser Eiche hier?«
Sein Bruder mahlte mit dem Kiefer, bis die Zähne knirschten, und hob den Stock auf, den er in die Erde gesteckt hatte, um die Hände frei zu haben. Das Fleisch daran war an einer Seite angebrannt.
»Verdammt!«, schimpfte er.
»Du hättest weniger an jenen verfluchten Schatz denken sollen als an dein Essen«, wies Martin ihn zurecht.
Er knabberte vorsichtig an seinem Brot, schnupperte aber ein paarmal genießerisch, weil ihm der Duft des gebratenen Pökelfleisches in die Nase stieg.
Alois entging das nicht, und er grinste spöttisch. »Das riecht freilich besser als dein Stockbrot. Lass dir gesagt sein, es schmeckt auch besser. Warum sollen wir uns kasteien, nur damit der Herr Laborant noch reicher wird?«
»Sag nichts gegen Herrn Just! Er ist ein braver Mann. Außerdem stehen die Preise fest, zu denen er uns all die Salben, Essenzen und Öle überlässt. Es liegt an uns, wie viel wir daran verdienen. Geben wir unterwegs mehr Geld aus, bringen wir weniger mit nach Hause. Auch wenn Fleisch noch so gut schmeckt, muss man es nicht jeden Tag essen, und das Wasser aus einer Quelle stillt den Durst besser als schlechtes Bier«, belehrte Martin seinen Bruder, der in seinen Augen zu verschwenderisch lebte.
Alois verzog das Gesicht. »Auch wenn du von der Strecke einen Taler oder zwei mehr nach Hause bringst, wirst du davon nicht reich.«
»Wozu brauche ich Reichtum? Gott hat mich genug gesegnet«, antwortete Martin. »Ich habe ein braves, strammes Weib, das wie keine Zweite ihre Kräuter ziehen kann, vier wohlgeratene Kinder und ein gutes Auskommen – und das ohne diesen verfluchten Schatz!«
»Jaja! Red du nur!«, knurrte Alois.
Es schien ihm unfassbar, wie dem Bruder alles zu gelingen schien, was dieser anfasste, und er zerfraß sich beinahe vor Neid. Er selbst hatte eine Frau zu Hause, die es in der Zeit, in der er durch die Lande zog, um Arzneien zu verkaufen, nicht schaffte, ihre kleine Landwirtschaft zu führen. Sein einziges Kind war eine Tochter im gleichen Alter wie Martins Klara, aber während diese ihrer Mutter half, wo es nur ging, liebte seine Reglind ebenso wie sein Weib den Müßiggang. Mit einer Bewegung, die seinen Ärger verriet, schüttelte er diesen Gedanken ab.
»Du wirst deine Meinung ändern, wenn du deine vier Kinder versorgen musst!«, fuhr er fort. »Dein Gerold wird auch nur die Tochter eines anderen Wanderapothekers freien können und Klara einen solchen zum Mann erhalten – wenn sie Glück hat! Sonst wird sie genauso wie deine jüngeren Kinder auf Taglohn gehen müssen. Ich hingegen will für meine Tochter einen Eidam suchen, der nicht den ganzen Sommer über das schwere Reff durch die Lande schleppen muss – einen wie Tobias Just zum Beispiel! Der wird einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten und selbst ein Laborant werden, welcher über mehrere Destillen gebietet. So einen stelle ich mir als Mann für meine Tochter vor.«
Martin musste lachen. »Du willst hoch hinaus für deine Reglind! Warum suchst du dir nicht gleich einen adeligen Beamten vom Rudolstädter Hof für sie?«
»Vielleicht tue ich es!«, trumpfte sein Bruder auf. »Mit Geld kriegst du heutzutage alles.«
»Dann solltest du bald mit dem Sparen anfangen, Alois, denn nur so kommst du zu Geld. Solange du deine Pferdesalben und die Hustentropfen für Fleisch und Wein hergibst, wird es mit dem Reichtum so bald nichts werden.«
Neben dem Ärger über den leichtlebigen Bruder schwang Spott in Martins Stimme mit. Er selbst hatte immer sparsam gelebt und sogar ein wenig Land erwerben können. Auf diesem zog nun seine Frau mit geschickter Hand Kräuter, welche sie an den Laboranten Just verkaufte. Dadurch kam weiteres Geld ins Haus. Zwar konnte er sich keinen reichen Mann nennen, aber es gab nur wenige in seinem Heimatort, deren Besitz den seinen übertraf.
Das war Alois ebenfalls klar, und er ärgerte sich, weil er trotz des Goldes, das er einmal besessen hatte, mittlerweile schlechter gestellt war als sein Bruder. Er hatte seinen Anteil an dem Schatz kurz nach der Heimkehr heimlich an einen Lombarden verkauft, der durch die Lande zog, um Edelmetalle zu sammeln, und war übers Ohr gehauen worden. Das aber hatte er erst viel später begriffen und bedauert, das Gold nicht dem damaligen Grafen und jetzigen Fürsten Ludwig Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt angeboten zu haben. Trotz der Steuern, die er hätte zahlen müssen, wäre sein Anteil größer gewesen als die Summe, die er von jenem Gauner erhalten hatte. Inzwischen hatte er das Schatzgeld restlos aufgebraucht und musste zusehen, wie er mit dem Verdienst als Wanderapotheker zurechtkam.
Obwohl sein Bruder vier Kinder zu versorgen hatte, würde dieser seinen beiden Töchtern reichere Ehemänner verschaffen können als er der seinen. Während er an seinem Fleisch knabberte, grübelte er, wie er das Gespräch fortführen könnte, um sein Schicksal zum Besseren zu wenden.
»Vor ein paar Jahren hast du erzählt, du würdest deinen Anteil an dem Schatz noch besitzen.«
Martin wollte sich gerade einen weiteren Bissen in den Mund schieben. Nun verharrte er auf halbem Weg und sah seinen Bruder verwundert an. »Zum Glück habe ich das Zeug nicht anrühren müssen. Mir ist es auch so gut ergangen.«
»Wenn du es nicht brauchst, kannst du es doch mir geben – oder zumindest einen Teil davon!«, antwortete Alois und streckte die Rechte aus, als erwarte er, der Bruder würde ihm die Goldmünzen auf der Stelle in die Hand zählen.
»Bist du übergeschnappt?«, rief Martin entgeistert. »Ich sagte doch, dass dieses Gold verflucht ist! Wer es verwenden will, dem stößt nur Unglück zu. Denke an dein erstes Weib! Es war weitaus fleißiger und sauberer als die Fiene, die du danach geheiratet hast. Sie hat deine Landwirtschaft gut geführt, und du hast auf deinem Acker einiges ernten können. Heute ist es nicht mehr so. Außerdem sollte deine Frau besser auf eure Tochter achtgeben! Deren Tugend ist nicht so rein, wie sie sein sollte.«
»Das nimmst du zurück, Martin! Reglind ist gewiss nicht schlechter als deine Klara. Aber sie ist hübscher, und deswegen sehen die jungen Herren, die übers Land reiten, sie gerne an. Ganz gewiss wird sie ihre Tugend nicht leichtfertig verschleudern!«, antwortete Alois zornerfüllt.
Zu seinem Ärger steckte ein Körnchen Wahrheit in den Worten seines Bruders. Er traute es seiner Tochter durchaus zu, einem der jungen Herren vom Rudolstädter Hof, die gelegentlich in der Umgebung seines Heimatorts jagten, für ein hübsches Geschenk an einen verborgenen Ort zu folgen. Nicht zuletzt deshalb wollte er sie so rasch wie möglich verheiraten. Als Eidam schwebte ihm Tobias Just vor, der Sohn des Laboranten, dessen Arzneien sein Bruder und er unters Volk brachten. Doch damit Tobias’ Vater Rumold Just Reglind als Schwiegertochter überhaupt in Betracht zog, musste ihre Mitgift weitaus höher sein, als er sie aufzubringen vermochte. Das war einer der Gründe, weshalb er den Bruder kurz vor dem Endpunkt ihrer Wanderung abgepasst hatte.
»Wir reden hier nicht über unsere Töchter, sondern über den Schatz, den wir damals gefunden haben. Da du deinen Anteil nicht brauchst, kannst du mir die Hälfte davon abgeben«, erklärte er mit Nachdruck.
»Niemals! Das Gold ist verflucht! Keiner darf es mehr anrühren.« Martins Miene zeigte deutlich, dass er in diesem Punkt nicht nachgeben würde.
»Wir sind doch Brüder und müssen einander beistehen, wenn es nottut«, beschwor Alois ihn.
»Wenn du Mehl brauchst, Gemüse oder Hilfe bei einer Reparatur, springe ich dir gerne bei. Doch das Gold bleibt, wo es ist!«
»Und wo ist es?«, fragte Alois Schneidt mit giererfüllter Stimme.
»An einem sicheren Ort, den nur ich allein kenne.«
»Nur du? Das glaube ich nicht! Was wäre denn, wenn du von deiner Strecke nicht mehr zurückkommst, sei es wegen Krankheit oder Tod?«, bohrte Alois weiter.
»Nur ich weiß es!«
Obwohl die Stimme seines Bruders fest klang, spürte Alois, dass er ihm nicht die ganze Wahrheit sagte. »Aber dein Weib muss es doch wissen.«
»Ich will nichts mehr davon hören! Mittlerweile ist es Nacht geworden, und ich mag endlich schlafen.« Martin legte ein paar Holzstücke nach, um das Lagerfeuer am Brennen zu halten, und blickte dann zu den Sternen auf, die durch die Lücken zwischen den Baumkronen schimmerten.
Alois begriff, dass er an diesem Abend nichts mehr erreichen konnte, und gab scheinbar nach. »Hast wohl recht, Bruder! Ich gehe noch einmal zur Quelle, denn das Pökelfleisch war arg salzig.«
»Du hättest es vorher abwaschen sollen!« Martin mochte der Jüngere der beiden Brüder sein und auch der Gleichmütigere, doch er dachte gut über das nach, was er tat. Den Älteren ärgerten seine Mahnungen nicht zuletzt deshalb, weil sie sehr oft ins Schwarze trafen.
Alois ging mit vor Ärger verzerrtem Gesicht zu der nahen Quelle und trank. Das Wasser löschte zwar seinen Durst, doch es vertrieb nicht den salzigen Nachgeschmack.
»Ein Krug Bier würde mir besser munden«, brummte er, als er zum Lagerfeuer zurückkehrte.
Sein Bruder hatte sich bereits aus Zweigen und Blättern ein Nachtlager errichtet und zog gerade seinen Rock aus, um ihn als Decke zu verwenden.
»Gute Nacht, Alois«, sagte er, nachdem er sich hingelegt hatte.
»Gute Nacht«, kam es unwirsch zurück.
Alois suchte sich nun ebenfalls Blätter und Zweige als Unterlage, fand aber weniger, als er erhofft hatte. Daher fluchte er in Gedanken auf seinen Bruder, der vor ihm sein Bett gemacht hatte.
»Da konnte nicht viel für mich übrig bleiben!«, murmelte er vor sich hin.
Martin war an diesem Tag weit mit dem Reff auf dem Rücken marschiert und daher erschöpft. Im Einschlafen vernahm er die Stimme des Bruders, ohne seine Worte zu verstehen, und hob daher mühsam den Kopf. »Hast du etwas gehört? Einen Bären vielleicht? Oder Räuber? Es könnten auch marodierende Soldaten sein.«
Vor all diesen Gefahren mussten sie sich hüten, wenn sie im Freien übernachteten.
Alois schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe nichts gehört. Schlafe endlich!«
»Vielleicht sollten wir abwechselnd Wache halten«, schlug Martin vor.
»Sonst noch was? In dieser Gegend ist seit einer Generation kein Bär mehr gesehen worden, und was Räuber angeht, trauen die sich auch nicht hierher. Hier hängt man derlei Gelichter sehr rasch am Halse auf! Die Franzosen ziehen über bessere Straßen als auf diesem elenden Pfad durch den Wald!«
Alois Schneidt lachte kurz und legte sich ebenfalls hin. Im Gegensatz zu seinem Bruder behielt er den Rock an und häufte Blätter über sich.
Da ihn eine Wurzel im Rücken drückte, bettete er sich noch einmal um. Obwohl er nun bequemer lag, floh ihn der Schlaf, denn er musste ständig an den Schatz denken, den sein Bruder und er vor vielen Jahren geborgen hatten. Er griff in seinen Beutel und holte die letzte Münze heraus, die er noch von jenem Fund besaß, und betrachtete sie im Schein des kleinen Feuers. Sie sah ganz anders aus als heutige Geldstücke. Kaum größer als der Nagel seines kleinen Fingers, war sie gewölbt wie ein kleines Schüsselchen und trug nur auf einer Seite ein unbekanntes Symbol.
Während er die Münze mit dem Daumen streichelte, stieg erneut der Ärger in ihm hoch, dass er sich von dem wandernden Edelmetallhändler hatte betrügen lassen. Aber das würde ihm nun, da er etliche Jahre älter und weitaus erfahrener war, nicht mehr passieren.
»Wenn Martin mir die Hälfte seines Schatzes abgibt, ist jeder von uns reich.« Der Klang seiner eigenen Stimme ließ Alois zusammenzucken.
Er kannte seinen Bruder gut genug, um zu wissen, wie stur dieser sein konnte. Doch er brauchte das Gold dringend, und leider nicht nur, um seine Tochter gut zu verheiraten. Er hatte Schulden bei Händlern in Königsee und sogar in Rudolstadt, und diese bedrängten ihn hartnäckig, damit er zahlte. Um alle zufriedenzustellen, hätte er in diesem Jahr dreimal so viel verdienen müssen wie sonst, und das würde ihm auch bei sparsamster Lebensführung niemals gelingen.
»Morgen rede ich noch einmal mit Martin. Er muss nachgeben! Schließlich ist er mein Bruder und kann nicht wollen, dass ich im Schuldturm lande.« Erneut sprach er seine Gedanken laut aus und sah dabei angespannt auf Martins Lager.
Sein Bruder schlief jedoch fest. Das war kein Wunder, sagte Alois sich neiderfüllt, wurde der Jüngere doch nicht wie er immerzu von Sorgen geplagt.
2.
Der Morgen dämmerte herauf, ohne dass ein Bär, ein Räuber oder ein französischer Soldat sich hatte sehen lassen. Da Alois Schneidt lange wach geblieben war, schlief er noch, während sein Bruder aufstand, die an seiner Kleidung haftenden Blätter abstreifte und sich am Bach wusch. Martins Überlegungen galten zunächst seiner jährlichen Wanderung, deren Endpunkt er am nächsten Abend zu erreichen hoffte. Dann musste er an seine Familie denken, die er in spätestens drei Wochen wiedersehen würde. Vorher würden er und Alois ihre restlichen Arzneien auf dem Markt in Gernsbach anbieten. Danach konnten sein Bruder und er endlich nach Hause eilen.
Mit einem sanften Lächeln stellte Martin Schneidt sich vor, dass seine Frau Johanna um diese Zeit bereits am Herd stehen würde und die Morgensuppe kochte. Klara würde ihr helfen, wie sie es immer tat, Gerold die beiden Ziegen und das Schwein füttern und die kleine Liebgard die Hühner. Der neunjährige Albert war höchstwahrscheinlich wieder ausgebüxt, um den Arbeitern zuzusehen, die in die Kupferschmelze eilten. Martin Schneidt meinte alle fünf so deutlich vor sich zu sehen, dass er einen sehnsuchtsvollen Seufzer ausstieß. Dann blickte er zur Sonne hoch, die bereits eine Handbreit über dem Horizont stand, und weckte seinen Bruder.
»He, Alois! Aufstehen! Sonst geraten wir in die Nacht hinein und stehen vor den geschlossenen Toren von Gernsbach. Du willst doch heute noch in Bollands Gasthof einen Becher Wein trinken.«
Alois quälte sich hoch und kniff die Augen zusammen. Seine Gedanken waren noch von dem Traum gefangen, in dem er einen großen Tontopf voll glänzender Taler gefunden hatte. Nun war er enttäuscht, weil das Geld sich als Trugbild erwiesen hatte.
»Wir kommen schon noch an unser Ziel«, antwortete er missgelaunt. Da fiel ihm ein, dass er seinen Bruder nicht verärgern durfte, wenn er Erfolg bei ihm haben wollte. »Freilich will ich einen Becher Wein trinken und mit dir darauf anstoßen, dass wir auch heuer mit Gottes Hilfe unsere Strecke geschafft haben.«
»Darauf trinke ich gerne!«, erwiderte Martin fröhlich. »Nächstes Jahr sind wir übrigens zu dritt. Ich werde nämlich meinen Gerold mitnehmen. Der Bursche ist jetzt achtzehn und soll lernen, ein guter Wanderapotheker zu werden.«
»Dann wirst du noch mehr verdienen, denn zu zweit könnt ihr mehr tragen als ich allein«, warf sein Bruder neidisch ein.
»Du musst dir eben einen guten Mann für deine Reglind suchen, dann könnt ihr ebenfalls zu zweit losziehen. Das Handelsprivileg für einen Schwiegersohn wird dir Seine fürstliche Hoheit gewiss gewähren«, schlug Martin vor.
»Keiner von uns müsste weiterhin Jahr für Jahr durch Sommerhitze und Regen laufen, wenn du vernünftig wärst, Martin«, antwortete Alois drängend. »Wir könnten selbst Laboranten werden und andere als Wanderapotheker in die Welt hinausschicken. Das Gold, das du versteckt hältst, würde uns dazu verhelfen.«
»Was du dir einbildest!«, rief Martin mit einem freudlosen Lachen aus. »Als Erstes würde der Amtmann von Königsee fragen, woher wir das Geld haben, um uns als Laboranten einzurichten. Wenn wir zugeben, einen Schatz gehoben zu haben – und das müssten wir! –, würde der Fürst seinen Anteil verlangen, ebenso der Pfarrer und der Amtmann. Für uns beide bliebe nicht mehr viel übrig, und wir müssten trotzdem weiterhin als Wanderapotheker durch die Lande ziehen.«
»Nicht, wenn wir es geschickt anfangen«, wandte sein Bruder ein. »Es braucht ja niemand von dem Schatz zu wissen. Wir verkaufen die Goldschüsselchen einfach an einem anderen Ort.«
»Und müssten dort der Obrigkeit ihren Anteil überlassen! Nein, Bruder, mein Anteil bleibt dort, wo er ist. Ich habe doch gesehen, wie es dir ergangen ist. Obwohl du als Älterer von uns beiden das Haus und den Acker unseres Vaters geerbt hast, besitzt du jetzt weniger als ich – und das trotz deines Schatzes. Ich sage dir, das Gold ist verflucht! Dein erstes Weib starb ebenso wie der Sohn, den sie gebären sollte. Das wäre nicht geschehen, wenn du dieses Teufelsgold nicht genommen und ausgegeben hättest.«
»Das war nicht deswegen!« In Alois Schneidt stieg rote Wut auf seinen Bruder hoch, der sich nicht überreden ließ, ihm wenigstens einen Teil des gefundenen Schatzes zu überlassen. Während sich Martin ein Stück von dem Stockbrot, das vom Abendessen übrig geblieben war, als Frühstück in den Mund steckte, packte er ihn bei den Schultern.
»Wenn du Angst vor dem Gold hast, dann gib es mir ganz! Ich fürchte mich nicht davor.«
»Dieses Gold würde dich endgültig ins Unglück stürzen. Das lasse ich nicht zu!« Mit einem Ruck befreite Martin Schneidt sich aus dem Griff seines Bruders, nahm sein Reff auf den Rücken und packte den mit einer Eisenspitze versehenen Stab, der ihm bei seiner Wanderung als Stütze diente. »Befreie dich von dem Dämon, der dich ergriffen hat, und du wirst glücklicher leben!«, riet er seinem Bruder noch und machte sich auf den Weg.
Alois starrte hinter Martin her und ballte die Fäuste. »Tu nicht so scheinheilig, du Heimtücker! Du willst das Gold doch nur für dich selbst haben«, murmelte er.
Einen Augenblick kam ihm der Gedanke, dass er eigentlich kein Anrecht mehr auf dieses Gold besaß. Es war schließlich der Anteil des Bruders, den er damals selbst gleich zu gleich abgezählt hatte. Dann aber erinnerte er sich, dass er das Gold entdeckt hatte. Seinem Bruder wäre es gewiss entgangen. Der Gedanke regte ihn noch mehr auf. Voller Zorn packte er sein Reff, schulterte es und eilte hinter Martin her.
Es dauerte einige Zeit, bis er ihn eingeholt hatte. Doch als er erneut über das Gold zu sprechen begann, sah Martin ihn kopfschüttelnd an. »Du hättest dir die Blätter abklopfen sollen, Bruder. Sie hängen dir sogar noch am Hut!«
»Lass mich mit den verdammten Blättern in Ruhe!«, schrie Alois ihn an. »Ich sehe nur, dass du mich im Stich lassen willst. Ich brauche das Gold! Verstehst du denn nicht? Du hast keine Verwendung dafür, wie du selber gesagt hast.«
»Alois, beruhige dich und denke nur einmal in Ruhe nach. Dann siehst du ebenfalls ein, dass dieses Gold nur Unglück bringt.«
Die Worte des Bruders gingen jedoch an Alois Schneidt vorbei. »Ich muss das Gold haben!«, schrie er. »Du musst es mir geben! Schließlich bin ich der Ältere von uns beiden!«
»Aber leider nicht der Klügere«, antwortete Martin, der nun ebenfalls zornig wurde. »Weißt du, Bruder, langsam bedaure ich es, dass wir uns gestern hier getroffen haben. Wenn du nicht gescheiter wirst, werde ich den Heimweg allein antreten und nächstes Jahr alles daransetzen, dir unterwegs nicht zu begegnen.«
Jedes Wort des Bruders traf Alois Schneidt wie ein Schlag. Mit einem gellenden Schrei entledigte er sich seines Reffs, stellte es achtlos hin und packte Martin am Kragen seines Rocks. »Du gibst mir das Gold, sonst …«
»Was sonst?«, keuchte Martin und versuchte, sich zu befreien. Doch er wurde von seinem Traggestell behindert und kam daher nicht gegen seinen Bruder an.
»Sag mir, wo du den Schatz versteckt hast! Sag es mir …« Alois Schneidt schüttelte seinen Bruder und legte, als dieser nach ihm schlug, die Hände um dessen Hals.
»Das Gold ist mein!«, kreischte er, während er immer stärker zudrückte. »Ich habe damals gesagt, dass wir unter jenem Baum lagern sollen! Ich habe den zerbrochenen Krug mit den Goldschüsselchen gefunden! Also hätte ich dir gar nichts abgeben müssen! Du hast nicht das Recht, mir das Gold zu verweigern.«
Martin spürte, wie ihm der Atem wegblieb. Bei Gott, er erwürgt mich noch, schoss es ihm durch den Kopf. Als er sich zu wehren begann, rutschte das Reff auf seine Oberarme und behinderte ihn noch mehr. Verzweifelt versuchte er, die Tragriemen abzustreifen, schaffte es aber nicht.
»Alois, wir sind doch Brüder!«, brachte er mühsam heraus, dann wurde es schwarz um ihn.
»Ja, wir sind Brüder! Doch das hast du vergessen, du Hund. Du hast mir neunzehn Jahre lang meinen Schatz vorenthalten. Aber nun ist er mein, mein, mein!« Alois lachte seinem Bruder höhnisch ins Gesicht und begriff erst allmählich, dass dieser sich nicht mehr rührte. Erschrocken ließ er den Hals des anderen los, sah die Würgemale und schüttelte verwirrt den Kopf.
»Martin, was ist mit dir?«
Doch sein Bruder antwortete nicht, sondern stürzte unter dem Zug des Reffs rücklings zu Boden und blieb starr liegen. Es dauerte eine Weile, bis Alois Schneidt begriff, dass er Martin umgebracht hatte. Entsetzen packte ihn, und er sah sich hastig um. Doch er befand sich noch immer im Wald, und es war weit und breit niemand zu sehen.
So schnell er konnte, schleifte er seinen Bruder hinter ein Gebüsch, versteckte dann dessen Reff und sein eigenes etwas abseits des Weges und setzte sich neben sie ins Moos. Seine Gedanken wirbelten in einem wirren Tanz.
»Ich habe meinen Bruder ermordet! Ich bin Kain! Kain! Kain!«, echote es in ihm. Gleichzeitig packte ihn die Angst, als Mörder entlarvt und hingerichtet zu werden.
»In diesem Waldgebirge hat es immer Räuber gegeben und auch wilde Tiere, denen Martin zum Opfer gefallen sein kann. Nur darf ihn niemand so schnell finden«, hörte er sich selbst sagen.
So nahe an dem Pfad, den zumeist Wanderer und Kiepenhändler benutzten, durfte der Leichnam auf keinen Fall liegen bleiben. Also musste er ihn weiter drinnen im Wald verstecken, und zwar rasch, bevor jemand vorbeikam. Obwohl ihm das Herz bis in den Hals schlug, raffte Alois sich auf und zog den Toten tiefer in den Wald hinein. Nach etwa zweihundert Schritten erreichte er eine mit Gebüsch bewachsene Senke und atmete auf. Wenn er die Leiche dort hineinwarf, würde sie nicht so rasch gefunden.
Alois wollte den Toten bereits über die Kante schieben, als er innehielt. Sein Bruder war ein sparsamer Mann und hatte gewiss einiges an Geld in der Tasche. Sollte er zulassen, dass derjenige, der den Leichnam fand, sich daran bereicherte? Außerdem würde niemand annehmen, Martin wäre von einem Räuber ermordet worden, wenn er sein Geld noch bei sich hatte.
»Da ist es schon besser, wenn ich es an mich nehme«, sagte Alois sich und erschrak vor seiner eigenen Stimme.
Er riss sich zusammen und durchsuchte die Kleidung des Toten. Die Börse fand er rasch, aber sie kam ihm sehr schmal vor. Daher zog er seinen Bruder bis auf die Haut aus und wurde belohnt, als er einen weitaus schwereren Beutel unter dessen Hemd fand. Er warf einen kurzen Blick hinein und atmete trotz seiner Anspannung auf. Darin befand sich genug Geld, um seine dringendsten Schulden in Königsee und Rudolstadt bezahlen zu können. An die Familie des Bruders, der dieses Geld eigentlich gehörte, verschwendete er keinen Gedanken. Die besaß schließlich noch den Schatz.
»Ich muss die Schwägerin dazu bringen, mir das Gold auszuhändigen«, murmelte er und begriff im selben Augenblick, dass dies nicht einfach sein würde. Johanna hörte fast immer auf ihren ältesten Sohn, und mit dem verstand er sich nicht besonders gut.
»Gerold wird mir das Gold geradewegs abschlagen. Verdammt! Kaum hat man einen Stein aus dem Weg geräumt, sieht man schon den nächsten vor sich«, schimpfte Alois Schneidt und rollte den Leichnam seines Bruders in die Senke.
Er schüttelte sich, als wolle er alle Schuld von sich abstreifen, kehrte zu den Reffs zurück und räumte die Reste der teureren Salben und Elixiere aus Martins Traggestell in seines. Die Heilmittel würde er auf dem Markt in Gernsbach gut verkaufen können. Das andere Reff trug er zu der Senke und warf es zu dem Toten hinab. Dann zupfte er seine Kleidung so gemütlich zurecht, als habe er ein gutes Werk vollbracht, las die letzten Blätter aus seinem Haar und kehrte zurück zu dem Pfad, den er nehmen musste, um nach Gernsbach zu gelangen.
Unterwegs sah er den Hut seines Bruders auf dem Moos liegen. Da er nicht noch einmal die Senke aufsuchen wollte, schleuderte er ihn tief in den Wald hinein. Mittlerweile hatte er seine Ruhe wiedergefunden, so dass er sein Reff auf den Rücken nehmen und weiterwandern konnte. Dabei dachte er an das Regenbogenschüsselchen in seiner Tasche und überlegte, wie er das Gold in die Hand bekommen konnte.
Einfach würde es nicht werden, das war ihm klar. Da er mit dem Geld des Bruders seine ärgsten Schulden bezahlen konnte, hatte er jedoch Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen. Im nächsten Jahr würde Gerold mit Sicherheit die Strecke seines Vaters übernehmen, und falls seine Schwägerin bis dahin nicht auf sein Ansinnen eingegangen war, würde er unterwegs mit seinem Neffen reden. Sollte dieser auf seinen Vorschlag eingehen, war es gut. Wenn nicht …
Bei dem Gedanken blickte Alois Schneidt in die Richtung, in der er seinen toten Bruder wusste, und verzog das Gesicht zu einer drohenden Grimasse.
3.
Alois Schneidt war schon auf halbem Weg nach Gernsbach, als ihm einfiel, dass er um Gottes willen nicht aus der Richtung kommen durfte, in der sein Bruder umgebracht worden war. Daher schlug er sich an einer einsamen Stelle durch den Wald, um eine andere Straße zu erreichen. Das bedeutete jedoch, eine weitere Nacht im Freien verbringen zu müssen. Als er am Abend endlich einen passenden Lagerplatz gefunden hatte, wagte er es nicht, ein Feuer zu entzünden, sondern wusch das Salz des Pökelfleisches an einer Quelle ab und aß es roh. Es war seine erste Mahlzeit an diesem Tag, dennoch verspürte er kaum Hunger. Immer wieder sah er das entsetzte Gesicht seines Bruders vor sich und dessen letzten, anklagenden Blick.
»Martin ist selbst schuld! Er hätte nur nachgeben müssen«, rechtfertigte er sich. Trotzdem quälten ihn in der Nacht wirre Träume, in denen sein Bruder geisterbleich auftauchte und ihn Kain nannte.
Der aufsteigende Morgen vertrieb die Gewissensbisse. Wie am Tag zuvor gab es kein Frühstück, obwohl er diesmal gerne einen Bissen gegessen hätte. Doch bis zu seiner Ankunft in Bollands Schenke würde er hungrig bleiben. Mehr Sorgfalt verwandte Alois Schneidt darauf, seine Kleidung zu säubern. An diesem Morgen blieb kein Blatt auf seinem Rock haften, und er kämmte die Haare mit den Fingern. Nachdem er sein Reff auf den Rücken genommen hatte, machte er sich auf den Weg.
Zwei Stunden später traf er auf die Straße und hatte Glück, dass gerade niemand die Stelle passierte, bei der er aus dem Wald auftauchte. Nun konnte er endlich rasch ausschreiten und erreichte schon am frühen Nachmittag das Stadttor. Da die Wachen ihn von seinen früheren Wanderungen kannten, ließen sie ihn unkontrolliert passieren. Kurz darauf tauchte Bollands Gasthaus vor ihm auf, und er trat eilig ein.
Der Wirt sah ihn kommen und begrüßte ihn. »Heuer bist du ausnahmsweise vor deinem Bruder hier, Schneidt!«
»Was? Martin ist noch nicht da?«
Alois Schneidt kam die eigene Stimme kratzig und unnatürlich vor. Daher hustete er kurz und schüttelte den Kopf. »Das wundert mich, denn ich dachte, ich hätte mich verspätet, und er würde schon auf mich warten. Füll mir einen Krug Wein, und wenn du was zum Essen hast, kannst du es mir geben. Ich habe großen Hunger mitgebracht!«
Nun klang Alois’ Stimme wieder normal. Er setzte sich, wartete, bis der Wirt ihm einen vollen Becher hinstellte, und leerte ihn zur Hälfte, ehe er ihn absetzte.
»Das tut gut, Bolland! Auf diesen ersten Becher Wein bei dir freue ich mich jedes Mal. Jetzt muss nur noch der Martin eintreffen, dann können wir auf ein weiteres Jahr mit guten Geschäften anstoßen.«
»Und? Waren die Geschäfte diesmal gut?«, wollte der Wirt wissen. »Das Meine wäre es ja nicht, mit der schweren Kiepe auf dem Rücken Dutzende von Meilen über Land zu ziehen.«
»Reff, Bolland! Es heißt Reff! Eine Kiepe ist nur ein besserer Korb, den ein schlichter Hausierer auf dem Rücken mit sich schleppt. Mein Bruder und ich sind Wanderapotheker – oder Königseer, wie die Leute sagen. Wir verkaufen Arzneien und Tinkturen, die Krankheiten fernhalten oder vertreiben. Was die Geschäfte angeht, gingen sie gewiss besser, wenn die Franzosen nicht ganze Landstriche verheert hätten.«
Alois gab sich Mühe, so zu tun, als wäre er stolz auf sein Gewerbe. Doch im Grunde war er nur ein wandernder Hausierer, der darauf aus war, seine Ware an den Mann oder, besser gesagt, an die Frau zu bringen. Die Weibsleute wussten die alten Heilmittel, die in seiner Heimat erzeugt wurden, am meisten zu schätzen.
»Jetzt ärgere dich nicht, Schneidt. Ich habe es nicht böse gemeint. Außerdem habt ihr doch noch den Markt hier in Gernsbach vor euch. Da verkauft ihr gewiss alles, was ihr übrig habt, und ich brauche auch ein paar Sachen. In einer Herberge wird leicht einer krank, und da ist es gut, gleich eine Arznei bei der Hand zu haben.«
»Du bekommst einen guten Preis von mir«, versprach Alois scheinbar versöhnt. »Bring aber zuerst etwas zu essen! Mein Magen hängt mir schon in den Kniekehlen. Weil ich dachte, ich wäre zu spät dran, bin ich nicht mehr eingekehrt. Hätte ich gewusst, dass Martin sich heuer versäumt, hätte ich mir unterwegs freilich etwas Zeit gelassen. Doch ich bin froh, hier zu sein, denn dein Braten ist eh der beste!«
Der Wirt lächelte geschmeichelt und wies dann auf die Küchentür. »Heute kannst du etwas ganz Besonderes bekommen. Bei mir haben nämlich ein paar Herren übernachtet, die zu Mittag unbedingt ein Spanferkel wollten. Ein wenig von dem Fleisch ist noch da. Das wird dir mit einem Stück Brot und meinem Wein gewiss ausgezeichnet schmecken!«
Alois Schneidt fand, dass er sich diesmal einen teuren Braten leisten konnte. »Her damit!«, rief er. »Doch sag es nicht meinem Bruder weiter. Martin ist arg sparsam und würde mich schelten. Aber wozu ist man Mensch, wenn man sich nicht einmal eine kleine Freude gönnen kann?«
»Das sind auch meine Worte«, erklärte der Wirt und ging in die Küche, um das Verlangte zu holen.
Auf Alois Schneidts Gesicht erlosch die betont frohe Miene, die er mühsam aufrechterhalten hatte, und sein Gesicht verzerrte sich wie im Schmerz. Nur wenig später kam der Wirt mit einem vollen Holzteller zurück und sah den Gast verwundert an.
»Was ist denn mit dir los? Hast du dir Blasen gelaufen, oder was, weil du eine so jämmerliche Miene ziehst?«
»Ich mache mir halt Sorgen um meinen Bruder, denn er ist in den letzten zehn Jahren immer vor mir hier eingetroffen. Nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist! Man hört allenthalben von Räubern und wilden Tieren. Und auch die Franzosen darf man nicht vergessen. Die haben schon so manchen braven Mann über die Klinge springen lassen.«
Der Wirt lachte dröhnend. »Bei Gott, du ängstigst dich ja wie ein Mädchen, Schneidt. Dabei bist du ein Trumm von Mannsbild, das selbst mit einem Bären fertigwerden könnte. Dein Bruder ist nicht schwächer als du, und was die Soldaten des vierzehnten Ludwigs angeht, so führt deren Feldzug heuer in eine andere Gegend. Wieso sollte deinem Bruder da etwas zugestoßen sein? Hier! Iss und trink, damit sich deine Eingeweide wieder beruhigen. Bis zum Abend oder spätestens morgen ist der Martin da und wird dich wegen deiner Besorgnis verspotten.«
Alois nickte, als wolle er dem Wirt zustimmen, zog sein Messer und begann, den Braten klein zu schneiden. Als er den ersten Bissen in den Mund schob und darauf herumkaute, sagte er sich, dass er mit dem Spanferkel eine gute Wahl getroffen hatte. Das Fleisch schmeckte ausgezeichnet, und mit dem Essen kehrte auch seine innere Ruhe zurück. Das, was geschehen war, konnte er nicht mehr rückgängig machen, also musste er zusehen, dass er den besten Gewinn daraus schlug. Dies hieß aber, sich mit seinem Neffen auseinanderzusetzen. Gerold war ihm gewiss noch weniger gewachsen, als sein Bruder es gewesen war.
Einen Augenblick dachte er an Klara, die älteste Tochter seines Bruders. Sie war im gleichen Alter wie seine Reglind und galt bei einigen als die Hübschere von beiden. Vor allem aber hatte sie den Dickkopf ihres Vaters geerbt und würde ihrer Mutter wahrscheinlich noch heftiger als ihr Bruder abraten, ihm den Schatz auszuliefern. Einerseits, so sagte er sich, war sie nur ein Mädchen und musste gehorchen, andererseits aber kannte er sie und war sicher, dass sie ihre Mutter und ihren Bruder gegen ihn beeinflussen würde.
»Gegen Gerold und Klara zusammen werde ich einen schweren Stand haben. Doch wenn der Junge im nächsten Jahr mit mir unterwegs ist, sieht die Sache schon anders aus. Was auch geschehen mag – das Gold ist bald mein!«
Im nächsten Augenblick begriff er, dass er erneut seine geheimsten Gedanken laut ausgesprochen hatte, und sah sich erschrocken um. Er befand sich jedoch allein in der Gaststube, denn Bolland war in die Küche zurückgekehrt, und andere Gäste würden erst am Abend eintreffen.
Alois Schneidt atmete tief durch, um die Beklemmung in seiner Brust loszuwerden, und widmete sich wieder seinem Spanferkel. Sobald er seine Hand auf das Gold gelegt hatte, würde er täglich so gut speisen können, dachte er und füllte seinen Becher aus dem Krug, den ihm der Wirt hingestellt hatte.
Erster Teil
Ein beherztes Mädchen
1.
Klara fühlte die tiefe Verzweiflung der Mutter und wünschte sich, ihr helfen zu können. Aber das Unglück, das über sie hereingebrochen war, war so niederschmetternd, dass sie glaubte, darunter zusammenzubrechen. Daher konnte sie den Onkel, der mit düsterer Miene vor ihnen stand, nur hilflos anstarren. Er trug sogar noch das Reff auf dem Rücken, war also gleich zu ihnen gekommen, ohne zuerst seine Frau und seine Tochter zu begrüßen.
»Nein! Nein! Sag, dass das nicht wahr ist, Schwager!«, rief Klaras Mutter ein ums andere Mal.
»Ich wollte, ich könnte es«, antwortete Alois Schneidt schließlich. »Aber ich habe über den Markt in Gernsbach hinaus noch eine ganze Woche auf den Jungen gewartet. Da ja bereits mein Bruder im letzten Jahr nicht von seiner Strecke zurückgekommen ist, bin ich Gerolds letztes Wegstück abgegangen und habe überall nach ihm gefragt. Doch ich fand nicht die geringste Spur von ihm. Daraufhin bin ich seinem Weg rückwärts gefolgt. An ein paar Stellen konnte man sich an ihn erinnern, doch weit kann er nicht gekommen sein. Einige der Leute, mit denen ich gesprochen habe, nehmen an, dass er Räubern wie dem Galljockel und dem Knüppelpeter zum Opfer gefallen ist, und andere meinten, die Franzosen hätten ihn bei einem ihrer Vorstöße umgebracht. In einem Ort hat man mir von einem kaiserlichen Regiment berichtet, das auf seinem Marsch jeden jungen Mann, den seine Werbeoffiziere fanden, unter seine Fahne geholt hätte.«
Klaras Gedanken rasten, und sie zwang sie nur mühsam unter Kontrolle. »Aber du musst doch die Stelle gefunden haben, an der mein Bruder verschwunden ist, Oheim. Wenn er in einem Ort noch gesehen wurde und in dem nächsten nicht, so kann ihm nur dazwischen etwas zugestoßen sein.«
»So einfach, wie du dir das einbildest, ist das nicht!«, fuhr Alois Schneidt sie an. »Ich hab euch doch gesagt, dass einige nicht wussten, ob sie ihn gesehen hatten oder nicht. Ich habe mir wahrhaftig Mühe gegeben und fast einen ganzen Monat lang nach Gerold gesucht. Er hätte niemals gehen dürfen! Nachdem schon mein armer Bruder im letzten Jahr verschwunden ist, habe ich ihn davor gewarnt. Ein Wanderapotheker zu sein ist ein hartes Brot, und wir werden nicht überall gerne gesehen.«
Klara trat einen Schritt zurück, während sie versuchte, sich auf den Bericht ihres Onkels einen Reim zu machen. Gleichzeitig fragte sie sich, ob jemand aus ihrer Familie Gott so erzürnt haben mochte, dass er sie prüfte wie den biblischen Hiob. Sie war sich keiner Schuld bewusst, und sie glaubte, für ihre Mutter und die Geschwister ebenfalls die Hand ins Feuer legen zu können. Das änderte aber nichts daran, dass ihr Vater im letzten Jahr nicht von seiner Wanderung zurückgekehrt war und nun auch von ihrem Bruder jegliche Spur fehlte. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass ihr Onkel gründlicher hätte suchen sollen, auch wenn er das seinen Worten zufolge getan hatte.
Während Klara ihren Gedanken nachhing, sank ihre Mutter in die Knie und rang die Hände. »Mein Herr und Gott, was haben wir nur getan, dass du uns so strafst?«
»Selbst wenn du den Pfarrer fragst, wird er dir darauf keine Antwort wissen«, warf ihr Schwager ein.
Klara kniff verwundert die Augen zusammen. Hatte in den Worten des Onkels etwa Spott mitgeklungen? Ihr Vater war mit seinem Bruder doch stets gut ausgekommen. Nach dessen Verschwinden allerdings hatte der Onkel sich mit ihrem Bruder und der Mutter zerstritten. Trotzdem war er pünktlich im Frühjahr erschienen und hatte Gerold bei den Vorbereitungen für die Wanderung mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Klara bedauerte, dass sie nicht wusste, worum es bei dem Streit gegangen war, erinnerte sich aber, das Wort Gold vernommen zu haben. Als sie mehr hatte herausfinden wollen, war Gerold zornig geworden und hatte es abgelehnt, darüber zu reden. Er hatte es sogar der Mutter verboten.
»Du wirst schon sehen, wohin dein Starrsinn dich bringt!«, hatte der Onkel ihn bei jenem Wortwechsel erbost angefahren.
In Klaras Ohren hatte das wie eine Drohung geklungen. Sie vertrieb diesen Gedanken schnell wieder. Wenn ihnen jetzt noch einer helfen konnte, so war es der Bruder ihres Vaters. Sie hatte keine Vorstellung davon, wie es weitergehen sollte, und sie bezweifelte, dass die Mutter Rat wusste.
»Was wird Herr Just dazu sagen? Er hat uns mehr als ein Viertel der Salben und Essenzen, die Gerold austragen sollte, auf Kommission überlassen, und nun können wir nicht einmal unsere Schulden bei ihm zahlen.«
Die Mutter kniete noch immer weinend am Boden, und Alois Schneidt starrte mit einem Gesichtsausdruck auf sie herab, als wolle er sagen: Jetzt habe ich dich! Außer Klara achtete niemand darauf, denn ihre jüngeren Geschwister drängten sich an die Mutter und weinten so, dass ihnen die Tränen wie kleine Bäche über die Wangen rannen.
»Wenn du willst, werde ich mit dem Herrn Laboranten reden, Schwägerin. Ich muss sowieso nach Königsee, um mit Just abzurechnen. Es wird ihm natürlich nicht gefallen, dass du nicht zahlen kannst. Du weißt ja, wie er gezögert hat, Gerold die Waren zu überlassen. Ihm schien es ein zu großes Risiko, den Jungen loszuschicken, weil Gerold noch keine Erfahrung als Wanderapotheker gemacht hatte. Mein Bruder hätte seinen Sohn schon in den letzten Jahren mitnehmen sollen, damit er dessen Wanderstrecke und vor allem die Menschen kennenlernt, die ihm etwas abkaufen.«
»Dann wäre er im letzten Jahr zusammen mit dem Vater verschwunden!«, rief Klara aus.
Alois Schneidt schüttelte den Kopf. »Das muss nicht sein. Wahrscheinlich hätten sie es gemeinsam geschafft, ihre Strecke zu Ende zu bringen. Doch so ist alles den Bach hinabgegangen. Mein Bruder und mein Neffe sind fort, ihr habt einen Haufen Schulden bei Just, und die Steuern werdet ihr heuer auch nicht zahlen können. Wir sollten daher noch einmal reden, Schwägerin. Einen Ausweg gibt es noch, das weißt du!«
Nun wurde Klara hellhörig. Ging es dabei wieder um Gold wie im letzten Jahr? Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Vater irgendwelche Reichtümer besessen hatte. Zwar war er stets sehr sparsam gewesen, aber er hatte alles Geld, was übrig geblieben war, in das Haus und das Stück Land gesteckt, auf dem ihre Familie nun Kräuter für den Laboranten zog. Ihr Onkel hingegen hatte stets auf großem Fuß gelebt, und dessen Ehefrau gab das Geld ebenso gerne aus wie ihre Base Reglind, sei es für Kleiderstoff oder ein Schmuckstück. Auch leisteten die beiden sich jedes Mal teure Leckerbissen, wenn sie den Jahrmarkt von Königsee oder andere Märkte besuchten. Ihr Vater hatte diese Lebensweise stets bekrittelt. Eine Bratwurst und einen Becher leichten Fruchtweins beim Jahrmarkt für jeden, das hatte er noch eingesehen, mehr aber nicht. Trotzdem hatte er nicht so viele Ersparnisse hinterlassen, wie nötig wären, um die Schulden und die fälligen Steuern bezahlen zu können, geschweige denn, um über den Winter zu kommen.
In ihre Überlegungen verstrickt, hatte Klara die Antwort ihrer Mutter überhört. Dem mit einem Mal so zufrieden glänzenden Gesicht ihres Onkels nach schien sie so ausgefallen zu sein, wie er es erhofft hatte. Klara fand das ganz und gar nicht gut. Wie es aussah, versuchte der Onkel, die Notlage ihrer Mutter auszunützen.
»Ich muss jetzt nach Hause! Mein Weib und meine Tochter machen sich gewiss Sorgen, weil ich wegen der Suche nach Gerold so lange ausgeblieben bin.«
Alois Schneidts Worte verstärkten das Gefühl der Witwe, in seiner Schuld zu stehen, und sie nickte. »Tu das, Schwager! Sobald ich mich besser fühle, werden wir über alles reden. Vielleicht ergibt sich doch ein Ausweg in dieser düsteren Stunde.«
»Der ergibt sich ganz gewiss, Schwägerin!« Damit wandte Alois Schneidt sich ab und schritt die schmale Straße hinab zu seinem eigenen Anwesen.
Das Haus und den kleinen Acker dahinter hatten er und Martin von ihrem Vater geerbt, und da er seinen Bruder mit einer bescheidenen Summe abgefunden hatte, gehörte es nun ihm allein. Martin hatte sich ein anderes Haus gekauft und war trotzdem nur wenige Jahre später besser dagestanden als er. Zwar hatte das Gold aus dem vergrabenen Schatz Alois eine Zeitlang das Gefühl gegeben, reich zu sein, doch es war ihm wie Wasser durch die Hände geronnen.
Zuletzt war es ihm und seiner Familie nur mit Ach und Krach gelungen, über die Winter zu kommen und dem Laboranten jene Erzeugnisse zu bezahlen, die er auf seinen Wanderungen verkaufte. Er hatte schließlich seinen Bruder und nach diesem auch seinen Neffen um Hilfe gebeten, doch die war ihm schnöde verweigert worden. Nun stand seine Schwägerin allein da und hatte keine andere Wahl, als auf seine Forderungen einzugehen.
Während Alois Schneidt auf sein Haus zuschritt, überlegte er, welchen Anteil an dem Schatz er Johanna Schneidt und ihren Kindern überlassen sollte. Die Hälfte erschien ihm zu viel. So viel brauchte die Witwe nicht, zumal sie noch ihren Kräutergarten besaß. Daher würde ein Drittel reichen. Da Frauen bekanntermaßen nicht mit Geld umgehen konnten, fand er schließlich ein Viertel des Schatzes für sie mehr als ausreichend. Es würde auffallen, wenn die Schwägerin zu viel Geld ausgab, denn das konnte zu Fragen führen, die er nicht beantworten wollte.
Mit diesem Gedanken erreichte er sein Heim und sah als Erstes seine Tochter. Sie fütterte gerade mit angeekelter Miene das Schwein. Schneidt roch sofort, warum sie das Gesicht verzog, denn der Koben war schon seit geraumer Zeit nicht mehr ausgemistet worden, und das Schwein stand beinahe bis zum Bauch im eigenen Dreck. Als er genauer hinschaute, entdeckte er sogar Läuse auf dem Rücken des Tieres.
Verärgert verglich er seinen kleinen Hof mit dem Anwesen des Bruders. Dort war alles sauber, und das Schwein und die Ziegen gediehen prächtig. Hier hingegen verlotterte alles.
Als er Reglind deswegen schelten wollte, eilte sie leichtfüßig auf ihn zu, umarmte ihn und küsste ihn auf beide Wangen.
»Du kommst heuer spät, Vater! Hast du mir etwas mitgebracht?«
Dem Charme des hübschen Mädchens vermochte er sich nicht zu entziehen. »Das habe ich, Reglind! Du bekommst es gleich, nachdem du den Schweinekoben ausgemistet hast.«
Jäh verlor sich der erfreute Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Ausmisten?«
Es klang so entsetzt, als hätte er sie eben zu einem Jahr Galeerenstrafe verurteilt.
Alois Schneidt wies mit seinem Stock auf das schmutzige Tier. »Es ist an der Zeit, dass es getan wird!«
Der Tadel ging an Reglind vorbei. Stattdessen warf sie einen finsteren Blick auf das Haus ihres Onkels. »Daran ist nur diese elende Klara schuld! Sie hatte mir versprochen, den Koben auszumisten, es aber nicht getan.«
Das war eine Lüge. Zwar hatte Reglind ihrer Base im Befehlston erklärt, sie solle den Dreck aus dem Koben wegschaffen, aber zur Antwort erhalten, sie habe selbst zwei Hände.
»Klara ist nun einmal ein faules Ding«, erklärte Alois Schneidt und wandte sich der Haustür zu.
Seine Frau hatte ihn kommen sehen und kam mit mehlverschmierter Schürze heraus. »Heuer hast du dir aber Zeit gelassen! Wir befürchteten schon, du wärst ebenso verschwunden wie dein Bruder und hättest uns im Stich gelassen«, schimpfte sie.
»Es war nicht meine Schuld, sondern die von Gerold«, erklärte ihr Mann.
»Der bekommt was von mir zu hören, sobald ich ihn sehe!« Fiene Schneidt bedachte das Anwesen ihrer Schwägerin ebenfalls mit einem finsteren Blick.
Um Alois Schneidts Mund zuckte der Anflug eines Lächelns. »Falls meine Vermutung stimmt, wird dir das kaum gelingen. Mein Neffe ist nämlich ebenso auf seiner Strecke verschwunden wie sein Vater. Die beiden sind vielleicht denselben Schurken zum Opfer gefallen.«
»Gerold ist tot?« Nun klang Fiene Schneidt doch ein wenig erschrocken.
Ihr Mann hob mit einer beschwichtigenden Geste die Rechte. »Ob er das ist, kann ich nicht sagen. Er ist auf alle Fälle nicht mehr aufgetaucht. Ich habe nach ihm gesucht, wie es meine Pflicht als Verwandter ist, aber nicht die geringste Spur entdeckt!«
In Wahrheit hatte er es sich auf dem Rückweg in Wirtshäusern gutgehen lassen, doch das ging seine Frau nichts an.
»Und was wird Johanna jetzt machen, nachdem sie neben dem Mann auch ihren ältesten Sohn verloren hat?«, fragte Fiene Schneidt neugierig. »Ihr Albert ist noch zu klein, um als Wanderapotheker zu gehen. Entweder sucht sie sich für Klara einen Mann, der das fürstliche Privileg übernehmen kann, oder sie verliert es!«
»Wenn sie das Reiseprivileg ihrer Familie einem Schwiegersohn überlässt, wird dieser es wohl kaum an Albert weitergeben, sobald der alt genug ist, um selbst das Reff tragen zu können«, wandte Reglind ein.
Sie gönnte es Klara nicht, vor ihr verheiratet zu werden, war sie selbst doch vier Monate älter als ihre Base und höchst neugierig auf das, was im Bett zwischen Mann und Frau geschah.
»Sobald ihr Kummer sie nicht mehr so arg drückt, werde ich mit ihr reden und zu einer Lösung kommen, die uns allen hilft.« Alois Schneidt bedauerte diese Worte sofort wieder, sagten sie doch schon zu viel über seine Pläne aus.
Die Gedanken seiner Frau gingen in eine andere Richtung. »Wir könnten mit ihr den Hof und das Land tauschen. Mir würde es in ihrem Haus besser gefallen als hier, und in ihrem Garten wächst auch etwas – nicht nur Steine wie bei uns.«
Daran hatte Alois Schneidt noch gar nicht gedacht. Er fand den Vorschlag durchaus bedenkenswert, denn so würde sich besser erklären lassen, weshalb die Schwägerin plötzlich zu ein wenig Geld gekommen war.
»Ich werde mit ihr darüber reden«, sagte er daher, stellte sein Reff in den Schuppen und ging ins Haus. Während er seinen Hut an den Haken hängte und den Rock auszog, wandte er sich an seine Frau, die ihm samt der Tochter gefolgt war.
»Tisch auf, Weib, denn ich habe Hunger!«
»Das übernehme ich!«, rief Reglind und hoffte, das versprochene Geschenk zu erhalten, ohne vorher den Schweinekoben ausmisten zu müssen.
2.
Es war ein trauriger Abend in Johanna Schneidts Heim. Klaras Mutter saß mit den Kindern in der Küche, die nur schwach von der zerfallenden Glut auf dem Herd erleuchtet wurde, und betete, dass Gott ein Einsehen hatte und ihr den Mann und den Sohn zurückgab.
»Ich wollte, ich wäre einige Jahre älter. Dann könnte ich nächstes Jahr das Reff nehmen und durch die Lande ziehen«, sagte der neunjährige Albert nach einer Weile.
»Nein!«, stieß seine Mutter hervor. »Du wirst nicht das Reff über die Landstraßen schleppen! Sollen andere gehen, aber du nicht. Ich will dich nicht auch noch verlieren.«
»Wir können das Wanderapotheker-Privileg nicht so lange behalten, bis du groß genug bist, um in die Fußstapfen des Vaters zu treten«, setzte Klara traurig hinzu.
Die Mutter nickte. »Es wird uns nichts anderes übrigbleiben, als es zurückzugeben. Vielleicht erhalten wir eine Kleinigkeit dafür.«
»Das wird nicht ausreichen, unsere Schulden bei dem Laboranten Just zu bezahlen, geschweige denn die Steuern, die Fürst Ludwig Friedrich erheben will, um seine Residenz auszubauen.«
Klara fand es ungerecht, dass ihr Landesherr, der doch bereits mehrere Schlösser besaß, Schloss Heidecksburg vergrößern und noch prächtiger ausstatten lassen wollte, während sie selbst nicht wussten, wovon sie im nächsten Jahr leben sollten.
»Ich werde mit Schwager Alois reden. Er weiß gewiss Rat«, sagte die Mutter mehr zu sich selbst als zu ihren Kindern.
Klara hob den Kopf und versuchte, in der wachsenden Finsternis das Gesicht ihrer Mutter zu erkennen. Dann stand sie auf, tastete sich zum Herd und blies die niedergebrannte Glut an. »Es ist nicht gut, wenn wir hier im Dunkeln herumsitzen«, sagte sie, während sie die Unschlittlampe an dem aufflammenden Feuer entzündete.
»Um mich herum ist alles dunkel!« Ihren Worten zum Trotz stand Johanna Schneidt doch auf und trat an den Herd, um ein paar Scheite nachzulegen.
»Habt ihr Hunger? Ich habe keinen«, sagte sie.
Klara wollte ebenfalls den Kopf schütteln, doch da meldete sich ihr jüngerer Bruder.
»Hunger direkt habe ich auch keinen, aber ich möchte essen, damit ich rasch wachse und bald so groß und stark werde, dass ich das Reff tragen kann.«
»Du wirst kein Wanderapotheker werden! Vielleicht lernt Herr Just dich als Destillateur an«, antwortete die Mutter. »Dann musst du nicht bei Wind und Wetter durch die Welt ziehen.«
»… sondern sitzt den ganzen Tag am Destillierkolben und mischst Öle an«, setzte Klara den Satz in ihrem Sinn fort. »Mutter, Herr Just hat zwar Gerold aushilfsweise als Destillateur beschäftigt. Doch Albert ist noch zu jung dafür. Warum also sollte Herr Just ihn nehmen?«
»Albert kann den Destillateuren zur Hand gehen«, erklärte die Mutter. »Wenn Just dies ablehnt, obwohl ich meinen Mann und meinen Sohn seinetwegen verloren habe, wird ein anderer unseren Albert anstellen.«
Klara bezweifelte das. Destillateur bei einem Laboranten wurde man, wenn bereits der Vater dort als solcher gearbeitet hatte, oder als jüngerer Sohn eines Laboranten, dem es nicht gelungen war, sich gut zu verheiraten. Bei diesem Gedanken kam ihr eine Idee.
»Wir müssen das Wanderapotheker-Privileg um jeden Preis behalten, Mutter, ganz gleich, ob Albert doch einmal das Reff auf den Rücken nehmen wird oder nicht. Mit ihm ist auch unser Recht verbunden, im Wald nach Kräutern zu suchen. Wenn wir das verlieren, können wir Herrn Just nur noch jene liefern, die wir in unserem Garten ziehen. Die Pflanzen, die er am besten bezahlt, finden wir jedoch nur im Wald.«
Mit bedrückter Miene nickte die Mutter. »Das ist wahr! Ich werde wohl doch auf den Rat des Schwagers hören. Er erscheint mir am besten.«
»Welchen Rat?«, fragte Klara beunruhigt.
»Das ist nichts, was ein Mädchen wie dich etwas angeht! Ich wollte im letzten Jahr bereits darauf eingehen, doch Gerold war dagegen. Hätte ich mich damals durchgesetzt, wäre er noch am Leben. So aber hat er mit seiner Weigerung nur den Schwager verärgert. Wir müssen diesem dankbar sein, dass Alois überhaupt nach dem Jungen gesucht hat.«
Johanna Schneidt begann wieder zu weinen und konnte nicht weiterarbeiten. Daher stellte Klara sich an den Herd, um die Abendsuppe zu kochen.
Anders als sie gab die Mutter sich ganz ihrer Verzweiflung hin. »Ich hoffe, dass mir der Schwager überhaupt noch hilft! Nicht, dass er sich von uns abwendet, weil Gerold ihm im letzten Herbst und auch noch im Frühjahr arg über den Mund gefahren ist. Du warst auch noch so ungefällig, der lieben Reglind nicht den Gefallen zu tun, um den sie dich gebeten hat. Wäre es so schlimm gewesen, den Schweinekoben auszumisten?«
Diesen Vorwurf der Mutter empfand Klara ungerecht. »Ich habe der Tante und Reglind über den Sommer wahrlich genug geholfen!«, erwiderte sie empört. »Erinnere dich, dass ich fast ihr ganzes Heu gemacht habe. Auch sonst war ich immer wieder bei ihnen, um mit anzupacken, ohne von der Tante auch nur ein Stück Brot oder einen anderen Trunk als Wasser zu bekommen. Ich hätte weitaus mehr Kräuter sammeln und an Herrn Just verkaufen können, wenn ich nicht für Reglind hätte mitarbeiten müssen. Sie aber hat es sich gutgehen lassen.«
»Klara hat recht! Reglind ist ein faules Ding«, stimmte Albert seiner Schwester zu und erhielt dafür von der Mutter eine Ohrfeige.
»Ich will kein Wort mehr gegen die Verwandtschaft hören! Verstanden?«, erklärte Johanna Schneidt streng. »Wir sind auf sie angewiesen, wenn wir die nächsten Jahre überstehen wollen. Oder wollt ihr, dass Herr Just uns das Haus über dem Kopf versteigern lässt, weil wir ihm die Öle und Salben, die Gerold mitgenommen hat, nicht bezahlen können?«
Klara hob erschrocken den Kopf. »So böse kann Herr Just doch nicht sein!«