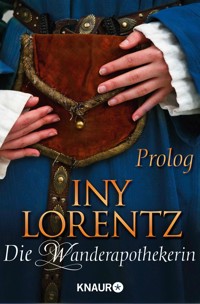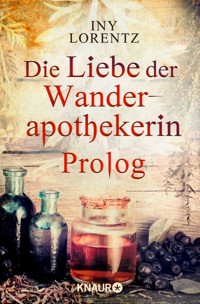16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die ehemalige Wanderhure Marie Adler erlebt ihr 10. Abenteuer: Im 10. historischen Roman der Bestseller-Reihe von Iny Lorentz begleitet Marie ihre Enkelinnen zur Brautschau nach Rom – wo der Papst mit allen Mitteln seine Macht sichern will … Die Enkelinnen der einstigen Wanderhure Marie sind zu bezaubernden jungen Frauen herangewachsen. Da erreicht sie eine Einladung aus Rom. Ein Edelmann aus der einflussreichen Familie Orsini sucht eine Braut. Da Marie Flavia und Michaela Maria als Conte Ercole Orsinis Enkelinnen gelten, will er sie seinem Verwandten vorstellen, damit dieser eine von ihnen als Braut erwählt. Marie begleitet die beiden Mädchen, um über sie zu wachen und ihr Geheimnis zu wahren. Sie ahnt nicht, dass der Papst ganz andere Pläne als Ercole Orsini hegt und die reichen Pfründe für seine Familie sichern will. Marie und ihre Enkelinnen geraten daher in einen Sumpf von Intrigen, der sie zu verschlingen droht. Dramatisch und zum Mitfiebern spannend: der 10. historische Mittelalter-Roman um die Wanderhure Marie Mit »Die Wanderhure und Intrigen in Rom« bietet Bestseller-Autorin Iny Lorentz wieder beste Unterhaltung für alle Mittelalter-Fans. »Die Wanderhuren-Reihe« ist die erfolgreichste deutsche Serie im historischen Roman. Die historischen Bestseller in chronologischer Reihenfolge: - Die Wanderhure - Die Kastellanin - Das Vermächtnis der Wanderhure - Die List der Wanderhure - Die Wanderhure und die Nonne - Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Die Tochter der Wanderhure - Töchter der Sünde - Die junge Wanderhure - Die Wanderhure und Intrigen in Rom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die ehemalige Wanderhure Marie Adler erlebt ihr 10. Abenteuer:
Im 10. historischen Roman der Bestseller-Reihe von Iny Lorentz begleitet Marie ihre Enkelinnen zur Brautschau nach Rom – wo der Papst mit allen Mitteln seine Macht sichern will …
Die Enkelinnen der einstigen Wanderhure Marie sind zu bezaubernden jungen Frauen herangewachsen. Da erreicht sie eine Einladung aus Rom. Ein Edelmann aus der einflussreichen Familie Orsini sucht eine Braut. Da Marie Flavia und Michaela Maria als Conte Ercole Orsinis Enkelinnen gelten, will er sie seinem Verwandten vorstellen, damit dieser eine von ihnen als Braut erwählt. Marie begleitet die beiden Mädchen, um über sie zu wachen und ihr Geheimnis zu wahren. Sie ahnt nicht, dass der Papst ganz andere Pläne als Ercole Orsini hegt und die reichen Pfründe für seine Familie sichern will. Marie und ihre Enkelinnen geraten daher in einen Sumpf von Intrigen, der sie zu verschlingen droht.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zehnter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Elfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Zwölfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Historischer Überblick
Personen
Glossar
Erster Teil
Der Plan des Kardinals
1.
Der Reisewagen hielt auf dem steinernen Platz vor dem atemberaubend großen Palazzo Orsini. Sofort eilten zwei Dutzend Bewaffnete mit Hellebarden in der Hand herbei, um die Insassen der Kutsche vor jeder Gefahr zu schützen.
Der Lakai verließ seinen Platz neben dem Kutscher auf dem Bock, stieg ab und klappte den Einstieg aus. Im selben Moment kam ein Herr in einem prachtvollen Brokatrock, eng anliegenden, gewirkten Strümpfen und einem in Schwarz, Gold, Blau und Rot geviertelten Barett aus dem Tor und trat auf die Kutsche zu.
»Seid mir herzlich willkommen, Conte Ercole, Contessa Flavia!«, grüßte er und deutete eine Verbeugung an.
Ercole Orsini fragte sich verwundert, weshalb Raimondo, der immerhin Sohn und Erbe des Herzogs von Gravina war, ihm und seiner Gattin die Ehre erwies, sie bereits vor ihrem Eintritt in den Palazzo zu begrüßen. Er hatte Raimondo und dessen Vater seit Jahren nicht mehr gesehen und hätte von sich aus auch keine weitere Zusammenkunft angestrebt. Das Schreiben jedoch, das ihm von einem Boten des Duca Jacobello überreicht worden war, hatte er nicht ignorieren dürfen.
»Ich danke Euch, mein Herr!«, beantwortete er den Gruß und zeigte damit deutlich, dass er auf Abstand bedacht war.
Seine Gemahlin Flavia grüßte Raimondo Orsini ebenfalls kühl. Auch wenn sechzehn Jahre seit jenem schlimmen Tag vergangen waren, an dem sie ihre Tochter durch einen Meuchelmörder verloren hatte, so verziehen weder sie noch Conte Ercole dem Herzog von Gravina, dass diese Tat durch einen seiner Handlanger begangen worden war.
Auch wenn Raimondo Orsini die deutliche Ablehnung des alten Paares nicht entging, lächelte er und bat sie freundlich, ihm in den Palazzo zu folgen. »Wir haben weitere Gäste, die sich freuen werden, Euch wiederzusehen«, setzte er hinzu.
Nun erst stieg Conte Ercole aus und half seiner Gemahlin aus der Kutsche. Das Paar war dunkel gekleidet und trug keinerlei Schmuck. Lediglich eine kleine goldene Stickerei auf der rechten Brustseite, die ein Kreuz zeigte, aus dessen Querbalken zwei Zweige wuchsen, zeugte vom Stand der Gäste.
Während die Kutsche weggebracht wurde, führte Raimondo Orsini die Gäste in den Palazzo. Einen Augenblick lang musterten die beiden das aufgestockte Marcellus-Theater, das ihrer Sippe als Stadtfestung wie auch als Schauplatz rauschender Feste diente. Conte Ercoles Einschätzung nach standen hier mehr Bewaffnete als in früheren Zeiten.
»Ihr habt ungewöhnlich viele Söldner zusammengeholt. Ist es in Rom wieder gefährlicher geworden?«, fragte er Raimondo Orsini.
Dieser lachte leise. »Ein Teil davon zählt zu Gentile Virginios Condotta. Er befindet sich ebenfalls unter unseren Gästen, wie auch etliche andere, die Euch und Contessa Flavia lange vermissen mussten.«
Die Tatsache, dass Gentile Virginio Orsini mit einer recht stattlichen Schar seiner Söldner erschienen war, wies nicht gerade auf friedliche Zeiten hin, dachte Conte Ercole mit Sorge. Dabei war es in Rom nie wirklich friedlich zugegangen. Immer wieder hatte sich ihre Familie gegen rivalisierende Sippen zur Wehr setzen müssen. Wahrscheinlich ging es auch diesmal um Macht und Einfluss in der Stadt und damit in halb Italien.
In seinen jungen Jahren hatte Conte Ercole sich an diesen Kämpfen beteiligt, wie auch an den Intrigen, die dafür gesponnen werden mussten. Seit dem Tod seiner Tochter aber hatte er sich zurückgezogen und führte mit seiner Gemahlin ein geruhsames Leben. Die meiste Zeit verbrachten sie außerhalb von Rom auf ihrem Landgut, das von den fünfzig Trabanten, die er dort hielt, gut verteidigt werden konnte. Rom mieden sie und wären auch an diesem Tag nicht zurückgekehrt, hätte Duca Jacobellos Einladung nicht so dringlich geklungen.
Raimondo Orsini tat weiterhin so, als bemerkte er die steife Zurückhaltung des alten Paares und die abweisenden Mienen nicht, und berichtete in munterem Tonfall, wer alles gekommen sei, um an diesem Fest teilzunehmen.
»Gibt es etwas zu feiern? Bis jetzt war mir nichts bekannt«, fragte Conte Ercole.
»Es gibt einige Gründe«, erklärte Raimondo Orsini lächelnd. »Da und dort sind Verlobungen zu vermelden, und der Besitz eines verstorbenen Onkels muss seinem Testament gemäß aufgeteilt werden. Er hat übrigens auch Euch bedacht! Auch müssen wir dringend die jetzige Situation in Rom und im Patrimonium Petri besprechen.«
Bis auf das Testament, dessen Inhalt der Herzog von Gravina ihm zumal brieflich hätte mitteilen können, war für Conte Ercole kein Grund zu erkennen, weshalb seine Gemahlin und er auf diesem Familientreffen anwesend sein sollten. Da kommt noch etwas nach, dachte er und fragte sich besorgt, was das sein mochte.
2.
Der Conte und seine Gemahlin kannten den Palazzo von früheren Besuchen her. Daher wunderten sie sich, als der Majordomo, in dessen Obhut Raimondo Orsini sie gegeben hatte, sie in eines der Prunkgemächer führte. Es bestand aus einem Schlafraum mit einem wuchtigen Himmelbett und mit kunstvollen Tapisserien bespannten Wänden, einem Ankleidezimmer und einem kleinen Salon, dessen Fenster einen guten Ausblick auf den Platz vor dem Palazzo boten.
»Eine kleine Kammer, in der wir kurz ruhen könnten, hätte uns durchaus genügt«, erklärte Contessa Flavia abweisend.
Der Majordomo verneigte sich. »Verzeiht, doch Seine Gnaden, der Herzog, wünscht das so! Ihr seid seine Gäste und werdet die Nacht hier verbringen.«
»Das ist nicht in meinem Sinne!«, erklärte Graf Ercole scharf.
»Wir haben den Kammerdiener meines Gemahls und meine Zofe zu unserem Stadtpalazzo geschickt. Wie sollen wir uns in diesem Haus ohne die beiden behelfen?«, setzte Contessa Flavia tadelnd hinzu.
Als hätten sie auf dieses Stichwort gewartet, kamen die Genannten herein. Die Frau knickste, während der Mann sich verbeugte.
»Wie Ihr seht, haben Seine Gnaden, der Herzog, auch daran gedacht und den Befehl gegeben, die beiden noch vor dem Tor Eures Palazzos aufzuhalten und hierherzubringen«, erklärte der Majordomo lächelnd.
Danach verabschiedete er sich und überließ das Paar dem Kammerdiener und der Zofe. Diese halfen dem Grafen und seiner Gemahlin, die Mäntel abzulegen, und bürsteten ihnen die Kleidung aus. Während das alte Paar sich den Reisestaub von Händen und Gesicht wusch, brachten Lakaien Wein und Früchte und verließen den Raum so leise, wie sie gekommen waren. Nun zogen sich auch ihre eigenen Bediensteten zurück, damit die Herrschaften etwas ruhen konnten. Davor versicherten sie ihnen noch, dass sie in einer Stunde wiederkämen, um ihnen zu helfen, sich für das heutige Fest zurechtzumachen.
»Was meint Ihr, mein Gemahl? Sind wir Gefangene des Herzogs?«, fragte Contessa Flavia besorgt, als sie endlich unter vier Augen sprechen konnten.
Ihr Mann entblößte die Zähne zu einem bissigen Grinsen. »Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler! Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Früher sind wir mit Herzog Jacobello gut ausgekommen und haben ihm auch später keinen Grund gegeben, uns zu zürnen.«
»Trotzdem ist es seltsam, dass wir die Nacht über hierbleiben sollen. Früher konnten wir doch auch nach den Festen in unseren eigenen Palazzo zurückkehren.« Contessa Flavia wusste sich keinen Reim auf die Situation zu machen. Mit einem Gefühl der Hilflosigkeit setzte sie sich auf einen bequemen Stuhl und schloss die Augen. Nach einer Weile trat ein sanfter Ausdruck auf ihr sonst so ernstes Gesicht.
»Ich habe unser Kind so gesehen, wie es damals war. Sollte das ein Vorzeichen sein?«, fragte sie ihren Mann.
Graf Ercole hob beschwichtigend die Hand. »Nicht alles, woran man denkt, ist ein Vorzeichen, meine Liebe. Meine Gedanken gelten auch gelegentlich unserer Tochter. Trotzdem eile ich nicht zu einer Wahrsagerin, um diese zu befragen, weshalb dies so ist.«
Seine Frau zog den Kopf ein, denn vor zwei Jahren hatte sie so intensiv von ihrer Tochter geträumt, dass sie sich von einer dieser Frauen hatte beraten lassen. Nach Graf Ercoles Ansicht waren die hundert Dukaten, die sie dafür bezahlt hatte, hinausgeworfenes Geld gewesen, und er hatte die blumige Erzählung, die jene Frau sich aus den Fingern gesogen hatte, als Unsinn abgetan.
»Wie mag es den Kleinen ergehen?«, fragte Gräfin Flavia voller Sehnsucht.
Die Miene ihres Mannes wurde für einen Augenblick hart. Er atmete tief durch und zuckte dann mit den Achseln. »Dem letzten Brief nach, den wir von ihnen erhalten haben, leben sie noch, sind gesund – und sehr teutonisch!«
Sechzehn Jahre hatten nicht ausgereicht, um seinen Groll über die heimliche Heirat seiner Tochter Francesca mit einem nachrangigen deutschen Ritter zu mindern. Dabei hatte ihn die Ehe, die Herzog Jacobello von Gravina für seine Tochter damals hatte stiften wollen, nicht weniger erzürnt.
»Dario d’Specchi war ein Schwein und sein Sohn Cirio eine Ratte«, entfuhr es ihm.
Seine Frau zuckte zusammen. »Wie kommst du jetzt auf die beiden Schurken? Möge der ewige Richter ihnen am jüngsten aller Tage das Himmelreich verwehren, sodass sie auf ewig in der Hölle schmachten müssen. Sie haben uns das einzige Kind gekostet.« Die letzten Worte wurden von einem Tränenstrom begleitet, der sich zu einem verzweifelten Schluchzen steigerte.
Graf Ercole verfluchte sich, weil er den Namen des Mörders seiner Tochter und dessen Vater genannt hatte. »Verzeih mir, meine Liebe!«, sagte er und legte einen Arm um die Schulter seiner Gemahlin.
Flavia beruhigte sich langsam und blickte zu ihm auf. »Auch wenn so viele Jahre seitdem vergangen sind, so schmerzt es mich noch wie am ersten Tag.«
3.
Als ihr Dienerpaar zurückkehrte, hatte Contessa Flavia sich beruhigt und wirkte so kühl wie immer. Sie hatte die Tränen abgewaschen und ließ sich nun die Haare neu aufstecken. Ihr schwarzes Kleid behielt sie an, ebenso ihr Ehemann das schwarze Wams und die gewirkten schwarzen Strümpfe. Auch sein Barett war schwarz und mit einer einzigen schwarzen Feder geschmückt. Trotz ihres Alters waren beide Eheleute stattliche Gestalten. Graf Ercole hatte sich die schlanke Gestalt der Jugend bewahrt, doch die scharfen Falten und das silberweiße Haar wiesen darauf hin, dass er den Zenit seines Lebens bereits vor etlicher Zeit überschritten hatte. Seine Gemahlin hatte eine leichte Fülle gewonnen, doch ihr Gesicht war noch glatt. Auch leuchtete ihr Haar rot unter ihrer barettartigen Kopfbedeckung hervor, das allerdings mochte auch dem Geschick ihrer Zofe und diversen Mittelchen geschuldet sein.
Als sie den Festsaal erreicht hatten, stellten sie fest, dass dieser Platz für gut einhundert Leute bot. Viel weniger waren auch nicht anwesend. Bereits auf den ersten Blick erkannten sie etliche Verwandte aus fast allen Zweigen der Familie. Die meisten der Jüngeren waren ihnen jedoch ebenso unbekannt wie sie diesen, und so sahen sie sich etlichen fragenden Blicken ausgesetzt.
Da der Herzog von Gravina darauf verzichtet hatte, seine Gäste durch einen Zeremonienmeister oder Herold vorstellen zu lassen, wurden Graf Ercole und Gräfin Flavia ohne Begrüßung zu den ihnen zugedachten Plätzen an der riesigen Tafel geführt. Um der großen Zahl der Gäste gerecht zu werden, bildeten die Tische ein großes Viereck, wobei an einer der Schmalseiten genug Platz gelassen worden war, sodass die Lakaien die Speisen mit kleinen Servierwagen in den freien Raum hineinfahren und sie von dort aus vorlegen konnten.
Einige, die den Grafen und seine Frau kannten, riefen ihnen Grüße zu. Nicht wenige von ihnen schienen sich jedoch zu wundern, dass sie bei einer solchen Feierlichkeit anwesend waren. Immerhin hatten sie sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten rargemacht.
Einige der Älteren trugen ebenfalls dunkle Farben und stachen wie sie selbst aus der Masse der Gäste heraus, die sich auffällig bunt gekleidet hatten. Die meisten Männer trugen Seide und Brokat in leuchtenden Farben. Einer hatte sich sogar ganz in Rot und Silber gehüllt, die Wappenfarben der Orsini.
Kardinal Latino Orsini, der in Graf Ercoles Nähe saß, wies mit einem nachsichtigen Lächeln auf den so auffallend gekleideten Mann. »Das ist Gentile Virginio, der trotz seiner Jugend bereits ein bekannter Kriegsheld und Heerführer geworden ist. Ihr werdet gewiss von ihm gehört haben.«
»Das haben wir!«, antwortete Conte Ercole in einem Ton, dem nicht zu entnehmen war, ob ihm das, was er von dem Condottiere gehört hatte, zusagte oder nicht.
Die Gräfin musterte unterdessen die anwesenden Damen und stellte fest, dass sie sich alle in Samt und Seide gehüllt hatten. Dazu waren ihre Kleider reich bestickt und wiesen unterschiedlichste Krägen und Ärmel auf. Allen Damen war gemeinsam, dass sie einander mit der Fülle ihres Schmucks zu übertreffen suchten. Selbst einige der älteren Frauen, die sich für gedeckte Farben entschieden hatten, bildeten keine Ausnahme. Anders als diese trug Contessa Flavia scheinbar gar keinen Schmuck. Von dem goldenen Kruzifix, das an einem dünnen Kettchen unter ihrem Hemd auf der Brust hing, wussten nur sie selbst und ihre Zofe.
Unterdessen stellte Kardinal Orsini dem Grafen weitere Gäste vor, darunter Condottiere Girolamo und Napoleone Orsini, außerdem Giovanni Battista Orsini, der bereits hohe Ämter in der Kirche innehatte. Die meisten dieser Verwandten hatte Conte Ercole als Kinder gesehen, manchmal auch noch als junge Männer, und einige hatte er ganz vergessen.
»Und das dort ist Conte Onofrio!«, sagte der Kardinal und wies auf einen Herrn, den Conte Ercole zwischen vierzig und fünfzig schätzte. Der Mann war untersetzt und trug dunklen Brokat. Sein Wams war mit einem breiten Pelzstreifen besetzt, und sein unförmiges Barett fiel ihm auf einer Seite bis auf die Schulter. Eine breite Goldkette mit einem auf die Entfernung nicht zu erkennenden Symbol und bis zu drei Ringe an den einzelnen Fingern wiesen ihn als reichen Mann aus.
Ein Laffe, dachte Conte Ercole, während der Kardinal weitersprach. »Conte Onofrio ist der Letzte seines Zweiges und vor Kurzem Witwer geworden. Seine Besitzungen liegen in Lazio, in der Romagna, in der Toskana und in Kampanien. Dazu zählt auch Castello Marella, das den Weg zwischen mehreren Besitzungen unserer Familie beschützt.«
Conte Ercole nickte und ließ den Kardinal erzählen. Für einige Augenblicke befürchtete er, dieser werde ihm jeden Gast so ausführlich beschreiben wie Onofrio, doch Latino Orsini beließ es zumeist bei den Namen. Daher versuchte Conte Ercole nach Kräften, sich die dazugehörigen Gesichter zu merken, doch schon bald schwirrte ihm der Kopf, sodass er es aufgab. Die sechzehn Jahre, die er sich von seiner Familie weitestgehend ferngehalten hatte, machten sich bemerkbar. Aus Knaben waren junge Männer geworden, aus jungen Männern nicht mehr so junge, während andere bereits dem Greisenalter zustrebten. Eines aber begriff er: Es waren Vertreter von mindestens drei Linien der Orsinis versammelt, und es würde in den nächsten Tagen etliche Gespräche geben, sei es, um Ehen anzubahnen oder um ältere Familienmitglieder dazu zu bewegen, jemanden in ihren Testamenten zu bedenken.
Da Conte Ercole beides nicht wollte, fragte er sich erneut, weshalb der Herzog ihn eingeladen hatte. Giacomo Orsini, den alle nur Jacobello nannten, saß in Onofrios Nähe und richtete auch mehrmals das Wort an ihn. Die Aufmerksamkeit des Sippenoberhaupts für diesen unsympathisch wirkenden Verwandten irritierte Conte Ercole, und er sah sich weiter um.
Mit einem Mal zupfte seine Frau ihn am Ärmel. »Könnt Ihr Seine Eminenz nach jenem Jüngling dort am unteren Ende der Tafel fragen? Er erinnert mich an jemanden, ohne dass ich es fassen kann«, bat sie ihn.
Conte Ercole blickte in die gewiesene Richtung und sah zwei junge Männer, die jeweils am Abschluss der Tafel saßen. Zwischen ihnen befand sich die Lücke, die von den Lakaien benutzt wurde, um in das freie Innere der Tafel zu gelangen.
»Welchen meint Ihr, den rechts oder den links?«, fragte er seine Frau.
Der Kardinal hatte ihn gehört und sah nun selbst zu den beiden Jünglingen hinüber. »Der Linke mit den rötlichen Haaren ist einer der Sekretäre des Grafen, der andere Valerio Grancio, ein Gefolgsmann Conte Onofrios.«
»Er ist sogar ein Halbbruder Onofrios. Ein Fehltritt, den sein Vater im höheren Alter begangen hat«, warf eine ältere Dame ein.
»Den meine ich nicht, sondern den anderen. Weiß jemand seinen Namen?«, fragte Contessa Flavia.
»Er heißt Daniele Iracondia«, berichtete die Dame.
Der Name stieß ebenso wie das Aussehen des jungen Mannes etwas in Gräfin Flavia an. Doch sosehr sie in ihrer Erinnerung suchte, vermochte sie nichts zu finden. Ihr blieb auch keine Zeit, lange nachzudenken. Da die Hauptgänge bereits serviert worden waren, gab es für die Gäste eine Pause, bevor es wieder ans Tafeln ging. Um diese Spanne zu verkürzen, hatte der Herzog Spielleute und Gaukler holen lassen, die nun ihre Künste darboten. Zu ihnen gehörte ein Buffone, ein Spaßmacher, der die Anwesenden mit geschickt gesetzten Worten zuerst beleidigen und dann in den Himmel heben konnte.
Unwillkürlich amüsierte Conte Ercole sich und stellte fest, dass sich auch die Mundwinkel seiner Frau zu einem Lächeln bogen. Vielleicht haben wir doch zu zurückgezogen gelebt?, fragte er sich. Doch sogleich kam er wieder zu dem Schluss, dass es so besser gewesen war. Er hätte sich sonst stärker für die Familie einsetzen und mit Männern zusammenarbeiten müssen, die er verachtete. Ein einziges Mal hatte er seinen Unwillen niedergekämpft, weil Herzog Jacobello es von ihm gefordert hatte. Im Nachhinein betrachtet hätte er sich weigern müssen, denn für ihn und seine Frau waren nur Leid und Tränen daraus entstanden.
»Übrigens haben wir heute einen besonderen Gast bei uns«, erklärte Kardinal Latino Orsini dem Grafen in einer kleinen Pause zwischen den Vorstellungen der Gaukler. »Donna Lucrezia Tornabuoni de Medici sitzt direkt neben dem Herzog. Sie ist Piero de Medicis Ehefrau und auf Brautsuche für ihren Sohn Lorenzo. Ich werde morgen mit ihr sprechen und ihr Clarice, die Tochter meiner Schwester Maddalena und ihres Gemahls Giacomo Orsini de Monterotendo, ans Herz legen. Ein Bündnis mit Florenz würde unseren Stand in Rom und in ganz Italien verbessern.«
Ohne es zu wollen, träufelte er damit Säure in Conte Ercoles Gemüt. Giacomo Monterotendos Tochter sollte dem Sohn und Erben von Florenz angenehm gemacht werden, während er, der im Rang nicht geringer war, seine Tochter einem aus der Gosse emporgestiegenen Lumpen hatte geben sollen. Es war daher kein Wunder, dass Francesca sich diesem Tedesco zugewandt hatte. Glück hatte es ihr keines gebracht, denn der verschmähte Bräutigam hatte sie aufgespürt und so schwer verletzt, dass sie daran gestorben war. Bei dem Gedanken musste Conte Ercole mit Schmerzen an die Zwillinge denken, die sie vor ihrem Tod noch geboren hatte. Diese weilten fern von Rom in Germania und wurden dort zu Teutoninnen erzogen.
»Wir hätten darauf dringen sollen, dass sie bei uns bleiben«, flüsterte er und wunderte sich selbst darüber.
Im Gegensatz zu seiner Frau war er bislang froh gewesen, die Mädchen als Töchter eines Deutschen in der Ferne zu wissen, denn solange er denken konnte, hatte er die Deutschen als dumpfe Schlagetots verachtet. Da sich seine Lebenszeit jedoch dem Ende zuneigte, sehnte er sich nach den Enkelinnen, in deren Adern zumindest zur Hälfte das edle Blut seiner Familie floss.
Mit einer gewissen Mühe wandte er sich wieder den Festivitäten zu. Jacobello Orsini ehrte Lucrezia de Medici dadurch, dass er ihr nicht nur zutrank, sondern ihr auch den ersten Teller mit Süßspeisen darreichen ließ, der eigentlich ihm vorgelegt worden war. Als Nächster erhielt Onofrio Orsini einen Teller, und schließlich wurden auch Ercole und seine Frau vor allen anderen auf diese Weise bedacht.
»Vor zwanzig Jahren hätte ich mich über diese Geste gefreut. Es hätte bedeuten können, dass der Duca von Gravina eine passende Ehe für Francesca im Sinn hat. Heute jedoch bedeutet es mir nichts mehr«, erklärte Contessa Flavia bitter.
Kardinal Latino Orsini hörte es, lächelte jedoch nur. Dann legte er Conte Ercole die Hand auf den Arm. »Jacobello Orsini wünscht, Euch und Eure Gemahlin morgen zu empfangen. Es werden nur wenige Leute anwesend sein.«
»Darunter wohl auch Ihr?«, fragte Conte Ercole bissig.
Das sanfte Lächeln und Nicken des Kardinals war ihm Antwort genug, und er fragte sich, was der Herzog Gravina von ihm wollte. Doch selbst, als sie das Fest verlassen hatten und er mit seiner Frau noch im Bett darüber sprach, fanden sie darauf keine Antwort.
4.
Als Ercole und Flavia Orsini am nächsten Vormittag erwachten, standen ihnen ihr Kammerdiener und ihre Zofe sofort zur Verfügung, und sie konnten sich aus ihrem eigenen Gepäck frisch ankleiden lassen. Nachdem sie frisiert waren, nahmen sie ihr Frühstück ein. Sie unterhielten sich über einige der Gäste, die sie entweder beeindruckt oder über die sie sich amüsiert hatten.
»Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, dass wir uns in den letzten fünfzehn Jahren so stark zurückgezogen haben«, sagte Conte Ercole schließlich. »Ich habe gestern mehrere Leute getroffen, mit denen ich gerne gesprochen hätte.«
»Das mag sein«, antwortete seine Frau, die nach wie vor der Stille und der Abgeschiedenheit den Vorzug vor solchen Festen gab.
»Jedenfalls wollen Gravina und der Kardinal heute mit uns sprechen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was sie von uns wollen«, sagte der Graf und setzte hinzu, dass dies auch mit weniger Aufwand hätte geschehen können.
»Ich vermag es Euch auch nicht zu sagen, mein Herr!«, sagte Contessa Flavia ablehnend. »Als wir das letzte Mal zum Vater des jetzigen Herzogs gerufen wurden, brachte uns dies nur Schmerz und Trauer.«
»Ich bin gespannt, wie lange man uns hier warten lassen wird!«, antwortete der Conte, der bereits unruhig wurde.
Seit anderthalb Jahrzehnten war er es gewohnt, selbst zu bestimmen, was er tun wollte. Daher fühlte er sich nun wie ein Pferd, das im Stall eingesperrt war und darauf warten musste, bis es seinem Herrn nach einem Ritt zumute war.
Da niemand kam, entschlossen sie sich, noch ein wenig zu ruhen. Doch bald darauf kam der Haushofmeister des Herzogs zur Tür herein und verbeugte sich vor ihnen.
»Seine Gnaden, der Herzog von Gravina, bittet Euch, zu ihm zu kommen!«
Der Conte und seine Frau wechselten einen kurzen Blick und folgten dem Mann über mehrere Flure in einen der kleineren Prunkräume des Palazzos. Dabei entging ihnen, dass auf ihrem Weg eine Tür einen Spalt weit geöffnet wurde und Daniele Iracondia hinter ihnen herschaute.
Kaum waren das Grafenpaar und der Haushofmeister in ein anderes Zimmer geführt worden, trat Daniele in den Flur und sah sich rasch um. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, eilte er zur Treppe und stieg ein Stockwerk höher. Dort wollte er in einen Raum treten, der genau über dem lag, in dem der Herzog das Paar empfing. Als er die Tür öffnete, sah er einen Bewohner des Palazzos mit geschlossenen Augen auf einem Sessel sitzen. Der Mann schien zu schlafen, doch Daniele fiel auf, dass dessen Kopf direkt neben der leicht geöffneten Klappe eines Kamins lag, der durch alle Stockwerke nach oben führte.
Daniele zog sich leise zurück, war aber sicher, dass Isidoro Orsini nicht schlief, sondern aufmerksam lauschte. Gleiches führte er im Schilde, und so stieg er ein Stockwerk höher. Diesmal war die Kammer frei, und er konnte eintreten. Um nicht überrascht zu werden, versperrte er sie und betete gleichzeitig, dass er nicht beim Verlassen gesehen werde. Sollte der Herzog zu der Überzeugung gelangen, er könne gelauscht haben, wären ihm ein Dolchstich und ein ewiges Bad im Tiber gewiss.
Angespannt trat er zum Kamin, öffnete die Klappe und spitzte die Ohren, um zu belauschen, was zwei Stockwerke tiefer besprochen wurde.
5.
Zu ihrer Verwunderung fanden Gräfin Flavia und ihr Mann außer dem Herzog von Gravina, dessen Sohn Raimondo und Kardinal Latino Orsini auch Onofrio Orsini, dessen jungen Gefolgsmann Valerio Grancio und einen Pater vor, der neben Conte Onofrio saß und eben noch auf diesen eingeredet hatte.
Der Herzog empfing das alte Paar mit einem freundlichen Lächeln. »Es erfreut mich, Euch nach so langer Zeit wieder in meinen Mauern begrüßen zu können.«
»Ich danke Euer Gnaden auch im Namen meiner Gemahlin für Eure Gastfreundschaft«, antwortete Conte Ercole mit hörbarer Distanz.
»Hebt Euch das ›Euer Gnaden‹ für die Zeit auf, in der wir unter Leuten sind. Unter so engen Verwandten ist es nicht nötig. Nennt mich Jacobello wie in alten Zeiten«, erklärte der Herzog lächelnd.
Conte Ercole verzog verwundert die Lippen. Im Allgemeinen achtete Giacomo Orsini sehr darauf, so angesprochen zu werden, wie es ihm gebührte. Mit dem Gefühl, dass hier etwas vor sich ging, das seine Frau und ihn aus ihrem ruhigen Leben reißen konnte, verbeugte er sich und nahm Platz. Seine Frau setzte sich neben ihn und war ebenso auf Abstand bedacht wie er – und nicht weniger neugierig.
Nach weiteren Höflichkeitsfloskeln musterte der Herzog zuerst Onofrio Orsini und dann das Grafenpaar. »Es gibt wichtige Dinge zu besprechen«, erklärte er mit ernster Stimme. »Ich habe mich mit Kardinal Latino beraten, wie wir den Einfluss, die Macht und den Besitz unserer Familie erhalten können.«
»So ist es!«, stimmte ihm der Kardinal zu und sah Onofrio Orsini an. »Ihr, mein lieber Onofrio, seid ein sehr reiches und mächtiges Mitglied unserer erlauchten Familie, und ich bedauere sehr, dass Eure Gemahlin verstorben ist, ohne Euch einen Sohn und Erben geschenkt zu haben.«
»Contessa Tullia starb bei der Geburt eines Sohnes. Bedauerlicherweise rief unser Herr im Himmel auch das Kind zu sich. Ich konnte ihm gerade noch mit einer Nottaufe das Himmelreich erhalten«, warf der Pater ein.
»Es ist ein Jammer, dass es so gekommen ist! Contessa Tullia war nicht mehr jung, und doch hat sie alles getan, um diesen Zweig der Orsini am Leben zu erhalten. Es kostete sie das Leben, ohne dass es ihr gelang.« Latino Orsini klang tadelnd, so als würde er es der Frau, aber auch Gott zum Vorwurf machen, dass dies hatte geschehen müssen. Er räusperte sich und legte mehrere Dokumente auf den Tisch. »Dies hier ist eine Abschrift des Testaments Eures Großvaters, Conte Onofrio. Es besagt, dass Euer gesamter Besitz nach dem Aussterben Eurer Linie an Eure Tante Immaculata beziehungsweise deren Kinder fallen soll.«
Der Herzog nickte und ergriff wieder selbst das Wort. »Es ist noch schlimmer! Eure Tante hat mit Contessa Mafalda nur eine einzige Enkelin. Seiner Heiligkeit, Papst Paolo secondo, ist dies nicht entgangen, und er betreibt mit Nachdruck die Werbung um dieses Mädchen für seinen Neffen Massimo. Sein Ziel ist es, diesem Verwandten Conte Onofrios Besitz zu verschaffen und uns Orsini damit zu schwächen.«
»Im Falle eines Streits mit dem Papst wäre dessen Neffe in der Lage, von Castello Marella aus etliche unserer Landgüter und Dörfer und sogar zwei Städte zu besetzen, ohne dass wir ihn daran hindern können«, erklärte Kardinal Latino, um die Gefahr zu verdeutlichen.
Conte Ercole fragte sich verärgert, was diese Angelegenheit mit ihm zu tun hatte. »Ich finde solche Überlegungen müßig. Conte Onofrio ist noch kein Greis, und selbst als solcher wäre er noch in der Lage, eine weitere Ehe einzugehen, die unser Herr im Himmel mit Kindern segnen könnte«, sagte er in der Hoffnung, sich bald verabschieden zu können.
Auf das Gesicht des Kardinals trat ein Lächeln. »Ihr sprecht wahre Worte, Vetter Ercole! Dies ist nämlich auch mein Rat, den ich Conte Onofrio gegeben habe. Er ist es unserer Familie schuldig, sich erneut ein Weib zu nehmen, damit seinen Lenden eine weitere Generation entspringt.«
»So ist es«, erklärte der Herzog in einem Tonfall, der jeden Widerspruch von vorneherein ausschließen sollte.
»Ich habe mein Weib über alles geliebt. Wie sollte ich da eine andere an ihre Stelle setzen, die ich weder lieben noch so in Ehren halten kann, wie ich es tun müsste?«, wandte Onofrio Orsini widerspenstig ein.
Der Pater legte ihm die Hand auf den Arm. »Es ist Gottes Wille, dass Eure Gemahlin von Euch gegangen ist. Ihr steht jedoch Eurer Familie gegenüber in der Pflicht. Verweigert Ihr sie, legt Ihr den Feinden Eurer Familie ein scharfes Schwert in die Hand, das schmerzhafte Wunden hervorrufen kann.«
Da Conte Onofrio nur leise schnaubte, sprach der Pfarrer weiter. »Oder glaubt Ihr, Ihr könntet Euren Halbbruder als Euren Erben einsetzen?«
»Den Sohn der Ziegenhirtin? Niemals!«, fuhr Conte Onofrio auf.
»Laut dem Testament Eures Großvaters darf Euer Besitz nur an ehelich geborene Kinder vererbt werden. Selbst eine nachträgliche Anerkennung reicht dafür nicht aus, es sei denn, sie würde durch Seine Heiligkeit vollzogen. Das aber wird der Papst mit Gewissheit nicht tun!« Latino Orsini klang tadelnd, so als habe er schon mehrfach mit Conte Onofrio gesprochen, ohne diesen zur Einsicht bringen zu können.
»Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Conte Onofrio eine Orsini zu heiraten hat«, erklärte der Herzog von Gravina erneut in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
»Hier kommt Ihr ins Spiel, Conte Ercole und Contessa Flavia«, fuhr der Kardinal fort. »Wir haben Euch vor gut siebzehn Jahren aufgefordert, Eure einzige Tochter mit einem jungen Mann zu verheiraten, der uns gemeinsam mit seinem Vater gute Dienste geleistet hat.«
»Cirio d’Specchi war ein elender Mörder!«, stieß Conte Ercole voller Zorn aus, während seine Frau die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.
Der Kardinal reichte ihr ein Taschentuch und sprach weiter. »Wir bedauern Contessa Francescas Tod von ganzem Herzen und freuen uns daher sehr, das damals Geschehene wiedergutmachen zu können.«
»Wie sollte das möglich sein?«, rief Conte Ercole schnaubend.
»Auch wenn Eure Tochter damals starb, so hat sie Euch doch zwei Enkelinnen geschenkt. Conte Onofrio wird eine von ihnen zum Weib nehmen.«
Kardinal Latino klang so selbstzufrieden, dass Contessa Flavia am liebsten aufgesprungen wäre und ihm ins Gesicht gesagt hätte, was sie von seinen Plänen hielt. Damals hatten sie ihre Tochter das Leben gekostet, und jetzt forderte er eine ihrer Enkelinnen, die ihr Ehemann und sie nur ein einziges Mal als Säuglinge gesehen hatten.
»Unsere Enkelinnen leben unter der Obhut ihres Vaters im Lande der Teutonen«, erklärte sie abweisend.
»Ich will keine Tedesca haben!«, rief Conte Onofrio zornig aus.
»In den beiden Mädchen fließt das Blut der Orsini«, wies der Kardinal ihn zurecht.
»Und wennschon! Sie wurden als Tedesci erzogen und sind die gleichen trampeligen Kühe, die aus den deutschen Landen als Pilgerinnen in unser Rom kommen.«
Conte Onofrios Vergleich ihrer Enkelinnen mit Kühen erboste die Contessa, während der Kardinal mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. »Wenn es die einzige Möglichkeit für Euch wäre, zu einem Erben zu gelangen, würde ich Euch zwingen, auch eine Kuh zu besteigen! Ihr seid ein Narr, Conte Onofrio! Vor allem habt Ihr vergessen, was Ihr der Familie schuldig seid.« Latino Orsini war so laut geworden, dass keiner der beiden heimlichen Lauscher in den Stockwerken über ihnen Mühe hatte, ihn zu verstehen.
»Beherrschen sie überhaupt unsere Sprache, oder muss ich mir ihr unverständliches Gebrabbel anhören?«, fragte Conte Onofrio, da er der Wucht, mit der die Forderungen über ihn hereinbrachen, nur wenig entgegenzusetzen hatte.
»Sie schreiben uns Briefe in lombardischem Dialekt«, erklärte Contessa Flavia, deren Sehnsucht nach den Enkelinnen nie vergangen war. Mit einem Mal sah sie eine Möglichkeit, Marie Flavia und Michaela Maria wiederzusehen.
Ihr Ehemann ahnte, dass sie nachzugeben drohte, und schob grimmig das Kinn vor. »Conte Onofrio geht auf die fünfzig zu, und unsere Enkelinnen sind gerade einmal sechzehn Jahre alt. Er könnte ihr Großvater sein.«
»Das ist nun doch übertrieben, mein guter Ercole!«, wandte der Kardinal lächelnd ein.
Dem Pater passte Conte Ercoles Ausspruch ebenfalls nicht. »Mein Herr ist gewiss nicht zu alt, eine zweite Ehe eingehen zu können!«, erklärte er beschwörend. »Es haben bereits weitaus ältere Männer Mädchen dieses Alters zum Weib genommen und mit ihnen Kinder gezeugt. Auch befindet Conte Onofrio sich bei bester Gesundheit und ist ein kräftiger Mann.«
»Damit sind wir uns ja alle einig«, sagte der Herzog und wischte mit diesen Worten alle Bedenken beiseite, die geäußert worden waren.
Weder Conte Onofrio noch Ercole Orsini wirkten so, als passte ihnen diese Entscheidung. Schließlich fasste Contessa Flavia nach der Hand ihres Ehemannes. »Es wäre die Gelegenheit für uns, unsere Enkelinnen wiederzusehen!«
»Ihr Weiber seid doch weich wie Butter in der Sonne!«, erwiderte Conte Ercole schnaubend.
Doch gegen den Herzog von Gravina, Kardinal Latino und seine eigene Frau stand er auf verlorenem Posten. »Dann sei es so! Ich werde einen Boten in dieses Ki…Ki…stein entsenden und den Vater der Mädchen auffordern, die beiden nach Rom bringen zu lassen.«
»Sobald dies geschehen ist, wird Conte Onofrio sich diejenige aussuchen, die ihm am besten zusagt, und die Ehe mit ihr eingehen.«
Kardinal Latino klang so zufrieden, als müssten die Zwillinge nur aus einem Vorort Roms geholt werden. Dabei hatten diese nicht nur eine Reise von sehr vielen Meilen vor sich, sondern mussten noch die gefährlichen Alpenpässe überwinden. Doch bevor sie überhaupt aufbrechen konnten, galt es, ihnen eine Botschaft zu senden, in der sie aufgefordert wurden, nach Rom zu reisen. Bis die beiden Mädchen eintrafen, würde mindestens ein Jahr vergehen. Dies verschaffte Conte Onofrio die Zeit, die Trauer um seine Ehefrau zu überwinden. Danach würde er froh sein, sein Bett mit einem jungen hübschen Ding teilen zu können. Was Conte Ercole betraf, so stellte diese Ehe einen Ausgleich für die Mesalliance dar, zu der er vor siebzehn Jahren dessen Tochter hatte zwingen wollen.
6.
Daniele Iracondia hatte Glück, denn niemand hatte die Kammer betreten wollen. Nun aber wurde es für ihn Zeit, sie ungesehen zu verlassen. Als er die Klappe schloss, entdeckte er einen Rußfleck auf dem Boden. Den darf keiner sehen, durchfuhr es ihn. Rasch beugte er sich nieder und beseitigte den Ruß mit einem Zipfel seines Hemdes. Danach steckte er das Hemd wieder in die Hose und eilte zur Tür. Ein Blick verriet ihm, dass niemand in der Nähe war. Erleichtert huschte er hinaus, wurde dann aber langsamer, damit es so aussah, als ginge er nur zufällig durch diesen Flur.
Er betrat den Raum, in dem er als Schreiber für den Herzog tätig war, und stellte erleichtert fest, dass die Männer, die ebenso wie er hier arbeiteten, an diesem Vormittag mit Aufträgen für ihren Herrn unterwegs waren. Daher war sein Fehlen niemandem aufgefallen. Er musste sich allerdings beeilen, die versäumte Arbeit aufzuholen, durfte sich jedoch nicht zu Fehlern oder einer schlechten Schrift verführen lassen.
Als bald darauf die anderen Schreiber zurückkamen, ließen ihre fröhlichen Mienen darauf schließen, dass sie unterwegs in eine Taverne eingekehrt waren oder sie sich an einem der Weinverkaufsstände ein paar Becher gegönnt hatten.
Daniele war froh über deren Pflichtversäumnis, denn damit hatten sie ihm die Gelegenheit verschafft, den Herzog bei dieser wichtigen Beratung zu belauschen. Gleichzeitig fragte er sich, warum auch Signore Isidoro an dem Gespräch so interessiert gewesen war. Dieser war ein entfernter Verwandter des Herzogs ohne Vermögen und größere Aussichten, aber zu stolz, um wie er als Schreiber zu dienen, und zu feige, sich einem Condottiere wie Girolamo, Gentile Virginio oder Napoleone Orsini als Söldneroffizier anzuschließen.
Da er viel zu tun hatte, verscheuchte er Isidoro Orsini aus seinen Gedanken und arbeitete weiter.
Als der Abend kam, verabschiedeten sich die anderen Schreiber, um noch eine Taverne aufzusuchen. Daniele blieb noch eine Weile, dann verließ auch er den Palazzo Orsini. Die Bediensteten und die einfachen Schreiber wohnten zumeist in Kammern unter dem Dach. Jenen aber, die wie er einen höheren Rang einnahmen, stand es frei, zu Hause zu übernachten. Er war froh um dieses Privileg, weil seine Mutter sonst ganz allein hätte leben müssen.
Als er an seine Mutter dachte, schwankte er zwischen der gebotenen Ehrfurcht ihr gegenüber und dem ketzerischen Gedanken, dass er, wenn er im Palazzo Orsini wohnte, ihren stetigen Klagen entkommen könnte.
Es war auch seine Mutter gewesen, die ihn aufgefordert hatte, das Gespräch seines Herrn mit Conte Ercole zu belauschen. Wäre er entdeckt worden, hätte es ihm den Zorn des Herzogs eingebracht, womöglich sogar den Tod. Mögliche Verräter lebten bei den Orsinis nicht lange, falls man sie erwischte. Obwohl er im Auftrag seiner Mutter bereits mehrmals Informationen gesammelt hatte, die ihm eigentlich hätten verborgen bleiben sollen, war dies der gefährlichste Auftrag gewesen, und er nahm sich vor, so etwas nie wieder zu tun.
Bisher genoss er das Vertrauen des Herzogs und durfte als Mitglied des niederen Adels sogar an dessen Festmählern teilnehmen. Auf Dauer konnte er sogar mit Protektion seines Herrn rechnen. Dies alles brachte seine Mutter mit ihren Forderungen in Gefahr. Mit diesem Gedanken erreichte er die Wohnung, in der sie lebten. Seine Mutter saß am Fenster und bestickte ein Tischtuch mit dem Wappen, das dem Vater seines Vaters einst verliehen worden war.
Beim Anblick ihres Sohnes hob Celestina Iracondia den Kopf. »Und? Hast du herausbekommen, was der Herzog von Ercole Orsini wollte?«, fragte sie drängend.
Daniele nickte. »Das ist mir gelungen! Aber es war zu gefährlich. Ein zweites Mal lasse ich mich nicht auf eine solche Sache ein.«
»Berichte mir, was gesagt wurde!«, forderte ihn seine Mutter auf, ohne auf seine Bedenken einzugehen.
»Der Herzog will, dass Conte Ercole seine Enkelinnen aus Deutschland kommen lässt, damit sich sein Verwandter Onofrio Orsini eine davon als Braut aussuchen kann.«
»Maledetto!«, rief seine Mutter. »Er will die Töchter dieser Hure holen, damit sie passende Ehen schließen können? Welch ein Hohn und welch eine Beleidigung unserer Ehre!«
»Ich weiß, dass du Rachegefühle gegen die Orsini hegst. Dennoch solltest du auf mich Rücksicht nehmen. Wenn dem Herzog oder einem seiner Verwandten auch nur das Geringste zu Ohren kommt, bin ich meine Stellung als Schreiber bei ihm los und muss zusehen, wie ich unseren Lebensunterhalt auf andere Weise verdienen kann«, erwiderte Daniele ungewohnt heftig.
Seine Mutter ließ sich jedoch nicht beruhigen, sondern lachte böse. »An manchen Tagen denke ich wirklich, dass du ein Iracondia bist und kein d’Specchi. Als d’Specchi wäre dein ganzes Sinnen und Trachten darauf ausgerichtet, dich an den Orsini und vor allem an Conte Ercole und dessen Weib zu rächen! Zu vieles ist geschehen, als dass ich ihnen jemals verzeihen könnte! Hast du das vergessen?«
»Nein, Mutter!«, sagte Daniele und senkte den Kopf.
»Mein Vater Dario und mein geliebter Bruder Cirio haben alles für diese verfluchte Sippe getan und sogar Leute getötet. Als Belohnung wurde Cirio eine Orsini als Braut angeboten, nämlich Conte Ercoles Tochter Francesca! Dieses überstolze Ding hat ihn jedoch verspottet und vor allen Leuten lächerlich gemacht. Statt sie zu zügeln, wie es seine Pflicht als Vater gewesen wäre, hat Conte Ercole dieses schreckliche Mädchen gewähren lassen. Dadurch konnte die Metze eine Liebschaft mit einem teutonischen Ritter anfangen und diesen heimlich heiraten, während sie ihren echten Bräutigam schamlos hingehalten hat. Schließlich gebar sie dem Teutonen sogar zwei Mädchen.
Mein Bruder tat das, was ein echter Edelmann tun muss: Er erdolchte diese Hure. Danach aber überfiel ihn dieser Teutone und erschlug ihn hinterrücks. Ein anderer Teutone tötete meinen Vater, und zwar, nachdem dieser bereits das Schwert weggelegt und sich ergeben hatte!« Celestina Iracondias Gesicht verzerrte sich zu einer hasserfüllten Grimasse, sie fasste ihren Sohn bei den Schultern und zog ihn näher an sich heran. »Nach Vaters Tod hätte der Herzog uns beistehen müssen. Aber er tat nichts! Weder hinderte er meine Mutter daran, das meiste Geld und den Schmuck an sich zu nehmen, um alles dieser Wirtstochter zu schenken …«
»Sie war deine Schwester!«, mahnte Iracondia sanft.
»Pah! Sie wurde nicht als solche erzogen!« Seine Mutter tat diesen Einwand mit einer heftigen Handbewegung ab. »Meine richtigen Schwestern hingegen wurden es. Dabei hat sich Clementina als eine noch falschere Schlange als jene im Paradies erwiesen. Kaum war unser Vater gestorben, heiratete sie einen Notar, und dieser brachte den größten Teil unseres restlichen Besitzes an sich. Auf sein Betreiben hin musste auch unser schöner Palazzo d’Specchi verkauft werden. Den Erlös hat Clementinas Ehemann in die eigene Tasche gesteckt! Wie oft habe ich deinem Vater gesagt, er muss etwas dagegen tun, doch dieser Narr hat sich in allem über den Tisch ziehen lassen.«
Neben dem Hass auf die Schwester und den Schwager spürte Daniele die grenzenlose Verachtung, die seine Mutter für seinen Vater hegte. Dieser war damals bereits krank gewesen und nur wenige Jahre nach jenen Ereignissen gestorben. Die Kraft, sich gegen einen raffgierigen Verwandten mit Erfolg wehren zu können, hatte er schon längst nicht mehr besessen.
Seine Mutter war noch nicht am Ende mit ihrem Lamento. »Clementinas Mann brachte dann auch noch meine nächstjüngere Schwester Concettina auf seine Seite, indem er sie in das Kloster einkaufte, in das sie einzutreten wünschte, und meine jüngste Schwester, dieses Luder Cristina, stellte er einem Bischof vor, der sie zu seiner Mätresse machte. Damit sicherte sich dieser Schuft auch noch den Schutz der Kirche. Dabei hätte mir als der ältesten Schwester der größere Erbteil und der Palazzo d’Specchi als Wohnsitz gebührt. So erhielt ich nur einen Bettel, und wir müssen uns mit diesem elenden Loch hier begnügen.«
Es hörte sich an, als hätte sie einen königlichen Palast und das Vermögen eines Krösus verloren, dachte Daniele Iracondia. Er kannte die Casa d’Specchi, die von seiner Mutter ein Palazzo genannt wurde. Natürlich war sie größer als die paar Zimmer, die sie jetzt bewohnten. Allerdings hatte die Familie damals auch weitaus mehr Köpfe gezählt. Daniele bedauerte den Verlust dieses Hauses weniger als die Tatsache, dass er mehrmals im Monat die Klagen seiner Mutter ertragen musste, die weder an den Orsini noch an ihren Verwandten ein einziges gutes Haar ließ.
»Warum hast du mich dann gedrängt, einen Dienst beim Herzog von Gravina zu suchen, wenn du ihn und seine Familie so hasst?« Diese Frage hatte Daniele schon mehrfach gestellt, aber zumeist eine ausweichende Antwort erhalten.
Diesmal huschte ein böses Lächeln über das Gesicht seiner Mutter. »Weil ich Rache will!«
»Am Herzog von Gravina? Der ist viel zu mächtig, als dass wir ihm etwas anhaben könnten«, antwortete Daniele verärgert.
»Man kann viel, wenn man es nur will«, erklärte seine Mutter spöttisch. »Dafür musst du jedoch lernen, weniger ein Iracondia als ein d’Specchi zu sein.«
»Ein Mordbube also!«, entfuhr es Daniele.
Augenblicke später schlug seine Mutter ihm mit aller Kraft ins Gesicht. »Wage es nie mehr, deinen Großvater und deinen Onkel zu schmähen. Ich müsste mich sonst verfluchen, dich geboren zu haben!«
Daniele senkte den Kopf. »Es tut mir leid, Mutter.«
»Das sollte es auch! Zur Wiedergutmachung wirst du für meinen Vater und meinen Bruder je zehn Seelenmessen lesen lassen. Oh Gott, ich wünschte, du wärst nur halb so kühn wie Cirio. Dieser hätte seine Rache gesucht und sie gnadenlos vollstreckt. Vor ihm wäre nicht einmal der Herzog von Gravina sicher gewesen. Bei dir will ich mich mit weniger begnügen.«
Celestina Iracondia strich ihrem Sohn nun sanft über die Wange, auf die sie eben noch geschlagen hatte, und sah ihn mit leuchtenden Augen an. »Du wirst deinen Onkel und deinen Großvater rächen – und auch mich, denn ich bin durch Conte Ercole und dessen Tochter um mein Erbe und meine Zukunft gebracht worden!«
»Um dein Erbe gebracht haben dich Clementina und deren Ehemann«, wandte Daniele ein.
»Auch sie wird unsere Rache treffen, doch erst, wenn die Schmach getilgt ist, die Ercole Orsini und seine Hurentochter uns angetan haben. Heute hast du mir die Möglichkeit aufgezeigt, wie wir ihn in den Staub werfen können, und das werden wir, mein Sohn. Das werden wir!«
Celestina Iracondia atmete tief durch und lächelte auf eine Weise, bei der sich ihrem Sohn die Nackenhaare aufstellten. Was auch immer sie plante, würde entsetzlich sein, und das Schlimme war, dass sie von ihm erwartete, es auszuführen. In dieser Hinsicht war er wirklich mehr ein Iracondia als ein d’Specchi.
»Du sagst, Conte Ercole lässt seine Enkelinnen aus Deutschland holen?«
Daniele Iracondia nickte. »So ist es, Mutter. Er will einen Boten in jene Lande schicken, der ihnen diese Aufforderung überbringen soll.«
»Gut, sehr gut. Mit jeder Meile, die dieser Bote und später die Zwillinge zurücklegen, kommt unsere Rache näher. Schon bald werden wir unsere Feinde zu unseren Füßen sehen. Sie werden um Gnade winseln, doch es wird vergebens sein. Das Blut meines Vaters und meines Bruders fordert das ihre!«
Celestina Iracondia griff zu dem Dolch, den ihr Sohn in einer Scheide an seinem Gürtel trug, und zog ihn heraus. Mit der anderen Hand packte sie seinen rechten Arm mit einem festen Griff und zog ihn auf sich zu. »Du wirst jetzt bei deinem Blut schwören, dass du diese Rache vollenden und keine Gnade walten lassen wirst!«
Noch während sie es sagte, drückte sie die Spitze des Dolches gegen seinen Arm, sodass ein dünner Blutfaden herausrann. Sie wartete, bis der Stahl sich rot gefärbt hatte, dann führte sie ihn zum Mund und leckte daran. Danach reichte sie ihm den Dolch.
»Tu es mir gleich!«, befahl sie.
Ihr Sohn gehorchte schaudernd.
»Schwöre mir nun, dass du nicht eher ruhen wirst, bis ich unsere Rache für vollendet erkläre!«, forderte sie ihren Sohn auf.
Daniele fühlte den Geschmack des eigenen Blutes im Mund, und ihm wurde übel. Doch wie stets in all den Jahren seit dem Tod seines Vaters beugte er sich auch jetzt dem Willen der Mutter. »Ich schwöre es dir, Mutter!«, sagte er und wusste gleichzeitig, dass er diesen Weg würde gehen müssen, mochte er auch noch so schrecklich sein.
7.
Bevor Conte Ercole den Palazzo Orsini verlassen konnte, wurde er zu einer Unterredung mit Kardinal Latino gerufen. Dieser umarmte ihn und bot ihm besten apulischen Wein und Gebäck an.
»Ich freue mich wirklich, dass Ihr Eure Abgeschiedenheit aufgegeben habt, mein Freund. Ihr tragt einen klugen Kopf auf den Schultern und habt der Familie in früheren Zeiten sehr geholfen. Ich wünschte, Ihr würdet es von nun an wieder tun!«
Ercole Orsinis Miene nahm einen abweisenden Ausdruck an. »Das, was ich damals für Euch tat, wurde mir übel gelohnt. Ihr wolltet mir einen Niemand als Schwiegersohn aufzwingen, und ich habe dadurch meine Tochter verloren. Sie war mein einziges Kind!«
Einen anderen Mann, der nicht wie Latino Orsini von Jugend an das Zentrum aller möglichen Intrigen gewesen war, hätte er mit diesen Worten rühren können. Für den Kardinal waren Menschen jedoch nur Schachfiguren. Auf den König und die Königin musste man achtgeben, und auch noch auf den Turm. Alle anderen hingegen waren Bauern, die man nach Belieben opfern konnte. Solange Dario und Cirio d’Specchi wertvolle Werkzeuge seiner Pläne gewesen waren, hätte der Sohn Conte Ercoles Tochter Francesca heiraten und damit in Rang und Ansehen aufsteigen können. Die d’Specchis hatten sich jedoch als Verräter entpuppt, und so hielt Latino Orsini es für einen Vorteil, dass Francesca Orsini eine heimliche Ehe mit einem deutschen Ritter eingegangen war und Zwillingstöchter geboren hatte. Nun gab es zwei Mädchen aus Conte Ercoles Blut, die zum Nutzen der Familie an den Mann gebracht werden konnten. Die eine würde Conte Onofrio heiraten und dafür Sorge tragen, dass dessen Besitz an einen Sohn weitergeben wurde, und für die Zweite würde er ebenfalls eine Ehe stiften, die ihm einen Vorteil brachte.
»Ihr solltet nicht vergessen, mein Freund, dass Eure Abneigung den d’Specchis gegenüber diese erst dazu gebracht haben könnte, sich gegen uns zu wenden. Auch ist Eure Tochter die Ehe mit diesem Tedesco eingegangen, obwohl sie mit Cirio d’Specchi verlobt war.« Kardinal Latinos Stimme klang sanft, doch es schwang ein strafender Unterton darin. In seinen Augen hatte Conte Ercole sowohl als Verbündeter wie auch als Vater versagt. Nur die Tatsache, dass daraus kein Schaden für die Familie erwachsen war, hatte ihn vor seinem Zorn und dem des Herzogs von Gravina bewahrt.
»Diesmal werdet Ihr so handeln, wie ich es will, mein Freund. Vergesst das niemals! Wäre vor siebzehn Jahren nicht der arme Friedrich von der Steiermark in Rom erschienen, sondern ein zweiter Carolus Magnus, hätten Euer Stolz und Eure Fehler die Vernichtung unserer gesamten Familie bedeuten können.«
Kardinal Latinos Stimme wurde noch eindringlicher. Damals hatten er und der Herzog von Gravina als stolze Guelfen alles getan, um den Romzug des gewählten römischen Königs Friedrich III. und dessen Krönung zum Kaiser zu verhindern. Sie hatten befürchtet, dieser könnte sich wie andere Kaiser vor ihm der Stadt Rom bemächtigen und seine Feinde, darunter auch ihre Familie, vertreiben und vernichten.
Diese Angst hatte sich als übertrieben herausgestellt, denn Friedrichs III. Begleitung war so armselig gewesen, dass er nicht einmal eine der Vorstädte hätte erobern können. Unterwegs hatten Grafen, Herzöge und andere Adelige ihm Quartier geben und mit Reisegeld versehen müssen, damit er überhaupt bis Rom gekommen war. Seitdem gab es etliche Reichsfreiherren und Reichsgrafen in Italien mehr. Kardinal Latino spottete darüber, wusste aber gleichzeitig, dass nicht einmal ein eingefleischter Guelfe wie Herzog Jacobello eine Standeserhöhung ablehnen würde.
Rasch fing er seine flatternden Gedanken wieder ein und legte den Arm um Conte Ercole. »All die Jahre waren wir Freunde und Verbündete und hatten dasselbe Ziel, nämlich den Besitz, den Ruhm und die Macht unserer Familie zu mehren. Das sollte auch weiterhin unser Bestreben bleiben.«
»Obwohl ich, wie Ihr sagtet, durch meine Fehler die Familie fast in den Untergang geführt hätte?«, fragte Conte Ercole bissig.
Der Kardinal lachte leise. »Ihr habt damals als stolzer Vater gehandelt, der seine Tochter einem weit unter ihm stehenden Mann zum Weib geben sollte. Auch wenn Eure Haltung nicht im Sinne der Familie war, so finde ich sie verständlich. Diesmal ist es jedoch ganz anders. Eure Enkelinnen werden mit Herren von mindestens gleichem Stand vermählt werden. Habe ich vergessen, Euch mitzuteilen, dass ich bei Seiner Heiligkeit, dem Papst, für Eure Enkelinnen die Erlaubnis erwirkt habe, sich als Contessa bezeichnen zu dürfen?«
»Nein, das habt Ihr nicht! Ist das wirklich so? Obwohl Ihr mit einem der beiden Mädchen die Pläne des Papstes durchkreuzen wollt?« Der alte Herr konnte es kaum glauben, während der Kardinal ein sanftes Lächeln zeigte.
»Es ist nun einmal so, dass Seine Heiligkeit einen Gefallen, der ihm erwiesen wurde, honorieren muss. Da ist die Geste, den Enkelinnen eines Conte zu erlauben, sich Contessa zu nennen, nur eine geringe Angelegenheit, zumal Seine Heiligkeit nichts von unseren geheimen Plänen weiß.«
»Wollen wir es hoffen«, antwortete Conte Ercole und sagte sich, dass die Zahl der Spione und Verräter seit der Zeit, in der er sich an diesem Spiel um die Macht beteiligt hatte, gewiss nicht geringer geworden war.
Der Kardinal wirkte jedoch so zuversichtlich, dass seine Besorgnis schwand. Da seine Frau sich nach ihren Enkelinnen sehnte, konnte er ihr diesen Wunsch erfüllen und durch die Heirat der beiden Mädchen mit hochrangigen Edelmännern die doppelte Schmach tilgen, die er damals hatte hinnehmen müssen.
»Ich werde einen Boten nach Norden entsenden und dem Vater der Zwillinge befehlen, dass sie zu mir gebracht werden«, erklärte er und sah sich vom Kardinal umarmt.
»Ich wusste, dass ich mich auf Euch verlassen kann, Conte Ercole. Ihr solltet in der nächsten Zeit länger in Rom weilen, damit Euer Gespür für das, was hier vor sich geht, zurückkehrt. Doch nun solltet Ihr zusammen mit Eurer Gemahlin Euren Palazzo aufsuchen. Die Contessa wird sich darüber gewiss freuen. Geht mit Gott, mein Freund! Da Ihr in Rom bleibt, werden wir uns wieder öfter sehen.«
»Das werden wir! Geht auch Ihr mit Gott, Eure Eminenz!« Conte Ercole küsste den Ring des Kardinals und verließ das Zimmer.
8.
Die vier Dutzend Söldner, die Graf Ercole und seine Frau zu deren Palazzo begleiteten, bewiesen den beiden, dass das Leben in Rom sich nicht verändert hatte. Noch immer rivalisierten die großen Familien miteinander. Manchmal gingen sie Zweckbündnisse ein und brachen sie wieder, sowie es ihnen Vorteile verschaffte. Zwar hielt auch der Conte sich genügend Waffenknechte zu seiner Sicherheit. Die meisten davon hatte er bei seinem Landsitz gelassen, um diesen zu verteidigen, falls es nötig sein sollte. Groß war die Gefahr zwar nicht, denn im Vergleich zu Conte Onofrio oder gar dem Herzog waren seine Liegenschaften unbedeutend. Sie zu besetzen würde keiner gegnerischen Familie einen Vorteil verschaffen, der eigenen aber einen Grund geben, gegen diese vorzugehen. Gefahr drohte höchstens von Räubern. Da reichten einige Dutzend handfester Männer aus, um diese fernzuhalten.
Verwundert, wohin sich seine Gedanken verirrten, blickte Conte Ercole zum Fenster seines Reisewagens hinaus und sah die Häuser an sich vorbeiziehen. Die meisten davon gehörten seiner Familie und deren Trabanten, daher hätte ein halbes Dutzend Bewaffneter als Geleit gereicht.
»Habt Ihr auch das Gefühl, dass immer wieder andere Menschen in unser Leben eingreifen und uns zu Dingen zwingen wollen, die uns nicht gefallen?«, fragte er seine Frau.
Diese sah ihn verwundert an. »Passt es Euch nicht, unsere Enkelinnen zu uns zu holen?«
»Das meinte ich nicht«, antwortete der Conte, musste sich aber sagen, dass es genau das war. Hätte er sich selbst entschieden, die Mädchen herzuholen, um sie standesgemäß zu verheiraten, wäre es etwas anderes gewesen. So aber fühlte er sich dazu gedrängt.
»Wir haben ein schönes, ruhiges Leben geführt, und aus diesem haben uns Herzog Jacobello und der Kardinal herausgerissen«, setzte er hinzu, um seinen Unmut zu erklären.
»Vielleicht war unser Leben zu ruhig«, antwortete seine Gemahlin leise. »Ich habe mir damals gewünscht, Ritter Falko würde wenigstens eines der Mädchen in unserer Obhut lassen. Ich hätte die kleine, süße Bionda so gerne erzogen.«
»So war es besser! Sie konnten zusammen aufwachsen, und wir wurden nicht von der Sehnsucht der Kleinen nach der Schwester bedrängt«, erklärte der Conte, obwohl er befürchtete, dass aus beiden Mädchen tölpelhafte Hinterwäldlerinnen geworden waren.
Die Ankunft vor ihrem Palazzo beendete die Unterhaltung. Conte Ercole schaute an dem turmartigen Gebäude mit seinen sechs Geschossen hoch, das vor ihm in den Himmel ragte. Es war um einiges kleiner als der Palazzo Orsini im Marcellus-Theater. Dafür aber war er hier der Hausherr und konnte in seinen eigenen Mauern tun und lassen, was er wollte.
»Wir sind angekommen, meine Liebe!«, sagte er zu seiner Frau und stieg als Erster aus der Kutsche.
Contessa Flavia folgte ihm. An der Tür wurden sie von ihrem Verwalter und der Wirtschafterin empfangen. Beide wirkten verwundert, ihre Herrschaft zu sehen, aber auch ein wenig schuldbewusst, wie Contessa Flavia fand. Sie verbeugten sich vor ihnen, schienen um Worte zu ringen. Schließlich begann die Frau zu sprechen.
»Seid uns tausendmal willkommen, edler Conte, vorzügliche Contessa.«
»Das sage ich auch!«, presste der Verwalter hervor. »Es ist nur etwas überraschend. Wir erhielten erst gestern durch einen Boten des Herzogs von Gravina die Nachricht, dass Ihr nach Rom zurückkommen würdet.«
»Ich hoffe, ihr habt das Haus in einem Zustand gehalten, sodass wir darin unseren Aufenthalt nehmen können.« Conte Ercole klang kühl, denn mit einem solchen Empfang hatte er nicht gerechnet.
»Nun, es ist so … Ihr seid vor mehr als drei Jahren zum letzten Mal in Rom gewesen, und da dachten wir …«, begann der Verwalter, wurde aber von der Wirtschafterin unterbrochen.
»Wir wollten Euch einen Gefallen tun, hoher Herr. Es ist schließlich teuer, so ein Haus zu erhalten, und da haben wir armen Pilgern eine Zuflucht gewährt, die sonst auf der Straße hätten nächtigen müssen.«
»Ihr habt Fremde in mein Haus gelassen?«, fuhr Conte Ercole auf.
»Es war ein Werk der Barmherzigkeit, hoher Herr!«, rief die Wirtschafterin verzweifelt.
Gräfin Flavia musterte sie mit einem vernichtenden Blick. »Es war eher ein Werk eurer Geldgier! Ihr habt euch gewiss gut dafür bezahlen lassen.«
»Ein paar Grossi haben wir genommen, aber nicht viel. Es sollte helfen, die Kosten für den Unterhalt des Hauses und des Personals zu senken«, erklärte der Verwalter mit gesenktem Kopf.
»Davon allerdings haben wir nichts bemerkt! Wir haben euch stets Geld zukommen lassen, ohne dass ihr gerufen hättet, es wäre genug. Im Gegenteil! Ihr habt immer neues verlangt, angeblich, um dieses oder jenes in Ordnung bringen zu müssen«, rief Conte Ercole zornig und sah seine Frau an. »Kommt, meine Liebe! Gehen wir ins Haus und sehen uns um.«
»Verzeiht, Herr, aber es sind noch ein paar Pilger im Haus!« Der Verwalter klang jammervoll, brachte seinen Herrn damit jedoch noch stärker gegen sich auf.
»Dann setze sie auf die Straße!«, befahl der Conte.
Der Mann wand sich wie ein Wurm. »Es sind Tedesci, Herr! Von diesen haben wir selbstverständlich viel Geld verlangt. Wenn wir sie jetzt auf die Straße setzen, werden sie zornig sein und Euch bei Gericht verklagen.«
Ohne ihn weiter zu beachten, betrat Ercole Orsini das Haus und fand das Erdgeschoss bis auf die Küche und den Vorratsraum voller Säcke und Fässer.
»Das haben wohl eure Pilger mitgebracht?«, fragte er den Verwalter und die Wirtschafterin höhnisch.
Gräfin Flavia warf einen Blick in die Küche und sah mehrere große Töpfe und Kessel auf dem Herd. Außerdem hing ein halber Hammel über der Glut und briet vor sich hin.
»Ihr kocht hier für viele Leute«, sagte sie zur Wirtschafterin.
»Die Tedesci haben uns Geld gegeben, damit wir sie verköstigen. Es sind Gesandte eines Fürsten, müsst Ihr wissen«, versuchte der Verwalter, sich herauszureden.
Conte Ercole öffnete einen Sack, grub darin mit der Hand und zuckte zusammen, als er unter dem Weizen etwas Hartes ertastete. Er zog es heraus und hielt ein sorgfältig umwickeltes Päckchen von einer gewissen Schwere in der Hand.
»Mach es auf!«, wies er den Verwalter an.
Dieser schüttelte entsetzt den Kopf. »Die Tedesci würden sehr zornig werden!«
»Also gilt dir mein Zorn weniger als der ihre!« Der Conte wurde wieder leiser, doch in seiner Stimme lag eine Schärfe, die seinen Verwalter zutiefst erschreckte.
»Nein, nein, selbstverständlich nicht, aber ich habe den Tedesci versprochen, dass sie drei Wochen bleiben können. Daran fehlt noch eine Woche. Bedenkt doch: Die Leute hätten große Schwierigkeiten, eine neue Unterkunft zu finden, und …«
»… würden von dir das Geld zurückverlangen, das sie dir bezahlt haben!« Die Stimme des Conte wurde eisig. Er öffnete nun doch das Päckchen und blickte hinein. Es lag nur ein Stück Knochen darin, das einmal zu einer Hand gehört haben mochte. Angeekelt wandte er sich dem Hauptmann der Wachen zu, die ihn begleitet hatten. »Da ich befürchte, dass die gesamte Dienerschaft mit diesem ungetreuen Gesindel im Bunde steht, muss ich Seine Gnaden, den Herzog, bitten, mir genug von seinen Leuten zu schicken, und zwar alles vom Schuhputzer bis zum Verwalter, sowie Waffenknechte, da ich denen, die ich hier zurückließ, nicht mehr trauen kann. Was dieses Gerümpel hier betrifft«, er warf das Päckchen wieder in den Sack, »das schafft nach draußen auf die Straße.«
»Das würde ich nicht tun!«, wandte Gräfin Flavia ein. »Die Leute, denen es gehört, sind Deutsche. Vielleicht können sie unsere Botschaft zu unseren Enkelinnen bringen.«