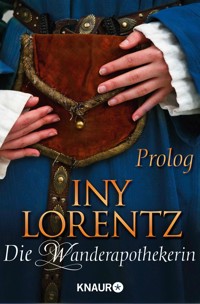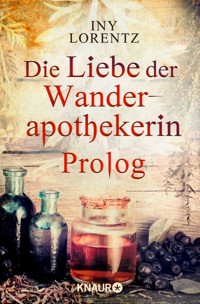9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eintauchen ins deutsche Mittelalter: Die ehemalige Wanderhure Marie Adler gerät mit ihrer Tochter Trudi und der Nonne Ignatia in die erbitterte Fehde zweier Adelshäuser. Da der neue Fürstbischof von Würzburg die Burg Kibitzstein unter seine Herrschaft zwingen will, geht Marie Adler ein Bündnis mit dem thüringischen Grafen Ernst von Herrenroda ein. Doch die Burg, auf der Marie sich mit dem Grafen trifft, wird überfallen, die Bewohner gnadenlos getötet. Lediglich Marie, ihre Tochter Trudi und die mit dem Grafen verwandte Nonne Ignatia können zunächst in die unwegsamen Wälder entkommen, Ignatia ist jedoch schwer verletzt. Als die drei Frauen schließlich von Räubern gefangen genommen werden, die mit dem Anführer des Überfalls in Verbindung stehen, begreift Marie das ganze Ausmaß der Katastrophe: Sie sind mitten in die erbitterte Fehde zweier Thüringer Adelsgeschlechter geraten! Band 7 der abenteuerlichen historischen Roman-Reihe um das Schicksal der Wanderhure Marie Mit ihrer historischen Roman-Serie über das Schicksal der Kaufmannstochter Marie, die im späten Mittelalter als Hübschlerin auf Wanderschaft gehen muss, hat Iny Lorentz einen historischen Bestseller nach dem anderen gelandet. Hochspannend, dramatisch und opulent lässt uns die Bestseller-Autorin tief ins deutsche Mittelalter eintauchen. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Wanderhure und die Nonne
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Da der neue Fürstbischof von Würzburg Kibitzstein unter seine Herrschaft zwingen will, geht die ehemalige Wanderhure Marie ein Bündnis mit dem thüringischen Grafen Ernst von Herrenroda ein. Als sie dessen Einladung folgt, wird die Burg, auf der sie sich treffen, überfallen und alle Bewohner bis auf Marie, ihre Tochter Trudi und eine mit dem Grafen verwandte, schwer verletzte Nonne umgebracht. Den drei Frauen gelingt die Flucht in unwegsame Wälder. Doch als sie von Räubern gefangen genommen werden, die mit dem Anführer des Überfalls in Verbindung stehen, begreift Marie das ganze Ausmaß der Katastrophe: Sie sind mitten in die erbitterte Fehde zweier Thüringer Adelsgeschlechter geraten.
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Glossar
Personenverzeichnis
Erster Teil
Abschied
1.
Zu anderen Zeiten hatten Marie und Michel die Zeit vor dem Schlafengehen genutzt, um über ihre Kinder zu sprechen und über das, was in den nächsten Tagen auf Kibitzstein wichtig war. An diesem Abend aber schlug Marie die Tür heftig zu und setzte sich noch im Kleid aufs Bett.
»Was hast du in Ungarn zu suchen?«, fuhr sie ihren Mann an. »Dein Platz ist hier! Du kannst nicht einfach gehen, während sich hier Entscheidungen anbahnen, die unsere Zukunft betreffen.«
»Mit den Ränken und Fehden der hohen Familien in Thüringen will ich nichts zu tun haben, mag Graf Ernst uns auch noch so viele Versprechungen machen«, antwortete Michel und schnaubte verärgert.
»Bitte, sprich zuerst mit Graf Ernst von Herrenroda und entscheide dich dann, ob du für irgendeinen Fremden in den Krieg ziehen willst!«
»Friedrich ist kein Fremder, sondern der kürzlich gewählte König des Reiches und damit mein Lehensherr. Ich bin ihm zu Treue und Gefolgschaft verpflichtet. Warum willst du das nicht einsehen?«
»Du bist schon einmal für einen König und Kaiser in den Krieg gezogen«, antwortete Marie heftig, »und das war beinahe dein Tod! Hast du das vergessen?«
Für einige Augenblicke wanderten ihre und Michels Gedanken in die Vergangenheit. Damals war er mit Kaiser Sigismund nach Böhmen geritten, um die aufständischen Hussiten zu bekämpfen. Nur mit viel Glück und Gottes Gnade hatte er diesen Feldzug überlebt, dabei aber für einige Zeit sein Gedächtnis verloren. Marie hatte die Nachricht von seinem Tod nicht glauben wollen und nach ihm gesucht. Es war eine harte und gefahrvolle Zeit gewesen, und die wollte sie niemals wieder erleben.
Auch Michel schauderte es bei dem Gedanken an das, was sich damals zugetragen hatte. Diesmal aber, das schwor er sich, würde es anders sein. Er fasste nach Maries Hand und zog seine Frau an sich. »Hab keine Sorge! Ich komme zurück. Diesmal ist es kein langer Kriegszug in Feindesland. Vermutlich wird es nicht einmal zu einer Schlacht kommen. König Friedrich will dem Polenkönig Ladislaus, der seinem Mündel die Krone Ungarns geraubt hat, nur beweisen, dass er Hilfe gegen ihn aus dem Reich erhält.«
»Es heißt, Friedrich will einige Burgen und Städte zurückerobern, die ihm der Pole weggenommen hat«, wandte Marie ein.
»Das ist richtig. Wenn Ladislaus klug ist, räumt er sie freiwillig. Kommen Friedrich nämlich genug Ritter zu Hilfe, wird er die Burgen belagern und mit Gottes Hilfe zurückgewinnen.«
Marie schüttelte erregt den Kopf. »Das bedeutet aber doch Kampf!«
»Es bedeutet nur Belagerung! Ob es dabei zu Gefechten kommt, muss sich erst zeigen. Auf jeden Fall endet meine Verpflichtung im Herbst, und dann kehre ich zurück. Du wirst sehen, wir werden beide auch heuer gemeinsam unseren Wein lesen.« Michel legte die Arme um Marie und lächelte sie an. »Ich liebe dich so sehr!«
»Ich liebe dich auch.« Der Streit, der kurz zwischen ihnen aufgeflackert war, war sofort wieder vergessen. Dennoch konnte Marie das, was sie bewegte, nicht zurückhalten.
»Mir wäre trotzdem lieber, du würdest hierbleiben und mit Graf Ernst von Herrenroda verhandeln. Sein Angebot, unsere Trudi mit seinem Sohn Robert zu verheiraten, ist eine Ehre für uns. Immerhin zählen die Grafen auf Herrenroda zu den ältesten Adelsgeschlechtern im Reich. Wir würden in ihnen mächtige Verbündete gewinnen, und diese Verwandtschaft wäre auch für unsere anderen Kinder von Vorteil. Denke nur an Falko! Mit Ernst von Herrenroda an seiner Seite könnte er sich gegen jeden Fürstbischof von Würzburg behaupten. Du weißt doch, wie Gottfried Schenk zu Limpurg zu den Verträgen steht, die sein Vorgänger Johann von Brunn mit uns geschlossen hat.«
Michel nickte mit verbissener Miene. »Er würde sie am liebsten für ungültig erklären! Aber auch das spricht dafür, dass ich König Friedrichs Ruf folge. Bin ich bei ihm gut angeschrieben, wird Gottfried Schenk zu Limpurg es sich zweimal überlegen, uns Steine in den Weg zu rollen.«
Diesem Argument konnte Marie sich nicht entziehen, und so nickte sie. »Es sieht wohl so aus, als wäre es für uns beide wichtig, dass du mit König Friedrich ziehst. Aber was schreibe ich Ernst von Herrenroda, wenn er unbedingt den Heiratsvertrag zwischen seinem Sohn und Trudi schließen will?«
Das Angebot war in Maries Augen ebenso ehrenvoll wie vorteilhaft für sie. Michel hing immer noch der Ruf an, der Sohn eines Bierschenks zu sein, der nur deshalb in den Adelsstand erhoben worden war, weil er Kaiser Sigismund in einer Schlacht das Leben gerettet hatte. Auch gegen sie wurde gehetzt, denn es hieß, sie wäre eine Hure gewesen, die Kaiser Sigismund beim Konzil in Konstanz erfreut habe. Als er ihrer müde wurde, habe er sie mit Michel Adler auf Kibitzstein vermählt.
Marie schüttelte die quälenden Erinnerungen ab und wiederholte die Frage: »Was soll ich Ernst von Herrenroda antworten, wenn er schreibt?«
»Weise ihn darauf hin, dass Trudi noch zu jung zum Heiraten ist. In drei oder vier Jahren können wir darüber reden.«
Michel ließ keinen Zweifel daran, dass ihm das Angebot des Grafen nicht passte. Kein Herr von Stand warb für seinen Sohn um ein Mädchen von so niederer Herkunft wie Trudi, es sei denn, er habe einen ganz bestimmten Grund. Bei Ernst von Herrenroda waren dies wahrscheinlich jene zehntausend Gulden, die als Trudis Mitgift so rasch wie möglich in seine Truhe wandern sollten.
»Denk doch einmal nach, Marie!«, erklärte Michel. »Graf Ernst verlangt Trudis Mitgift bereits weit vor der Hochzeit. Was ist, wenn er es sich in der Zwischenzeit anders überlegt und eine andere Braut für seinen Sohn sucht?«
»Das kann er nicht!«, rief Marie aus.
»Wer will ihn daran hindern? Wir sind nicht in der Lage dazu. Selbst wenn wir ihn bei König Friedrich oder dem Reichskammergericht anklagen, würden wir die zehntausend Gulden nicht wiedersehen.«
Dieser Punkt bereitete auch Marie Sorgen. Trotzdem war sie nicht bereit, ihre Hoffnungen fahren zu lassen. »Ich vertraue auf geschriebene Verträge, gegen die zu verstoßen auch einen Ernst von Herrenroda Ansehen und Vertrauen kosten würde!«
»Mich stört, dass er darauf drängt, das Geld sofort zu erhalten. Es würde doch reichen, wenn er es bei der Hochzeit bekommt«, antwortete Michel. »Daher traue ich ihm nicht, und du solltest es auch nicht tun. Erinnere dich daran: Auch dir ist einmal eine hochwohlgeborene Ehe angetragen worden. Dabei ging es dem Keilburger nur darum, sich auf verbrecherische Weise in den Besitz deines Vaters zu setzen!«
Marie fröstelte bei dieser Erinnerung, denn auf diese Verlobung war die schlimmste Zeit ihres Lebens gefolgt. Trotzdem war sie nicht bereit, Graf Ernsts Angebot so einfach auszuschlagen.
»Vielleicht braucht er die Summe dringend und kann sie sich von niemand anderem leihen«, erwiderte sie deshalb.
»Wofür braucht er das Geld, wenn nicht für die Fehde mit Graf Joachim von Herrenstein? Beide Sippen entstammen demselben Geschlecht, und bereits zu Kaiser Sigismunds Zeiten kam es zu erbitterten Kämpfen zwischen ihnen.«
Marie nickte. »Du meinst die blutigen Kämpfe zwischen den neuen Landgrafen aus dem Geschlecht der Wettiner und den einheimischen Adelsgeschlechtern. Damals ging es um die Macht in ganz Thüringen, und die Grafenfamilien auf Herrenroda und Herrenstein standen auf verschiedenen Seiten. Aber die Fehde ist bereits vor mehr als einem Dutzend Jahren beendet worden. Außerdem haben die Herrensteiner nach ihrer Niederlage Urfehde schwören müssen.«
»Dies mag alles stimmen, trotzdem frage ich mich, weshalb Ernst von Herrenroda ausgerechnet uns dieses Angebot gemacht hat. Zehntausend Gulden sind viel Geld. Wofür braucht er es?«
Auf diese Frage wusste auch Marie keine Antwort. Sie sprachen noch eine ganze Weile über Ernst von Herrenrodas Angebot, kamen aber zu keinem befriedigenden Schluss.
Schließlich fasste Michel nach Maries Händen und lächelte sie an. »Sollte er einen Boten schicken oder schreiben, so teile ihm mit, dass wir ihm erst Antwort geben können, wenn ich aus Ungarn zurück bin.«
»Das mache ich.« Marie lächelte nun auch und ließ es gerne zu, dass Michels Hände immer fordernder über ihren Körper glitten. Schließlich bat sie ihn, ihr aus dem Kleid zu helfen, und streifte dann ihr Hemd ab. Obwohl sie nicht mehr jung war, hatte sie eine glatte Haut, einen gut geformten Hintern und feste Brüste. Wohl war sie mit der Zeit ein wenig stämmig geworden, doch das machte sie nicht weniger reizvoll.
»Ich bin ein glücklicher Mann«, sagte Michel, »denn ich habe ein ebenso schönes wie kluges Weib.«
»Und ich einen wunderbaren Mann, mit dem es sich auch mal wunderbar streiten lässt.« Marie umarmte ihn und rieb ihren Oberschenkel an dem seinen.
»Du weißt die Lust eines Mannes zu entflammen«, meinte er lachend und zog sich ebenfalls aus. Dann hob er Marie auf und trug sie zum Bett. Es war, als wollten beide ihr Zerwürfnis vergessen machen, denn sie gaben sich voll ihrer Liebe hin, bis sie beide erschöpft nebeneinander einschliefen.
2.
Am nächsten Morgen stieg die Frühlingssonne strahlend über dem Horizont auf und vertrieb die letzten Schatten, die Michels Entscheidung, König Friedrichs Ruf zu folgen, herbeigerufen hatte. Marie wurde vor ihm wach, wusch sich und zog ihre Kleider an. Als sie die Schlafkammer verließ, herrschte in der Burg bereits reges Treiben. Ihr Blick nahm alles wahr, doch sie entdeckte weder Nachlässigkeiten noch Fehler. Die Leute arbeiteten gut, und das stellte sie zufrieden.
Als Erstes suchte Marie die Küche auf und besprach mit der Köchin die Mahlzeiten für die nächsten Tage. »Du wirst einiges an haltbaren Vorräten einpacken, damit mein Gemahl und seine Begleiter auf ihrem Weg zum König nicht hungern müssen«, setzte sie hinzu.
»Hannes hat mir gestern Abend gesagt, dass der Herr auf Reisen gehen wird, und so habe ich schon einiges herausgesucht. Neben getrockneten Erbsen, Bohnen und Pilzen werden sie einen oder zwei Säcke Mehl brauchen, dazu geräucherte Würste und Schinken, ein oder zwei Fässchen Wein und eines mit Bier. Den Hafer für die Pferde muss der Stallmeister bereitstellen.« Das Gesicht der Köchin glänzte zufrieden, weil sie der Herrin damit gezeigt hatte, dass diese sich auf sie verlassen konnte.
»Das hast du gut gemacht!«, lobte Marie sie. »Sprich bitte auch mit der Ziegenbäuerin. Sie soll dir ein paar Laib von jenem Käse geben, den mein Mann am liebsten isst.«
»Das habe ich schon getan. Frau Hiltrud ist vorhin gekommen, um zu fragen, ob wir etwas brauchen. Auch sie hat bereits gehört, dass Herr Michel zum König gerufen worden ist.«
Marie lachte leise auf. »Hier bleibt wohl nichts geheim.«
»Fremden sagen wir schon nichts«, rief die Köchin rasch, »aber die Ziegenbäuerin ist keine Fremde.«
»Nein, das ist sie wahrlich nicht.« Marie dachte an die Zeit, in der sie in Konstanz zu Unrecht der Hurerei beschuldigt und nach einer scharfen Auspeitschung aus der Stadt gewiesen worden war. Ohne Hiltrud, die damals als Wanderhure durch die Lande gezogen war, hätte sie nicht überlebt.
Sie wechselte noch ein paar Worte mit der Köchin und überlegte, ob sie gleich nach Hiltrud sehen oder vorher noch mit den Knechten sprechen sollte, die auch einiges für Michels Reise vorbereiten sollten. Die Pflicht ging vor. Daher begab sie sich zum Stall und befahl dem Stallmeister, die besten Reitpferde und genug Hafer bereitzustellen. Hannes, den treuesten und zuverlässigsten Knecht auf Kibitzstein, wies sie an, die Waffen und Rüstungen für Michel und seine Schar zu überprüfen und, wenn nötig, reparieren zu lassen.
»Putzt und fettet das Leder ein und reibt die Metallteile mit feinem Sand ab, so dass sie glänzen«, erklärte sie Hannes zuletzt.
»Das tun wir, Herrin.« Hannes grinste, denn er wusste, dass er Michel zum König begleiten würde. Zwar arbeitete er gerne auf Kibitzstein, freute sich aber darauf, Friedrich III. sehen zu dürfen.
Nachdem auch das geklärt war, ging Marie in die große Halle und sah dort ihre Töchter Trudi und Hildegard mit der Ziegenbäuerin am Tisch sitzen. Dieser war noch nicht gedeckt, da erst aufgetischt wurde, wenn Michel oder sie selbst erschienen.
»Guten Morgen, ihr drei! Wie geht es dir, Hiltrud?« Marie klang ein wenig besorgt, da ihre Freundin erst vor wenigen Wochen ihren Mann verloren hatte.
»Das Leben geht weiter«, antwortete Hiltrud mit einem Achselzucken. »Thomas und ich haben brave Kinder, die, nachdem ihnen der Vater genommen wurde, ihre Mutter umso mehr brauchen. Stimmt es, dass Michel wieder in den Krieg ziehen will?«
Diese Frage verriet Marie, dass die Freundin trotz ihrer Trauer auch an ihrem Schicksal teilnahm, und nickte seufzend. »König Friedrich hat etliche Ritter aufgerufen, ihm gegen Ladislaus von Polen beizustehen. Als Reichsritter und damit nur dem König verpflichtet, kann Michel sich diesem Ruf nicht entziehen.«
»Das tun genug andere«, murmelte Hiltrud.
Sie kannte Michels geraden Sinn und wusste, dass er leicht gegen wendigere Männer ins Hintertreffen geriet. In der Hinsicht war es gut, dass er mit Marie eine Frau hatte, die sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen ließ.
»Hat Papa etwas über Graf Ernst von Herrenrodas Vorschlag gesagt?«, fragte Trudi, die aufgeregt auf ihrem Stuhl hin- und herrutschte.
Sie war vierzehn Jahre alt und versprach ein hübsches Mädchen zu werden. Obwohl sie sich alles andere wünschte, als Kibitzstein in absehbarer Zeit verlassen zu müssen, fühlte sie sich geschmeichelt, weil ein reicher, mächtiger Graf sie als Braut für einen seiner Söhne in Betracht zog.
»Papa hat gestern gemeint, dass ihm die Forderung des Herrenroda nicht passt!«, rief Hildegard, die um drei Jahre jünger war als Trudi. Im Allgemeinen war sie ein stilles Kind, das sich meist den Launen der älteren Schwester beugte und nur gelegentlich etwas sagte, was dieser nicht gefiel.
»Aber es ist doch ein sehr ehrendes Angebot«, wandte Trudi ein.
»Das ist es«, antwortete Marie, die sich trotz aller Bedanken von der Verbindung mit der mächtigen Sippe einen Vorteil erhoffte.
Inzwischen war auch Michel erschienen und hatte Trudis Ausruf gehört. »Wärst du drei oder vier Jahre älter, mein Kind, so würde ich über eine Heirat mit einem Sohn des Grafen Ernst von Herrenroda nachdenken. So aber drängt mir der Herr zu sehr. Ich werde mich daher erst nach meiner Rückkehr mit diesem Antrag befassen.«
»Aber das wird Monate dauern!«, rief Trudi enttäuscht.
»Was sind schon ein paar Monate, wenn ich dich erst in einigen Jahren vor den Traualtar treten lassen will?«, erwiderte Michel mit einer abwehrenden Geste und griff zum Krug, um den ersten Schluck seines Morgenbiers zu trinken.
Trudi schwankte zwischen Trotz und Nachgeben. Allerdings wusste sie, dass ihre Mutter, selbst wenn sie mit ihr einer Meinung war, keine Kritik am Vater dulden würde.
»Aber was ist, wenn Graf Ernst sich anders besinnt und seinen Sohn einer anderen Familie als Eidam anträgt?«, fragte sie besorgt.
»Dann war seine Anfrage nicht viel wert.« Michel fand, dass die Eierspeise, die eben aufgetragen wurde, im Augenblick mehr Beachtung verdiente als Graf Ernst von Herrenroda, und ignorierte die bittenden Blicke seiner Tochter.
Dafür legte Hiltrud die Hand auf den Arm ihres Patenkinds. »Dein Vater hat recht«, flüsterte sie Trudi zu. »Wenn Graf von Herrenroda so handelt, liegt ihm nichts an deinen Eltern und dir, sondern nur daran, möglichst rasch die Mitgift einstreichen zu können. So einem Mann würde ich mein eigenes Kind nicht zur Schwiegertochter geben wollen.«
»Und wenn er nach Papas Rückkehr immer noch die Heirat wünscht?«, bohrte Trudi weiter.
»Dann werden deine Eltern die richtige Antwort finden. Auf jeden Fall bist du zu jung, um bereits einem Mann gegeben zu werden. Also bezähme dich! Sollte aus dieser Heirat nichts werden, so werden deine Eltern gewiss einen anderen Ehemann für dich finden.«
»So sehe ich es auch«, stimmte Michel der Ziegenbäuerin zu.
Sein Blick warnte Trudi davor, weiter auf diesem Thema zu beharren. Für ihn gab es genug anderes zu bedenken. Der Weg nach Wiener Neustadt oder nach Graz, der Stadt, bei der König Friedrich seine Truppen sammeln wollte, war weit und führte durch Landschaften, die Herren gehörten, die Friedrich nicht wohlgesinnt waren. Wie es hieß, sollte sich sogar sein jüngerer Bruder Albrecht mit dem Polenkönig verbunden haben, um die Krone Karls des Großen und den Titel Kaiser, den Friedrich anstrebte, an sich reißen zu können.
3.
Es war, als hätten Marie und Michel ein stillschweigendes Übereinkommen getroffen, Graf Herrenrodas Anfrage nicht mehr zu erwähnen. Es gab auch so genug zu tun, denn außer Michel hatten auch andere Herrschaften aus diesem Landstrich Friedrichs III. Ruf vernommen, und einige wollten ihre Männer dem König zuführen. Die frommen Damen des Klosters Hilgertshausen stellten Kriegsknechte und baten Michel, diese in seine Schar einzugliedern. Ebenso hielt es ihre nächste Nachbarin Hertha von Steinsfeld. Zwei Tage bevor Michel aufbrach, erschien Ludolf von Fuchsheim und brachte einige Reisige mit. Seine Tochter Bona begleitete ihn. Sie war in Trudis Alter und deren beste Freundin. Die beiden Mädchen verschwanden auch gleich in der Burg, ohne Hildegard mitzunehmen. Diese wanderte zum Ziegenhof, um mit Hiltruds Tochter Mechthild zu spielen.
Michel begrüßte den Fuchsheimer freundlich und lud ihn in die Halle ein. »Einem Schluck Wein und einem Stück Rauchfleisch werdet Ihr gewiss nicht abgeneigt sein«, meinte er.
»Dagegen habe ich gewiss nichts«, antwortete der Fuchsheimer mit einem schiefen Grinsen.
Nachdem sie miteinander angestoßen hatten, legte Ludolf von Fuchsheim das Gesicht in kummervolle Falten. »Ihr seid noch im besten Alter, Kibitzstein, doch ich spüre immer mehr die Jahre, die auf mir lasten. Als ich gestern meine Rüstung anlegen wollte, drückte sie mich an allen möglichen Stellen und wurde mir zu schwer.«
Diese Einleitung verhieß nichts Gutes, fand Michel, erwiderte aber nichts.
»Ich habe nur diese eine Tochter, da mein Weib mir keinen Sohn geschenkt hat. Wer soll also mein Aufgebot anführen, da ich es nicht mehr kann? Ich kann doch nicht Bona in eine Rüstung stecken und zum König schicken!«
Michel begriff nun, worauf der Fuchsheimer hinauswollte, und da ihm an einer guten Nachbarschaft gelegen war, klopfte er ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Äbtissin Margarete von Hilgertshausen und Hertha von Steinsfeld haben mir bereits ihre Männer anvertraut. Da kann ich auch die Euren mitnehmen und Euch beim König entschuldigen.«
»Das würdet Ihr für mich tun?« Die Augen des Fuchsheimers leuchteten zufrieden auf, denn genau das war seine Absicht gewesen. Er umarmte Michel und ließ sich einen zweiten Becher Wein schmecken, bevor er weitersprach.
»Es soll, wie es heißt, kein großer Kriegszug werden. König Friedrich will dem Polenkönig nur zeigen, dass er jederzeit Unterstützung aus dem Reich herbeirufen kann. Selbst wenn nur wir Ritter aus Franken kommen, reicht das aus, um Ladislaus in seine Schranken zu weisen. Sollte es dennoch zu einer Schlacht kommen, weiß ich, dass Ihr meine Männer gut führen werdet.«
»Ich werde sie genauso gut behandeln wie meine eigenen«, versprach Michel.
Unterdessen hatte auch Marie sich hinzugesellt und betrachtete den Nachbarn mit einer Mischung aus Ärger und Spott. Sie hatte die Männer, die er mitgebracht hatte, gemustert und festgestellt, dass ihre Bewaffnung und die Ausrüstung um einiges schlechter waren als die der eigenen Leute. Auch haperte es an Vorräten für den Marsch. Hertha von Steinsfeld hatte ebenfalls daran gespart, und selbst das Kloster hatte seinen Männern weniger mitgegeben, als diese benötigen würden. Wie es aussah, erwarteten alle, dass Michel ihre Leute ernährte. Auch wenn Marie nichts dagegen hatte, dass er sie anführte, so ärgerte sie sich doch, dass seine Gutmütigkeit von den Nachbarn auf eine solche Weise ausgenutzt wurde.
»Ihr solltet morgen noch zwei Saumpferde mit Vorräten schicken, Herr Ludolf. So haben Eure Leute zu wenig zu beißen«, stichelte sie.
»Herr Friedrich hat versprochen, für die Männer zu sorgen«, antwortete der Nachbar dickfellig.
Michel, dem an einer guten Nachbarschaft mit Fuchsheim lag, bedeutete Marie, es dabei zu belassen. Ähnlich wie sie von einer Hochzeit Trudis mit dem Sohn Ernst von Herrenrodas träumte, überlegte er sich, ob nicht eine Heirat seines Sohnes Falko mit Ludolfs Tochter und Erbin Bona wünschenswert wäre. Kibitzstein und Fuchsheim stießen aneinander und würden zusammengefasst mehr Gewicht in diesem Teil Frankens erlangen, als wenn sie für sich blieben. Zwar war Bona gut zwei Jahre älter als sein Sohn, aber das war kein Unterschied, der eine Heirat unmöglich machte. Zurzeit befand Falko sich jedoch mit seiner Ziehschwester Lisa bei deren Verwandten Heinrich von Hettenheim, um sich dort als Page und später als Knappe zu bewähren. Wenn er in einigen Jahren nach Kibitzstein zurückkehrte, war immer noch Zeit, mit Ludolf von Fuchsheim zu sprechen. Jetzt galt es, an anderes zu denken.
»Ich werde übermorgen aufbrechen«, erklärte Michel. »Habt Ihr etwas von Moritz von Mertelsbach gehört? An ihn erging der Ruf des Königs ebenfalls.«
Der Fuchsheimer schüttelte den Kopf. »Ich habe Herrn Moritz letzte Woche in Dettelbach getroffen. Aber er hat mit keinem Wort erwähnt, ob und wann er aufbrechen will. Eigentlich hatte ich angenommen, er würde seine Männer ebenfalls Euch anvertrauen. Immerhin zählt er noch ein paar Jahre mehr als ich. Vermutlich wird er seinen ältesten Sohn losschicken, auf dass dieser sich beim König einen guten Ruf erwirbt.«
»So wird es wohl sein.« Auch wenn er Moritz von Mertelsbach nicht mochte, ärgerte Michel sich, weil dieser ihn einfach überging. Dabei war er der noch von Kaiser Sigismund bestellte Hauptmann der in ihrem Gau ausgehobenen Truppen. Auch Maximilian von Albach hatte keine Nachricht gesandt. Dessen Herrschaft war kleiner als Kibitzstein, und dieser Umstand wurmte den Mann, weil er auf eine stattliche Ahnenreihe zurückblicken konnte.
»Nun denn! Er muss wissen, was er tut. Auf jeden Fall halten Fuchsheim, Steinsfeld, Hilgertshausen und wir zusammen«, sagte er und ließ sich einen weiteren Becher einschenken.
Marie bat Ludolf von Fuchsheim noch, Grüße an seine Gemahlin auszurichten, und ging wieder ihren Pflichten nach. Michel leerte noch den einen oder anderen Becher Wein mit seinem Gast und half ihm am späten Nachmittag in den Sattel.
Es dauerte ein wenig, bis der Trupp aufbrechen konnte, denn im Gespräch mit Trudi hatte Bona von Fuchsheim die Zeit vergessen und musste erst in der Burg gesucht werden. Schließlich aber konnte Michel das Mädchen aufs Pferd heben. Kaum hatten die Fuchsheimer das Burgtor passiert, trat Marie an Michels Seite. »Ich finde es nicht richtig, dass du dich von unseren Nachbarn so ausnützen lässt, Liebster.«
»Warum ausnützen?«, fragte Michel verblüfft.
»Sowohl die frommen Damen wie auch Hertha von Steinsfeld und Ludolf von Fuchsheim haben ihren Männern zu wenig Vorräte mitgegeben. Auch sind die Waffen der Fuchsheimer und Steinsfelder Waffenknechte alt und teilweise sogar unbrauchbar. Wir werden sie aus unseren eigenem Zeughaus ausrüsten müssen.«
»Auch wenn es uns gewisse Kosten bereitet, sollten wir nicht alles auf Heller und Pfennig aufrechnen. Immerhin geht es um eine gute Nachbarschaft«, antwortete Michel.
»Die darf aber nicht zu einseitig ausfallen!« Im Gegensatz zu ihrem Ehemann nahm Marie es den Nachbarn übel, dass sie ihm neben der Verantwortung für ihre Leute auch die Pflicht aufhalsten, für sie zu sorgen.
»Wir werden von den paar Gulden gewiss nicht arm! Immerhin hast du genug Geld, um Ernst von Herrenroda zehntausend Gulden als Trudis Mitgift auszahlen zu können.« Nach Michels Ansicht war seine Frau in dieser Beziehung zu engherzig. »Im Gegensatz zur Steinsfelderin und dem Fuchsheimer sind wir reich, und so kann ich es mir leisten, ihre Männer in den Krieg zu führen«, erklärte er. »Allerdings darf Großzügigkeit nicht in Dummheit ausarten.«
»Ich sagte nicht, dass du dumm bist«, antwortete Marie gekränkt.
Michel sah sie lächelnd an. »Ich habe dir doch eben recht gegeben. In einem gewissen Rahmen bin ich bereit, für die Männer unserer Nachbarn zu sorgen. Sollten die Kosten jedoch zu hoch werden, werde ich die Summe den Herrschaften in Rechnung stellen.«
»Als wenn du das je tun würdest!« Marie lachte leise, ihre Verstimmung war bereits wieder verflogen. »Du solltest allerdings bedenken, dass auch für uns härtere Zeiten kommen können. Immerhin zweifelt der neue Fürstbischof von Würzburg die Rechte an, die wir von seinem Vorgänger Johann von Brunn gekauft haben. Die meisten von ihnen haben noch lange nicht die Summe eingebracht, die wir dem Fürstbischof dafür gegeben haben. Wenn Gottfried Schenk zu Limpurg die Zahlung verweigert, werden wir etliches an Geld verlieren.« Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Deswegen bin ich ja auch dafür, das Angebot Ernst von Herrenrodas anzunehmen. Steht er auf unserer Seite, wird der Fürstbischof es sich gut überlegen, gegen uns vorzugehen.«
»Unsere Rechte stehen geschrieben. Das muss auch Gottfried Schenk zu Limpurg anerkennen«, erklärte Michel voller Zuversicht.
»Er hat noch andere Möglichkeiten, uns zu schaden. Immerhin besitzt er das Vorschlagsrecht für die Äbtissinnen von Hilgertshausen. Die ehrwürdige Mutter Margarete ist alt und war im Winter sehr krank. Stirbt sie, könnte der Fürstbischof sie durch eine Frau ersetzen, die sich gegen uns stellt.«
»Auch diese muss sich an die geltenden Verträge halten, Marie«, antwortete Michel mit einem nachsichtigen Lächeln.
Seiner Ansicht nach machte sie sich zu viele Sorgen. Sowohl die Vogteirechte und die Verpfändung mehrerer Würzburger Dörfer durch Johann von Brunn wie auch der Hilgertshausener Weinberge, die die Äbtissin ihnen als Pfand für eine gewisse Summe überlassen hatte, waren vertraglich geregelt. Die Abschriften der Verträge wurden hier in der Burg an einer sicheren Stelle verwahrt.
Marie wünschte sich, die Zuversicht ihres Mannes teilen zu können. Doch bereits die Art, mit der Gottfried Schenk zu Limpurg erklärt hatte, alle Verpflichtungen des Hochstifts nachzuprüfen und jene als erloschen zu erklären, die er als nicht gültig erachtete, bewies, von welchem Schlag dieser Mann war.
4.
Marie und Michel waren zu oft und zu lange getrennt gewesen, als dass ihr Abschied frei von Schmerz hätte sein können. Am Morgen hatten sie sich lange umarmt, und Marie hatte sogar geweint, doch als sie vor ihre Leute traten, beherrschten sich beide. Michel war sogar ein wenig stolz, als er die Schar musterte, die er anführen sollte. Durch die ihm übertragenen Krieger der Nachbarn würde er nicht wie ein kleiner Reichsritter zum Aufgebot des Königs stoßen, sondern wie jemand, der über mehr Land gebot als die paar Dörfer, die zu Kibitzstein gehörten. Vielleicht, so dachte er, würde Friedrich ihn sogar in den Freiherrenstand erheben, wenn er sich an seiner Seite bewährte.
Im Gegensatz zu ihm war Marie eine Rangerhöhung gleichgültig. Ihr wäre es weitaus lieber gewesen, ihr Mann hätte bei ihr bleiben und es anderen überlassen können, für König Friedrich zu streiten. Ein Stallknecht brachte ihm eben sein Pferd, und er schwang sich geschmeidig in den Sattel.
»Auf Wiedersehen!«, rief er ihr, Trudi und Hildegard zu, winkte noch einmal und ritt als Erster zur Burg hinaus. Die Gewappneten des Kibitzsteiner Aufgebots folgten ihm zu Pferd, während die aus Hilgertshausen, Fuchsheim und Steinsfeld den langen Weg nach Ungarn zu Fuß bewältigen mussten. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ein Stück auf der Donau fahren, vorausgesetzt, sie fanden ein Schiff, das sie mitnahm. Doch auch dann würde der Weg mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Marie bezweifelte daher, dass Michel wie versprochen zur Weinlese zurück sein würde. Wenn es sehr lange dauerte, lag bei seiner Rückkehr unter Umständen bereits der erste Schnee auf den Höhen.
Marie verdrängte diesen Gedanken, weil er ihr den Abschied erschwerte, und folgte der Schar ein Stück. Mehrmals drehte Michel sich um und winkte, dann aber richtete er seinen Blick nach vorne. Ihr erstes Ziel würde Schwarzach sein und die erste Nachtrast bei Bibart erfolgen.
Nach einer Weile blieb Marie stehen und bemerkte jetzt erst, dass Trudi ihr gefolgt war. In den Augen des Mädchens glänzten Tränen. Marie trat zu ihr und legte ihr den Arm um die Schulter. »Kopf hoch, Kind! Dein Vater wird gewiss wieder zurückkommen.«
Sie selbst aber fror trotz des warmen Frühlingstags so stark, als kündete sich nahendes Unheil an. Mehrmals versuchte sie, das Gefühl abzuschütteln, doch es blieb.
Was konnte nicht alles geschehen! Michel musste nicht einmal auf Feinde treffen. Krankheiten kosteten auf einem Feldzug oft mehr Männer das Leben als eine Schlacht, und dann war auch noch der lange Weg nach Graz, der teilweise durch Länder führte, deren Herren Friedrich nicht wohlgesinnt waren.
In dem Augenblick bedauerte Marie, dass ihre Ziehtochter Lisa auf Einladung ihres Oheims Heinrich auf Hettenheim weilte und sie ihr Alika als Begleitung mitgegeben hatte. Mit ihrer Freundin hätte sie über ihre Sorgen reden können. Das war bei Anni, ihrer Wirtschafterin, unmöglich. Zwar nannte sie auch diese ihre Freundin, doch Anni zeigte wenig Verständnis für die Empfindungen anderer und hätte sie höchstens gefragt, ob sie Michels Kleider bereits jetzt oder erst später waschen lassen sollte.
Doch es gab jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konnte, dachte Marie und lenkte ihre Schritte zum Ziegenhof. Sie hörte, dass Trudi hinter ihr herlief, wartete, bis diese zu ihr aufgeschlossen hatte, und drückte sie tröstend an sich.
Sie trafen Hiltrud dabei an, wie diese den Rahm von der Milch abschöpfte. Als die Ziegenbäuerin Marie entdeckte, reichte sie ihrer Tochter Mechthild den Löffel.
»Mach hier weiter! Gib aber acht, dass du nicht zu viel Rahm auf der Milch lässt. Ich will Magerkäse daraus machen.«
»Ja, Mama«, antwortete das Mädchen und tauchte den Löffel in die Milch.
Hiltrud trat auf Marie und Trudi zu. »Ihr beide habt gewiss Hunger. Ich werde euch ein Butterbrot zurechtmachen.«
Hunger war zwar das Letzte, was Marie empfand, doch für Hiltrud war es wie ein Ritual, ihr etwas aufzutischen, bevor sie miteinander redeten. Sie und Trudi folgten ihr in die Küche, setzten sich auf die Bank und sahen zu, wie Hiltrud zwei große Scheiben Brot abschnitt und sie dick mit Butter beschmierte.
»Was mögt ihr trinken? Ich könnte euch einen Kamille-Pfefferminz-Aufguss machen. Oder seid ihr mit Milch zufrieden? Saft von Früchten gibt es um die frühe Jahreszeit leider noch nicht.«
»Bitte Milch«, antwortete Marie, die nicht wollte, dass Hiltrud auch noch Wasser für einen Kräuteraufguss erhitzen musste.
Hiltrud begriff, dass es ihre Freundin drängte, mit ihr zu reden, und holte rasch zwei Becher Milch. Nachdem sie alles vor Marie und Trudi hingestellt hatte, setzte sie sich zu ihnen. »Du siehst aus, als hättest du etwas auf dem Herzen.«
»Wie soll es mich freuen, wenn Michel für den König in den Krieg zieht? Beim letzten Mal hätte es ihn beinahe das Leben gekostet!« Maries Stimme schwankte, und durch ihren Kopf zogen Bilder des Schreckens, den die Hussiten verbreitet hatten. Eine leichte Ohrfeige rief sie in die Gegenwart zurück.
»Du solltest dir davon nicht das Leben verbittern lassen! Es ist ein anderer Krieg als damals, ein anderer König, der Michel zu sich ruft, und der Feind soll bei weitem nicht so grausam sein, wie es Jan Zyskas Scharen gewesen sind. Du solltest diese Grille fangen und wie eine Laus knacken«, erklärte Hiltrud. »Es kommt, wie es kommt! Wir Menschen können es nicht ändern, sondern müssen nur das Beste aus den Möglichkeiten machen, die uns das Leben bietet. Und da haben wir beide es wirklich nicht übel getroffen. Hätten du und ich damals verzagt, wäre unser Schicksal ein anderes gewesen.«
Mehr Worte wollte Hiltrud nicht über jene Jahre verlieren, weil Trudi dabeisaß und nicht erfahren sollte, dass ihre Mutter ihr Brot als wandernde Hure hatte verdienen müssen.
»Damals hatte ich ein Ziel«, antwortete Marie leise und meinte damit die Rache an ihren Verleumdern, die sie als Hure denunziert und aus Konstanz hatten vertreiben lassen.
»Du hast auch jetzt noch ein Ziel, nämlich die Burg so zu verwalten, dass Michel sich deiner nicht schämen muss, wenn er zurückkehrt«, erklärte Hiltrud streng.
»Das könnte ich auch Anni überlassen. Sie ist sehr tüchtig.«
»Fast zu tüchtig, würde ich sagen! Du hast ihr damals das Leben gerettet, und nun glaubt sie, sie sei verpflichtet, dir so viele Aufgaben abzunehmen, wie es nur geht.«
Eigentlich mochte Hiltrud Anni, doch ihr war die junge Frau viel zu versessen darauf, Marie ihre Dankbarkeit zu beweisen.
»Wenn sie wenigstens besser mit Alika zurechtkäme!«, rief Marie aus.
»Hättest du Alika genauso das Leben gerettet wie ihr, wäre sie wohl freundlich zu ihr. Da du jedoch Alika dein Leben verdankst, und nicht umgekehrt, ist Anni eifersüchtig, weil sie glaubt, du könntest Alika lieber haben als sie.«
»Dir gegenüber ist sie doch auch freundlich und freut sich, wenn du ihr einen Rat geben kannst«, wandte Marie ein.
Hiltrud schenkte ihr Milch nach und lächelte. »Du bist eine kluge Frau, Marie, aber das begreifst du doch nicht. Ich war vor Anni da und konnte ihr daher deine Freundschaft nicht wegnehmen. Sie war im Gegenteil glücklich, weil du ihr trotzdem deine Liebe geschenkt hast. Alika kam erst nach ihr, und so lebt sie in dem Wahn, dir weniger zu gelten als diese. Das kannst du nicht ändern. Menschen sind nun einmal so. Dazu kommen Alikas Herkunft und ihre dunkle Haut. Es gibt immer Leute, die sich gegen Fremde sträuben, vor allem wenn sie glauben, dass diese ihnen überlegen sind.«
»Lass uns von etwas anderem reden!«, sagte Marie in komischer Verzweiflung. Seit Jahren versuchte sie zwischen Anni und Alika auszugleichen, doch es war nur dem gutmütigen Wesen der schwarzhäutigen Frau zu verdanken, dass der Streit zwischen ihr und Anni nicht höher kochte.
»Wie geht es Falko und Lisa? Sind die beiden gut auf Hettenheim angekommen?«, fragte Hiltrud, die gerne auf Maries Wunsch nach einem Themenwechsel einging.
»Heinrich von Hettenheim hat einen Boten mit der Nachricht geschickt, dass die beiden und Alika gut angekommen sind. Seine Frau will Lisa den Sommer über auf Hettenheim behalten und sie ihren Verwandten und Freunden vorstellen und er selbst Falko zu einem jungen Edelmann erziehen.«
»Du willst mit diesem Besuch wohl die Bande mit Hettenheim und dessen Freunden und Verbündeten stärken«, schloss Hiltrud aus diesen Worten.
»Man kann heutzutage nicht genug Verbündete und Freunde haben«, erwiderte Marie und dachte an Ernst von Herrenroda, dessen Herrschaft nördlich des Henneberger Landes lag und der ein mächtiger Verbündeter für sie werden könnte.
Das Gespräch wandte sich nun weniger gewichtigen Themen zu. So hatte Hiltrud eine neue Salbe angerührt, die den Falten im Gesicht Einhalt gebieten sollte. Marie musste sie gleich ausprobieren und lobte ihre Freundin dafür.
»Die Salbe fühlt sich gut an. Du könntest mir ein Töpfchen davon verkaufen.«
»Als wenn ich von dir dafür Geld nehmen würde!«, spottete Hiltrud und sah, wie Trudi ebenfalls nach der Salbe greifen wollte.
»Dafür bist du noch ein wenig arg jung. Wenn du einmal in unser Alter kommen solltest, kannst du solche Salben nehmen«, sagte sie, strich aber, als Trudi eine enttäuschte Miene zog, doch ein wenig Salbe auf deren Gesicht.
5.
In den folgenden Wochen war es ruhig auf Kibitzstein. Marie überwachte die Knechte und Mägde und bemühte sich dabei, nicht in Annis Pflichten einzugreifen. Der jungen Frau entging buchstäblich nichts. Jeden Abend erstattete sie Marie Bericht und besprach mit ihr, welche Arbeiten am nächsten Tag anstanden. Die Felder mussten für die Sommersaat vorbereitet und die Weinberge vom ersten Unkraut befreit werden. Dazu galt es, Fässer zu reparieren und neu auszupichen. Vor allem aber musste die Burg jetzt im Frühjahr gründlich gereinigt und Kleidung, Leinenzeug und Decken gelüftet oder gewaschen werden.
Ein Wanderhändler, der in dieser Zeit zur Burg kam, verdiente gut, weil er berichten konnte, er habe Michel und dessen Männer in Regensburg beim Einsteigen in mehrere Ulmer Schachteln gesehen.
Marie war froh, dass ihr Mann nicht den gesamten Weg zum König auf Straßen zurücklegen musste, die oft ihren Namen nicht verdienten. So konnte er wenigstens bis Passau oder sogar bis Linz oder Wels auf den Ulmer Flussschiffen reisen.
Gelegentlich erschienen Nachbarn zu Besuch, sei es Bona von Fuchsheim, die zu Trudi wollte, oder Hertha von Steinsfeld. An Ansprache mangelte es Marie daher nicht. Auf den Gast, der an einem sonnigen Nachmittag auf Kibitzstein erschien, hätte sie jedoch gerne verzichtet, denn es handelte sich um ein Mitglied des Domkapitels von Würzburg.
Der Kleriker erschien mit einem halben Dutzend Begleiter und musterte die Burg in Maries Augen viel zu eingehend. Auch wenn Kibitzstein zurzeit nicht gut mit dem Fürstbistum stand, gebot es die Höflichkeit, dem Besucher und seinen Männern Unterkunft zu bieten und sie zu verköstigen.
Der Kleriker ließ sich zu Marie führen und sah hochmütig auf sie herab. »Mein Name ist Guntram von Ebrach! Du wirst gewiss bereits von mir gehört haben.«
Auch wenn er Geistlicher war, hätte er ihr als Gast mehr Höflichkeit geschuldet, fand Marie und schüttelte den Kopf. »Ich bedauere, das habe ich nicht.«
»Ich gehöre zu jenen Herren, die Seine hochwürdigste Exzellenz Gottfried Schenk zu Limpurg zu seinen Beratern ernannt hat«, fuhr Guntram von Ebrach fort.
Die Arroganz des Domherrn ärgerte Marie zunehmend, und sie stellte die Stacheln auf. »Da es dem neuen Fürstbischof von Würzburg noch nicht gefallen hat, meinen Gemahl und mich einzuladen, können wir seine Berater nicht kennen.«
»Es wird eine Einladung geben, spätestens dann, wenn Seine Eminenz über die Rechte entschieden hat, die dein Mann und du angeblich von seinem Vorgänger Johann von Brunn erhalten haben wollt.«
Marie ahnte, dass der Fürstbischof den Mann geschickt hatte, weil Michel fort war und er annahm, sie einschüchtern zu können. Doch da sollte Gottfried Schenk zu Limpurg sich täuschen.
»Was heißt hier angeblich?«, fragte sie von oben herab. »Jede unserer Forderungen ist mit Verträgen abgesichert, von denen jeweils eine Ausfertigung im Archiv des Fürstbischofs liegt.«
»Verträge mag es geben, doch ist die Frage, ob sie zu Recht geschlossen wurden«, antwortete der Domherr voller Überheblichkeit.
»Die Verträge sind mit den Siegeln und Unterschriften von Herrn Johann von Brunn und mehreren Zeugen versehen, von denen einige wie Herr Viktor von Grasheim noch dem Domkapitel von Würzburg angehören. Diese Herren werden Euch und Eurem Fürstbischof bestätigen, dass die Verträge gültig sind.«
Marie lächelte verbindlich, doch ihre Augen blickten kalt. Vielleicht hätte Michel sich auf einen Handel mit dem neuen Fürstbischof eingelassen. Da dieser sie aber ausgerechnet zu einer Zeit bedrängte, in der ihr Mann in der Ferne weilte, war sie nicht bereit, auch nur einen Fingerbreit zurückzustecken.
Der Besucher war es ebenso wenig. »Johann von Brunn hat von deinem Mann und dir eine gewisse Summe geliehen und euch dafür den zehnten Teil des Mainzolls überlassen. Das Geld kam jedoch nicht dem Fürstbistum zugute, denn Johann von Brunn kaufte dafür die Stelle eines Bamberger Domherrn für einen seiner Neffen. Ihr habt daher das Geld von diesem Neffen oder dem Domkapitel von Bamberg zu verlangen, aber nicht vom Fürstbistum Würzburg!«
»Wir haben dieses Geld Herrn Johann von Brunn in seiner Eigenschaft als Fürstbischof von Würzburg geliehen, und nicht seinem Neffen. Auch war es nicht an uns, Herrn Johann von Brunn Vorschriften zu machen, wie er diese Summe verwenden solle. Jedes Gericht wird dies Eurem Herrn bestätigen.«
Die Miene des Domherrn verriet Marie, dass ihre Bemerkung getroffen hatte. Als freier Reichsritter unterlag Michel nicht dem Gericht des Fürstbischofs, sondern dem des Königs, und es hieß von Herrn Friedrich, er wäre, was Verträge betraf, ein sehr pedantischer Herr. Wenn Gottfried Schenk zu Limpurg jene, die seinem Vorgänger Geld gegen Pfänder geliehen hatte, zum Einlenken bewegen wollte, war das Gericht des Königs der falsche Weg.
»Soll ich diese Antwort Seiner hochwürdigsten Exzellenz, dem Fürstbischof, überbringen? Er wird nicht erfreut sein«, versuchte Ebrach Marie zu verunsichern.
»Ihr könnt ihm ausrichten, dass mein Gemahl und ich auch nicht erfreut darüber sind, dass er gültige Verträge anzweifelt«, gab Marie bissig zurück. »Außerdem könnt Ihr ihm noch etwas hinzufügen: Es spricht nicht gerade von christlicher Gesinnung, dass Herr Gottfried Schenk zu Limpurg seine Forderungen ausgerechnet zu einem Zeitpunkt stellt, in dem mein Gemahl in Diensten des Königs in der Ferne weilt. Ich werde ihm eine Nachricht senden müssen, damit er Seine Majestät um Unterstützung gegen diese ungerechten Ansprüche bittet.«
Es war eine Kampfansage, und der Domherr verstand sie auch als solche. Dabei hatte er es sich recht einfach vorgestellt, die Ehefrau des Kibitzsteiners mit ein paar strengen Worten zum Gehorsam zu zwingen. Bei anderen, die dem früheren Fürstbischof Geld geliehen hatten, war ihm dies bereits gelungen. Fast alle hatten auf einen Teil der Forderungen verzichtet, auf die sie Anspruch hatten, um sich mit dem neuen Fürstbischof gut zu stellen. Dieser Frau aber, die, soweit er wusste, nur die Tochter eines Konstanzer Wollhändlers war, ging solch vornehme Gesinnung völlig ab.
»Ich werde morgen wieder abreisen. Merke dir aber, dass du dir mit deinem Starrsinn in Würzburg keine Freunde machst!« Mit dieser schwächlichen Drohung bat er Marie, sich zurückziehen zu dürfen.
Sie nickte, sah ihm nach und zog die Schultern hoch. Es war eine unangenehme Situation, die ihr ihre Machtlosigkeit vor Augen führte, doch der Ärger über den Fürstbischof überwog ihre Furcht vor dem, was daraus entstehen mochte. Sie wünschte sich allerdings, auf Freunde und Verbündete zurückgreifen zu können, und bedauerte daher, dass eine Vereinbarung mit Ernst von Herrenroda warten musste, bis Michel wieder nach Hause kam.
6.
Etliche Meilen von Kibitzstein entfernt saß Ernst von Herrenroda im Turmerker seiner Stammburg, die sich auf einer der Höhen des Thüringer Waldes erhob, und musterte die drei Männer, die sich um ihn versammelt hatten. Der älteste von ihnen war Hugo, der Kastellan der Burg. Der zweite war ein Mönch im Habitus der Benediktiner, aber mit nachlässiger Tonsur, und der letzte ein Jüngling in der Tracht eines einfachen Edelmanns. Sein Gesicht wies eine gewisse Ähnlichkeit mit den scharf geschnittenen Adlerzügen Graf Ernsts auf, und er hatte die gleichen eisgrauen Augen. Allerdings waren die Haare von gewöhnlichem Braun und nicht hellblond wie die des Grafen.
Graf Ernst trank einen Schluck aus einem silbernen Pokal, während die anderen sich mit Zinnbechern begnügen mussten. Als er das Gefäß abstellte, lachte er leise. »Wenn mein Herrensteiner Verwandter Joachim glaubt, uns überlisten zu können, wird er erkennen müssen, dass ich noch gerissener bin als er.«
»Ihr glaubt, Joachim von Herrenstein will die Fehde wieder aufnehmen, obwohl sein Vater Urfehde geschworen hat?«, fragte der Kastellan entgeistert.
»Er hat es oft und laut genug hinausposaunt«, antwortete der Mönch angewidert.
»Es war das Geschwätz eines Knaben! Sein Vater hat ihn deswegen immer wieder gerügt«, gab Hugo zu bedenken.
Graf Ernst winkte ab. »Bruder Friedmundus hat recht! Die Leute werden sich an Joachims Worte erinnern, wenn es so weit ist, und sich sagen, dass wir ihm nur zuvorgekommen sind. Um diesen Schlag vorzubereiten, werde ich alle Verwandten und Verbündeten auf die Waldburg einladen.«
»Weshalb auf die Waldburg?«, fragte der Kastellan befremdet. »Herrenroda wäre dafür weitaus besser geeignet. Die Waldburg wird für all die Gäste zu klein sein.«
»Deren Begleitung kann im Dorf unterkommen. Ich will die Zusammenkunft nicht zuletzt dort abhalten, um mich der Treue meines Vetters Ludwig zu versichern. Sein Vater hat in der großen Fehde zunächst zu den Herrensteinern gehalten und ist erst später auf unsere Seite umgeschwenkt. Bei seinem Sohn will ich erst gar nicht zulassen, dass er sich gegen mich stellt«, erklärte Graf Ernst selbstzufrieden.
»Um die Waldburg einzunehmen, braucht Ihr ein kleines Heer. Deshalb hat Euer Vater sie auch nicht angegriffen, sondern Euren Oheim in Gnaden wieder aufgenommen«, erklärte Hugo.
»Wenn ich mit einem Heer vor der Waldburg erschiene, würde Ludwig mir die Tore verschließen und Joachim von Herrenstein um Hilfe bitten. Daher ist es besser, wenn jeder meiner Brüder und Vettern zehn bis zwanzig Bewaffnete mitbringt. Als mein Lehnsmann kann Ludwig sich nicht weigern, uns einzulassen. Sind wir erst einmal in der Burg, bleibt sie auch unser«, erklärte Graf Ernst lachend.
Der junge Bursche hatte sich bis jetzt zurückgehalten. Nun aber beugte er sich nach vorne. »Wenn Ihr die Fehde mit den Herrensteinern wieder aufleben lassen wollt, braucht Ihr mehr Söldner, als Ihr jetzt aufbieten könnt, Herr Vater!«
»Das ist richtig«, gab Graf Ernst zu. »Hier kommt mein zweiter Plan zum Tragen, Robert, und in dem nimmst du eine wichtige Rolle ein. Würde ich mir von den Lombarden oder einem der Juden Geld leihen, erführe dies mein Verwandter Joachim rasch und könnte sich auf meinen Angriff vorbereiten. So aber greifen ich und all meine Verbündeten in ihre Truhen und kratzen zusammen, was herauszuholen ist.«
»Das wird immer noch nicht reichen«, wandte Kastellan Hugo ein. »Ihr werdet eine Eurer Burgen oder wenigstens einige Dörfer verpfänden müssen, um die nötige Summe zu erhalten!«
»Auch das würde Joachim von Herrenstein erfahren«, wandte Bruder Friedmundus ein.
Ernst von Herrenroda grinste breit. »Ich habe mich nach einer anderen Möglichkeit umgesehen, um an Geld zu kommen. Es gibt im Fränkischen einen Reichsritter, der mir, ohne sich selbst zu verschulden, zehntausend Gulden auf den Tisch legen kann. Das hat natürlich seinen Preis, und der ist eine eheliche Verbindung mit meinem Haus. Da ich dies keinem meiner edel geborenen Söhnen antun will, habe ich Robert holen lassen. Er wird die Tochter des Kibitzsteiners heiraten. Dafür werde ich das Paar mit einer der Burgen ausstatten, die wir Joachim von Herrenstein abnehmen.«
»Sagtet Ihr Kibitzstein, Herr Vater? Eine Tochter dieses Ritters will ich nicht! Es heißt, ihre Mutter sei eine Hure gewesen«, rief Robert empört.
»Was war deine Mutter anderes?«, fragte Graf Ernst spöttisch. »Die hat auch für jeden, der es wollte, die Beine breitgemacht. Bei dir kann ich meiner Vaterschaft jedoch sicher sein, denn es hat keiner gewagt, sich ihr zu nähern, während sie mein Bett wärmte.«
Er lachte laut und hallend, während der Knabe eine beleidigte Miene zog. Etwas darauf zu antworten, wagte er jedoch nicht.
Nun hob der Mönch die Hand. »Verzeiht, Vetter Ernst, doch gerade hier türmen sich neue Schwierigkeiten auf. Ritter Michel von Kibitzstein ist nach Österreich aufgebrochen, um König Friedrich beizustehen. Seine Ehefrau ließ mich wissen, dass über eine mögliche Verlobung ihrer Tochter mit Eurem Bastard erst nach dessen Rückkehr entschieden werden kann.«
»Wenn das so ist, brauche ich das Mädchen nicht zu heiraten!«, rief Robert, der lange genug darunter gelitten hatte, der Sohn einer Magd zu sein, die Graf Ernst einige Monate lang angenehme Stunden beschert hatte. Um diesen Makel zu tilgen, wünschte er sich die Heirat mit einer Jungfrau von Stand und nicht mit der Tochter eines Mannes, der als Vater anstelle eines Edelmanns nur einen Bierschenk aufweisen konnte.
Graf Ernst sah seinen Bastard grimmig an. »Ich habe mit dem Geld der Kibitzsteiner gerechnet und bereits Söldner angeworben. Wenn ich sie nicht bezahlen kann, laufen sie womöglich zu Joachim von Herrenstein über.« Er schwieg einen Augenblick und überlegte. Dann suchte sein Blick erneut den Mönch. »Du wirst so rasch wie möglich Kibitzstein aufsuchen und die Frau dazu bringen, meinem Vorschlag zuzustimmen.«
»Wenn man sie zu sehr drängt, wird sie fragen, weshalb Ihr das Geld so dringend braucht«, wandte der Mönch ein.
»Das ist allerdings wahr.« Graf Ernst verzog das Gesicht erneut, dachte aber nicht daran, so einfach aufzugeben. »Du wirst trotzdem nach Kibitzstein reisen. Überbringe der Frau meine Einladung auf die Waldburg. Sie soll dort unsere Verwandten und Freunde sehen und wird dann gewiss der Verlobung zustimmen. Notfalls müssen wir eben ein wenig nachhelfen.«
»Wir werden sie schon dazu überreden«, meinte Bruder Friedmundus lächelnd, während Robert eine Grimasse schnitt. »Ich will nicht die Tochter einer Hure heiraten!«
Sein Vater drehte sich mit eisiger Miene zu ihm um. »Ich kann auch einen anderen Verwandten nehmen, vielleicht sogar einen legitim geborenen Neffen, der sich darüber freuen wird, durch diese Heirat eine eigene Burg zu erhalten. Dann aber wirst du von mir keine einzige Hufe Land bekommen und wärst nach meinem Ableben ganz von der Gnade meiner ehelich geborenen Söhne abhängig. Dass die dir eine Burg als Erbe überlassen würden, bezweifle ich. Sie würden dich nicht einmal als Kastellan einer Burg einsetzen, aus Angst, du könntest versuchen, sie in deinen Besitz zu bringen. Nach meinem Tod wärst du nicht mehr als ein Knecht, und das wäre die gerechte Strafe für deinen Ungehorsam.«
Diesen harten Worten hatte Robert nichts entgegenzusetzen. Erst jetzt begriff er, dass sein Vater ihn nicht aus Liebe und Zuneigung aus dem Dorf hatte holen lassen, in dem er bisher gelebt hatte, sondern nur, um ihn wie einen Stein in einem Spiel zu seinem eigenen Vorteil zu verwenden.
7.
Auf Kibitzstein ärgerte Marie sich mehrere Tage lang über den Besuch des Würzburger Domherrn. Guntram von Ebrachs unverschämtes Auftreten und die unverfrorene Art, mit der der neue Fürstbischof sich gesiegelter Verpflichtungen entledigen wollte, bereiteten ihr Sorgen. Wie es aussah, würde sich das Verhältnis mit Würzburg weitaus schwieriger gestalten als früher. Nicht zuletzt deshalb bedauerte sie Michels Abreise von Tag zu Tag mehr. Er hätte gewiss die richtige Antwort für diese Herren gefunden. So aber musste sie damit rechnen, dass Gottfried Schenk zu Limpurg seine Abwesenheit ausnützen und die Zahlung der ihnen zustehenden Gelder verweigern würde.
Eine Woche nach dem Auftauchen des Domherrn erschien erneut Besuch auf Kibitzstein. Es handelte sich um Hertha, die verwitwete Burgherrin auf Steinsfeld. Sie war eine mittelgroße, vollschlanke Person mit einem breitflächigen Gesicht und einer mürrischen Miene, die nur selten einmal einem zufriedeneren Ausdruck Platz machte. Ihr Sohn Hardwin begleitete sie. In den sechzehn Jahren seines Lebens hatte der Junge gelernt, dass seine Mutter direkt nach Gott kam und danach lange nichts mehr.
Marie war klar, dass Hertha von Steinsfeld hoffte, ihr Sohn könne einmal Ludolf von Fuchsheims Tochter Bona heiraten und sich deren Erbe sichern. Da es jedoch sein konnte, dass der Fuchsheimer eine andere Braut für seinen Sohn wählen wollte, behielt Frau Hertha auch Trudi im Auge. Immerhin hieß es, diese würde einmal eine Mitgift erhalten, die den Wert mancher Herrschaft in diesem Teil Frankens überstieg.
»Seid mir willkommen, Frau Hertha«, begrüßte Marie den Gast.
Hertha von Steinsfeld nickte herablassend und ließ sich von ihr in die Halle führen. Eine andere Edeldame hätte Marie in ein kleineres, aber bequemer ausgestattetes Zimmer geführt. Sie kannte jedoch Herthas Stolz, der nicht zuließ, dass sie schlechter empfangen wurde als andere Nachbarn, denen hier in der Halle Wein und Braten gereicht wurde.
Auch diesmal wurde reichlich aufgetischt, und Frau Hertha und ihr Sohn aßen mit gutem Appetit.
»Das hat geschmeckt!«, rief Hardwin, als er mit seiner Portion fertig war.
Er hätte auch sagen können, dass auf Kibitzstein weitaus besser gekocht und gebraten wurde als zu Hause. Damit aber hätte er seine Mutter verärgert.
»Es war so in Ordnung«, erklärte nun seine Mutter, die um nichts in der Welt etwas als besser bezeichnet hätte als das, was es bei ihr zu Hause gab.
»Was liegt Euch auf dem Herzen?«, fragte Marie, die sich nicht denken konnte, dass Hertha von Steinsfeld nur für ein Plauderstündchen gekommen war.
Frau Herthas Gesicht wurde womöglich noch mürrischer als sonst. »Zu Euch ist doch auch dieser Domherr aus Würzburg gekommen, um Rechte zurückzufordern, die frühere Fürstbischöfe von Würzburg erteilt haben?«
Marie nickte. »Ja, er war hier.«
»Bei mir war er auch!«, schnaubte Frau Hertha. »Aber dem habe ich heimgeleuchtet. Wo kämen wir denn hin, wenn ein Mann der Kirche einer armen Witwe ihre einzigen Einnahmen wegnehmen wollte?«
Marie verkniff sich ein Lächeln, denn so arm, wie Hertha von Steinsfeld tat, war sie nicht. Ihre Ländereien brachten genug ein, um gut davon leben zu können. Dazu erhielt sie Anteile an den Einnahmen mehrerer Vogteien, die einer von Johann von Brunns Vorgängern ihrem Schwiegervater zugesprochen hatte, und das waren immerhin zweihundert Gulden im Jahr.
»Ich weiß auch nicht, was der neue Fürstbischof will, außer sich bei sämtlichen Nachbarn und vielen Herren des Hochstifts unbeliebt zu machen«, sagte Marie.
»Es ist eine Schande!«, brach es aus Hertha heraus. »Seine Vorgänger haben sich Geld geliehen und Pfänder dafür gegeben. Jetzt behauptet Gottfried Schenk zu Limpurg, die Pfandsumme sei durch die Vogteirechte bereits zurückgezahlt worden und er sähe nicht ein, weshalb er mir weiter Geld zukommen lassen solle. Dabei wurde die Laufzeit dieser Rechte niemals eingeschränkt!«
Wie Frau Hertha sich anhörte, wollte sie ihren Anspruch auf die Vogteieinnahmen bis zum Tag des Jüngsten Gerichts erheben. Marie fragte sich, wie die früheren Fürstbischöfe dazu gekommen waren, unbefristete Rechte für geliehenes Geld zu erteilen. Sie hätte dies niemals getan, sondern genau darauf geachtet, wann diese wieder eingezogen werden konnten. Doch da es nun einmal geschehen war, durfte ihrer Ansicht nach auch der neue Fürstbischof nichts daran ändern.
»Ich jedenfalls werde meine Rechte verteidigen«, erklärte Marie mit Nachdruck.
»Deshalb bin ich auch zu Euch gekommen, denn ich will Euch bitten, Euch nicht dem Willen des Fürstbischofs zu beugen, so wie Ludolf von Fuchsheim es wohl tun wird. Er erhält vierzig Gulden im Jahr aus alten Verträgen, doch scheint er darauf verzichten zu wollen. Wenigstens behauptete dieser Domherr so etwas. Vielleicht war das auch eine Lüge.«
Hertha von Steinsfeld schien diesbezüglich im Zweifel zu sein, doch Marie kannte Ritter Ludolf gut genug, um zu glauben, dass dieser auf Geld verzichten würde, wenn er sich im Gegenzug mit dem neuen Fürstbischof gut stellen konnte. Wenn der Fuchsheimer jedoch nachgab, würde er Gottfried Schenk zu Limpurg darin bestärken, auch anderen Leuten ihre Rechte abzupressen.
»Ich werde mit Ritter Ludolf reden und ihn davon abbringen. Wir müssen alle mit einer Stimme sprechen, sonst hebelt der Fürstbischof uns einen nach dem anderen aus«, versprach Marie.
Sie hatte jedoch wenig Hoffnung auf Erfolg, denn außer Frau Hertha und ihr würde sich vielleicht noch Moritz von Mertelsbach den Forderungen des Fürstbischofs widersetzen. Die anderen Nachbarn hingegen würden alles tun, um sich Gottfried Schenk zu Limpurg anzudienen.
Mit dem Gefühl, mehr Lasten aufgebürdet zu bekommen, als sie zu tragen vermochte, verabschiedete sie Hertha von Steinsfeld und deren Sohn und sah ihnen nach, als sie die Burg verließen.
Ihre Wirtschafterin Anni trat an ihre Seite und schüttelte den Kopf. »Frisst die Steinsfelderin immer so viel Rauchfleisch? Mit ihrer Portion hätte ich drei erwachsene Männer satt bekommen!«
»Es zeigt, dass es ihr geschmeckt hat, und das ist bei einem Gast doch immer das Beste«, antwortete Marie lächelnd.
Allerdings hatten Frau Hertha und ihr Sohn kräftig genug zugelangt, um sie sich nicht jeden Tag als Gäste zu wünschen.
8.
Bereits der nächste Tag brachte einen weiteren Gast nach Kibitzstein. Diesmal war es Ludolf von Fuchsheim, und er hatte erneut Bona mitgebracht. Diese winkte bereits von weitem Trudi zu. Als die beiden Mädchen in der Burg verschwinden wollten, hielt Marie sie jedoch auf.
»Nehmt Hildegard mit! Sonst hat sie überhaupt nichts von diesem Besuch.«
Bona und Trudi zogen Schnuten, denn sie fühlten sich weit über Hildegard erhaben. Doch seit Lisa zu ihren Verwandten nach Hettenheim gereist war, sah Marie es als Trudis Pflicht an, sich um ihre jüngste Schwester zu kümmern. Ihr Tonfall warnte das Mädchen davor, Hildegard allein zu lassen. Daher fasste Trudi Hildegards Arm und zog sie mit sich.
»Komm, aber störe uns nicht!«
»Trudi!« Marie sagte nur dieses eine Wort, doch ihre Älteste begriff, dass sie es nicht übertreiben durfte.
»Also gut, wir spielen mit dir«, sagte sie zu Hildegard und wunderte sich wenig später ebenso wie Bona, wie sehr es ihnen gefiel, sich mit Hildegards Puppen zu beschäftigen.
Marie führte unterdessen den Fuchsheimer in die Halle und ließ ihm Wein und ein Mahl vorsetzen. »Nun, Herr Nachbar, wo drückt der Schuh?«, fragte sie, als Herr Ludolf sein fettiges Messer an einem Tuch abwischte und es wieder in die Scheide steckte.
»Nun, es ist … nun …« Der Beginn fiel dem Fuchsheimer schwer, und so beschloss er, mit der Tür ins Haus zu fallen. »Herr Guntram vom Ebrach, seines Zeichens Domkapitular zu Würzburg, war bei mir und hat erklärt, dass der neue Fürstbischof alle Rechte überprüfen lassen und jene streichen will, die bereits verfallen sind.«
»Unsere Rechte sind noch lange nicht verfallen«, antwortete Marie herb.
»Euer Mann und Ihr habt sehr viele Rechte erworben«, sagte Ludolf von Fuchsheim mit kaum verhohlenem Neid in der Stimme.
Kibitzstein war mit seinen Dörfern eine der ertragreichsten Herrschaften in diesem Landstrich. Zusätzlich erzielten seine Besitzer noch größere Einnahmen durch die Privilegien, die ihnen Johann von Brunn für gewisse Darlehen gewährt hatte. Guntram von Ebrach hatte ihm jedoch angedeutet, dass der neue Fürstbischof sich erkenntlich zeigen würde, wenn es ihm gelang, Marie zum Nachgeben zu bringen.
»Ihr seid doch wirklich reich genug, um auf ein paar dieser Anrechte verzichten zu können«, setzte er nach einer kurzen Pause hinzu.
»Nimmt der Fürstbischof uns erst einmal ein Recht, wird er auch vor den anderen nicht haltmachen.«
Marie hatte es aufgegeben, Ludolf von Fuchsheim als Verbündeten gewinnen zu wollen. Wie es aussah, hatte der Nachbar sich auf die Seite von Gottfried Schenk zu Limpurg geschlagen und hoffte, belohnt zu werden, wenn er seinen Einfluss zu dessen Gunsten nutzte.
»Ihr seht das zu extrem, Frau Marie! Dem Fürstbischof geht es nur um einige wenige Verträge, die seine Vorgänger abgeschlossen haben und die nicht im Sinne des Hochstifts waren.«
»Jeder Fürstbischof hat sich bisher Geld geliehen, um seine Verwandten zu versorgen, und es mit Anrechten auf Zölle, Vogteien oder verpfändete Dörfer bezahlt«, begann Marie, wurde aber vom Fuchsheimer unterbrochen.
»Euer Mann und Ihr habt mehrere Dörfer von Johann von Brunn erhalten. Gottfried Schenk zu Limpurg will euch diese nicht wegnehmen, sondern nur, dass ihr sie als Würzburger Lehen betrachtet und ihm dafür Steuern zahlt.«
»Wir haben diese Dörfer gekauft und nicht als Pfänder erhalten«, antwortete Marie harsch. »Nun gehören sie zu Kibitzstein! Der Fürstbischof hat kein Anrecht mehr darauf.«
»Mein Gott, mit Euch ist nicht zu reden!«, schnaubte Ludolf von Fuchsheim. »Was wäre so schlimm daran, diese Dörfer als Würzburger Lehen zu behalten und nicht als Eigenbesitz?«
»Ein Lehen kann einem weggenommen werden, Eigenbesitz nicht.«
»Ihr malt stets den Teufel an die Wand, auch wenn nur eine Fliege summt. Ich habe Euch gewarnt! Der Fürstbischof wird nicht lange zaudern, um seine Rechte einzufordern«, rief Herr Ludolf hitzig.
»Ich werde auch nicht zaudern, unsere Rechte zu verteidigen!« Marie lächelte, doch ihre Augen schleuderten Blitze. In ihren Augen war Ritter Ludolf ein Narr, der sich von der Kreatur des Fürstbischofs hatte einseifen lassen. Um der Nachbarschaft willen hielt sie jedoch die Worte zurück, die über ihre Zunge kommen wollten, und verabschiedete ihn freundlicher, als er es ihrer Ansicht nach verdiente.
Es war, als hätte die ganze Nachbarschaft beschlossen, sie aufzusuchen, denn zur Mittagsstunde des nächsten Tages erschien Ritter Ingobert von Dieboldsheim und versuchte ebenfalls, sie davon zu überzeugen, sich den Ansprüchen des Fürstbischofs zu beugen. Auch er war von dem Domherrn Guntram von Ebrach aufgesucht und eingeschüchtert worden.