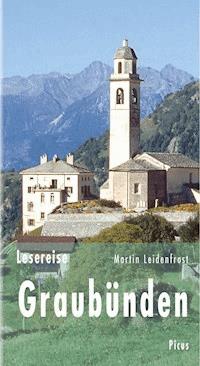Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Martin Leidenfrost ist Österreicher und lebt seit 2004 im slowakischen Grenzort Devínska Nová Ves, auf der langsam vernarbenden Naht des Eisernen Vorhangs. Von dort sind es nur wenige hundert Meter nach Österreich, dreißig Kilometer nach Ungarn und fünfzig in die Tschechische Republik. 'Die Welt hinter Wien' versammelt Geschichten aus einer Gegend, die auf vier Staaten, vier Staatssprachen und Dutzende Ethnien verteilt ist, und doch liegt alles ums Eck. Das Gebiet bezeichnet den mitteleuropäischen Zentralraum zwischen Alpen und Karpaten, irgendwo um die Städte Wien und Bratislava, Györ und Brno herum. Sie hat einige Bezeichnungen erhalten, Namen wie 'Centrope' etwa, doch kaum ein Bewohner empfindet diesen von Grenzen zerfurchten Raum als eine organische Region. Von Devínska Nová Ves aus betrachtet erscheint sie indessen als eine natürliche Einheit. Ein Jahr lang tauchte Leidenfrost Woche für Woche in eine andere Sphäre, in eine andere Sprache, in ein anderes Milieu ein. Aus der Summe dieser Wanderungen entstand das Porträt einer verblüffend vielfältigen Region. 'Die Welt hinter Wien' erzählt von Anziehung und Abstoßung, von Stammesfehden und Megalopolen-Utopien, von der Schönheit, Traurigkeit und Wirklichkeit der europäischen Integration. 'Die Welt hinter Wien' ist das Buch zur Serie, die im Spectrum der Tageszeitung Die Presse erschienen ist und mit dem Journalistenpreis 'Writing for CEE 2007' ausgezeichnet wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Leidenfrost
Die Welt hinter Wien
Copyright © 2011 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien Alle Rechte vorbehalten Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien Umschlagfoto: © Martin Leidenfrost Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien ISBN 978-3-7117-5077-8 Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Martin Leidenfrost
Die Welt hinter Wien
Picus Verlag Wien
Inhalt
Zum Geleit
Ostflieger
Liebeserklärung
Wagon Slovakia
Volkskörper
Monaco der Zapfsäulen
Mit dem Dreschflegel
Der Förster von Stopfenreuth
Was ein Ungar ist
Roma Road Show
Kittsee geheim
Das letzte Schiff
Sieben Versuche über Wilsonovo
Die Schwelle
Südmährische Kommunion
Monument des Sinkflugs
Ein Wahnsinnsortl
Über Pferde und Männer
Den Meeren glauben
Im Stausee
Die Markomannen
Lobau Love
Lundenburg Thrill
Der Turmbau von Brabel
Im Rosengarten
Abschied von Piroschka
Das große Zittern
Warmes Wasser
6x6 m
Prügel
Der dritte Anlauf
Tief im Westen
Sex, Vietnam, Kellergasse
Wasser stehlen
Wenn ich geh nach Schwitzerland
Parndorfer Vision
Unter Walachen
Hm
An der schönen
Die neuen Nachbarn
Wo man Hochzeit macht
Quelle der Hoffnung
Der Referent
Ein Trdelník auf Reisen
Wieder Weltkrieg
Ballade von der Sinica
Auf dem Postenstand
Ein Sommerregen
Zum Abschied
Centrope 2020
Zum Geleit
Die Gegend hat viele Namen und keinen. Vielleicht ist die Gegend auch keine Gegend und braucht keinen Namen. Ihre Bewohner sprechen vier Staatssprachen und Dutzende sonstige Idiome. Die Wenigsten unter ihnen würden sagen, dass die Gegend, von der ich erzähle, eine Gegend ist.
Ein paar Leutchen mühen sich mit Benennungen. Als hätte Europa nicht Dutzende gemessener, gefühlter, behaupteter Mitten, haben sie die Gegend zur Mitte Europas erklärt. Den mitteleuropäischen Freiraum, der sich zwischen Alpen und Karpaten erstreckt, um die Achse Wien–Bratislava herum, ungefähr von Györ bis Brünn, mal etwas weiter, mal etwas enger gefasst.
Centrope, Europa Region Mitte, Central Danube, Twin-City. Kein Name hat sich bislang durchgesetzt, sonst ließe sich mein Buch in den Buchhandlungen einsortieren, im Reiseregal oder überhaupt irgendwo. Stattdessen lege ich einen Bastard vor: deplatziert unter den Wien-Büchern, weil ich das Stadtgebiet umgehe, randständig im Österreich-Fach, weil ich nur durch den verschmähten Ostsaum der Alpenrepublik spaziere. Ein Tschechien-Buch ohne Prag, ein Ungarn-Buch ohne Budapest, ein Slowakei-Buch – aber für die Slowakei gibt es ohnehin kein Regal.
Also Rest und Rand, Sonstiges und Vermischtes. Immerhin ist die Gegend zu einem Ort der Fantasie geworden. Vladimír Bajan, 2005 zum Verwaltungschef der Region Bratislava gewählt, hat seine Vision von »Groß-Bratislava« vorgestellt. Er zitiert namentlich nicht genannte »Developer«, die der Gegend »nicht zufällig eine schier unglaubliche Zukunft vorhersagen«. Die sechs Millionen Einwohner der Gegend würden sich – so Bajans Developer – in zwanzig Jahren verdoppeln. »Einige Studien sprechen von bis zu zwanzig Millionen Einwohnern.«
Eine ruhigere Zukunft hat uns »CENTROPE 2015« prophezeit, eine Wiener Magistrats-Utopie reinsten Wassers. In dem 2006 veröffentlichten Zukunftsbild steigt die Gegend zur »dynamischen Biosphärenwachstumsregion« auf, zu einer »Learning Region« mit »Centrope Card« und »Gender Center Centrope«.
Eingeleitet wird die Vision so: »April 2015. Heute treffen die Landeshauptleute, Komitatspräsidenten und Bürgermeister der Europa Region Mitte zu ihrer diesjährigen Generalversammlung zusammen, um das Arbeitsprogramm für CENTROPE für die nächsten beiden Jahre zu beraten und zu beschließen.«
Als ich in »Centrope 2015« auf Begriffe wie »cross border skills net« stieß, musste ich an die niederösterreichische Pensionistin denken, die mir auf einer Bahnfahrt durch das Marchfeld begegnet ist. Die Frau hatte sich über viele Jahre ihren eigenen Reim darauf gemacht, was die englische Durchsage in den Regionalzügen bedeuten soll. Sie konnte kein Englisch und hätte auch nicht erwartet, dass Helmahof und Silberwald in der Weltsprache angekündigt werden. Bevor ein sprachkundiger Jugendfreund sie aufgeklärt hat, war sie all die Jahre der Überzeugung gewesen, dass die rätselhafte Lautkombination »next stop« nur eins bedeuten kann: Nächstdorf.
Die Gegend wird auch sonst zu einem Ort der Fantasie. Das ist schon deshalb so, weil man sich gegenseitig nicht kennt, in Wiens nahem Osten. Man mag es mit historischen Traumata erklären, mit Krieg, Vertreibung, Eisernem Vorhang und Schengengrenze, oder auch mit Einkommensgefälle, Verkehrsbarrieren, Komplexen und Ignoranz. Jedenfalls haben alle in der Gegend siedelnden Stämme ihre höchst eigene Vorstellung davon, was nah und was fern, was fremd und was vertraut ist.
Umfragen haben den Verdacht bestätigt, dass die gefühlte Entfernung zwischen Wien und Bratislava ungleich größer ist als jene zwischen Bratislava und Wien. Viele Wiener wähnen Bratislava hundert bis dreihundert Kilometer entfernt, während fast jeder Pressburger die richtige Antwort gibt. Und sollte sie auch sonst kein Wort Deutsch verstehen, kommt jeder jungen Pressburgerin »Mariahilfer Straße« vollendet über die Lippen.
Dennoch erhebe ich nicht den Vorwurf: Wie kann man noch nie dort gewesen sein! Ich war selbst nicht anders. Nur durch ein Experiment bin ich mitten in die Gegend hineingeraten – durch ein offenkundig entglittenes Experiment, denn aus einer vorübergehenden Verlagerung des Wohnsitzes wurden mindestens vier Jahre meines Lebens.
Dass man in der Gegend so wenig übereinander weiß, stimmt mich eigentlich froh. Es hat mir beim Schreiben – dabei ist alles wahr! – eine schwindelerregende Freiheit verschafft.
Die meisten Texte dieses Buches gehen auf Reisen zurück, die ich für die Serie Die Welt hinter Wien unternommen habe, erschienen im Spectrum der Wiener Tageszeitung Die Presse. Ein Jahr lang, von Oktober 2006 bis Oktober 2007, bin ich jede Woche an einen anderen Ort gegangen und in eine andere Sphäre getaucht, in Shoppingcenter und Roma-Slums, in Business-Towers und Dorfkaschemmen, in Stauseen, Wohnstuben, Grenzorte, Puff-Hütten und Verkäufer-Seminare, in schwule Pferdefarmen und in hussitische Messen. Was ich für die Essenz meiner Erkundungen halte, ist in dieses Buch gepresst.
Natürlich habe ich mir die Frage nach dem Stil gestellt. Ich habe mich umgesehen und fand mindestens drei Stile, in denen über »den Osten« geschrieben wird: Mitteleuropa-Nostalgie, Ostkitsch, Investoren-Pathos.
Mitteleuropa-Nostalgie ist das Programm kleiner Minderheiten, aber unter Dichtern, Dissidenten, Intellektuellen vorwiegend fortgeschrittenen Alters verbreitet. Sie raunen eher von »Mitteleuropa«, als dass sie davon sprächen, und die sozio-ökonomische Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts kommt dabei nur als störendes Ärgernis vor.
Dass ich speziell zur habsburg-nostalgischen Linie dieser Schule nicht tauge, wurde mir bei der Stasiuk-Lektüre bewusst. In seinem Europa-Essay »Logbuch« schildert der Wahl-Galizier, wie er in der ungarischen Provinz mit einem unbekannten Narren Körte säuft. Der Pole und der Ungar verstehen die Sprache des anderen nicht, aber es ist der 18. August, und sie wissen beide, worauf sie trinken – auf Kaisers Geburtstag. Der Österreicher in mir musste das Buch beschämt zur Seite legen. Ich hätte nicht einmal gewusst, an welchem Tag der Kaiser Geburtstag hat.
»Ostkitsch« ist das vernichtendste Werturteil, das der slowakische Schriftsteller Michal Hvorecký zu vergeben hat. Da ich dieses Urteil im Innersten fürchte, habe ich ihn nie nach der genauen Bedeutung von »Ostkitsch« gefragt. Er meint wohl das Schwelgen in einer Romantik des Verfalls, der Armut und kommunistischer Relikte.
Mit dem Wirtschaftsboom der postsozialistischen Länder ist ein dritter Stil aufgekommen, das globalisierte Pathos der Investoren, die ihre mit Anglizismen versetzten Businesspläne über die Gegend stülpen. Von Intellektuellen verachtet, erscheint mir das Investoren-Pathos dennoch relevant. Seine Protagonisten sind leicht zu erkennen: Ein Wort wie »Mitteleuropa« käme ihnen nie über die Lippen, ihr Schaffen gilt »Zentraleuropa« oder »CEE«. Zu ihnen gehören wohl Bajans Developer und auch die Werktags-Propheten vom Wiener Magistrat.
Alle drei Stile stehen für Initiativen, Institutionen und Neigungsgruppen, die sich der Gegend annehmen, fein säuberlich voneinander getrennt. Ich habe versucht, mich all dieser Stile fromm zu enthalten – und nahm bestimmt einige Anleihen auf.
Meine Spaziergänge sollen von Nutzen sein. Wer in meinen Geschichten gute Gründe findet, warum er nie in die Gegend zu fahren braucht, ist mir als Leserin und als Leser lieb und wert. Ich freue mich sogar diebisch, wenn niemand meine Angaben überprüft. Ja, eigentlich könnte ich Märchen erzählen. Märchen aus der Gegend. Märchen aus Nächstdorf.
Ostflieger
1
Vor Jahren hat ein französischer Freund namens A. die Nachricht erhalten, dass ein Schulkollege seiner Kindheit in der österreichischen Provinz gelandet war. Der Schulkollege war Mönch geworden und hatte ausrichten lassen, A. möge ihn doch im Kloster besuchen. Im Kloster von Marchegg.
Wir lebten damals in Wien und hatten weder von dem Kloster noch von dem Ort je gehört. Wir fanden Marchegg auf der Karte, am Ostrand Niederösterreichs, an der slowakischen Grenze. Die Einladung machte A. nervös, ein beinahe vergessener Schulkollege seiner Kindheit in der Umgebung von Paris hatte sich in einen Mönch verwandelt.
A. war konfessionslos und sagte zu mir: »Du bist doch Niederösterreicher, liebst den Osten und verteidigst bei jeder Gelegenheit die katholische Kirche, übrigens völlig zu Unrecht. Du musst mitkommen. Nur wenn du mitkommst, fahre ich an die March.«
Mich hat nichts weniger als Marchegg interessiert. Ich sehnte mich gerade nach Minsk, nach der Krim, nach Astrachan, sagte A. jedoch zu. Das muss im Jahr 2002 gewesen sein, denn wir schoben den Ausflug ein Jahr vor uns her.
Am Palmsonntag 2003 sind wir gefahren. Was ich dort draußen sah, wühlte mich so auf, dass ich nach der Rückkehr einen Haufen Zeug in mein Tagebuch klopfte und hektisch Informationen sammelte – als hätte ich einer Bestätigung bedurft, dass jener unheimliche Ort tatsächlich existiert. Ich nahm mir vor, etwas sehr Grundsätzliches über Marchegg zu schreiben. Na ja, einen »exemplarischen Essay«.
Wieder verstrich ein Jahr, und ich tat nichts in der Art. Wie kein Land zuvor hat mich die Ukraine gefesselt, monatelang trieb es mich durch Kiew und durch die Steppen am Schwarzen Meer. Erst im Frühjahr 2004 überwand ich mich, ein zweites Mal nach Marchegg zu fahren. Pünktlich zur großen Osterweiterung der EU erschien mein Essay.
Ich gebe den Text wieder, obwohl mir das »Exemplarische« des Essays, der unpersönliche Tonfall, nicht mehr sympathisch ist. Seit die Schengengrenze von Österreich abgerückt ist, liest er sich beinah historisch, wie eine Erinnerung an Marchegg.
Aber damit hat alles begonnen. Der Text hat mich in Marchegg nicht beliebt gemacht, und kurz nach der Veröffentlichung brach in meinem Leben das Chaos aus. Wieder einmal stand mir ein Umzug bevor, wieder einmal ein Umzug innerhalb von Wien. Es verging kein Monat, und ich zog an die March.
2
Es fiele leicht, den Marchegger als Idealtyp verbiesterter Provinzialität, als bösen Spießer, als auffallend niedrige Spielart des Niederösterreichers zu karikieren. Verfolgte man diese Absicht, böte sich ein Hinweis auf die junge Klosterschwester an, die von der Straße weg zur Polizei geschleppt wurde. Die in Marchegg lebende Ausländerin hatte einen Marchegger nach dem Weg gefragt und wurde in voller Ordenstracht zum Opfer ihres Akzents. Man weiß ja nie, mag der eifrige Mann gedacht haben, auf was für Tricks die Illegalen kommen.
Es fiele aber allzu leicht, den trüben Eindruck, den die Kleinstadt an der slowakischen Grenze hinterlässt, einer Charakterschwäche des Marcheggers zuzuschreiben. Der Marchegger ist derartigen Widrigkeiten ausgesetzt und wurde auf eine Weise in den Windschatten der Geschichte geworfen, dass es ihm unverhältnismäßig schwer fallen muss, ein guter Multikulturalist zu sein.
Immerhin lernen einige Dutzend Marchegger die slowakische Sprache, die neuerdings als Freifach in den Schulen und als Abendkurs angeboten wird. Den Anstoß dazu hat das »Grenzüberschreitende Impulszentrum« gegeben, das mit Mitteln der Europäischen Kommission dem Auftrag folgt, »am Abbau der hartnäckigen Barrieren der Wahrnehmung unserer slowakischen Nachbarn zu arbeiten«. Wofür Marchegg heute in Mitteleuropa steht, dafür kann der Marchegger selbst gar nicht einmal viel.
So sehr ein Einzelner sich dagegen stemmen mag, formt doch das bittere Regime der Schengengrenze Tag für Tag das Bewusstsein. Die Bedürftigen und Entrechteten, die aus den Weiten Eurasiens nach Westen strömen, beunruhigen nicht den Schlaf des Kitzbühlers. Es ist der Marchegger, den nachts die Angst beschleicht, die March könnte das ganze Elend dieser Welt vor die Tür seines bescheidenen Einfamilienhauses spülen.
Zum leisen Horror Schengens kommt der Umstand hinzu, dass auf dem Gebiet der 3500 Einwohner zählenden Gemeinde drei Stämme ansässig sind, die nicht alle in bestem Einvernehmen stehen: Die Gemeinde zerfällt in Marchegg-Stadt und Marchegg-Bahnhof, zwei voneinander abgesonderte Entitäten, die drei Kilometer auseinanderliegen. Und in den abgestorbenen Eichen der Aulandschaft siedelt die größte baumbrütende Weißstorchkolonie Europas.
Die Marchegger Störche sind Ostflieger, wählen für ihren Flug nach Südafrika die Route über den Bosporus statt jener über Gibraltar. Das »Storchendorf Europas« ist eine touristisch erschlossene Attraktion: An sonnigen Wochenenden wandern heitere junge Familien die Naturlehrpfade entlang, besteigen die hölzerne Aussichtsplattform, und manches kindliche Auge sieht man vom Lebensgefühl der Vögel träumen, das für Freiheit und Geborgenheit gleichermaßen steht. Es ist ein Ort der Weite.
Die Störche bleiben ihrem Partner nicht treu, ihrem Nest hingegen schon. Oft bauen sie ein Leben lang daran, bis es einige hundert Kilo wiegt. Das Phänomen der Zugvögel ist eine rätselhafte Verschwendung der Natur, in dem sich schwerlich ein Sinn erkennen lässt. Die Jungen fliegen vor den Alten los, dennoch landen alle zusammen in Südafrika. Sie fliegen bis zu zweihundert Kilometer am Tag, zwei Drittel gehen in der Sahara zugrunde. Jene, die den Flug überstehen, kommen immer wieder nach Marchegg zurück. Sie sind so sesshaft wie die Marchegger selbst, nur eben sesshaft an zwei Orten.
Mutlos möchte man dem Integrationsprozess der EU-25 entgegenblicken, wenn man das blanke Unverständnis erfährt, das Marchegg-Stadt und Marchegg-Bahnhof voneinander trennt. »Wenn ich einen Bahnhöfler nur seh, muss ich schon speiben«, entfährt es einer älteren Einwohnerin von Marchegg-Stadt. In der jungen Generation wird die tradierte Hassbeziehung zwischen der bäuerlich-kleinbürgerlichen Stadt und dem proletarischen Ortsteil Bahnhof weiter gepflegt und verfeinert.
Jeder Ortsteil hat seine Kirche mit eigenen Gottesdiensten, am Bahnhof wird dieser faktisch nicht besucht. Die Kirche am Bahnhof, ein schmutzigbeiger moderner Bau, liegt an einer Seitenstraße. Umstanden von magersüchtigen Nadelbäumchen, führt eine Art flacher Garagenzufahrt aus grauen Betonplatten zu der Kirche hin. Wo die Zufahrt in die Straße mündet, soll jeden Vollmond ein Huhn geschlachtet worden sein, nach Möglichkeit auch eine konsekrierte Hostie zerstampft.
Es gibt eine Marchegger Gewissheit, die der mürrischen Mentalität des Ortes zugrunde liegt: Für uns interessiert sich niemand. Dies auf die Grenzbildung von 1918 und den Eisernen Vorhang zurückzuführen, hieße um sechs Jahrhunderte zu kurz zu greifen.
In Wirklichkeit kam Marchegg nie über den Umstand hinweg, dass die österreichischen Erblande 1278 an Habsburg fielen. Die herausragende Stellung, die der hoffnungsvollen Neugründung von Böhmenkönig Ottokar versprochen war, sollte Marchegg im Verlauf seiner Geschichte niemals einnehmen dürfen. Geplant war die größte Stadt Ostösterreichs.
An die weitausgreifenden Pläne des untergegangenen Přemysliden erinnern die Reste der acht Meter hohen Stadtmauer. Gut erhalten ist das nach Westen führende Wiener Tor, nach dem Brauch der Zeit mit Schießscharten und Pechnasen ausgestattet. Das nach Osten weisende Ungartor ist verfallen.
Von niedrigen eingeschoßigen Häusern umrahmt, liegt der Hauptplatz in der unbelebten Starre seiner Nutzlosigkeit. In der Mitte des Hauptplatzes steht fest gemauert der mehrflügelige Grenzüberwachungsposten, wo auf mehreren Etagen jene Flüchtlinge eingesperrt werden, die es heil über die March geschafft haben. Seit der Innenminister 2001 die dort untergebrachten »Anhalteräume« eröffnet hat, werden mehr als 7000 Flüchtlinge pro Jahr durchgeschleust. Auf den nachsichtig gepflegten Wiesen rundherum muntern sich wilde Bienenschwärme gegenseitig auf.
In der jüngeren Geschichte Österreichs steht Marchegg für mehr als einen Abweg der österreichischen Politik. Längst ist allgemein akzeptiert, dass Österreich milchgesichtige Präsenzdiener an seine Grenze stellt, um sie zur Asylantenabwehr heranzuziehen. Welchen pädagogischen Effekt dieser Dienst auf Teenager hat, interessiert dabei wenig.
»Die Illegalen haben nicht pariert«, erzählt ein 19-jähriger Oberösterreicher von seiner letzten Nachtwache. Die Grenzgendarmerie habe ihn zur Verstärkung gerufen, da sich einige Georgier der Verhaftung widersetzt hätten. Der Junge erzählt die Geschichte so beiläufig, wie er nur kann. Seinen Stolz vermag er nicht zu verbergen.
Ein unermessliches Versagen drückt sich in der Tatsache aus, dass es für Marchegg und das ganze Marchfeld vierzehn Jahre nach dem Fall des Kommunismus immer noch keine Autobrücke ans andere Ufer der March gibt. Will man von Marchegg ans andere Ufer der March fahren, besteht die einzige zuverlässige Verbindung in einer vierzig Kilometer langen Route, die weit nach Süden, zweimal über die Donau und durch das Stadtgebiet von Bratislava führt. Dabei ist der Nachbarort Devínska Nová Ves, ein entlegener Stadtteil Bratislavas, keine fünf Kilometer entfernt.
Ende des 19. Jahrhunderts führten noch zwölf Übergänge, darunter vier Straßenbrücken, über die March. Zum Zeitpunkt der Osterweiterung kann die vierundsiebzig Kilometer lange Flussgrenze nur an zwei Stellen überquert werden: Die provisorische Pontonbrücke in Hohenau tut ihren Dienst nur dann, wenn die March weder zu wenig noch zu viel Wasser führt. Ähnliches gilt für die Fähre in Angern, die bei Nacht nicht operiert.
Schuldige ließen sich benennen, doch gibt es ihrer zu viele. Abgesehen von der politischen Ignoranz jeglicher Couleur leistet auch die Marchfelder Bevölkerung hinhaltenden Widerstand, ausgedrückt in Bürgerinitiativen und einem ablehnenden Bürgerentscheid zur Angerner Fähre. Ökologische Argumente sind in der sensiblen Auenlandschaft Marchfeld/Záhorie schnell zur Hand, als Kronzeugen benennt man die Marchegger Störche.
Was manche den »Schock von Marchegg« nennen, bezeichnet einen vergessenen und dennoch folgenschweren Moment der Zeitgeschichte. Im Herbst 1973 überfielen palästinensische Terroristen in Marchegg einen Zug, der jüdische Emigranten aus der Sowjetunion brachte. Die Terroristen nahmen mehrere Geiseln und verschanzten sich mit ihnen auf dem Flughafen Schwechat.
In den Verhandlungen traf Bundeskanzler Kreisky eine Entscheidung, welche die israelische Premierministerin Golda Meir als »die bisher größte Ermutigung für Terroristen« bezeichnete: Er gab den Terroristen nach. Er erlaubte ihnen, Österreich unbehelligt zu verlassen, und schloss eine Unterkunft für jüdische Emigranten. Dass Österreich auf diese Weise Terrorismus von seinem Boden fernhalten konnte, bestätigte sich in Form des Gegenteils. In den folgenden Jahren wurde Österreich mindestens fünfmal Schauplatz arabischer Anschläge, viermal mit Toten, unter denen jedes Mal auch Österreicher waren.
Auf der Homepage Marcheggs ist eine Landkarte dargestellt, die Marchegg und Umgebung zeigt. Während auf der österreichischen Seite jeder Spargel namentlich vermerkt ist, erstreckt sich jenseits der March eine abweisende dunkelgrüne Landmasse. Besseres Kartenmaterial würde den Marcheggern sagen, dass sie einen Vorort von Bratislava bewohnen.
Und sollten sie eines Tages nicht mehr mit dem Rücken zur Grenze leben, würden die Marchegger feststellen, dass sie ihrer Nachbarschaft froh sein können. Am anderen Ufer hat sich eine junge Nation zu einer pulsierenden Marktwirtschaft hochgekämpft. Am anderen Ufer liegt Volkswagen Slovakia, eine Autofabrik für 10.000 Beschäftigte.
Ungeachtet aller Verzögerungen naht die Stunde, in der Marchegg aus dem Isolator gerissen wird. Bislang verfügt Marchegg nur über eine Eisenbahnbrücke, doch stehen parallel dazu ein paar Brückenpfeiler, im Jahr 1917 von italienischen Kriegsgefangenen errichtet. 2003 ist ein Spatenstich erfolgt, man will eine provisorische Brücke auf die Pfeiler legen.
Auf absehbare Zeit bleibt Stand der Dinge, dass Marchegg sich als militarisierte Trutzburg eingerichtet hat, und darin eingenistet lebt das Marchegger Gefühl. Grenzgendarmerie und Bundesheer drücken dem Gemeindeleben ihre visuelle Präsenz auf. Wer noch hinhört, vernimmt die immer gleichen Nachrichten ertrunkener, von Schleppern ausgesetzter Flüchtlinge.
Erst wenn der Marchegger Arbeiter überlegt, nebenan für VW zu arbeiten, anstatt ins ferne Wien zu pendeln, wird Marchegg in seiner Normalität angekommen sein. Noch verfiele der gestandene Bahnhöfler in wildes Hohngelächter, konfrontierte man ihn mit einem solchen Vorschlag. Es wäre aber einfach nur normal.
3
Als ich 2004 diese Zeilen schrieb, ahnte ich noch nichts. Ich dachte wahrscheinlich, ich würde irgendwann wieder einmal in dem Ort vorbeischauen, aus dem die bösen Briefe kamen. Dass ich Marchegg noch 400 bis 500 Mal frequentieren würde – die Vorstellung hätte mich erschreckt.
Und doch kam es so. Pfingsten 2004 bin ich nach Devínska Nová Ves gezogen, an das gegenüberliegende Ufer der March.
Was sich seither getan hat, ist schnell erzählt. In Hohenau, im Dreiländereck Österreich-Tschechien-Slowakei, wurde der Ponton durch ein festes Brücklein ersetzt, einspurig und im Ampelbetrieb. Wie 2003 in Marchegg, wurde 2005 in Záhorská Ves eine Brücke versprochen. Zu bauen begonnen hat man in beiden Fällen nicht. Die Marchegger Autobrücke sollte 2006 freigegeben werden, irgendwann sprachen die Verkehrsplaner nur noch von 2018.
Seit ich an die March gezogen bin, habe ich Marchegg Dutzende Male betreten, und Hunderte Male muss ich durchgefahren sein. Immer mit der Bahn, auf der Strecke Wien–Devínska–Wien.
Oft habe ich durch das Zugfenster auf den »Wirtschaftspark Marchegg« geschaut, eine fünf Millionen teure Investition, die ohne die Brücke nutzlos blieb. Wo gibt es in der Gegend ein gepflegteres Wiesenstück – mit Gleisanschluss, Installationen und asphaltierten Straßen!
Und viele hundert Mal habe ich auf die Brückenpfeiler geschaut, klobige Betonklötze mit ein wenig Moos, seit 1917 verwaist und verwittert. Mein liebgewonnenes Monument centropischer Melancholie.
Liebeserklärung an eine Zwischenwelt
Der Ort, an dem ich heute lebe, erschien mir damals als ein dämonischer Gruß der Eiszeit. Damals, in der Zeit nach 1989, als wir mit der Bahn nach Osten fuhren, über die frisch vernarbte Naht des Eisernen Vorhangs, von Wien nach »Gratislava«, Reste von Regime und Revolution und überschminkte Slawinnen zu schauen.
Von dem Ort, an dem ich heute lebe, nahm ich damals nur den trägen grauen Bahnhof wahr, die erste Station auf slowakischem Gebiet. Kein einziges Mal fielen mir die rauschenden Birken am Bahnsteig auf, so gebannt las ich in den Gesichtern der Grenzer, untersuchte ihre Züge auf Schießbefehl und Korruption, in der Physis verbliebene Dünste fensterloser Verhörzellen, auf Normalität, Perversion und Spuren von Menschlichkeit.
Der Zug fuhr planmäßig weiter in Richtung Pressburger Hauptbahnhof. Als ich mich einmal nach hinten wandte, fiel mein Blick aus der erhöhten Perspektive des Bahndamms in eine unerwartete, erstaunliche, in eine neue Welt hinein: eine Flucht frischer Wohnblöcke, entlang eines breiten Boulevards in das Grenzland gesetzt, untypisch, geradezu römisch-mediterran in der Farbgebung. Kaum begann ich das Gesehene für real zu halten, war es dem Sichtfeld schon entschwunden.
Was sollte das sein? Eine Siedlung, fünfzehn Kilometer vor der eigentlichen Stadt – wem sollte sie dienen? Den Mammuts der Eiszeit, erwählten Werktätigen, abgeschirmten Forschern, am Ende gar Verbannten? Ich war angezogen, angeregt, verwirrt – und vergaß es.
Über jenen Boulevard, der für die Dauer eines kleinen Zeitalters in den Unterkammern meines Bewusstseins verschüttet war, gehe ich nun seit Jahren; immer wenn ich zu essen brauche; also eigentlich jeden Tag. Der Boulevard heißt Eisnerova, der Ort Devínska Nová Ves, Thebener Neudorf, Devinsko Novo Selo. Ein abgelegener Stadtteil Bratislavas, von 17.000 der 425.000 Hauptstädter bewohnt. Entlang der ost-westlich verlaufenden Eisnerova eine Arbeitervorstadt der späten Achtziger. Entlang der Nord-Süd-Achse Istrijská ein seit 500 Jahren von Burgenlandkroaten besiedeltes Dorf. In den hohen Gräsern der nach Norden ausgreifenden Záhorie-Ebene ein riesenhaftes Autowerk, gemeinsame Plattform des VW Touareg, des Porsche Cayenne und des Audi Q7.
Die schaudernde Empfindung des Exotischen haben seit dem flüchtigen Blick von damals neuere und stärkere Reize überlagert. Im Frühjahr 2006 zähle ich dazu: die über Gaststätten jeder Art sich ergießende Tonsuppe minderwertigen Express-OK-Fun-Radio-Westpops; die behelfsmäßige Selbstfindung einer verspäteten Nation in Eishockey und Reality-Shows; die mitternächtlich-verlorenen Streifzüge durch die lichten Hallen der Hypermärkte; die solide ummauerten Familienvillen, die an Devínskas Rändern hochwachsen; mein Entzücken, dass ich mir die Steuer schneller ausrechne, als der Tee zum Auskühlen braucht; der apolitische Erwerbsfleiß meiner Altersgenossen; die alles überwölbende Macht des Alltags selbst.
Die Ergriffenheit der Zeitenwende erfasst mich nicht einmal mehr vor dem letzten Stück des Eisernen Vorhangs, den paar Metern Stacheldraht, die mahnend an der March stehen. Das Regime hat die Systemgrenze mit kurzlebigem Material geschützt, der Stacheldraht ist längst ausgetauscht, ein beliebter Radweg führt daran vorbei. Auch auf der Landstraße, die der March zur Donaumündung folgt, muss ich mir den Gedanken erzwingen, dass sich die exzellente Straßenbeleuchtung dem Ausleuchten des Todesstreifens verdankt. Ich staune die Österreicher an, die ihre postsozialistischen Fährten mit einem unbeirrt auf Ostblock gepolten Kompass lesen. Ich habe ihn verloren.
Devínska liegt am Fuß der Devínska Kobyla, eines breit thronenden, dicht belaubten Berges, auf den ich morgens gelegentlich ein Stück laufe. In der Langeweile des Laufens sage ich mir vor, dass es die Karpaten sind, auf die ich mich quäle, auf den westlichen Beginn des Karpatenbogens.