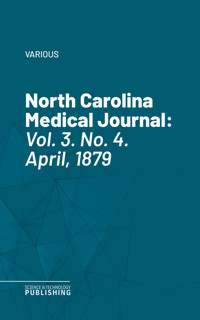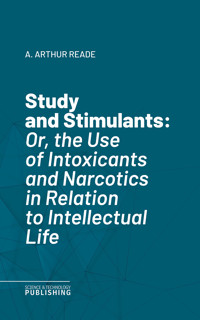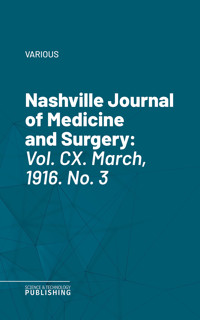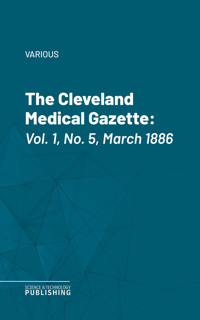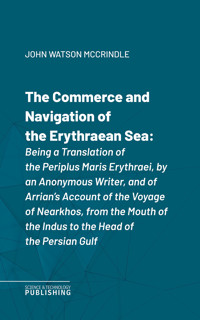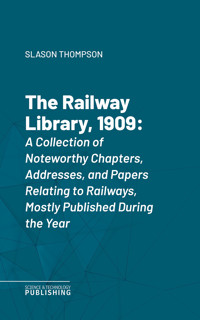0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Ähnliche
Die Welt in hundert Jahren
Unter Mitwirkung von: Hermann Bahr, Eduard Bernstein, B. Björnson, Hofrat Max Burckhard, Dora Dyx, Alexander von Gleichen-Rußwurm, Professor Dr. Everard Hustler, Baronin von Hutten, Ellen Key, Dr. Wilhelm Kienzl, Cesare Lombroso, Reg.-Rat Martin, Hudson Maxim, Dr. Karl Peters, Prof. Garrett P. Serviss, Robert Sloss, Jehan van der Straaten, Bertha Baronin von Suttner, Fred. Walworth Brown.
Herausgegeben von Arthur Brehmer. Mit Illustrationen von Ernst Lübbert.
Verlagsanstalt Buntdruck G. m. b. H. Berlin SW. 68.
Vorwort.
Seit je war es das grosse Sehnen der Menschheit, von der Zukunft den Schleier zu heben und einen Blick in die Zeiten zu tun, die kommen werden, wenn wir nicht mehr sind. Propheten und Seher sind uns erstanden, falsche und echte; Träumer und Wisser. Männer, die selbst den Keim mit gelegt haben zu dem, was werden wird, und die gestützt auf das, was jetzt schon erreicht ist, und was uns die Jahrhunderte brachten, in klarer, logischer, wissenschaftlich unanfechtbarer Folgerung, das Bild der Welt zu entwerfen vermögen, das die kommenden Zeiten uns zeichnet. Und dieses Bild ist so grosser Verheissungen voll, daß diese uns oft anmuten gleich Märchen, und doch ist in unserer alles überholenden Zeit vieles von dem, was uns am märchenhaftesten scheint, seit der kurzen Spanne Zeit, die vergangen ist, seit es geschrieben, doch schon zur Wahrheit geworden. Dadurch aber erhält das, was uns als in der Zukunft liegend noch weiter geschildert wird, doppelten Wert.
Der Verlag.
Hudson Maxim. Das 1000 jährige Reich der Maschinen.
Das 1000 jährige Reich der Maschinen. Von Hudson Maxim.
Könnten wir durch den weiten Weltenraum mit einer ausreichend großen Geschwindigkeit fliegen, so würden wir die Strahlen des von unserer Erde vor tausend und abertausend Jahren ausgegangenen Lichtes überholen; und hätten wir unendlich weitblickende Augen, so könnten wir, während wir dahinfliegen, zurückschauen und könnten die ganze Geschichte unserer Erde sich wieder vor unseren Augen abwickeln sehen. Wir würden den Menschen wieder zu dem affenähnlichen Geschöpfe werden sehen und würden schließlich sehen, wie er und alle andern lebenden Wesen wieder zu dem Urtierchen wird, das in dem azoischen Meere mit aufging.
Was für eine Wunderwelt aber würde sich uns erst erschließen, könnten wir uns auf ähnliche Weise Flügel nehmen und der Zukunft entgegeneilen, um dem Menschen auf seiner aufstrebenden Bahn zu folgen, bis er den Höhepunkt allen physischen, intellektuellen und ethischen Lebens erreicht haben wird, von dem aus der dann auf uns, seine Vorfahren, mit demselben staunenden Blick zurückschauen wird, der uns bewegt, wenn wir die Spur unseres Aufstieges bis zu dem Ursprung des Menschen verfolgen. Denn wenn wir der irdischen Entwicklung immer weiter und weiter nachgehen würden, dann würden wir sehen, wie die Sonne sich nach und nach abkühlt und wie sie ihr Licht verliert und es auch uns damit nimmt, und wir würden das seltsame Schauspiel vor uns sehen, daß die ausgetrocknete Erde gierig die Seen aufschluckt und aufsaugt, und daß der Mensch wieder gezwungen wird, ein Höhlenbewohner zu werden, der ebenso nach Wasser gräbt, wie wir jetzt nach Gold. Denn das Wasser wird seltener und kostbarer sein als jetzt das Gold ist.
Ein Blick in die Zukunft.
Kein Mensch ist imstande, die Zukunft voraus zu verkünden, es sei denn, daß er dies aus der Kenntnis der Gegenwart heraus tut — dann aber muß eben das, was er voraussagt, notgedrungen das ideelle Resultat sein, das sich aus den gegenwärtigen Strömungen, Errungenschaften und Entwicklungsphasen ergibt. Es kann naturgemäß keine Wirkung ohne Ursache geben, und widerum keine Ursache, die nicht an sich wieder eine Wirkung einer vorhergegangenen Ursache ist. Jede Wirkung ist im ewigen Kreislauf Ursache zu anderen Wirkungen, die ihr wieder genau gleich sind. Es kann deshalb in der Natur keine Wirkungen mehr geben, die nicht den veranlassenden Ursachen gleichen.
Jedes vorhandene Atom folgt einer mathematisch genauen Bahn, die sicher durch die von allen anderen bestehenden Atomen ausgeübten Kräfte genau ebenso bestimmt ist, wie ein Stern nicht gehen kann, wohin er will, sondern seiner vorgeschriebenen Himmelsbahn folgen muß. Wir wissen daher, daß die Summe aller Kräfte der gesamten Natur bis zum gegenwärtigen Augenblick genau der Summe der gesamten Kräfte gleich ist, die von den Atomen unter sich auf einander ausgeübt werden. Und deshalb wissen wir auch, daß alle Ereignisse der Geschichte, alle Himmelserscheinungen, alle Produkte der organischen und anorganischen, der beseelten und unbeseelten Natur die ganze Zeit hindurch genau diejenigen gewesen sind, die der Summe der vereinten Kräfte aller vorhandenen und auf einander wirkenden Atome entsprechen.
In der Natur gibt es keinen Zufall. Es gibt kein derartiges Ding, wie Glück oder Gelegenheit. Unser Leben stellt nur ein ganz geringes Teilchen der großen kosmischen Entwicklung dar, und sogar unser freier Wille ist vorausbestimmt, gerade so zu wollen und nicht anders wie er will; denn wir können, wenn keine Ursache zum Wollen da ist, ebenso wenig wollen, wie eine Sonne von ihrer Bahn abgelenkt werden kann, wenn keine Ablenkungsursache da ist.
Hätten wir, die wir auf der Schwelle alles dessen, was kommen wird, stehen, von allen jetzt wirkenden Ursachen genaue Kenntnis, und würden wir ihre Kraft und die Richtung kennen, in der sie sich äußern, dann würden wir einen weitreichenden Ausblick in die Zukunft haben. Da aber unser Wissen, so groß es auch ist, nur gering ist, und da unsere Kräfte beschränkt sind, so können wir weiter nichts tun, als allgemeine Betrachtungen anstellen, die auf dem, was wir wissen, aufgebaut sind.
Was Können wir prophezeien?
Es gibt mancherlei, was wir trotz unserer Unzulänglichkeit bis zu einem gewissen Grade sicher voraussagen können. Man kann zum Beispiel sicher vorhersagen, daß das menschliche Vorwärtsstreben von jetzt ab weit schneller von statten gehen wird, als es jemals bisher der Fall gewesen ist, und daß vermutlich das Jahrtausend der ideellen Vollendung nicht mehr so fern sein kann, wie unsere Zeit dies anzunehmen gewohnt war.
Die Gegenwart ist ein Zeitalter mechanischer und chemischer Entdeckungen und Erfindungen. Sie ist eine wissenschaftliche Epoche und eine Periode materieller Vollendung; ihr aber wird eine soziologische Zeit folgen, eine Aera der ethischen und philosophischen Vollendung und der Entwicklung einer höheren psychischen Kultur — kurz eine Reife der geistigen und moralischen Eigenschaften, die zu höchster Blüte gelangen werden.
Schon in der gegenwärtigen Zeit stehen wir, vom menschlichen Gesichtspunkte aus betrachtet, auf einer ganz beträchtlich höheren Stufe als die Alten. In den alten Zeiten gab es keine Anerkennung von Dingen, wie beispielsweise unsere unveräußerlichen Menschenrechte es sind; und ein Volk, in dessen Macht es stand, ein anderes mit Erfolg zu berauben oder zu unterjochen, hielt es für eine Dummheit, ja für eine Schmach, es nicht zu tun und es nicht zu berauben und nicht in die Sklaverei schleppen.
Als Julius Cäsar über das Lager der Germanen herfiel, während die Friedensverhandlungen schwebten, und er sie überraschte und in ein paar Stunden zweihundertundfünfzigtausend Männer, Weiber und Kinder erschlug, da hielt man das für ein Meisterstück echt römischer Politik; denn die Römer ersahen ja für sich von seiten dieser Germanen gar keinen Nutzen.
Eine der größten Segnungen der modernen Zivilisation ist aber die Erweiterung der menschlichen Nutzbarkeit. Und man würde es heutzutage nicht nur als eine Grausamkeit, sondern geradezu als eine unverantwortliche Verschwendung an Menschenleben ansehen, wenn jemand über ein benachbartes Volk herfallen und es bis auf den letzten Mann niedermetzeln wollte.
Es ist eben glücklicherweise ein wachsendes Verständnis dafür da, daß die Welt, die wir bewohnen, nur ein einziges großes, einheitliches Vaterland ist. Der Patriotismus wagt sich jetzt schon über die nationalen Grenzlinien hinaus. Ein zunehmender Geist internationaler Verbrüderung ist vorhanden, und eine immer allgemeiner werdende Erkenntnis bricht sich Bahn, daß ja doch im Grunde alle Menschen an einer gemeinsamen Tafel essen und an einem gemeinschaftlichen Herdfeuer sitzen. Und sagen wir’s uns doch selbst, erfreut man sich der Wärme eines Feuers nicht mehr, wenn man auch andere sich mit daran wärmen läßt, und wenn man sie nicht auf Kosten jener anderen, die in der Kälte stehen und frieren müssen, für sich monopolisiert und mit Beschlag belegt?
Die Hälfte eines Bissens, von dem man anderen abgibt, schmeckt tausendmal besser als der ganze Bissen, den man ungeteilt selber genießt. Nur die volle Gegenseitigkeit im Genuß des Besitzes gibt diesem seinen Wert.
Gütergemeinschaft.
Carnegie bringt Hunderte von Bibliotheken in dem großen Hause „Welt“ unter, das er mit der Menschheit bewohnt. J. P. Morgan hängt an die Mauern dieses Hauses lauter Bilder, die er den Museen seines Landes schenkt. Rockefeller gibt Millionen aus, um seinen Einfluß zu vergrößern und sich in der Welt Anerkennung zu verschaffen, in der ja auch er und seine Kinder leben müssen. Menschenfreunde aller Art spenden jährlich große Summen für die Ausgestaltung der Städte und machen sie dadurch nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst reizvoller und schöner.
Ein großer französischer Philosoph sagte einst mit Recht: „Alles Gesetz, alle Philosophie und alle Weisheit hängen nur von der Anwendung folgender Grundsätze ab: Mäßige Dich. Erziehe Dich und lebe für Deine Mitmenschen, auf daß auch sie für Dich leben.“ Und der, der nach diesen Gesichtspunkten lebt, ist sicherlich der tüchtigste Geschäftsmann.
Es gibt keinen allgemeiner verbreiteten Fehler, als den, zu glauben, daß Selbstlosigkeit und Nächstenliebe eine bloße Gefühlssache seien. Nein, sie haben eine recht große praktische, ich möchte sagen geschäftliche Seite, eine Seite, die ein klein wenig von kühler, berechnender Politik an sich hat. Gänzliche Selbstlosigkeit und vollkommene Nächstenliebe führen zu einem gemeinsamen Ziel, an welchem das Leben in der Formel einer Gleichung steht: hier ich — dort die anderen, und ich und die anderen sind gleich.
Wenn es zwei Menschen gäbe, die beide mit demselben Wissen, derselben Klugheit und demselben Können ihren Weg gehen, von denen aber der eine von ausschließlich selbstischen Motiven getrieben wird, während der andere von rein menschenfreundlichen Beweggründen ausgehen würde, so würde der eine, Anderen durch seinen eigenen Selbstdienst, der andere aber sich selber dadurch dienen, daß er den Anderen einen Dienst erwiesen hat. Der Altruist würde es für nötig halten, sich selber im Interesse der anderen zu erhalten, der Egoist aber würde finden, daß er die anderen in seinem Interesse erhalten müsse.
Wenn wir — um ein Beispiel anzuführen — einen Zustand so großer mechanischer und wissenschaftlicher Vollendung annehmen könnten, daß alles, was wir wollen und brauchen, durch den bloßen Druck auf einen Knopf herbeigeschafft werden könnte — nur unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Sympathie und unsere Liebe nicht, dann würde es keinen Platz auf der Welt geben, der nicht einem Gefängnisse gliche, denn jedes Glücksempfinden würde uns fehlen, und wir würden alle Qualen durchmachen, die der Sträfling in der Einzelhaft durchmacht. Ja, das würden wir, denn so sehr sind wir auch in seelischer Hinsicht aufeinander angewiesen.
Der erste Schritt, den man beim Herannahen des tausendjährigen Reiches[1] unternehmen muß, ist der, den großen menschlichen Entwicklungsgang den tausendfältigen Möglichkeiten desselben anzupassen. Es kann kein tausendjähriges Reich, d. h. keinen Weg, ein vollkommenes Gemeinwesen zu schaffen, geben, ehe nicht das Unkraut aus dem großen Garten der Menschheit ausgejätet ist, dieses Unkraut, das jetzt in dem Gewächshaus unserer ungezähmten Leidenschaften wild emporwuchert, in dem es mit Gift befruchtet und mit Alkohol getränkt wird.
Der humanitäre Fortschritt.
Gerade so, wie, sich Amerika das Recht vorbehalten hat, nur die Einwanderer aufzunehmen, die ganz bestimmten Bedingungen entsprechen, und die sie geeignet machen, in der neuen Heimat zu wohnen und ihr Blut mit den bisherigen Bürgern zu mischen, ebenso hat auch die Menschheit das Recht, zu bestimmen, was für ein Blut sie auch fernerhin in dem großen Menschenstrom fließen lassen will, und wir werden zweifellos auch bald dazu kommen, dieses unser Recht auszuüben und den Menschen aufzuzwingen. Damit, daß wir einen Missetäter bestrafen und ihn dann wieder freilassen, ist für die Menschheit gar nichts gewonnen. Wir müssen ihn vor allem vollständig isolieren. Der Verbrecher wird künftig wie ein Aussätziger behandelt werden; kein Mensch wird aber fernerhin daran denken, wegen Diebstahls oder Mordes Strafen zu verhängen, so wie wir ja auch auf Wahnsinn und Pocken keine Strafen ausgesetzt haben. Und gerade dadurch wird die Allgemeinheit viel wirksamer vor Verbrechen geschützt sein, als es jetzt der Fall ist. Die Unwissenheit des Barbarentums verleitet uns noch immer dazu, Menschen wegen irdischer Vergehen einzukerkern, die zu begehen sie direkt gezwungen waren, da der ganze Impuls ihrer Seele sie zum Verbrechen trieb. Das zu tun, ist ebenso unklug, wie wenn wir einen Aussätzigen absperren, sobald sich das erste Anzeichen seiner Krankheit zeigt, um ihn dann aber wieder freizulassen und ihm Gelegenheit zu geben, sich unter die Menge zu mischen und andere anzustecken, worauf wir ihn abermals einsperren und wieder in Freiheit setzen, und ihn dadurch immer wieder befähigen, die Krankheit in immer weitere Kreise zu tragen.
Das Allheilmittel gegen die Verbrecher wird künftig in der Schaffung einer großen Reservation für die Aufnahme und Absonderung des Abschaums der menschlichen Gesellschaft bestehen. Diese Institution wird eine nationale Einrichtung werden. Sie wird nicht irgend einem der uns jetzt bekannten Gefängnisse gleichen, weil Güte und Mitleid ihre milden Wärterinnen sein werden. Ein großes Stück fruchtbaren Landes wird abgesteckt werden. Daraus wird ein ungeheurer Garten oder Park geschaffen werden, in welchem Hunderte von kleinen Farmen und Häuschen verteilt sein werden. Auch Städte mit schönen Wohnhäusern, mit Schulen und Bildungsanstalten, mit Klubs, Büchereien und Kunstgalerien wird es hier geben — kurz: jeder Fortschritt, der dem Kulturvolke jener kommenden Zeit gegeben wird, wird auch den Einwohnern der großen Kolonie psychischer Kranken zugute kommen. Nur eine einzige Einschränkung aber wird es geben, die nämlich, daß das Leben all derer, die in diesen großen Garten einziehen werden, keine Nachfolge finden wird. Keine Töchter und keine Söhne werden vorhanden sein, um das Eigentum des dahingegangenen Fabrikanten, Haus- oder Grundbesitzers zu erben; denn alles Eigentum wird dem Gemeinwesen gehören, und bei dem Tode eines Insassen wird das Besitztum, welches er inne hatte, an das Gemeinwesen zurückfallen, um anderen Sündern, die aus der Außenwelt angelangt sind, zugewiesen zu werden. Sündern, denen auch nur erlaubt sein wird, ihr Dasein in Ruhe zu vollenden, deren Geschlecht aber untergehen und nicht wie bisher, das sich forterbende Stigma verbrecherischer Neigungen mit sich einhertragen wird.
— — —
Der Mensch ist ein kriegerisches Geschöpf. Das erste Dämmern der Sonne unserer Kultur brach durch eine Kriegswolke hindurch, und alles Licht, das sie bisher auf die Menschheit herniedergeschickt hat, gelangte nur durch einige wenige Risse in diesen Kriegeswolken zu uns. Die Geschichte aller Nationen ist die Geschichte von Kriegen; aber während sich Armeen von Männern gegenseitig bekämpften und mit der Axt niederschlugen, gab es in den Reihen der Kämpfenden selbst viel tödlichere Feinde, als ihre Schwerter und Waffen es waren.
Der Kampf mit der Krankheit.
In jedem Kriege kommen auf jeden einzelnen in der Schlacht Gefallenen Dutzende anderer, die Krankheit und Pestilenz dahingerafft haben. In den Kriegeswolken, die den Kampf mit den Krankheitskeimen aufnehmen, gibt es eben keine Risse. Da herrscht ein beständiger blutiger, immer weiter um sich greifender Krieg. Die schöne, reizende Tochter, in deren Gesicht Gesundheit und Glück lächeln, küßt einen Spielgefährten, an dessen Lippen die Bazillen der Tuberkulose haften, und fällt der schrecklichen Krankheit zum Opfer, und bei Diphtheritis, bei Scharlachfieber, Typhus und jeder anderen unserer zahlreichen ansteckenden Krankheiten droht ihr die Gefahr, selbst krank zu werden, ebenso oder noch mehr.
Wir haben noch keine Waffen, mit denen wir diesen Feind angreifen könnten. Wir müssen noch immer als hilflose Zuschauer zusehen, wie unsere Lieben von den mikroskopisch-kleinen Gegnern des Lebens unerbittlich dem Sensenmann überantwortet werden. Allerdings haben wir ein paar Gegenmittel gefunden; einige neue Behandlungsmethoden sind da und das Messer des Chirurgen. Die helfen aber leider nur wenig. Aus diesem Grunde haben wir eine immerwirkende Heilkraft auf das dringendste nötig. Eine Heilkraft, die alles zerstört, was unser Leben gefährdet, und alles erhält, was unserem Leben notwendig ist.
Mit anderen Worten: wir bedürfen der Entdeckung eines elektrochemischen Prozesses, durch welchen die Krankheitskeime im Gewebe, in der Lymphe und im Blute getötet werden, ohne den Zellen des lebendigen Körpers Schaden zu tun. Und daß dieses Problem wirklich gelöst werde, gehört zu den aussichtsreichsten Verheißungen der allernächsten Zukunft. Dann wird jedes Opfer jeder wie immer gearteten Krankheit in einem einzigen Tage wieder hergestellt werden können, und jede Krankheit wird mit einem Schlage verschwinden. Der aber, der dieses Problem endgültig lösen wird, wird der größte Wohltäter des Menschengeschlechts werden, größer als die Weltgeschichte jemals einen gehabt hat oder je wieder haben wird. Für einen anderen neben ihm ist kein zweiter Platz mehr vorhanden.
Chemiker, Elektriker und Physiker sollten dieser Aufgabe die ernsteste Beachtung schenken und tun es wohl auch, und ich möchte ihnen da gleich folgenden Wink geben, der ihnen möglicherweise von Nutzen sein könnte:
Seit geraumer Zeit ist es bekannt, daß, wenn man ein Diaphragma in einen Elektrolyten bringt und einen elektrischen Strom von ausreichenden Volts hindurchschickt, der Inhalt der einen Elektrodenkammer solange durch das Diaphragma hindurch in die andere eingepreßt wird, bis sich ein gewisser Druckunterschied zwischen den Lösungen der beiden Kammern eingestellt hat. Diesen Vorgang nennt man Elektro-Osmose oder Kataphorese. Gerber verwenden Elektro-Osmose beim Gerben von Häuten, indem sie eine Gerblösung auf das Fell einwirken lassen; sie sparen auf diese Weise viel Zeit und viel Geld.
Meine Anregung geht nun dahin, den ganzen menschlichen Körper als einen Teil des Diaphragmas in der Elektro-Osmose oder Kataphorese zu verwenden und so heilkräftige bezw. Krankheitskeime zerstörende Chemikalien in und durch das Hautgewebe, die Lymphe und das Blut zu pressen. Könnte nicht zum Beispiel, wenn der menschliche Körper einen Teil einer solchen Scheidewand darstellen müßte, eine Chlorlösung in die eine der Kammern gegossen und ein derartig starker elektrischer Strom hindurch geschickt werden, daß das Chlor in und durch das menschliche Zellengewebe, die Lymphe und das Blut gepreßt würde, wodurch alle Krankheitskeime zerstört werden müßten, ohne daß dadurch die Gewebe und die flüssigen Stoffe des Körpers auch nur im geringsten in Mitleidenschaft gezogen würden?
Chlor ist nämlich eines der stärksten und wundervollsten Desinfektionsmittel, das unsere Wissenschaft kennt; von ihm genügt eine weit schwächere Lösung als von den meisten anderen, unsere Krankheitskeime zerstörenden Chemikalien, wie zum Beispiel Karbolsäure (Phenol), Aetzsublimat und übermangansaures Kali. Wenn die Bandagen einer frischen Wunde sofort mit einer schwachen Chlorlösung, die ein wenig mit gewöhnlichem Kochsalz gemengt ist, angefeuchtet und feucht gehalten werden, so vernarbt die Wunde fast immer ohne jede Eiterung und hinterläßt keinerlei Schmerzhaftigkeit an der betreffenden Stelle. Das ist doch ein augenscheinlicher Beweis dafür, daß eine ausreichend starke Chlorlösung angewendet werden darf, um infizierende Krankheitskeime zu töten, ohne die Zellengewebe des menschlichen Körpers in Mitleidenschaft zu ziehen.
Der menschliche Organismus ist gleichsam eine komplizierte Maschine. Er ist eine Art elektrischer Generator. Sein Blut ist alkalisch, während die Lymphe oder der Körpersaft seines Fleisches sauer ist; beide sind durch eine undurchdringliche Membran von einander getrennt, so daß ein Mensch wohl an einer Erkrankung des Blutes leiden kann, ohne dabei kranke Lymphgefäße haben zu müssen. Umgekehrt können wieder seine Lymphgefäße erkrankt sein, wie dies beispielsweise bei der Tuberkulose der Lymphgefäße, die wir unter den Namen Skrofulose kennen, der Fall ist, ohne daß er an Tuberkulose des Blutes erkrankt zu sein braucht. Um daher jeden Krankheitskeim in der Lymphe und im Blut, in den Knochen und in den Muskeln sicher zu zerstören, wäre es notwendig, den ganzen Körper einheitlich mit einem Desinfektionsmittel zu durchdringen.
Und das zu erreichen, das muß das Ziel der desinfizierenden Elektro-Osmose sein. Ein Ziel, dem wir — ich wiederhole es — heute schon nahe sind.
Die Eroberung der Luft.
Die Eroberung der Luft, die zu verwirklichen wir jetzt schon beginnen, ist eine der großen Errungenschaften, die dem „tausendjährigen Reich“ ganz besonders zu statten kommen werden. Alles, was uns das Reisen, den Verkehr und Transport zu erleichtern geschaffen ist, verringert für uns die Entfernungen, bringt uns das bisher Ferne näher und näher und macht uns den Fremden und Ausländern förmlich zum Landsmann, zum Nachbar und Freunde.
Der Mechaniker Fulton[2] lehrte uns, wie wir dem Orkan trotzen und den Ozean zu unserem Fahrwasser machen können. Morse machte die Elektrizität zu unserem Sendboten, bei dem Zeit und Raum bei der Beförderung von Nachrichten keine Rolle mehr spielen, und Alexander Graham Bell stellt uns den Fernhörer auf unseren Schreibtisch, so daß wir damit der Kunde aus aller Welt lauschen können. Jetzt, durch das Erscheinen der Flugmaschine, werden wir bald die irdische Landstraße verlassen und uns auf der unbegrenzten Himmelsbahn ergehen können. Bald werden wir unsere Luftautomobile haben und damit den sibirischen Himmel und die arktische Wüste durchkreuzen, und wir werden der Fata Morgana über die dürre Wüste hin nachjagen, wie wenn wir jetzt eine alltägliche Reise in ein benachbartes Land oder Städtchen machen.
Neue Kraftquellen.
Es gibt ein Problem, welches der Mensch bald zu lösen genötigt sein wird; denn von dessen Lösung hängt die Möglichkeit eines andauernden menschlichen Fortschrittes und einer fortschreitenden Zivilisation vollständig ab. Wir müssen einen Vorrat von Wärme und Kraft haben, der sowohl unerschöpflich in der Quantität, als auch billig in der Gewinnung ist. Ist erst diese Aufgabe gelöst, dann ist der menschliche Emporstieg sehr leicht.
Bald werden wir unsere Luftautomobile haben und damit den sibirischen Himmel durchkreuzen.
Hätten wir eine Maschine, mittels welcher wir die in der Kohle schlummernden Kräfte ebenso vollständig ausnützen könnten, wie die Seemöwe den Kohlenstoff ausnutzt, den sie aus ihren Nährstoffen zieht, so würden wir aus unserem Feuerungsmaterial das Zehnfache der Kraft herausholen können, die wir jetzt brauchen, um die Räder unserer Maschinen zu drehen. Aber selbst wenn wir imstande wären, eine solche Maschine zu erfinden, so würde uns das doch noch lange nicht genügen, um unseren Bedarf auch für die Zukunft zu decken; denn die großen Kohlenlager der Erde könnten ja doch nur noch ein paar Jahrhunderte vorhalten. Bei dem jetzigen Stande des Kohlenverbrauchs werden alle jene großen Kohlenlager, welche die Sonne in der Kohlenzeit für uns angelegt hat, binnen wenigen Generationen aufgebraucht sein.
Aber nicht die Gefahr des Kohlenmangels allein droht uns, wir werden auch, wie es Lord Kelvin prophezeit hat, unsere Luft dabei völlig verbrannt haben; denn jede Tonne Kohle, die von uns verbraucht wird, macht 12 Tonnen Luft zum Atmen untauglich, so daß, wenn wir selbst hinreichend Kohle auf ganz unbegrenzte Zeit hätten, wir doch nicht genug Sauerstoff in der Luft vorrätig fänden, um sie zu verbrennen; denn die Luft würde schon bis zum Ersticken mit Kohlensäure angefüllt sein.
Möglicherweise erfinden wir eine Art Motor, der die Wärme nutzbar machen kann, die von den Sonnenstrahlen ausgeht. Man schätzt den Totalwert der Energie, welche die Erde von der Sonne empfängt, als gleichwertig mit der, die von einem Wasserfalle entwickelt werden würde, der, wenn er dem Niagarafall an Mächtigkeit gliche, 75000 englische Meilen breit sein müßte, breit genug also, um die Erde dreimal damit zu umspannen. Die ungeheuere Kraft verteilt sich aber auf eine riesige Ausdehnung, daß die Schwierigkeit nur darin liegt, sie zu konzentrieren. Freilich ist die Wasserkraft selbst nichts anderes als eine indirekte Ausnutzung der Sonnenwärme. Aber würden wir auch wirklich jeden Strom, jeden Wasserfall und jeden Wasserlauf bis zu seiner höchsten Möglichkeit ausnutzen, so würde die also gewonnene Kraft doch nicht mehr ausreichen, den menschlichen Bedürfnissen zu genügen.
Die Entdeckung der strahlenden Materie hat uns eine ganz neue Perspektive und so wunderbare Möglichkeiten eröffnet, daß wir mit unserem gegenwärtigen Wissen kaum wagen können, an deren doch so zweifellose Verwirklichung auch nur zu glauben. Wir haben gefunden, daß die der Materie innewohnenden Molekularkräfte so über jeden irdischen Begriff hinausgehen, daß, wenn es uns jemals gelingen sollte, sie dem menschlichen Gebrauch dienstbar zu machen, wir bis in alle Ewigkeit hinein die Welt damit erleuchten, erwärmen und befahren könnten.
Jedes Molekül der Materie ist aus einer großen Anzahl kleiner Partikelchen zusammengesetzt, die wir Atome nennen; diese Atome aber bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 100000 englischen Meilen in der Sekunde — d. i. mit mehr als der Hälfte der Geschwindigkeit des Lichts. Ins gewandte Technische übersetzt, heißt das aber nichts anderes, als daß in jedem Pfund wägbarer Substanz eine Kraftmenge vorhanden ist, die genügen würde, ein einpfündiges Projektil mit einer Geschwindigkeit von 100000 englischen Meilen in der Sekunde hinausschleudern zu können!
Zukunftsträume.
Die Erfüllung jedes menschlichen Erfordernisses hängt lediglich mit Wärme und Kraft zusammen, und wenn Wärme und Kraft so billig zu haben sein werden, dann wird die Erde nichts als ein Spielplatz sein und jedes Land und jedes Meer wird unter der Hand des Menschen und der Führung des menschlichen Hirns pulsieren und vibrieren. Wenn jener Tag einst kommen wird, dann werden alle unsere Felder mit Hilfe der auf elektrischem Wege direkt aus dem Stickstoff der Luft gewonnenen Stickstoffdüngung fruchtbar gemacht werden können, und die Landwirtschaft wird zu einem bloßen Zeitvertreib werden. Es wird elektrisch geheizte Treibhäuser geben, die Tausende von Aeckern bedecken, und selbst die Landgüter unter nördlichem Klima werden ihre Sommer- und Winter ernten haben. Man wird neue Methoden erfinden, das Wachstum der Pflanzen durch elektrische Wärme und elektrisches Licht zu beschleunigen. In Gärten, die in dieser Weise eingerichtet sein werden, wird es Johannisbeeren geben, so groß wie die Damascenerpflaumen, Damascenerpflaumen in der Größe von Aepfeln, Aepfel, so groß wie Melonen, Erdbeeren, so groß wie Orangen und alle werden in Form und Wohlgeschmack die besten von heut übertreffen, so daß sie selbst dem wählerischesten Geschmack eines Gourmets entsprechen werden.
Nachts, wenn Millionen von Lichtern den Himmel erhellen, werden die Flugmaschinen riesigen Motten gleich vorbeischweben und verschwinden.
Das drahtlose Telephon wird zu jener Zeit die ganze Welt umfassen, und es wird dann ebenso leicht sein, mit unseren Antipoden Zwiegespräche zu halten, wie wir jetzt zwischen Newyork und Boston, London und Paris, Berlin und Budapest sprechen.
Einsame Bauernhäuser wird es keine mehr geben; das Volk wird sich vielmehr zu kleinen Städten mit hauptstädtischen Erholungs- und Vergnügungsplätzen zusammenfinden. Obgleich auch die kleinste Ortschaft ihr Theater haben wird, werden doch die Schauspieler nur in Newyork, London, Paris oder Wien leben und auch nur dort spielen. Die Bühne solch einer Kleinstadt wird ein einfacher Vorhang sein, und der „Hamlet“, der in. London gespielt wird, wird mittelst Fernseher, Fernsprecher und Fernharmonium auf dem Schirm, der die Bühne in Chautauqua ersetzt, reproduziert werden. Die Patti jener Zeit wird nicht nötig haben, erst weite Konzertreisen zu machen, denn jedes Theater der ganzen Welt wird sich das Weltrepertoire gleichzeitig zu eigen machen: Gestern abend Londoner Schauspiel, heute abend Pariser Premiere, morgen abend Newyorker Posse, Petersburger Oper, Wiener Hofoper und Mailänder Ballett, und selbst der Polarreisende wird sich dieses Repertoire auf dem ewigen Eise der Arktis oder Antarktis zu leisten vermögen.
Neuerliche Versuche haben die Hoffnung der Alchimisten erneuert, daß wir denn doch noch dazu kommen werden, gemeine Metalle in Gold umzuwandeln, und wenn wir damit wirklich Erfolg haben, dann wird das Gold eine neue ausgedehnte Anwendung finden. In schwacher Legierung würde Gold ganz genielle Gewehrkugeln abgeben; denn es könnte so hergestellt werden, daß es die erforderliche Härte besitzt, während seine Dichtigkeit den Geschossen eine ungeheuere Tragweite und Durchschlagsfähigkeit geben würde. Eine solche Kugel müßte selbst von jedem Friedensfreunde auf das wärmste empfohlen werden, denn wer würde nicht lieber eine goldene Kugel in seinem Fleische verheilen lassen, als eine von gewöhnlichem Blei!
Der Erfinder des ersten Maschinengewehres versah dieses mit einem Lauf für runde und mit einem zweiten für eckige Geschosse, und zwar waren erstere für Christen und letztere für die Türken bestimmt. Nun ist es keineswegs leicht, Kugeln von angenehmer Wirkung herzustellen, in jedem Falle aber würde die runde, goldene Kugel doch die mildtätigste und menschlichste sein.
Die Stücke, die in London gespielt werden, werden selbst im ewigen Eis der Arktis oder Antarktis mittelst Fernseher und Fernsprecher auf einem Schirm reproduziert werden.
Die Kriegsführung der Zukunft wird einem Schachturnier gleichen. Jede Bewegung wird dem Auge der ganzen Welt sichtbar sein, und Verstecke und Scheinmanöver werden unmöglich sein. Die Zeitungen werden ihre Luftkorrespondenten haben die über allen Schlachtfeldern, über allen Lagerplätzen und allen Flotten schweben und jede Bewegung der Seeschiffe und Landheere wird man in jedem Hause verfolgen und jeder seine Kritik üben können.
Im Jahre 1896 leitete ich in Faradays Haus in London einige Experimente mit elektrischer Heizung, und da gelang es mir bekanntlich zuerst, auf galvanischem Wege mikroskopisch kleine Diamanten herzustellen. Damals nahm ich mir vor, diese Arbeit später wieder aufzunehmen. Ich bin fest überzeugt und neuere Experimente geben mir Recht, daß es sehr bald gelingen wird, Diamanten jeder beliebigen Größe so billig und zahlreich herzustellen wie man nur will.
In jedem Falle aber werden sie nicht kostspieliger sein, als alle anderen elektro-chemischen Produkte. Diamanten in Erbsengröße wird man zweifellos bei einer Mark noch mit Gewinn verkaufen, und Diamanten, so groß wie der Kohinoor, werden nicht mehr als einen Taler kosten.
Die Stadt der Zukunft.
Der Fremde, der Newyork besucht, wird bei dem Anblick der gen Himmel strebenden Geschäftsgebäude von Staunen ergriffen; könnte er aber wie Rip Van Winkle schlafen gehen und erst nach einem Jahrhundert wieder erwachen, dann würde er den größten Teil der jetzigen Stadt dem Boden gleichgemacht und von neuem aufgebaut finden. An Stelle der alten Häuser würden sich Monumentalbauwerke erheben, mit denen verglichen ihm die mächtigsten Gebäude der Jetztzeit wie kleine Hütten vorkommen würden.
Die Stadt der Zukunft wird nicht mehr aus einzelnen getrennten Gebäuden bestehen, die eine verschiedenartige Architektur haben, nein, sie wird ein einziges weit ausgedehntes Gebäude sein.
Die Straßen von jetzt werden nur die Zugangsstraßen zu dem untersten Stockwerk bilden, sofern wir nicht gar, was sehr wahrscheinlich ist, auch in die Tiefe der Erde unsere Häuser hineinbauen werden, die eigentlichen Geschäftsstraßen aber werden sich hoch oben in der Höhe der verschiedenen Stockwerke ziehen. Riesige Brücken und Bogen, mächtige Durchgänge, wundervolle Gärten und Spielplätze werden sich immer einer über dem anderen hoch und höher erheben, so hoch, daß das Auge kaum bis hinauf wird reichen können, und der ganze luftig schöne Häuserkomplex wird durch mächtige turmähnliche Bauten gestützt und gehalten werden, die zweitausend Fuß hoch und noch höher emporragen werden, und deren jeder eine Basis haben wird, die zehn, zwölf oder mehr Häuservierteln von jetzt entsprechen wird. Jedes Gebäude wird natürlich so eingerichtet sein, daß es bequem mehrere hunderttausend. Leute beherbergen kann. Die höchsten Wohnungen werden in Gärten liegen, die gleichsam im Himmel hängen, oder in großen Parkanlagen hoch oben in der klaren, kühlen, reinen Luft, und die Leute werden Expreß-Elevatoren nehmen, um nach mühevollem Tagewerk ihr Heim zu erreichen, das wirklich im luftigen, schönen Traumland der Lerchen und Nachtigallen liegen wird, dort wo die Wolken vorüberziehen und noch lange im Abendsonnenschein glühen werden, während das Dunkel der Nacht die niedrigen Stockwerke längst wird umfangen haben.
Wenn man solch eine Stadt aus der Ferne betrachten wird, dann wird sie wie ein durchbrochenes Netzwerk von Stahl und Eisen erscheinen.
Wenn man solch eine Stadt aus der Ferne betrachten wird, dann wird sie wie aus durchgebrochenem Netzwerk von Stahl und von Eisen erscheinen, durch welches Licht und Luft einen weit freieren Zutritt zur Erde finden werden, als dies jetzt, innerhalb der Mauern unserer jetzigen Städte der Fall ist.
Und nachts, wenn Millionen von Lichtern den Himmel erhellen, und durch ihr vereintes Feuer weit in das Dunkel umher eindringen werden, dann wird die Stadt einer ungeheueren Fackel gleichen, um die schnell vorwärtsstrebende Flugmaschinen, riesigen Motten gleich, vorbeihuschen und verschwinden werden.
Der Nachthimmel der Landbewohner aber wird in der kommenden „tausendjährigen Zeit“ der Maschine durch hellstrahlende, hoch in der Luft verankerte Fahrzeuge erleuchtet werden, deren Schein die Sterne verdunkeln und den bleichen, neidischen Mond sicher beschämen wird.
[1] Der Ausdruck: das „tausendjährige Reich“ entstammt dem Glauben der Chiliasten an ein 1000 jähriges Reich der Frommen nach der sichtbaren Wiederkunft des Messias. Dieses Reich soll das bevorstehende Zeitalter des Geistes werden. Hudson Maxim macht sich diese Idee zunutze, um uns das 1000 jährige Reich unserer fortgeschrittenen Entwicklung zu zeigen.
[2] Der Erfinder des Dampfschiffes.
Robert Sloss. Das drahtlose Jahrhundert.
Das drahtlose Jahrhundert. Von Robert Sloss.
Der „Sturmvogel“ war seit länger als achtundvierzig Stunden ruhig und sicher über die Eisfelder geflogen, als ein plötzliches Stillstehen des Motors den Kapitän aus seinem tiefsten Schlummer weckte.
„He, Kettner, was ist denn los?“ rief er, aus der Kajüte auf Deck tretend, dem Leutnant zu.
„Die Kraft ist ausgeblieben“, kam die Antwort. „Ich habe aber die Ersatzbatterien sofort angeschlossen und ’s hat nichts weiter zu sagen. Sie sehen ja selbst, es geht ganz gut auch so.“
Und tatsächlich flog der „Sturmvogel“ ganz wundervoll seinen Kurs weiter.
„Keine Meldung vom Schiff?“ fragte der Kapitän, sich ans Steuer begebend, und gerade, als er fragte, kam ein zuckendes, blitzartiges Aufleuchten und ein metallisches Knistern von dem Telephonapparat zu seinen Füßen. Er nahm den kombinierten Reciver und Transmitter sofort auf und befestigt ihn an seinem Kopfe.
„Das Schiff spricht mit uns“, sagte er. „Der Dynamo ist nicht in Ordnung.“
„Wie lange kann der Schaden denn dauern?“ fragte der Leutnant, dem man’s wohl ansah, wie schwer ihm das Mißgeschick des Flugschiffs zu Herzen ging.
Geber und Empfänger einer modernen Telefunken-Station.
„Sie können’s nicht sagen“, war die Antwort des Kapitäns, der noch immer am Telephon lauschte, „in jedem Fall aber können sie uns in absehbarer Zeit keine Kraft mehr abgeben.“
„Dann ist es wohl besser, wir landen“, meinte der Leutnant, „und sparen uns unsere Batterien für alle Fälle auf.“
Und da der Kapitän zustimmend nickte, so lenkte er sofort den Aeroplan gegen eine etwa eine Meile weit ab südlich liegende Eisfläche zu. Hier wurde die Maschine glatt zum Landen gebracht und von den beiden Männern fest vertaut und verankert.
„Ja, ja“, sagte der Kapitän, durch den Zwischenfall sichtlich sehr deprimiert. „Das ist’s, was ich gefürchtet habe. Steinmetz hat den von Cook entdeckten Nordpol 1918 nur deshalb durchforscht, weil es ihm möglich gewesen ist, in Spitzbergen seine Dynamos aufstellen zu können. Wir aber müssen uns mit einem einzigen begnügen und haben den noch auf einem Schiffe. Ich weiß, ich weiß, Kettner, was Sie sagen wollen. Ich weiß, daß der Südpol so unglücklich liegt, daß ihm kein Festland nahe genug liegt, um mit Sicherheit operieren zu können. Gerade darin aber liegt unser Nachteil, denn Steinmetz konnte immer von einem oder dem anderen seiner Dynamos Kraft genug von dem kolossalen Energiestrom abbekommen, den die Kraftanlagen am Niagarafall durch den Aether entsandten. Wir aber . . .“
„Wir werden uns durch diesen Zwischenfall auch nicht entmutigen lassen, Kapitän“, sagte der Leutnant. „Denken Sie nur daran, wie sehr wir heutzutage Richtung und Kraft des Stromes in unserer Gewalt haben, und wie viel drahtlose Kraft zur Zeit Steinmetz verloren ging. Nein, nein, ein Pech ist es freilich, daß wir nur einen Dynamo haben, aber daß wir von unserem Schiff von Melbourne aus ebenso viel Kraft erhalten, wie er damals vom Niagara, das ist gewiß.“
Eine fahrbare Telefunkenstation im Betriebe.
„Sie können recht haben“, sagte der Kapitän, „aber eine verdammte Geschichte bleibt es doch. Im übrigen können wir wenigstens feststellen, wo wir uns befinden, und Sie, Kettner, sehen Sie mal zu, daß Sie ein bißchen Feuer hinter den Leuten machen, sie sollen sich mal sputen, denn, hol’ mich der Teufel, wenn ich diesmal die Fahrt unterbreche und nicht bis zum Pol komme.“
Und während sich Leutnant Kettner den Hörer anschnallte, ging der Kapitän in seine Kabine zurück. Noch aber hatte der Leutnant keine Verbindung erhalten, als der Kapitän, den Sextanten in Händen, atemlos auf ihn zustürzte.
„Kettner! Freund! Mensch! Wissen Sie, wo wir sind? Weit näher dem Pole, als Steinmetz damals dem Nordpol war, als er sein letztes Lager bezog, von dem aus er dann seinen glücklichen Flug unternahm. Und wissen Sie, was das heißt? . . . Daß wir in drei Stunden unser Ziel erreichen können. Daß wir den Südpol erreichen werden, selbst wenn uns das Schiff im Stich läßt, denn unsere Batterien müssen genügen.“
„Darf ich dem Schiff davon Nachricht geben?“ fragte der Leutnant, der den Enthusiasmus seines Vorgesetzten selbstverständlich teilte.
„Ja, lieber Kettner, tun Sie das.“
Auf dem Schiffe erregte die Nachricht natürlich lauten Jubel.
„Sie sind außer Rand und Band“, sagte der Leutnant. „Sie lassen Ihnen Glück wünschen zu dem grandiosen Erfolge. Sie fragen an, ob sie die Nachricht weiter geben können. Sie versichern, daß sie alles daran setzen werden, um die Maschine wieder in Gang zu bringen.“ Und plötzlich schmunzelte er, „Conners vom Internationalen Nachrichten-Bureau will die Nachricht noch rechtzeitig für die Londoner Morgen- und die Newyorker Abendblätter geben. Er möchte aber gern ein Interview mit Ihnen selbst haben. Geht’s?“
Der Kapitän lachte. „Das ist ein unternehmender Bursche“, sagte er. „Sagen Sie, ich stehe ihm später gern zur Verfügung. Gibt’s sonst noch was? Hat meine Frau nicht angefragt?“
Kettner gab die Frage an das Schiff, das hart an den Eisbarrieren des Mont Erebus lag, die Antwort weiter.
„Nein. Sobald sie aber anrufen wird, wird man Sie davon verständigen.“
„Gut. Dann wollen wir also vor allem etwas essen, und es uns dann bequem machen und schlafen. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen.“
Und mit diesen Worten begab sich der Kapitän auch schon in die asbestausgelegte, feuersichere Kabine, und bald waren beide Forscher emsig damit beschäftigt, sich über den elektrischen Kocher ihr Mahl zu bereiten, und als der Kaffee dampfte und die Pfeifen gestopft und in Brand gesteckt waren, da kam jene behagliche Stimmung über die beiden, in der man wenig spricht und sich im Schweigen doch so unendlich viel sagt.
Plötzlich aber legte der Kapitän die Pfeife beiseite. „Kettner“, sagte er, „ich habe eine Idee. Wie wär’s, wenn wir mal alle unsere Batterien in Gang brächten und den Versuch machten, uns mit Umgehung der drahtlosen Station mit der Welt telephonisch in Verbindung zu setzen. Das wäre mal wieder was, wovon die Welt sprechen könnte. Hier, nicht hundert Meilen vom Südpol und . . . ja, wir wollen versuchen. Wie spät ist es jetzt?’“
„Zehn Uhr siebenundzwanzig Ortszeit.“
„Gut. Wir sind nahezu am 180. Meridian. Dann ist’s in London ungefähr halb elf Uhr abends und in Bermuda halb sieben. Da ist sie zu Haus. Bitte, Kettner, verbinden Sie mich mit meiner Frau.“
Große Oper am Südpol.
Kettner verband das Halbdutzend leichter, aber ungemein kraftvoller Batteriezellen mit einander, machte die nötigen Handgriffe, drückte den Knopf nieder und das allgemeine Anrufsignal ging hinaus in den Aether. Der Leutnant lauschte und lauschte, aber keine Antwort kam; plötzlich aber lächelte er: „So, jetzt habe ich sie; die Bermuda-Station hat sich gemeldet. Ja . . . mit Frau Kapitän Kingsley . . . jawohl.“
Ein Blitz zuckte auf und ein eigentümliches Summen wurde gehört.
„Die Kälte hat den Ton ein bißchen beeinflußt“, sagte er, „der Apparat ist verschnupft. So . . . das werden wir gleich beheben . . . ja . . . jawohl . . . bitte, Kapitän, Ihre Frau ist am Apparat.“
Sofort legte sich der Kapitän den Hör- und Sprechapparat um und schaltete den Fernseher mit ein, so daß er mit seiner Frau nicht nur sprechen konnte, sondern sie in dem an den Apparat aufgeschraubten, feingeschliffenen Metallspiegel auch sah und jede ihrer Bewegungen und den Ausdruck ihres Gesichtes beobachten konnte. Eine Viertelstunde lang und noch länger dauerte das Gespräch, denn was hatte man sich nicht alles zu sagen. Er gab einen ganz genauen Bericht von seiner Fahrt über das ewige Eis und seinem Zwischenfall, der ihn verhinderte, jetzt schon am Südpol zu sein. Sie war natürlich stolz auf den unsterblichen Triumph ihres Mannes, und ehe sie das Gespräch abbrach, ließ sie noch des Kapitäns Töchterchen, seinen Liebling, an das Telephon kommen.
„Großartig, Kettner“, sagte der Kapitän. „Wenn uns das gelungen ist, dann können wir auch versuchen, uns mit Newyork zu verbinden. Da ist’s gerade um die Theaterzeit. Wie wär’s, wenn wir uns auch ein klein wenig Musik gönnten und uns die Oper ein Stündchen anhörten? — Wollen wir?“
Statt jeder Antwort gab Kettner wieder das Anrufsignal. Wieder sprühten, zuckten und flammten die knisternden Blitze. „In fünf Minuten haben wir die Musik. Soll ich den Megaphonreciver anschließen?“
„Selbstverständlich. Wissen Sie schon, was gegeben wird?“
„Jawohl. „Der Held der Lüfte“.“
„O,“ rief der Kapitän. „Von Redfers, dem Wagner unserer Zeit? Das trifft sich famos.“ Und nun saßen die beiden Männer und lauschten — hier im ewigen Eise der Polarregion den Klängen und Stimmen der Newyorker Oper.
Mitten in der Aufregung aber kam ein anderer Ton. Ein Anruf. Ein wahrer Sprühregen von Blitzen prasselte nieder.
„Nanu, was ist denn los? Hurra!“ rief er aber plötzlich aus. „Der Dynamo auf dem Schiff ist wieder im Stand. Wir haben wieder die Kraft. Herr Leutnant, der Platz am Steuer gebührt jetzt mir.“
Und fünf Minuten später erhob sich das zierliche Luftschiff auf seinen Schwingen hoch in die Luft und glitt über die Eisfelder hin — dem Pole entgegen.
Wunder, denen wir entgegengehen.
Ich könnte in diesem Stile fortfahren, Gott weiß wie lange, und Wunder über Wunder erzählen, ohne meine Phantasie auch nur im geringsten anzustrengen, denn alles, was in dem bisherigen Gang der „Erzählung“ so wunderbar sich angehört hat, sind Probleme, die heut schon gelöst sind und die keineswegs mehr in das Gebiet der frommen Wünsche oder der überspannten Hoffnungen und Erwartungen gehören. Nein, es sind Tatsachen, die nur darauf warten, in unser praktisches Leben eingeführt zu werden, gerade so, wie Telegraph und Telephon und Phonograph sich darin eingeführt haben.
Wilhelm Marconi. Der Erfinder der drahtlosen Telegraphie.
Der Berliner Graf Arco und der Amerikaner De Forest und der Däne Paulsen haben den Nachweis geliefert, daß eine Entfernung von 4 bis 500 englischen Meilen kein ernstes Hindernis für ein drahtloses Telephongespräch ist, und daß man Musik und Gesang ebenso drahtlos übertragen kann, wie jede andere menschliche oder andere Stimme. Und was das „Sehen“ der Person betrifft, mit der man spricht, so ist das Problem auch schon gelöst, wenn auch noch nicht jene Vollkommenheit erreicht ist, auf die wir aber keineswegs mehr zehn, geschweige denn hundert Jahre warten müssen. Und was das Treiben eines Aeromobils durch diese erstaunliche Kraft, die wir die „Drahtlose“ nennen, anbelangt, weshalb nicht? Gerade im letzten Jahre haben wir das Problem auch dieser Kraftanwendung gelöst, und ein schwerer Treidelzug wurde auf „drahtlosem“ Wege in Bewegung gesetzt. Was aber die Geschwindigkeit der Luftschiffe und Flugmaschinen anbelangt, so haben wir selbst gesehen, daß man jetzt schon Geschwindigkeiten von 90 Kilometern in der Stunde erreicht, und auf dem letzten „Fliegerkongreß“ wurde die gar nicht sanguinische Ansicht vertreten, daß wir „jeden Tag“ diese Geschwindigkeit auf 500 Kilometer werden erhöhen können.
Professor Korn.