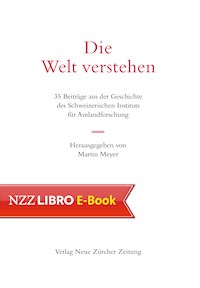
Die Welt verstehen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sozialwissenschaftliche Studien des Instituts für Auslandsforschung
- Sprache: Deutsch
Das Schweizerische Institut für Auslandforschung – seit 70 Jahren ein Forum des Gedankenaustauschs und der Meinungsbildung – präsentiert mit 35 Vorträgen von renommierten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur eine eindrückliche Rückschau auf die komplexen Wirklichkeiten und Themen der Jahre 1951 bis 2012. Vieles, was uns heute umtreibt, hat Wurzeln in der Vergangenheit. Dazu zählen etwa die Krise der Staatsverschuldung, die Wiederkehr der politischen Theologie oder die Diskussion um Werte und Moral, Freiheit und Verantwortung. Mit einem Verzeichnis sämtlicher Vorträge, die im Rahmen des Siaf an der Universität Zürich gehalten worden sind. Beiträge von: Raymond Aron, Die Intellektuellen und der Totalitarismus (1955) Hannah Arendt, Freiheit und Politik (1959) Raymond Barre, Liberté et progrès dans le monde contemporain (1987) Ulrich Beck, Kant oder Katastrophe – Neue Formen kosmopolitischer Schicksalsgemeinschaft und Konfliktdynamiken in der Weltrisikogesellschaft (2011) Ulrich Bremi, Blick auf die Schweiz aus unternehmerischer Perspektive (2000) Edouard Brunner, Die Schweizerische Neutralität und der Ost-West-Konflikt (1985) The Right Honourable The Lord Cockfield, Beyond 1992: The Single European Economy (1989) Ralf Dahrendorf, Krise der Demokratie? Eine kritische Betrachtung (1978) Howard S. Ellis, Die Wiederentdeckung des Geldes (1951) Ludwig Erhard, Wandlungen in der deutschen Wirtschaftspolitik (1968) Timothy Garton Ash, Europe in a Non-European World (2011) Friedrich A. von Hayek, Entstehung und Verfall des Rechtsstaatsideals (1953) Samuel P. Huntington, The Religious Factor in World-Politics (2001) Jean-Claude Juncker, Europa – wie weiter? (2011) Henry A. Kissinger, Reflections on the World's Situation (1980) Hans Küng, Globale Religion oder globales Ethos? Überlegungen zur Globalisierungsproblematik aus theologischer Sicht (2001) Christine Lagarde, Anchoring Stability to Sustain Higher and Better Growth (2013) Otto Graf Lambsdorff, Die moralische Verantwortung in der Marktwirtschaft (2002) Walter Laqueur, Die Beziehungen zwischen den Supermächten (1985) Jean-Pierre Lehmann, The Pacific Century – Will it happen? (1997) Fritz Leutwiler, Reformbedürftiges Weltwährungssystem? (1984) Willy Linder, Chancen und Risiken der chinesischen Wirtschaftspolitik (1986) Fred Luchsinger, Die Schweiz – ein europäischer Outsider? (1980) Helmut Maucher, Die Globalisierung aus Sicht des Unternehmers (1998) Sir Jeremy Morse, Do We Need a New Bretton Woods? (1984) Joseph S. Nye Jr., The Information Revolution and American Power in the 21st Century (2003) Karl R. Popper, Woran glaubt der Westen? (1959) Wilhelm Röpke, Erziehung zur wirtschaftlichen Freiheit (1959) Helmut Schelsky, Die neuen Formen der Herrschaft: Belehrung, Betreuung, Beplanung (1976) Günter Schmölders, Vom Goldautomatismus zur freiwilligen Zusammenarbeit der Notenbanken (1963) Urs Schoettli, Pakistan – Gefahr für die Welt (2009) Gerhard Schwarz, Wettbewerb der Systeme – eine -ordnungspolitische Sicht (1994) Wolfgang Schürer, Reflexion und Interpretation der chinesischen und indischen Neupositionierung (2006) Kaspar Villiger, Perspektiven der Schweiz in einer Welt im Wandel (1996) Rolf M. Zinkernagel, Wie sicher/frei ist freie/sichere Forschung? (2003)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE STUDIENDES SCHWEIZERISCHEN INSTITUTSFÜR AUSLANDFORSCHUNG
JUBILÄUMSBAND:70 JAHRE SIAF 1943–2013
Begründet vonProf. Dr. Dr. h.c. Friedrich A. Lutz (†)
www.siaf.ch
DIE WELT VERSTEHEN
35 Beiträge aus der Geschichtedes Schweizerischen Instituts für Auslandforschung
Herausgegeben von Martin Meyer
Mitarbeit: Liliane Stadler
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel.
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2013 (ISBN 978-3-03823-863-8)
Gestaltung, Satz: Claudia Wild, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI Books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf andern Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-907291-18-4
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Die Herausgabe des Jubiläumsbuches wurde ermöglicht dank freundlicher Unterstützung durch die Gemeinnützige Stiftung ACCENTUS, Zürich.
INHALTSVERZEICHNIS
MARTIN MEYERDie Welt verstehen
2013*CHRISTINE LAGARDEAnchoring Stability to Sustain Higher and Better Growth
2011 JEAN-CLAUDE JUNCKEREuropa – wie weiter?
2011 ULRICH BECKKant oder Katastrophe – Neue Formen kosmopolitischer Schicksalsgemeinschaft und Konfliktdynamiken in der Weltrisikogesellschaft
2011 TIMOTHY GARTON ASHEurope in a Non-European World
2009 URS SCHOETTLIPakistan – Gefahr für die Welt
2006 WOLFGANG SCHÜRERReflexion und Interpretation der chinesischen und indischen Neupositionierung
2003 ROLF M. ZINKERNAGELWie sicher/frei ist freie/sichere Forschung?
2003 JOSEPH S. NYE JRThe Information Revolution and American Power in the 21st Century
2002 OTTO GRAF LAMBSDORFFDie moralische Verantwortung in der Marktwirtschaft
2001 HANS KÜNGGlobale Religion oder globales Ethos? Überlegungen zur Globalisierungsproblematik aus theologischer Sicht
2001 SAMUEL P. HUNTINGTONThe Religious Factor in World Politics
2000 ULRICH BREMIBlick auf die Schweiz aus unternehmerischer Perspektive
1998 HELMUT MAUCHERDie Globalisierung aus Sicht des Unternehmers
1997 JEAN-PIERRE LEHMANNThe Pacific Century – Will it Happen?
1996 KASPAR VILLIGERPerspektiven der Schweiz in einer Welt im Wandel
1994 GERHARD SCHWARZWettbewerb der Systeme – eine ordnungspolitische Sicht
1989 THE RIGHT HONOURABLE THE LORD COCKFIELDBeyond 1992: The Single European Economy
1987 RAYMOND BARRELiberté et progrès dans le monde contemporain
1986 WILLY LINDERChancen und Risiken der chinesischen Wirtschaftspolitik
1985 EDOUARD BRUNNERDie schweizerische Neutralität und der Ost-West-Konflikt
1985 WALTER LAQUEURDie Beziehungen zwischen den Supermächten
1984 FRITZ LEUTWILERReformbedürftiges Weltwährungssystem?
1984 SIR JEREMY MORSEDo We Need a New Bretton Woods?
1980 FRED LUCHSINGERDie Schweiz – ein europäischer Outsider?
1980 HENRY A. KISSINGERReflections on the World’s Situation
1978 RALF DAHRENDORFKrise der Demokratie? Eine kritische Betrachtung
1976 HELMUT SCHELSKYDie neuen Formen der Herrschaft: Belehrung, Betreuung, Beplanung
1968 LUDWIG ERHARDWandlungen in der deutschen Wirtschaftspolitik
1963 GÜNTER SCHMÖLDERSVom Goldautomatismus zur freiwilligen Zusammenarbeit der Notenbanken
1959 WILHELM RÖPKEErziehung zur wirtschaftlichen Freiheit
1959 HANNAH ARENDTFreiheit und Politik
1959 KARL R. POPPERWoran glaubt der Westen?
1955 RAYMOND ARONDie Intellektuellen und der Totalitarismus
1953 FRIEDRICH A. VON HAYEKEntstehung und Verfall des Rechtsstaatsideals
1951 HOWARD S. ELLISDie Wiederentdeckung des Geldes
Referentenverzeichnis
DIE WELT VERSTEHEN
MARTIN MEYER
Mit der Gründung des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung (SIAF) im Frühling 1943 wurde eine Institution ins Leben gerufen, die für qualifizierte Orientierung in schwierigen Zeiten sorgen sollte. Das Land war damals nicht nur umzingelt, sondern auch bedroht von Mächten, die sich bereits grosse Teile Europas unterworfen hatten und seine Neutralität lediglich aus pragmatischen Gründen noch respektierten. Zwar hatte der unmittelbare Druck nachgelassen, als Hitler den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion führte. Doch blieb dessen Ausgang bis 1944 unklar, und hinzu kam, dass auch Mussolini wiederholt mit Gedanken an eine Invasion im Tessin gespielt hatte. Die Schweiz war zur Insel geworden; niemand konnte mit Sicherheit abschätzen, wie lange sie diesen begünstigten Status noch beibehalten können würde.
Vor solchem Hintergrund und unter dem Druck der Zeitläufte schien es geboten, ein Kompetenzzentrum zu schaffen, das für Information und Aufklärung über das nähere und ferne Geschehen besorgt war. Die Initianten setzten sich aus verschiedenen Gremien zusammen. Involviert waren der Bundesrat, Exponenten der Neuen Helvetischen Gesellschaft sowie der 1939 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Pro Helvetia, die sieben Jahre später als Stiftung Pro Helvetia etabliert wurde, aber auch der Rektor der Universität Zürich, Professor Emil Brunner, sowie Vertreter der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Als erster Präsident des Vorstands amtete der Romanist Professor Arnald Steiger, als erster geschäftsführender Direktor konnte der renommierte Historiker Eduard Fueter gewonnen werden.
Fueter hatte Grosses im Sinn, als er das Institut im Sinne einer Hochschule auf- und ausbauen wollte. Zum Programm sollten Forschungstätigkeit, Vorlesungen, Dozenten- und Studentenaustausch, internationale Beziehungen, Dokumentation, Auskunftsdienst und anderes mehr zählen. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte er Forschungen über das aktuelle Geistesleben Chinas in Aussicht, während sich einzelne Arbeitsgemeinschaften bereits mit Wirtschaftsthemen beschäftigten und im Dezember 1945 eine Diskussionsrunde zum Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Nationen stattfand. Eine «Amerika-Europa-Sektion» analysierte die transatlantischen Beziehungen, bald kamen Forschungen zu Südamerika hinzu, schliesslich wurden zunehmend auch Lehrveranstaltungen organisiert. Als Eduard Fueter 1947 zurücktrat, übernahm Arnald Steiger in Doppelfunktion neben dem Präsidium die Leitung des Instituts.
Wenig später wurde es auf zwei Sektionen oder «Abteilungen» verteilt und fokussiert. Während die Kulturwissenschaft weiterhin prominente Förderung erfuhr, trat als zweite massgebliche Disziplin für Lehre und Forschung die Volkswirtschaft hinzu, die von Albert Hunold geführt wurde, der nach 1950 auch die Gesamtleitung des Instituts übernahm. Finanziert wurde das SIAF einerseits und zum kleineren Teil von staatlichen Quellen, anderseits von der Privatwirtschaft. Ab 1951 erschienen im Verlag Eugen Rentsch die Volkswirtschaftlichen Studien, ab 1959 unter dem Titel Sozialwissenschaftliche Studien – im Wesentlichen handelte es sich dabei um die Druckfassungen von Referaten aus der Vortragstätigkeit des Instituts, wie sie bis heute, inzwischen beim Verlag NZZ Libro, als Jahrbücher publiziert und in weiten Kreisen geschätzt werden.
1958 kam es zur Verschmelzung der beiden Abteilungen. 1965 übernahm der an der Universität Zürich lehrende Wirtschaftswissenschaftler Friedrich A. Lutz die Geschäftsleitung, 1976 folgte ihm der Politologe Daniel Frei im Amt und nach dessen Tod Willy Linder, Chef der Wirtschaftsredaktion der NZZ und Professor an der Universität Zürich. Bis ins Jahr 2007 wirkte Freis Nachfolger auf dem Lehrstuhl, Professor Dieter Ruloff, als Delegierter des Vorstands. Seit 2008 wird das Institut für Auslandforschung vom Verfasser geleitet. – Nach hochfliegenden Plänen in den Gründerjahren und bald eindrücklichen Zeugnissen wissenschaftlicher Erkundung des Weltgeschehens unter vielfältigen Aspekten hat sich das SIAF inzwischen hauptsächlich auf die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen an der Universität Zürich konzentriert: eine Bündelung der Kräfte, die sich in Zeiten breiter Angebotspaletten bestens bewährt. Das Institut ist der Universität Zürich assoziiert.
***
So viel in aller Kürze zur Geschichte und zu den Formalien. Die gedanklich-geistige Richtung war seit je klar definiert. Forschung, Lehre und Vermittlung in die Öffentlichkeit definierten sich von einem liberal-bürgerlichen Kompass her. Das Gut der Freiheit, die Werte von Rechtsstaat und Demokratie, aufgeklärte Skepsis gegenüber allen politischen Heilslehren sowie das Prinzip der Selbstverantwortung bei Anerkennung gesellschaftlicher Solidarität – so lauteten die Grundbegriffe, und so sollten diese auch im Wirken des Instituts zur Entfaltung gelangen. Der Vorteil dieses Bekenntnisses lag auf der Hand: Waren es bis 1945 die totalitären Kräfte und Versuchungen von rechts, denen der Widerstand mit der Arbeit besserer Argumente entgegengebracht wurde, rückten danach jene von links in den Fokus. Schon kurz nach dem Zusammenbruch von Faschismus und Nationalsozialismus verschoben sich die Fronten der Alliierten, und unter der Regie der Sowjetunion formierte sich in Osteuropa das Glacis ihrer Satelliten. Der Kalte Krieg hob an und verscheuchte rasch alle Illusionen von Koexistenz mit einem friedlichen Wettbewerb der Systeme. Diese Politisierung des Globus zwischen Westen und Osten, der Aufstieg Chinas unter Mao sowie zahlreiche Stellvertreterkriege an diversen Schauplätzen bestimmten fortan und während eines halben Jahrhunderts die Gesamtlage. Hinzu kamen die Dekolonialisierung, der forcierte Kampf um Rohstoffe und Energie und schliesslich ab 1968 auch neue Formen von Revolten und Protesten, die der Legitimität bestehender Zivilgesellschaften auf den Leib rückten. Zugleich liefen engagierte Diskussionen um die Vor- und Nachteile von Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Noch bis in die späten 1970er-Jahre waren solche Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern einer unter freiheitliche Rahmenbedingungen gesetzten Ökonomie und den Anwälten staatlich und zentral gesteuerter Wirtschaft keineswegs nur akademisch. Denn so viel war bereits damals durchaus evident: Die langfristige Produktivität mit Prämien für Wohlstand und Daseinssicherheit entschied im Grunde genommen à la longue wesentlich über die Lebensfähigkeit eines Herrschaftssystems, selbst wenn es der Macht vorübergehend gelingen konnte, Erfolg zu stilisieren und Misserfolg zu kaschieren. Im Nachhinein gesehen täuschte man sich im Westen lange Zeit über die Leistungskompetenz einer unter sozialistisch-zentralistischem Diktat betriebenen Planwirtschaft.
Das Institut sah sich in bewegten Zeiten als Forum des Gedankenaustauschs und der Meinungsbildung. Es hielt aus innerer Überzeugung weiterhin unbeirrt liberalen Kurs, was nicht bedeutete, dass nur Anlässe organisiert worden wären, die von den Persönlichkeiten wie von der Botschaft her diesem Credo entsprochen hätten. Komplexe Wirklichkeiten riefen nach einem entsprechenden Spektrum von qualifizierten Stimmen, die das Schema zwischen «links», «Mitte» und «rechts» auch unterliefen. Politisches und Wirtschaftliches stand, dem Auftrag gemäss, im Vordergrund, daneben kam Gesellschaftliches und Kulturelles nicht zu kurz. Ab den späteren 1970er-Jahren wurden vermehrt Fragen aufgeworfen, die sich mit der längerfristigen Leistungsfähigkeit westlicher Sozietäten befassten – mit der Zukunft des Sozialstaats, mit Wirtschaftskrisen vor der Folie der Energieversorgung, mit den Voraussetzungen und Chancen der Vollbeschäftigung, mit den Währungssystemen, mit der Integrationskraft der europäischen Einigung, aber auch mit den Werten und Überzeugungen im Zeitalter der säkular gewordenen Moderne. Nicht weniger spannend war die Thematik der Anschlussprozesse von Entwicklungsländern, insbesondere mit Blick auf Asien.
Zwei Eckdaten schufen dann überraschend neue Realitäten. «1989» brachte die unerwartete Implosion des Sowjetimperiums und damit verbunden die grosse Wende für Osteuropa auf schwierigen Wegen zur neuen Freiheit. «9/11» demonstrierte ebenso unvorhergesehen die Renaissance des religiösen Fundamentalismus im Gewand islamistischer Verschärfung – und falsifizierte damit indirekt auch die Illusion, dass mit dem Jahr 1989 das sogenannte Ende der Geschichte erreicht sei, das sich nunmehr organisch über den Globus verbreiten würde im Sinne der Alternativlosigkeit westlich-demokratischer Gesellschaftsmodelle.
Seither sind viele Euphorien verflogen, und mit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, der alsbald die Krise weitflächiger Staatsverschuldung quer durch Europa und bis in die Vereinigten Staaten folgte, steht die Welt abermals vor kapitalen Herausforderungen und Problemen der Steuerbarkeit solcher Phänomene. Auch der «arabische Frühling» hat die übertriebenen Erwartungen, die vielerorts in ihn gesetzt worden sind, bisher nicht erfüllt. Im Gegenteil: Grössere Teile der Mittelmeerregion und des Nahen und Mittleren Ostens sind gezeichnet von Aufständen, ideologischen Verwerfungen und brutalen Bürgerkriegen.
Das Institut reagiert darauf wie bisher mit einer Fülle von Vorträgen, die das Verstehen der Vorgänge fördern sollen. Während die Veranstaltungen des Frühjahrssemesters an der Universität Zürich in der Wahl der Themen frei sind, stehen jene des Wintersemesters traditionsgemäss unter einer motivischen Klammer. Zu den jüngsten Zyklen mit Leitmotiv zählen etwa «Amerika und die Welt», «Zukunft Europas», «Brennpunkte im Weltgeschehen» und «Geopolitik im Umbruch».
***
Das siebzigjährige Bestehen soll und darf Anlass sein, Rückschau zu halten. Diesem Unterfangen ist am besten Genüge getan mit der Wiederveröffentlichung von 35 Vorträgen, die zwischen 1951 und 2012 im Rahmen der Tätigkeiten des SIAF an der Universität Zürich gehalten wurden und danach Eingang in die Jahrbücher fanden. Es wäre falsch, aus dieser Auswahl ein Best-of abzuleiten. Die Selektion ist zwar nicht einfach nach subjektiven Kriterien erfolgt, doch sie hätte mit gleichem Recht und identischen Qualitätsstandards auch anderes beiziehen können. Die Anzahl der veröffentlichten Beiträge von den frühen 1950er-Jahren bis auf unsere Tage beträgt fast ein halbes Tausend. Besonders interessant sind die frühen Dokumente, weil sie Referentinnen und Referenten präsentieren, die längst zu tragenden Gestalten der Geschichte des Denkens geworden sind. Friedrich August von Hayek, ein gerne und öfters gesehener Gast, analysiert «Entstehung und Verfall des Rechtsstaatsideals» (1953), wenig später philosophiert Raymond Aron aus damals aktuellem Anlass über «Die Intellektuellen und der Totalitarismus» (1955), Karl R. Popper stellt die kritische Frage «Woran glaubt der Westen ?» (1959) und beantwortet sie originell mit dem Hinweis auf die Glaubensverweigerung der Vernunft, wo letzte Heilswahrheiten locken, Hannah Arendt thematisiert das Verhältnis von Freiheit und Politik vor dem Hintergrund ihres engagiert politischen Denkens: Freiheit kann niemals anders gelebt werden als in politisch-demokratisch verfasster Öffentlichkeit.
In den 1960er- und 1970er-Jahren betreten prominente Wirtschaftspolitiker die Bühne. 1963 etwa referiert Günter Schmölders über «Vom Goldautomatismus zur freiwilligen Zusammenarbeit der Notenbanken», was sich heute wie ein Kapitel aus der Vorgeschichte aktueller Herausforderungen liest. Ludwig Erhard spricht zu den «Wandlungen in der deutschen Wirtschaftspolitik» und zeigt anhand der Erfahrungen des Wiederaufbaus, dass die soziale Marktwirtschaft deshalb gelang, weil damit auch der Sinn des Arbeitens für die individuellen Bedürfnisse gewährleistet und nachvollziehbar wurde. Kämpferische Töne schlägt Helmut Schelsky in seinem Vortrag «Die neuen Formen der Herrschaft: Belehrung, Betreuung, Beplanung» (1976) an – die Folgen von 1968 sind greifbar evident. Neue Gäste sind dann beispielsweise der Soziologe Ralf Dahrendorf, der schon 1978 die «Krise der Demokratie», versehen allerdings im Titel mit einem Fragezeichen, ins Visier nimmt, und Henry Kissinger mit einem Überblick über das Kräfteverhältnis der beiden Supermächte vor aktuellen Spannungslagen: «Reflections on the World’s Situation» (1980).
Es führte zu weit, alle weiteren Beiträge hier Revue passieren zu lassen. Erwähnt seien die ergiebige Analyse des NZZ-Chefredaktors Fred Luchsinger «Die Schweiz – ein europäischer Outsider?» (1980), Fritz Leutwilers überraschend aktuelle Reflexionen zum Weltwährungssystem (1984), Willy Linders aus direkten Erfahrungen geschöpfte Betrachtungen zur aufsteigenden Wirtschaftsmacht China (1986) oder Kaspar Villigers und Ulrich Bremis Blicke auf die Schweiz mit politisch-wirtschaftlichen respektive unternehmerischen Implikationen (1996, 2000). – Seit der Jahrtausendwende spielen religiöse Faktoren wieder eine stärkere Rolle, wie Samuel Huntington (2001) und Hans Küng (2001) aus verschiedenen Perspektiven darlegen, und in die jüngste Gegenwart führen Referate des Soziologen Ulrich Beck, des Historikers Timothy Garton Ash und der Chefin des IWF, Christine Lagarde.
***
Siebzig Jahre zeigen: Moderne heisst bekanntlich Wandel, inzwischen mitunter in atemberaubendem Tempo; meint aber auch Konstanten oder jedenfalls Geschehnisse und Lagen, die eher der longue durée gehorchen. Vieles, was uns heute umtreibt, hat Wurzeln in Vergangenheiten, die Latenzen erzeugten, die teils plötzlich, teils schleichend zur Wirkung kamen. Dazu zählen etwa die Krise der Staatsverschuldung oder auch der retour offensif politischer Theologie. Die Diskussion um Werte und Moral, wie unter Menschen richtig und gedeihlich zu leben und zu kooperieren wäre, ist freilich so alt wie das Gehäuse von Zivilisation und Kultur überhaupt. Freiheit in Verantwortung für einen selbst wie für andere wäre aus Sicht unseres Instituts allerdings immer noch die beste Voraussetzung für Gegenwart und Zukunft. Die Geschichte lehrt, dass dieses anspruchsvolle Gut niemals selbstverständlich war und fortwährend von Neuem erstritten werden muss.
Diesem Band ist im Anhang ein Verzeichnis sämtlicher Vorträge beigegeben, die im Rahmen der Veranstaltungen des SIAF in den Jahrbüchern veröffentlicht worden sind. Sie legitimieren dessen Tätigkeit mehr, als es jede Jubiläumszeremonie vermag. – An dieser Stelle sei herzlich gedankt: allen, die uns als Vortragende mit ihrer Gastpräsenz beehrten und künftig beehren werden, zweitens der intensiven Zuhörerschaft, drittens der Universität Zürich für ihre offenen Türen, viertens unserem Vorstand und unserem Kuratorium und nicht zuletzt unseren Partnern aus der Wirtschaft wie aus privatem Engagement – ohne sie wäre die Arbeit am Verstehen der Welt und der Zeitläufte nicht möglich.
Zürich, im Juli 2013
Dr. Martin MeyerPräsident des Vorstands Schweizerisches Institut für Auslandforschung
ANCHORING STABILITY TO SUSTAIN HIGHER AND BETTER GROWTH
CHRISTINE LAGARDE2013
Christine Lagarde plädiert in ihrem Beitrag für höheres und besseres Wachstum und, in diesem Zusammenhang, für eine sorgfältige Kombination geschickter Massnahmen. Hierfür setzt sie sich mit kurz- und mittelfristigem Wachstum auseinander und letztlich mit der Problematik internationaler Kooperation, um dann zu demonstrieren, dass es möglich wäre, gemeinsam eine Strategie so zu gestalten, dass sie Stabilität und Wachstum zugleich fördert.
I would like to address the central economic challenge facing the world today – how to get back to solid, sustained and balanced growth that lifts all boats and provides a better future for all. Growth, of course, is not really an end in itself. It is a means to an end – enriching human lives, ennobling human dignity, engendering human potential and developing progress. And for that we need growth that spreads its gains far and wide. In a world that is more interconnected and bound together than at any time in human history, everyone has a stake in this. It is a collective responsibility towards a common destiny. I know this is well appreciated in Switzerland, which is deeply interconnected with the global economy. Trade accounts for 94 percent of the country’s GDP and the Swiss franc plays a prominent role in the global financial system.
Clearly, today’s global economy needs higher and better growth. Getting there depends on choosing the right combination of policies. With the wrong choices, we risk losing a decade of growth, a generation of young people and an opportunity to put the global economy on a secure footing. We dare not fail. In that context, let me talk about three issues today:
– The short-term path to growth.
– The medium-term path to growth.
– The fundamental importance of international cooperation.
By way of introduction, let us take a quick look at where we stand. The global economy is not delivering the growth the world needs. The IMF estimates global growth to be about 3.5 percent this year, but much weaker in advanced economies – a mere 1.5 percent, including a mild recession in the euro area. Among the advanced economies, the output gap – the difference between what an economy is producing and what it can produce – remains close to 4 percent this year on average. The emerging markets and developing countries are holding up much better, with expected growth of 5.75 percent. Turning to the financial side, financial markets in the euro area have seen some relief, thanks in part to recent European policies, but conditions remain volatile.
Why is growth so urgent? Look at the jobs situation. Right now, there are 200 million people worldwide who cannot find work, including 75 million young people trying to find their place in society. In the countries of Southern Europe, one in every five people and one in every two young people cannot find work. This is a potential disaster – in economic, social and human terms.
In advanced economies, especially in Europe, the issue is well understood, but people have very different views on remedies. They gravitate toward one of two camps – growth versus austerity. The growth camp says that we need more government stimulus to increase growth. The austerity camp says that markets are sitting in judgement over a mountain of public debt, and governments need to do what is necessary to reduce that debt as fast as possible. These positions are slight caricatures, but austerity versus growth is very much the debate of the hour. I believe it is a false debate. I would argue it is not “either/or”. We can design a strategy that is good for today and good for tomorrow. Good for stability and good for growth – where stability is conducive to growth and growth facilitates stability.
SHORT-TERM GROWTH
Let me turn to the first issue – short-term growth. In the short term, demand matters most for growth and jobs. And here, one of the engines that drive demand is already running fast. I am talking about loose monetary policy and very low nominal interest rates. And while it is already at close to full speed, there might be some scope – and need – to go faster in some cases.
People tend to forget the full power of these central bank actions. In normal times, this kind of monetary policy would lead to very high demand growth. But these are not normal times. The monetary engine cannot do the job alone. In fact, growth is being held back by three “brakes” in the system – fiscal adjustment, weak banks and poor housing markets. We need to manage these brakes so that the growth engine runs smoothly – much like a train in the mountains. Switzerland of all places understands the virtues of precision and precise calibration. Let me talk about each brake in turn.
The Fiscal Brake
First, fiscal adjustment. It is essential. Countries have a legacy of huge public debt – partly due to the crisis, partly due to their inability to store up wealth when times were good. Among the advanced economies, the ratio of debt to GDP is expected to hit 109 percent next year – the largest ratio since the Second World War. It is not sustainable. It has to come down. The most important element is to lay out a credible medium-term plan to lower debt. Without such a plan, countries will be forced to make an even bigger adjustment sooner.
At the same time, we know that fiscal austerity holds back growth, and the effects are worse in downturns. So the right pace is essential – and the right pace will be country-specific. The right mix between cutting spending and raising revenue is also critical. Some countries under severe market pressure have no choice but to move faster. On the whole, however, adjustment should be gradual and steady. By our estimates, most countries are moving at a prudent pace this year – about 1 percent of GDP on average.
As next year looms on the horizon, countries need to keep a steady hand on the wheel. If growth is worse than expected, they should stick to announced fiscal measures rather than announced fiscal targets. In other words, they should not fight any fall in tax revenues or rise in spending caused solely because the economy weakens. So again, there is no avoiding this brake on fiscal adjustment. But if set against a medium-term plan and calibrated correctly, we can make sure it does not do too much harm to growth.
The Banking Brake
The second brake on growth comes from the banking system. Banks are certainly looking healthier today than a few years ago, but they still have too much leverage on their books. They need to shed excess weight to become fit and healthy. But as with any weight-loss program, there are good and bad ways to do this. Ideally, it should be done by raising more capital rather than cutting back lending.
We expect large banks based in the European Union to shed as much as $2.6 trillion by the end of next year, or 7 percent of total assets. Fortunately, only a quarter of this is coming from reduced lending. The effect on euro area credit supply should be manageable – 1.7 percent of credit outstanding over two years. When bank health returns, we should see lower borrowing costs for all – and monetary policy should be able to do its job even more effectively.
The Housing Brake
The third brake on growth comes from the housing market. Another legacy of the crisis is too much housing and too much household debt that holds back recovery. This is primarily a problem in the United States, and also in some peripheral European countries such as Ireland and Spain.
The good news is that it, too, is being resolved. The excess stock of housing is working itself out, as there is little new investment. That said, we still need bolder programmes to reduce the debt burden, defaults and foreclosures. Countries such as Iceland have done a lot, but countries such as the United States still need to do more.
***
So let me try to tie this all together. The banking and housing “brakes” are easing, and will continue to ease over the next few years. The fiscal brake will not, but it can be applied in a way so as to do as little harm to growth as possible. And as I state above, monetary policy can remain supportive for as long as is needed, and will become more effective over time, as the banking channel becomes more fluid.
So if countries choose the right policies, and calibrate them correctly, the economy can grow faster. As T.S. Eliot once said: “We wait, and the time is short, but the waiting is long.” We must not waste time by getting distracted from the issue at hand, or by losing focus on the end game. This brings me to the medium-term dimension of the growth challenge.
MEDIUM-TERM GROWTH
Encouraging demand is the first step to get the economic engine to run faster and stop it stalling. But we need to make sure that the spark of demand will fuel sustained growth. If demand matters most for today, then supply matters most for tomorrow. That requires that product and labour markets work for everybody. Product market reforms are the avenue to higher productivity and growth in the future. This is particularly the case in the non-traded sector, where the cosseted few reap the benefits of being shielded from competition, while everybody else loses out. Sectors such as distribution, construction or regulated professions come to mind. This is a particular problem in Southern Europe.
Let me give you an anecdotal example from Greece. Because the local trucking industry was so protected in Greece, it actually cost less to import a tomato from the Netherlands than to buy one from a Greek farmer. There is something deeply wrong with this picture – unlike the cold and damp north, Greece has a fantastic climate for growing delicious tomatoes. This sector is now being liberalized, so things should change for the better.
On labour markets, our primary concern must be youth unemployment. Here, I believe that well designed labour policies can help young people take that crucial first step up the ladder. I am thinking of policies such as job-search assistance, wage subsidies, on-the-job training and apprenticeship programmes. Young people are especially disadvantaged by dual labour markets, which give strong protection to insiders and weak or no protection to outsiders. In such situations, young people tend to bounce back and forth between unemployment and dead-end jobs. Again, this is an especially serious problem in Southern Europe. And let me add that the same problem often confronts older people looking for work and similar solutions need to be identified for them.
Make no mistake: improving labour markets often means taking tough decisions. But it really is a matter of balance. We need to address the shortfalls and pitfalls of the market, while respecting the legitimate rights of workers and keeping a keen eye on income distribution. This can only be achieved through a constructive dialogue with all stakeholders, including workers and business representatives. The issue of product and labour market reform is most pressing for countries that have lost competitiveness relative to their economic partners, such as those in Southern Europe. This loss of competitiveness depresses growth today and blocks the path to sustained growth tomorrow. In these euro zone countries with no exchange rate valve to release the pressure the only options are boosting productivity or reducing wages.
But reforms take time to unlock productivity, and time is what these countries do not have. So, in some instances, wages will have to adjust. Sometimes this is just common sense. While minimum wages serve valid social goals, they can sometimes get out of line, which hurts the young and the unskilled in particular. For instance, the minimum wage in Greece is 50 percent higher than in Portugal, 17 percent higher than in Spain and 5–7 times higher than in Romania and Bulgaria.
Over the medium term, reforms will pay off. Some preliminary analysis by the IMF for the euro area countries suggests that over five years, large-scale product market, labour and pension reforms could boost GDP by 4.5 percent. Part of this reflects the magnified gains from a synchronized effort, showing the importance of everybody moving together. These gains are too important to turn down. That takes me to my third point – the centrality of cooperation.
THE CENTRALITY OF COOPERATION
The final point I want to make is that strong and sustained growth in each country benefits all countries. So we must all support the common effort. Let me talk about cooperation in three main areas – rebalancing the global economy, financial sector reform and the global financial safety net.
On rebalancing – better growth means more balanced growth. With many of the advanced countries saving more and going through a fragile healing process, other countries must step into the breach. I am thinking especially of the emerging markets with external surpluses like China, which are starting to shift more from exports toward domestic demand. This is good for them, good for the world, and they need to continue walking this path. The only way for global deficits to shrink is for global surpluses to shrink too. In other words, the advanced economies must export more to grow more, and other countries need to have enough demand to buy these goods and services. It is two sides of the same coin.
As we talk about rebalancing, let us not forget the plight of the low-income countries. These countries are especially vulnerable, home to millions of poor people, just one short step away from financial ruin and economic disaster. By implementing sound policies, these countries did relatively well during the crisis, but are now running short of options to cope with any further dislocation. We need to help them help themselves, urgently.
The second issue where we must do more together is financial sector reform. We cannot continue with the faulty financial system that toppled the global economy. We need a financial sector that puts societal interests ahead of its own financial gain. As with product markets, we face some powerful vested interests here. I am pleased to note that progress is being made under the Basel III process, which seeks to improve banks’ solidity. The ongoing work on shadow banking will also help address risks that lie outside the banking sector. The time has come to implement what has been agreed and make more progress on what has not. But this will only work with cooperation. Any new regime of heightened regulation and fairer taxation must be implemented consistently across countries to avoid the risk of arbitrage.
And here, I want to pay tribute to Switzerland, which is living proof that strong financial regulation is compatible with, and conducive to, a thriving financial sector. For example, it is imposing capital requirements on large and globalized banks that are well above the Basel III standards, and yet its financial sector, profoundly modified, is faring well.
The third area for increased cooperation is a global financial safety net – to help protect all countries against sharp economic downturns or the risk of financial contagion. Here, the recent efforts by European countries to build such a “firewall” are to be commended. This is also why the recent decision by the IMF’s membership to boost its resources by more than $430 billion is a major step in the right direction – a true symbol of global solidarity in the face of common threats to our common future. And I am proud to say that Switzerland played a key role in that response.
Let me make one more point. So far, I have talked about solidarity between countries. But solidarity within countries is also important. Difficult decisions in tough times are best taken in an atmosphere of social partnership – where everybody has a seat at the table, where the poor and vulnerable are protected, and where the government acts as an honest broker. This makes it easier to share fairly the gains of growth in good times and the pains of adjustment in bad times – ensuring greater political buy-in and social cohesion.
CONCLUSION
To sum up: strong, more sustained, balanced and inclusive growth is within our grasp. It is for us to choose the right combination of policies and resolutely walk the path together. This is not the time for short-termism or insularity. Switzerland is a country that shows how stability goes hand-in-hand with growth, how fiscal decentralization goes hand-inhand with monetary union, and how financial sector success goes handin-hand with strong oversight. It is a country that shows how cooperation with its neighbours can benefit all – important lessons.
If I were to leave you with one thought today, it would be this: growth and stability are not mutually exclusive – it is not “either/or” – and we can design a path that reconciles them both. It is the job of the IMF to stand with its members and to help its members. We bring 188 countries together to seek stability and growth, the sure foundations of a better future. Let me end with some wisdom from Albert Einstein, who once invited people to “learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”. Let us work together today to make our collective hopes for tomorrow a reality.
CHRISTINE LAGARDE, geboren 1956, ist zurzeit geschäftsleitende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Ihre berufliche Laufbahn führte sie über ein Studium in Rechtswissenschaften zu Baker & McKenzie, wo sie ab 1995 in geschäftsleitender Funktion tätig war. Im Jahr 2005 wurde sie zur Ministerin für Auswärtigen Handel der französischen Regierung berufen. Im Folgenden leitete sie das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei und schliesslich das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft. Im Jahr 2000 erhielt sie die Auszeichnung des Chevalier der Légion d’honneur.
EUROPA – WIE WEITER?
JEAN-CLAUDE JUNCKER2011
Die gegenwärtige Krise, so Jean-Claude Juncker, ist keine Eurokrise, sondern eine Schuldenkrise. Dabei ist zu beachten, dass in den verschiedenen europäischen Staaten die Gründe und die Abläufe dieser Krise ganz unterschiedlich sind. Vor diesem Hintergrund setzt sich Juncker mit der finanz- und wirtschaftspolitischen Lage in Irland und Griechenland auseinander. Er analysiert das Verhältnis zwischen demokratischen Prozessen und der Dynamik der Finanzmärkte und thematisiert auch die stetig sinkende Bedeutung Europas.
Ich mag die Schweiz sehr und ich bin nicht der Auffassung, dass diejenigen in der Europäischen Union recht haben, die Europa nur als Europäische Union denken und die Schweiz aussen vor lassen. Für mich gehört sie dazu, ist europäisches Kerngebiet, wenn auch von EU-Euphorie nicht erkennbar übermannt. Und es gibt weitere tüchtige, aufstrebende Nationen, die dazugehören. Mir fällt auch zur Schweiz und in Sachen Schweiz nicht nur Negatives ein. Ich bin, wenn es um die Schweiz geht, eher von Neugier getrieben als von Neidgier, wie dies bei anderen der Fall ist, weil ich die Schweiz zu jenen Staaten, Nationen in Europa zähle, an denen man sich eher ein Beispiel nehmen als dass man ihre Leistungen in Abrede stellen sollte.
Die Europäische Union umgreift auch nicht nur das Euro-Währungsgebiet, diese 17 Staaten, die sich eine gemeinsame Währung gegeben haben, indem sie die 17 bestehenden Währungen zu einer einheitlichen fusionierten. Diese Wirtschafts- und Währungsunion, die in der Weltgeschichte einmalig und unerreicht ist, gehört insgesamt zu einer der grössten europäischen Nachkriegsleistungen, trotz der aktuellen Problemlage. Der Euro, die europäische Währung, hat in den von ihr abgedeckten Staaten in Europa eine insgesamt maximal stabilisierende Wirkung, sowohl geldpolitisch als auch wirtschaftspolitisch. Und sie hat im Übrigen auch sehr zur Stabilisierung der nicht zum Euro-Währungsgebiet gehörenden EU-Mitgliedstaaten sowie der direkten Nachbarstaaten der Europäischen Union geführt.
Viele, die sich geografisch bedingt um das Euro-Währungsgebiet herum versammeln, leiden unter der sich anbahnenden Instabilität des Euro-Währungsraums und fürchten um ihre eigene Stabilität, was im Umkehrschluss ja heisst, dass sie in den letzten zwölf Jahren maximal von der Währungsstabilität profitiert haben, die vom Euro-Währungsgebiet ausging. Insofern, bei aller Notwendigkeit, die es gibt, dass wir kritischen Zungenschlägen und Zwischenzungenschlägen unser Augen- und Ohrenmerk schenken, ist es nicht sehr angebracht, wenn andere uns so massiv kritisieren, wie dies zurzeit im angelsächsischen Raum passiert. Die amerikanischen und britischen Schuldenstände sind deutlich höher als der Durchschnittsschuldenstand des Euro-Währungsgebiets. Gleiches gilt für die jährlichen Defizitbildungen. Insofern hielte ich es für angebracht, wenn man sich etwas in Bescheidenheit üben würde, was aber nicht zuletzt deshalb schwerfällt, weil die Europäische Union selbst ebenfalls Mühe hat, wenn es um Bescheidenheit in der Betrachtung der Leistungen anderer geht.
Wir haben es aktuell nicht mit einer Eurokrise zu tun, wie dies fälschlicherweise auch in Teilen der überregionalen schweizerischen Presse immer wieder beschrieben wird, sondern mit einer Schuldenkrise in einigen Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets. Und diese Schuldenkrise, die das aktuelle Tagesgeschehen so sehr prägt, lässt in Vergessenheit geraten, dass es, seit wir den Euro haben, doch zu erheblichen Fortschritten im Euro-Währungsgebiet und in der Europäischen Union insgesamt gekommen ist. Noch nie hat es eine derartige Nettoarbeitsplatzschaffung gegeben wie in den ersten zehn Jahren des Bestehens des Euro. Ja, die Einführung des Euro hat aufgrund der stabilisierenden Wirkung, des Wegfallens der Transaktionskosten sowie der Herstellung währungspolitischer Aussichts- und Perspektivsicherheit zu einem regelrechten Wachstumsschub geführt.
Die Inflation war mit 1,97 Prozent in den ersten zwölf Jahren der Euro-Geschichte so niedrig wie noch nie. Die Deutschen mit ihrem die Zukunft negativ und die Vergangenheit verherrlichend betrachtenden Denken behaupten, die Deutsche Mark wäre wesentlich stabiler, die Inflation niedriger gewesen – doch das Gegenteil ist der Fall. Die durchschnittliche Inflationsleistung der Währungszone ist deutlich positiver als diejenige der letzten zehn Jahre unter der Vorherrschaft der Deutschen Mark. Die Zinssätze waren niedriger und sie sind immer noch niedriger als im Durchschnitt der europäischen nachkriegs-geldpolitischen Geschichte. Die Defizitstände waren auf 0,7 Prozent im Direktvergleich zum Bruttosozialprodukt Ende 2007 zusammengeschrumpft und sind erst unter dem Eindruck der weltweit tobenden Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der Notwendigkeit des Auflegens breiter Konjunkturprogramme wieder nach oben geschnellt. Ähnliches gilt für den Gesamtschuldenstand. Insofern, trotz aller Betrübnis des Augenblicks, kann man die Eurogeschichte nicht als die Geschichte eines grossen Misserfolgs beschreiben, sondern eher als eine konsolidierte und konsolidierende.
Die Schuldenkrise, die wir in einigen Mitgliedsstaaten des einheitlichen Währungsgebiets haben, ist auch nicht allein darauf zurückzuführen, dass die dort Regierenden nicht ordentlich haushalten zu können. Das Absinken einiger Staaten in der Skala der internationalen Erfolgsträger hat wesentlich damit zu tun, dass Griechenland, aber auch Portugal und Irland ihre Wettbewerbsfähigkeit nach ihrem Eintritt in das Euro-Währungsgebiet nicht zu erhalten wussten. Griechenland beispielsweise hat über 50 Prozent seiner Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst, seit es in das Euro-Währungsgebiet eingetreten ist. Dieser Eintritt stand ja, wie wir jetzt wissen, nicht in vollem Einklang mit der nachweisbaren Erfüllung der beitrittsöffnenden Konvergenzkriterien. Und das wiederum hat eher mit zu wenig als mit zu viel Europa zu tun, weil es dem Statistischen Amt der Europäischen Union bis vor Kurzem untersagt war, die statistischen Daten der Mitgliedsländer kritisch zu überprüfen. Das zeigt, dass der Schlachtruf «Weniger Europa ist besser als zu viel Europa» nicht stimmt, wenn es um wirklich ernste Dinge des europäischen Zusammenwachsens geht.
Auch die Iren, die Portugiesen, die Italiener und die Spanier haben an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst. Und die Tatsache, dass diese fünf Staaten eigentlich im Fokus der Euro-Schuldenkrise stehen, hat wesentlich damit zu tun, dass in Sachen Wettbewerbsfähigkeit nicht mit der notwendigen Härte und Vorsicht vorgegangen wurde. Dabei möchte ich ungern Griechenland, Portugal und Irland in einen Topf werfen, weil die Vorgänge unterschiedlicher Prägnanz und auch unterschiedlicher Provenienz sind. In der Causa Irland muss man die Banken- und Immobilienkrise ursächlich hinzuzählen. In Spanien kann man die Lage auf dem Immobiliensektor nicht ausser Betracht lassen sowie spezifische Finanzierungsprobleme der Regionen in Spanien. Und auch Teile des spanischen, vornehmlich öffentlich verwalteten Bankengewerbes haben ihren Teil zur spanien-spezifischen Krisenhaftigkeit beigetragen.
Irland ist auf einem guten Weg. Seit es eine Programmhilfe der Eurogruppe erhalten hat, konnte es seine Leistungen permanent verbessern. Irland hat die Hälfte seines Wettbewerbsfähigkeitsverlusts wieder wettgemacht aufgrund sehr tief greifender politischer Massnahmen, die alle Sektoren des politischen Tuns umfassten, und auch aufgrund der Tatsache, dass die Iren so sind wie die Schweizer und die Luxemburger, nämlich bodenständig. Wenn wir uns verrannt haben, sind wir wie die Iren: Wir versuchen, den Weg wieder zurückzufinden, ohne den Rest der Welt für das eigene Unvermögen haftbar zu machen. Die Iren sind Schweizer und die Schweizer sind erst gut, wenn sie luxemburgische Züge tragen, insofern ist Irland eigentlich ein Erfolgsprogramm, das nur ihre schweizerische und luxemburgische Eigenart erklären kann.
Aber man redet nicht darüber, dass sich Irland nach erfolgter und Erfolg versprechender Konsolidierungsphase wieder hier auf dem Weg zurück in den Kreis erfolgreicher Volkswirtschaften befindet. Man findet mehr Gefallen daran, auch in der angelsächsischen und Teilen der schweizerischen Presse, über die Probleme im Euroraum zu reden als über die Erfolge, die wir auch jetzt in Sachen Irland erleben. Ich möchte ein Beispiel geben. Die Financial Times hat einen fundierten Artikel geschrieben über den Weg Irlands zurück auf den Erfolgskurs. Am selben Tag habe ich Analysten aus dem asiatischen Raum empfangen und sie gefragt, ob sie diesen Artikel gelesen hätten. Und dann stelle ich fest, dass in der asiatischen Ausgabe der Financial Times dieser Artikel fehlte. Das ist keine Verschwörung, die Verantwortlichen vergessen nur manchmal, ihr Wissen weltweit zu verbreiten. Kurz: Über den Erfolg Irlands redet man nicht. Mit unserer solidarischen Hilfe, aber auch wegen der irischen Soliditätsbereitschaft war es möglich, Irland wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Und so kann es, so wird es, so müsste es auch in Gesamteuropa möglich sein, Staaten, die sich verrannt oder verirrt haben, wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
In Griechenland ist das jedoch ausgesprochen schwierig, weil die griechischen Probleme den Problemen der anderen genannten Länder nur im Entferntesten ähneln. Denn Griechenland – und ich habe den grössten Respekt vor der griechischen Nation – ist kein Staat, wie wir denken, dass ein Staat geführt werden müsste. Und ich sage das nicht despektierlich, sondern als Feststellung. Es ist so, dass das Phänomen der Korruption, das es wahrscheinlich in allen Staaten gibt, in Griechenland zum täglichen Modus Vivendi gehört – auf allen Ebenen, alle Schichten durchkreuzend, aufgrund vieler Irrungen und Wirrungen jahrhundertelanger griechischer Geschichte. Viele Griechen sehen das inzwischen auch so.
Ich entdecke an Griechenland Dinge, von denen ich nicht wusste, dass es sie geben kann. Auch diese Bemerkung ist nicht despektierlich gemeint. Beispielsweise stellte ich fest, dass es in Griechenland kein Grundbuch gibt. Ich debattierte mit den griechischen Kollegen über Monate hinweg über die Notwendigkeit, aus Haushaltskonsolidierungsgründen ein 50-Milliarden-Privatisierungsprogramm in Griechenland zur Anwendung zu bringen, und stellte dann fest, dass es kein Grundbuch gibt. Das heisst, ich privatisiere etwas, von dem ich nicht weiss, ob es mir überhaupt gehört. Daraus erwächst eine Rechtsunsicherheit, die natürlich das Privatisierungsbegehren massiv in sich zusammenbrechen lässt. Wenn ich nicht weiss, ob das, was ich jetzt kaufe, dem gehört, dem ich es abkaufe, und ich es vielleicht morgen mit jemandem zu tun habe, der denkt, er wäre der Eigentümer und er wäre nicht rechtmässig entschädigt worden – ob das die Investorenlust bis zu ihren absoluten Maximum steigert, ist infrage zu stellen. Das ist ein Erbe des ottomanischen Reiches, von dem sich die Griechen jetzt selbstverständlich befreien müssen.
Ähnliche Phänomene könnte ich in epischer Breite vorbringen, nur um zu zeigen, dass der griechische Staat nicht in dem Masse als Staat funktioniert wie die Schweiz, Luxemburg, Österreich, Deutschland oder die Niederlande. Dabei geht es auch um, ich sage nicht gerne «nation building», vielmehr um ein Stück «administrative state building». Wir wissen von unseren Staaten, dass sie nicht optimal funktionieren. Insofern ist es ein Trost, dass es Staaten gibt, die noch weniger gut funktionieren, aber es ist kein zielführender Trost.
Wenn es jetzt um die Behebung des Griechenlandproblems geht, gilt es mehrere Ebenen zu unterscheiden. Die Beteiligung des privaten Sektors muss geklärt werden und die Privatgläubiger müssen in die Pflicht genommen werden. Das wurde am 21. Juli 2011 so verabredet. An sich bin ich auch sehr dafür, dass sich diejenigen, die partiell, wenn nicht darüber hinaus mitschuldig sind an dem in Griechenland und andernorts eingetretenen Zustand, an den Kosten des Austritts aus der Krise beteiligen. Sehr klug finde ich das aber nicht, weil es sehr viele Investoren vor weiteren Engagements in Teilgebieten des Euro-Währungsgebiets abschreckt. Es wäre gut, wenn wir deutlich machten, dass diese Privatgläubigerbeteiligung nicht prinzipieller Ex-ante- und A-priori-Natur ist, sondern dass dies in der Causa Griechenland gemacht werden musste wegen der Anhäufung so vielfältiger und auch unterschiedlicher Gesamtverantwortung und dass man das in anderen Fällen nicht tun wird.
Es muss klar sein, dass wir in Sachen Griechenland alles tun müssen, um ein Kreditereignis zu verhindern, alles. Und dass wir alles tun müssen, um ein Default zu verhindern, sei es ein Teildefault oder ein ganzes Default. Dies hätte für Griechenland erhebliche Negativfolgen, die ich mir nicht vorstellen möchte, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass sich Griechenland heute schon, was man verstehen muss, in einem vorbürgerkriegsähnlichen Zustand befindet. Wenn wir unseren Bevölkerungen in der Schweiz, in Liechtenstein, Österreich, Deutschland oder in Luxemburg derartige Sparprogramme zumuten müssten, dann wäre hier die Hölle los. Wenn die Deutschen in einem Jahr 340 Milliarden Euro einsparen müssten, hätten sie wahrscheinlich mehr Verständnis für das, was wir Griechenland zumuten. Und das genau entspricht der Summe, die umgerechnet in Deutschland einzusparen wäre.
Zu sagen, Griechenland tut nichts und Griechenland schaut seinem eigenen Elend zu, ist eine falsche Behauptung. Die griechische Regierung hat in den letzten zwei Jahren Erhebliches geleistet. Bleibt zu hoffen, dass das, was entschieden wurde, auch durchgesetzt wird. Wenn in unseren Ländern das Parlament ein Steuergesetz erlässt, dann kommt es zur Anwendung. In Griechenland sagen jetzt viele Menschen, auch aufgrund dessen, was ihnen zugemutet wird: Wir zahlen keine Steuern. Doch dann ist es schwierig, den Haushalt zu finanzieren. Wenn sich Bürger weigern, Steuern zu zahlen – wer verstünde sie nicht? Aber ich war 20 Jahre Finanzminister und habe deshalb kein Verständnis für jemanden, der keine Steuern zahlt. Aber nicht jeder Grieche war 20 Jahre Finanzminister. Insofern muss man verstehen, dass es, wenn einem viel zugemutet wird, auch schwierig ist, die Umsetzung positiv zu begleiten. Doch das muss von den Griechen geleistet werden.
Es kommt überhaupt nicht infrage, weder jetzt noch in Zukunft, dass ein Land aus dem Währungsgebiet ausgeschlossen wird. Es kommt auch nicht infrage, dass ein Land aufgrund eigener Beschlusslage aus dem Währungsgebiet austritt. Ein Währungsgebiet lebt nicht nur von seiner feststellbaren Substanz, sondern auch von dem zu vermutenden Erhalt dieser festgestellten Substanz. Und wenn es über Jahre und Jahrzehnte Rätselraten an den Finanzmärkten darüber geben würde, ob diese Konstruktion des Euro-Währungsgebiets Bestand hat oder ob da ein Rückzug in Teilgebiete stattfindet, mit Rückkehr zu nationalen Währungen, hätte das natürlich eine den Erfolg des Gesamtunterfangens stark infrage stellende Auswirkung. Deshalb muss man davon Abstand nehmen.
Wir müssen ein neues Griechenlandprogramm definieren. Es wird einen vom öffentlichen Sektor zu bewältigenden Kostenpunkt haben, der über den 109 Milliarden liegen wird, die wir am 21. Juli 2011 festgelegt haben. Die ebenfalls an diesem Tag beschlossene 21-prozentige Privatgläubigerbeteiligung wird massiv nach oben korrigiert werden müssen, etwa um 50 Prozent.
Wir werden die europäischen Banken rekapitalisieren müssen. Als Finanzminister haben wir uns darauf verständigt, dass die Eigenkapitalquote 9 Prozent betragen muss, was eine erhebliche Anstrengung von vielen Bankenhäusern in Europa zur Folge haben wird. Und wir haben uns darauf verständigt, dass dies bis zum 30. Juni 2012 zu gewährleisten ist in einem «market to market approach», so heisst das auf Neudeutsch. Das wird ein Gesamtvolumen von über 100, aber nicht über 112 Milliarden Euro umfassen. Wir werden das machen müssen, und das ist die wichtigste Aufgabe, sodass mögliche griechische Irrwege in anderen Ländern vermieden werden.
Wenn wir über Griechenland reden, reden wir de facto auch über Italien. Griechenland macht 2 Prozent der Euro-Wirtschaftsleistung aus. Vor Monaten befanden sich nur 2 Prozent des europäischen Bruttosozialprodukts unter intensiver Beobachtung der Finanzmärkte. Heute sind es schon 40 Prozent. Aus unerfindlichen Gründen ist das Euro-Währungsgebiet zum Epizentrum einer globalen Herausforderung geworden. Eigentlich müssten die Finanzmärkte ihr Augenmerk auf die Unmöglichkeit amerikanischer und japanischer Entschuldung richten. Japan hat einen Schuldenstand von 240 Prozent Bruttosozialprodukt. Aber nein, man findet Gefallen daran, jetzt die Eurozone als Ganze infrage zu stellen. Wir sind das Epizentrum einer globalen Herausforderung, und deshalb geht es eben nicht nur um Griechenland. In diesem Fall wären die Dinge einfacher, wenngleich sehr schwierig. Aber es geht nicht nur um Griechenland. Deshalb müssen wir Schutzwälle gegen Ansteckungsgefahren in Richtung Italien, Spanien und andere Länder aufrichten. Und wenn wir das nicht richtig machen, dann – das sage ich heute voraus – kommen alle an die Reihe. Alle Eurostaaten und nicht nur die – auch die Schweiz wird betroffen sein, wenn wir dieses Problem nicht adäquat einer Lösung zuführen.
Ich gehöre nicht zu diesen aufgeregten Menschen, die sagen, wenn der Euro explodiert, explodiert die Europäische Union und der ganze Kontinent. Ich bin ein sehr aufgeregter Europäer, weil ich die europäische Geschichte kenne. Ich spiele nicht gerne mit dem Feuer und weiss, dass die Europäer nicht klüger sind als die anderen Menschen auf der Welt. Und das, was wir an Unheil im 20. Jahrhundert angestiftet haben auf unserem Kontinent, dazu sind wir jederzeit wieder in der Lage. Man darf nicht vergessen, dass vor 15 Jahren im Kosovo und in Bosnien getötet, gemordet, vergewaltigt wurde. Das war mitten in Europa, keine 18 Flugstunden von hier entfernt, sondern anderthalb Stunden. Insofern müssen sich die Europäer vor sich selbst in Acht nehmen.
Ich spiele also nicht mit Errungenschaften wie dem Euro, von dem ich immer gesagt habe, dass er Friedenspolitik mit anderen Mitteln ist. Das sind die Friedensmittel, die unserer Generation zur Verfügung stehen, also müssen wir, auch eingedenk dessen, was die Churchill-Generation gemacht hat, dafür sorgen, dass unsere Mittel, die Mittel unserer Zeit und das Handwerkszeug unserer Generation funktionieren. Daran arbeiten wir, und deshalb müssen wir auch das Griechenlandproblem in den Griff kriegen. Wir müssen die Eingriffsmöglichkeiten des Europäischen Rettungsschirms durch Hebelwirkungsmechanismen in einer Weise ausfeilen, dass die Eindämmungsgewalt und die abschottende Mauergewalt dieses Rettungsschirms so stark sein werden, dass eine Ansteckung nach Italien und sonst wohin keine Chance hat.
Natürlich müssen wir auch in Sachen Finanzmarktregulierung von der Stelle kommen. Nicht nur in Europa, sondern weltweit, nicht nur in der G-20-Gruppe, sondern auch darüber hinaus.
Ich bin mit dem, was wir in Europa seit der Lehman-Brothers-Krise an Regularien geschaffen, was wir überhaupt als Eurogruppe aufgestellt haben, nicht unzufrieden. Es gab in Europa noch nie so viele Entscheidungen wie in den letzten anderthalb Jahren. Es war auch notwendig, dass wir diese getroffen haben. Aber wir waren viel zu langsam dabei. Weil die Finanzmärkte nicht demokratisch funktionieren, verstehen sie nicht, dass Demokratien etwas mehr Zeit brauchen, um sich intern und interdemokratisch zu verständigen. Das ärgert mich, auch wenn ich weiss, dass das nichts nutzt. Finanzmärkte funktionieren in Sekundenschnelle, Demokratien hingegen sehr, sehr langsam. Da braucht es demokratisch legitimierte Entscheidungen in 17 Staaten, da braucht es die Zustimmung von 17 Regierungen, da gibt es insgesamt 60 politische Parteien, die in der Eurogruppe zusammensitzen. Diese Probleme haben die jungdynamischen Trader in New York, die mit kurzer Hose in klimatisierten Büros sitzen, nicht. Ich habe sie.
Unsere Systeme sind demokratisch verfasst. Ich lege grossen Wert auf die parlamentarische Begleitung dessen, was Regierungen tun, obwohl ich der Auffassung bin, dass die parlamentarischen Beratungen eigentlich eher zur Information der Spekulanten angelegt sind als zur Behebung der Probleme. Demokratien brauchen Zeit, Finanzmärkte brauchen keine Zeit. Demokratien haben keine Zeit, und Finanzmärkte nehmen sich keine Zeit.
Das ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Es muss regulierende Gesamtumrahmungsgesetzgebungswerke weltweit und auch in Europa geben, damit wir das Spontihafte der Finanzmärkte in den Griff kriegen. Anstatt dass die Politik und ergo die Menschen von den Finanzmärkten, die niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig sind, getrieben werden, müssten eigentlich wir gegenüber den Finanzmärkten einen Vorsprung haben.
Die Finanzmärkte und zum Teil auch die Banken haben sich in den letzten Jahren an den Kardinaltugenden der sozialen Marktwirtschaft versündigt, das Haftungsprinzip ist in Vergessenheit geraten, dass derjenige, der etwas Falsches tut, dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Stattdessen müssen Staaten und Steuerzahler oder sonstige Institutionen dafür geradestehen. Ich gehöre nicht zu den systematischen Bankenkritikern. Aber hier müssen wieder mehr Ordnung und mehr System Einzug halten. Die Verirrungen des sozialmarktwirtschaftlichen Grundgedankens müssen abgestellt werden, und deshalb ist es zwingend notwendig, an der Finanzmarktregulierung, die ja nicht gleichzusetzen ist mit Finanzmarktstrangulierung, intensiv zu arbeiten.
Aber Europa ist nicht nur Währung, ist nicht nur Geldpolitik, ist nicht nur Griechenland, Irland, Portugal. Europa ist mehr als das. Ich bin kein Euro-Phoriker in dem Sinne, dass ich alles, was man sich in Brüssel zusammendenkt, als der Weisheit letzten Schluss begreifen würde. Seit vielen Jahren erlebe ich das ja alles hautnah, live und in Farbe. Beispielsweise zeugt die Idee, das kaum überschaubare Gebiet des Grossherzogtums Luxemburgs in Regionen einzuteilen, damit man die regionalen Beihilfen auch in Luxemburg entsprechend zur Anwendung bringen kann, davon, dass es eine erhebliche Unkenntnis in Bezug auf die geografischen Verhältnisse des Grossherzogtums Luxemburg gibt, wo man auf dem linken Bürgersteig der Strasse 15 Prozent Beihilfe kriegt und auf dem rechten wegen der regionalen, interkontinentalen Differenz 18 Prozent – das versteht in Luxemburg niemand. Das führt übrigens dauernd dazu, dass die Geschäfte die Strassenseite wechseln, damit sie 3 Prozent mehr kriegen. Einen solchen Blödsinn von einigen Reissbrettfanatikern muss man abstellen. Ich bin der Auffassung, dass zu viel Europa an der falschen Stelle zu zu wenig Europa führen wird. Insofern muss man das in den Griff kriegen.
Die europäische Sache hat nichts mit Regionalhilfe in Luxemburg, sondern im Wesentlichen mit Vergangenheitsbetrachtung und mit Zukunftsvorstellungen zu tun. Die europäische Vergangenheit war keine gute. Die guten alten Zeiten, die hat es in Europa nie gegeben. Das 20. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte war kein gutes Jahrhundert. Das Leben meiner Generation, ich bin 1954 geboren, ist ja in keinerlei Weise vergleichbar mit dem, was unsere Grosseltern und unsere Eltern haben erleben, erleiden und erdulden müssen. Diese Menschen, die Krieg führen mussten – niemand kommt ja individuell auf die Idee, Krieg zu führen, es ist ja immer eine Entscheidung der Politik bzw. der nicht funktionierenden Politik –, die kamen aus den Konzentrationslagern und von den Frontabschnitten nach Hause und beschlossen: Das machen wir nicht noch einmal. Das hatten die Europäer schon so oft vorher gesagt, aber zum ersten Mal nach Kriegsende wurde aus diesem ewigen Nachkriegsgebet «Nie wieder Krieg» ein politisches Programm, das bis heute Wirkung zeigt.
Wenn ich das vergleiche mit dem, was unsere Generation heute tut, dann ist das nicht nur unvergleichlich, sondern fast empörend, weil wir ja in der Sonne gross geworden sind. Die Sonne hat offenbar auf viele Köpfe gebrannt, die das schlecht vertragen haben, wenn ich mir heute anschaue, was aus diesen Köpfen an europäischem Gedankengut sprudelt. Also, wir sollten der Vorgängergeneration dankbar sein, dass sie uns erlaubt hat, in eine Welt hineingeboren zu werden, in der es keine existenziellen und essenziellen Probleme mehr zu bewältigen gibt.
Es reicht aber nicht, die Themen Krieg und Frieden in Bezug zu Europa einfach abzuarbeiten. Ich bin der Meinung, dass es immer noch darum geht. Das Kurzzeitgedächtnis der Europäer tendiert gegen null. Ich habe bereits die Ereignisse in Bosnien angesprochen: Diese Kriege und Menschenrechtsverletzungen fanden nicht im 19., sondern Ende des 20. Jahrhunderts statt. Es geht um eine perspektivische Erzählung über Europa. Und diese basiert auch, zum Teil jedenfalls, auf ökonomischen Betrachtungsweisen.
Unsere Bedeutung in der Weltwirtschaft nimmt rasant ab. Ich rede nicht nur von EU und Euro-Europa, sondern von Europa im weitesten Sinne des Wortes. Heute steht die Europäische Union für 20 Prozent des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Das wird so nicht bleiben. Wir rutschen unaufhörlich in Richtung 14 Prozent. Mit oder ohne Wettbewerbsfähigkeitsverlust lässt sich eine konstante Entwicklung beobachten. Von 2007 bis 2010 haben wir 2000 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung allein im Euro-Währungsgebiet eingebüsst, weil wir den rezessiven Entwicklungen keine konsequente und unmittelbare Wiederaufmöbelungspolitik entgegenstellen konnten. Wir werden schwächer.
Und wir werden immer weniger. Auch dieses Thema treibt mich um. Geschichte ist das Ergebnis vom Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander von Geografie und Demografie. Die europäische Geografie ist irrsinnig kompliziert. Deshalb gehöre ich zu denen, die immer noch denken – obwohl viele das inzwischen nicht mehr so sehen –, dass der Erweiterungsprozess der Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa ein historisch zu begrüssender ist, weil es uns gelungen ist, europäische Geschichte und europäische Geografie sich wieder miteinander versöhnen zu lassen. Wir haben uns nicht mit diesem unmöglichen Nachkriegsdiktat abgefunden, dass die Europäer auf ewig in zwei getrennten Untergruppierungen funktionieren müssen.
Aber die Demografie, betrachtet man sie in der Retrospektive und stellt man sie sich in der Perspektive vor, erzählt eine eindeutige Geschichte, die uns zu mehr Europa wird veranlassen müssen, es sei denn, wir hätten uns endgültig dazu entschieden, völlig geschichts- und zukunftsblind zu sein. Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Europäer 20 Prozent der Erdbevölkerung gestellt, am Anfang dieses Jahrhunderts waren es noch 11 Prozent. Die Weltbevölkerung wächst weiter, während wir schrumpfen, wirtschaftlich und demografisch. Mitte des Jahrhunderts werden die Europäer noch etwa 7 Prozent der Erdbevölkerung ausmachen und am Ende dieses Jahrhunderts werden es noch 4 Prozent sein. In zwei Jahrhunderten wird sich also der Anteil der europäischen Bevölkerung an der Erdbevölkerung durch fünf geteilt haben.
Das heisst, dass sich diejenigen, die denken, der Nationalstaat wäre das optimale politische, auch aussenpolitische Instrumentarium, um in der Welt des ausgehenden 21. Jahrhunderts zurechtzukommen, fundamental irren. Das ist jetzt kein Plädoyer für den Beitritt der Schweiz, sondern nur der Hinweis darauf, dass es keine grossen europäischen Länder mehr gibt. Es gibt sie schon heute nicht mehr und morgen wird es sie erst recht nicht mehr geben. Niemand wird angesichts der Bevölkerungsexplosion – weniger in China als in Indien: die Inder werden in 20 Jahren die Chinesen überrundet haben, mit all dem, was dies an gesamtwirtschaftlichen Implikationen zur Folge haben wird – mehr von den sich heute noch gross wähnenden europäischen Nationen reden. Das ist meine Überzeugung. Ich reise ja durch die Welt, bin in Moskau, in Peking, rede mit den Medwedews und Putins dieser Welt und mit den Wus und Wins und Wens. Wenn Frankreich, England, Italien nicht Mitglieder der Europäischen Union wären, sie würden als Einzelstaaten nicht mehr zur Kenntnis genommen, sie wären keine Players mehr.
Die Chinesen haben ja in Sachen Demografie eine eigene Sicht der Dinge. Man muss sich dieser Sicht der Dinge anschliessen, um überleben zu können. Zweimal im Jahr bin ich in China, um den chinesischen Premierminister zu treffen. Ich nehme ihn dann immer an der Schulter und sage: Stell dir mal vor, du und ich, wir beide, wir repräsentieren ein Drittel der Menschheit. Und dann lacht er. Aber er würde auch lachen, wenn Frau Merkel, Herr Sarkozy oder Herr Berlusconi ihn so ansprechen würde. Das macht für ihn überhaupt keinen Unterschied, weltweit betrachtet.
Wieso sollen eigentlich die Europäer die Einzigen sein, die an der Sonne leben, die Wohlstand kennen? Sind die Chinesen oder die Inder weniger wert als wir? Wir sind doch nicht die Herren der Welt. Wir waren es nie. Und als wir dachten, wir wären es, war es nicht zum Guten der Welt.
Insofern kommt es auch – und ich bin kein Sozialist – auf Brüderlichkeit an, in Europa und ausserhalb Europas. Solange jeden Tag 25000 Kinder den schlimmsten aller Tode sterben, nämlich an Hunger, solange sind wir, die Europäer, die EU-Europäer, die Euro-Europäer, die Schweizer mit ihren Aufgaben der Welt nicht fertig.
JEAN-CLAUDE JUNCKER, geboren 1954, war von 1982 bis 2013 Mitglied verschiedener Regierungen und von 1995 bis 2013 Premierminister Luxemburgs. Von 2005 bis 2013 war er Vorsitzender der Euro-Gruppe. 1991 wurde er zu einem der federführenden Akteure bei der Ausarbeitung des Maastrichter Vertrags, insbesondere der Kapitel über die Wirtschafts- und Währungsunion, und war im Februar 1992 einer der Unterzeichner des Vertrags von Maastricht. Zahlreiche internationale Auszeichnungen, unter anderem der Karlspreis der Stadt Aachen (2006), dokumentieren die Verdienste und auch die Popularität dieses Europäers.





























