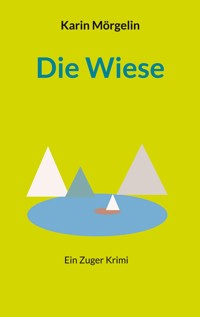
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Zugersee wird eine Leiche geborgen. Die neu bei der Zuger Polizei arbeitende, unkonventionelle Ermittlerin Tabea Stocker glaubt nicht an einen Bootsunfall und gerät bei ihren teils eigenmächtigen Nachforschungen in den Sumpf kardinaler menschlicher Untugenden. Die Wiese, ein grosses, unbebautes Seegrundstück, wird zum Nährboden für Macht- und Geldgier. Hat dies zum Tod eines Mannes geführt oder war es am Ende doch ein Unfall?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
„Die Wiese“ ist ein Schweizer Regionalkrimi. Er spielt in Zug und Zürich. Durch Sprachwitz, Ironie und die Verwendung von Klischees weist der Krimi parodistische Züge auf.
Im Zugersee wird eine Leiche geborgen. Die neu bei der Zuger Polizei arbeitende, unkonventionelle Ermittlerin Tabea Stocker glaubt nicht an einen Bootsunfall und gerät bei ihren teils eigenmächtigen Nachforschungen in den Sumpf kardinaler menschlicher Untugenden. Die Wiese, ein großes, unbebautes Seegrundstück, wird zum Nährboden für Macht- und Geldgier. Hat dies zum Tod eines Mannes geführt oder war es am Ende doch ein Unfall?
Über die Autorin
Karin Mörgelin wurde 1956 in Weil am Rhein geboren.
Nach ihrem Studium der Germanistik und Anglistik lebte sie einige Jahre in England. Dort und später in Frankfurt am Main komponierte sie eine Vielzahl von Songs mit eigenen Texten, die sie mit ihren Bands auch in Funk und Fernsehen aufführte. Die Songs sind in einem Songbook zusammengestellt.
Daneben schrieb und übersetzte sie Fachtexte und war Mitautorin eines Fachbuchs.
Sie arbeitete in England, Deutschland und in Zug (Schweiz) als Lehrerin.
Neben dem Kriminalroman „Die Wiese“ ist ihr Roman „Tareks Dilemma“ ebenfalls bei BoD erschienen.
Seit 2019 ist sie freie Schriftstellerin und lebt mit ihrem Mann wieder in Südbaden.
"Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht."
Sprichwort
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 1
Punkt zwölf Uhr fuhren ein schwarzer Maserati Ghibli Cabriolet Vintage und ein silbergrauer Volvo XC60 auf den Parkplatz der Zugerbergbahn. Dem Maserati entstieg ein lässig gekleideter Bär um die vierzig, der einen aber nicht zum Knuddeln verleitete, und aus dem Volvo stellten sich zwei schwarze Lederschuhe und ein dunkelgrauer maßgeschneiderter italienischer Anzug auf den heißen Asphalt. Das Gesicht war unter einem breitkrempigen schwarzen Hut versteckt, beim Verriegeln des Wagens reflektierte eine goldene Uhr die mittägliche Sonne.
Die beiden gingen aufeinander zu und setzten kurz ihre Sonnenbrillen ab.
„Herr Ostrowsky, schön Sie zu sehen. Haben Sie gut hierher gefunden?“, wollte der im grauen Anzug wissen.
„Herr Wyss. Einen schönen guten Tag. Auch in ein altes Auto kann man neue Technik einbauen. Mein mobiles Navigationssystem fand den Ort problemlos. Danke.“ Sie schüttelten sich die Hände und gingen zum Fahrkartenschalter.
„Lassen Sie mich das machen, Herr Ostrowsky“, offerierte Wyss großzügig. Ostrowsky hatte sowieso keine Anstalten gemacht, sich eine Fahrkarte für die Bahn zu kaufen. „Danke, danke, mein lieber Wyss. Sie kennen sich hier besser aus.“
Kaum hatten die beiden ein ruhiges Plätzchen besetzt, fuhr die Standseilbahn auch schon los. Vorbei an saftigen Wiesen und durch dunkelgrüne Waldstücke wurden die Passagiere auf den knapp 1000 Meter hohen Zugerberg transportiert.
“Hier lang“, sagte Wyss nach dem Aussteigen und deutete nach rechts, wo sich das Restaurant Zugerberg befand. Sie betraten das Gasthaus.
„Wir haben reserviert“, informierte Ostrowsky den Kellner, der ihnen den Eingang versperrte. „Ostrowsky. Zwei Personen. Fensterplatz.“
Der Kellner verneigte sich leicht und führte die Gäste an ihren Tisch.
„Kann ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen?“ Der Kellner lächelte die beiden erwartungsvoll. Ostrowsky schaute fragend zu Wyss.
„Äh, ich nehme ein Glas Weißen.“ „Für mich ein Bier. Und die Speisekarte.“ Der Kellner nickte und verschwand.
„Traumhafte Aussicht.“ Hinter dem Panoramafenster erblickte Ostrowsky weit unten den See und dahinter die Alpen.
„Ja, wir haben hier ein schönes Fleckchen Erde erwischt“, kommentierte Wyss stolz.
Nachdem die Getränke serviert waren und sich beide für den Niederwiler Zuchtsaibling mit Kräuterrahmsauce auf Gemüsereis entschieden hatten, übernahm Ostrowsky die Gesprächsführung.
„Um noch einmal auf das schöne Fleckchen Erde zurückzukommen, Herr Wyss. Ich will nicht lange drumherum reden: Mich interessiert diese Wiese am See. Sie wissen, welche ich meine?“
„Ich gehe davon aus, Sie meinen die 6000 Quadratmeter große Schützenmattwiese in der Nähe des Jachthafens? Das ist schwierig. Die Stadt ist sich noch nicht sicher, ob sie das Grundstück verkaufen oder als Freizeitgelände für die Bürger der Stadt ausbauen soll. Es ist jetzt schon ein beliebter Platz zum Ballspielen, Picknicken und dergleichen. Andererseits – ein Investor mit einer guten Idee, die den Zuger Einwohnern Vorteile bringt, wäre durchaus auch denkbar.“ Das Gespräch wurde vom Kellner unterbrochen, der die Speisen servierte. Um sie nicht kalt werden zu lassen, begannen beide zu essen. Nach einer Weile nahm Ostrowsky das Gespräch wieder auf. Er klaubte sich eine Gräte aus den Zähnen und spülte mit einem Schluck Bier nach.
„Meine Ideen sind gut. Was würde das Gelände kosten?“
„Wir sprechen da von gut 16 Millionen Schweizer Franken. Zug ist ein teures Pflaster und die Wiese am See ist ein Filetstück der Gemeinde. Welche gute Idee schwebt Ihnen vor?“
„Ein Wellness-Hotel. Premium Klasse.“
„Oh! Schwierig, schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das im Gemeinderat durchbekommen. Was brächte das der Zuger Bevölkerung?“
„Mehr Touristen, mehr Steuereinnahmen für andere Projekte, eine tolle Sauna- und Pool-Landschaft. Ferien zuhause – bestimmt fällt Ihnen auch noch etwas ein. Ich zahle 20 Millionen und erlasse Ihnen Ihre Spielschulden bei mir für Ihren persönlichen Einsatz in dieser Sache. Überlegen Sie gut. Andernfalls … Sie wissen, was ich meine.“
„Aber, aber, Herr Ostrowsky, wir sprechen hier nicht von Bestechung und Erpressung, oder? Das hören wir hier in der Schweiz nicht gern. Außerdem: Ich kann ja gar nichts entscheiden,“ versuchte Wyss sich herauszureden. Er war blass geworden und fühlte sich sichtlich unbehaglich.
„Ich rede von Einsatz und Erfolg, Herr Wyss, nicht von Entscheidung.“ Ostrowsky beugte sich über den Tisch in Richtung Wyss und grinste verschlagen. Die Kräuter der Sauce hatten sich in einer unregelmäßigen Reihe auf seinen Zähnen niedergelegt. „Und außerdem: Es bleibt Ihnen keine andere Wahl.“ Wyss drehte den Kopf in Richtung Fenster, um einer leichte Übelkeit Einhalt zu gebieten.
„Nun gut.“ Er zwang sich, sich wieder Ostrowsky zuzuwenden und schaute ihm in die bedrohlich blickenden dunklen Augen. „Schicken Sie mir Ihre Pläne per Mail und ich schau, was ich machen kann.“
„Das klingt doch schon besser. Darauf müssen wir anstoßen.“ Noch bevor Wyss etwas entgegnen konnte, hatte Ostrowsky schon den Kellner herbeigewinkt. „Zwei Wodka, und bringen Sie mir die Rechnung.“
Auf der Fahrt ins Tal wurden noch ein paar Belanglosigkeiten ausgetauscht, dann stieg jeder in seinen Wagen und fuhr davon. Wyss hatte seine Übelkeit nicht wirklich in den Griff bekommen. Im Gegenteil: Während der ganzen Fahrt zurück zum Baudepartement plagte sie ihn zunehmend. Er musste sich beruhigen.
„Ach, der Herr Stadtrat ist zurück vom Mittagessen“, begrüßte ihn Regula, seine Sekretärin mit vorwurfsvollem Ton.
„Guido, du weißt schon, dass in einer halben Stunde das Meeting wegen dem Bauantrag am Hirschenplatz stattfindet. Ich hab dir die Unterlagen auf den Schreibtisch gelegt. Wäre gut, du würdest nochmal reinschauen.“
„Du bist wie eine Mutter zu mir, liebe Regula. Was wär ich ohne dich?“ Wyss lächelte, was ihm nicht besonders gut gelang und ging an ihr vorbei in sein Büro. „Schiiss Bauantrag,“ murmelte er vor sich hin. „Ich hab jetzt wirklich andere Sorgen.“
Nach dem Meeting nahm Wyss seinen Parteikollegen von der FDP, Hans-Ruedi Temperli, zur Seite. „Sag, Hans-Ruedi, wie stehst du persönlich eigentlich zum Verkauf der Schützenmattwiese?“
„Ich finde es eine gute Idee, wenn der Verkauf mit einem guten Projekt verbunden ist. Du bist ja eher dagegen, wie ich dich in der letzten Gemeinderatssitzung verstanden habe. Oder?“
„Ja, das stimmt. Aber ich bin auch nicht mehr ganz sicher. Außerdem hätte ich da jemanden an der Hand, der Interesse an einem Kauf bekundet hat. Er wollte mir seine Pläne zuschicken.“
„Aha! Sag mir Bescheid, wenn du die Pläne hast. Ich würde gerne einen Blick darauf werfen, wenn das okay ist.“
„Sicher, sicher. Mach ich. Also, wir sehen uns.“
„Äh, Guido, wer ist denn der Interessent?“
„Kennst du nicht. Du wirst's erfahren, wenn du die Pläne kriegst. Sorry, aber ich muss los.“ Wyss wandte sich ab und verließ eilig den Sitzungsraum. Zurück in seinem Büro, dachte er nach.
Im Gemeinderat war man gespalten, was den Verkauf der Wiese anbelangte. Wyss ging im Kopf noch einmal die Zahlenverhältnisse durch. Eine Abstimmung hatte noch nicht stattgefunden, aber man konnte in etwa annehmen, dass die Sozialdemokraten der SP, also seine Partei, und die Grünen der ALG-CSP eher dagegen waren, die FDP und die CVP waren dafür und bei der SVP war er sich nicht ganz sicher. Der kleine grün-liberale Ableger, die glp, würde in diesem Fall wohl eher noch mit den Sozialdemokraten und den Grünen abstimmen. Der Gemeinderat setzt sich aus vierzig Mitgliedern zusammen. Also rechnete er sich folgendes Szenario aus: SP, ALG-CSP und glp könnten auf 19 Stimmen kommen, die FDP und die CVP auf 14 Stimmen. Die rechtsbürgerliche SVP käme auf 7 Stimmen.
Wenn die SVP geschlossen gegen den Verkauf der Wiese wäre, ergäbe das ein Gewicht von 26 Stimmen dagegen und nur 14 dafür. Würden sie aber geschlossen für den Verkauf stimmen, kämen die Befürworter auf 21 Stimmen und die Gegner auf 19. Also, schlussfolgerte Wyss, musste er sich um die SVP kümmern. „Mal die Lage sondieren“, brummelte er vor sich hin.
„Was willst du? Das Lager sortieren. Eine tolle Idee, Guido. Das wär schon lange mal nötig.“
„Regula, du nervst. Was gibt es?“ Wyss betrachtete seine Sekretärin, die im Türrahmen stand und frech grinste. Sie hätte sich wirklich mehr Mühe mit ihrer Kleidung geben können, befand er. Die halb durchsichtige, sommerliche, dunkelrote Bluse mit Blumenmuster hatte sie bestimmt bei diesem Kaufhaus gekauft, das alle anzieht und der viel zu enge graue Rock war auch nicht gerade Haute Couture. Zumindest wies das leicht glänzende Material auf einen billigen Stoff hin. Wenigstens hatte sie heute ihre braunen Locken einigermaßen in den Griff bekommen.
Als hätte sie seine Gedanken erraten, reichte sie ihm mit nun mürrischer Miene eine rote Mappe. „Hier sind die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung nächste Woche. Du hast ja sicher schon deine Empfehlung für die Nutzung der Schützenmattwiese formuliert. Schick sie mir, damit ich sie für die Sitzung vorbereiten kann.“ Auf dem Absatz ihres halbhohen Pumps machte sie kehrt und verschwand im Vorzimmer.
Die Empfehlung konnte er jetzt in die Tonne werfen. Sie musste total umformuliert und mit hieb- und stichfesten Argumenten versehen werden. Vor allem die Mitglieder der SVP musste er überzeugen. Aber wie? Als er zum letzten Mal mit dem Fraktionschef Philipp Tanner gesprochen hatte, klang das gar nicht nach Verkauf der Wiese. Er konnte sich noch gut an das Gespräch nach der letzten Gemeinderatssitzung erinnern:
„Du, Philipp, wart doch noch einen Moment.“ Philipp Tanner drehte sich überrascht um. „Was willst du?“ Wyss war sich bewusst darüber, dass er nicht gerade Tanners Liebling war. Der hielt ihn für einen eher windigen Typen.
„Es geht um die Schützenmattwiese. Sollte die Gemeinde selbst die Nutzung übernehmen oder das Grundstück verkaufen? Was meinst du?“
„Ich meine, durch einen Verkauf an eine Privatperson oder einen privaten Investor aus dem Ausland geht den Zugern wieder einmal ein Stück Schweizer Land verloren. Es gibt hier schon genug Firmen und reiche Ausländer, die Zug in Besitz genommen und weiter Interesse haben. Und von einem Schweizer Investor habe ich noch nichts gehört. Also eher nein. Kein Verkauf. Aber einen Plan für eine sinnvolle Nutzung der Wieseliegt ja auch noch nicht vor. Daran sollten wir arbeiten.“
„Okay. Danke für deine Einschätzung, Philipp.“ Tanner nickte jemandem zu und verabschiedete sich von Wyss. Der packte die restlichen Unterlagen zurück in seine rote Mappe und wollte ebenfalls den Sitzungssaal verlassen, als ihm sein Freund Theo Landtwing den Weg versperrte. „Was hast du denn mit dem Tanner zu besprechen?“, wollte er wissen.
„Ach, wollte nur mal hören, ob die SVP wegen der Schützenmattwiese auf unserer Seite steht.“
„Und?“
„Ja, sieht gut aus soweit. Ich glaub, die wollen nicht verkaufen.“
„Das ist ja beruhigend.“ Landtwing entspannte sich. „Dann brauchst du deine Parteikollegen ja gar nicht mehr zu bearbeiten. Dann reicht es ja auch so.“ Er grinste erfreut und schlug Wyss auf die Schulter. Landtwing war ein karrierebewusstes Mitglied der linken ALG-CSP, die sich durch den Erhalt der Wiese für die Zuger Bevölkerung mehr Stimmen für seine Partei erhofften. Landtwing seinerseits erhoffte sich einen lukrativen Posten in der Profi-Politszene.
Ja, der Theo, dachte Wyss und schaute von seinem Schreibtisch auf, den muss ich auch bedenken. Für heute hatte er allerdings genug. Es war bereits nach fünf Uhr.
„Regula. Ich mach Schluss für heute“, rief er ins Vorzimmer. „Die Empfehlung möchte ich noch einmal überarbeiten. Du kriegst sie in den nächsten Tagen.“
Seine Sekretärin hatte sich ihrerseits auch schon für den Feierabend bereit gemacht und stand mit ihrer großen Tasche und ihrem kleinen Autoschlüssel an der Tür. „Ja, tu das, Guido, aber nimm dir nicht zu lange Zeit. Ich habe auch noch anderes zu tun.“ Sie grinste provokativ. „Ciao, Guido. Schönen Feierabend.“
Wyss wollte den Kopf frei kriegen und fuhr mit seinem Wagen zum Hafen. Dort ging er zu seinem Segelboot und machte es startklar. „Meine kleine Beauty“, flüsterte er leise und strich zärtlich über das glatte Holz auf dem Deck. Er navigierte das Boot aus dem Hafen und ließ sich vom Wind auf die Mitte des Sees treiben. Ihm fiel das Gespräch mit Ostrowsky wieder ein. Traumhafte Aussicht. In der Tat. Zwischen der dunklen Wand der Rigi und dem zackigen Gipfelgrat des Pilatus erstrahlten hinter vorgelagerten Hügeln und Bergen in drei verschiedenen Farbschattierungen von Blau die noch weißen Alpengipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau. Und genau diese Kulisse würde sich vor den Augen der Gäste von Ostrowskys Hotel eröffnen. Wyss seufzte leise, drängte die Gedanken an den Russen beiseite und genoss die Ruhe, den leichten Wind und den Geruch des Sees.
Kapitel 2
Wyss stand mit seinem Wagen vor einer großen, grauen Betonmauer, in die das Tor zur Tiefgarage eingelassen war, betätigte die Fernbedienung und rangierte sein schwarzes Gefährt durch das geöffnete Tor auf seinen Stellplatz. Das moderne Haus, das seine Frau vor fünf Jahren von ihren Eltern geerbt hatte, stand in den oberen Reihen der Häuser am Zugerberg. Im Innern der Garage musste er erst einmal eine Treppe hochsteigen, bevor er die Wohnung erreichte. Er hasste es.
15 Stufen in einem engen, kalten Treppenhaus. Der ebenfalls graue Betonschacht war von grellem Neonlicht erhellt. Er fühlte sich jedes Mal wie auf einem Fluchtweg aus einem der Tunnels, die man in den Granit der Alpen gebohrt hatte oder an manchen Tagen noch schlimmer: wie in einem Grab. Das Gefühl, das aufkam, wenn man das Innere der Wohnung erreicht hatte, konnte unterschiedlicher nicht sein: Eine riesige Fensterwand öffnete den Blick auf die Altstadt, den See und weiter noch bis zum dem über Luzern thronenden Pilatus. Darüber hinaus konnte man heute wieder einen umwerfenden Sonnenuntergang betrachten, was Wyss aber alles ignorierte.
„Hoi, Guido“, rief ihm seine Frau entgegen, „schön, dass du schon da bist. Da kannst du noch mit uns zu Abend essen. Wir haben eben erst angefangen.“ Es roch gut nach italienischen Kräutern und Knoblauch.
„Einen Moment noch“, rief er zurück. „Muss nur noch schnell Hände waschen.“ Im Bad sah er sich im Spiegel an. Er wirkte noch immer angespannt. Mit ein paar Lockerungsübungen der Gesichtsmuskulatur und etwas kaltem Wasser versuchte er einen etwas gelasseneren Ausdruck zu erreichen.
„Hoi, meine Lieben.“ Er ging um den langen Holztisch und begrüßte seine Frau Patricia, seine Tochter Nadine und seinen Sohn Joel mit einem Wangenküsschen, bevor er sich auf seinen Platz setzte.
„Das schmöckt ja fein, was gibt's denn?“
„Tagliatelle alla Mamma“, scherzte Nadine, während sie ihm Nudeln und die Sauce auf den Teller schöpfte.
„Ein Glas Roten dazu?“, erkundigte sich seine Frau, die schon dabei war, ein Glas für ihren Mann zu füllen. „Mhm. Gern. Danke, Schätzchen.“ Sie prosteten sich zu und tranken einen Schluck.
Es war nicht oft in der letzten Zeit, dass er mit seiner Familie zu Abend aß. Er war fast ein wenig gerührt über ihre Freude, ihn dabei zu haben.
„Und, wie läuft es in der Schule?“ Wyss schaute vom Essen auf und blickte auf seine zwei Kinder. Nadine war 17 Jahre alt geworden, die dunklen Haare zu einem straffen Dutt hochgebunden, die braunen Augen hinter einer dickrandigen trendy Brille, hübsch, mit ein wenig Babyspeck, und eine fleißige Schülerin, die im nächsten Jahr ihre Matura machen würde. Bei Joel war er sich nicht so sicher. Er war 13, etwas klein geraten und immer zu blass, und er hatte keine Ahnung, wie es schulisch bei ihm weitergehen sollte. Für das Gymnasium hatte es bei ihm nicht gereicht und so vertrieb er seine Zeit auf der Sekundarschule, wo er entsprechend seinem Einsatz nur mäßige Noten nach Hause brachte.
„Ich hab eine Sechs in Englisch geschrieben und eine Fünfeinhalb in Geschichte.“ Nadine war schon daran gewöhnt, gute Noten bekannt zu geben. Ihr Gesicht zeigte weder Stolz noch Freude.
„Das ist doch sehr schön“, lobte Wyss seine Tochter. „Und bei dir Joel, wie sieht's aus?“
„Du wirst es nicht glauben, aber heute haben wir was Cooles in der Schule gemacht“, erzählte Joel begeistert. „Wir haben jetzt einen neuen Lehrer, der mit uns Computerunterricht macht. Ich hab ja zuerst gedacht, das würde langweilig werden, aber er hat gleich ein Projekt mit uns angefangen, wo jeder zeigen kann, was er schon drauf hat.“
„Er oder sie“, korrigierte ihn Nadine. „Ihr seid ja sicher nicht eine reine Bubenklasse, oder?“
Wyss und seine Frau schauten sich vielsagend an.
„Ich freu mich für dich, Joel. Da hast du doch Gelegenheit zu zeigen, was in dir steckt.“ Wyss klopfte Joel auf die Schulter. Heute Abend war alles gut. Sonst gab es immer irgendeinen Streit oder einer von ihnen musste gleich wieder weg. Wyss fühlte sich heute richtig wohl mit seiner Familie und war froh, dass er sie hatte.
Später am Abend, die Kinder hatten sich längst in ihren Zimmern vor ihre Laptops platziert und folgten ihren Lieblingsserien, sagte Patricia: „Es war richtig schön heut Abend. Family quality time, das haben wir nicht oft. Könnten wir das nicht häufiger hinkriegen?“
„Ja, du hast Recht, Schatz, aber du weißt ja: Die vielen Sitzungen, die meistens erst abends stattfinden, da kann ich einfach oft nicht bei euch sein.“ Er wandte ihr seinen bedauerndsten Gesichtsausdruck zu.
„Das ist mir schon klar, Guido, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn du nach den Sitzungen nicht noch ewig in Zürcher Spielcasinos versumpfen würdest. Das ist eine Sucht. Das muss dir doch auch klar sein. Du solltest unbedingt etwas dagegen unternehmen.“ Patricia schaute ihrem Mann ernst ins Gesicht. „Bevor es zu spät ist.“ Der legte seinen Arm über die Lehne des weißen Ledersofas und um die Schulter seiner Frau.
„Ich weiß, ich weiß, aber ich war jetzt schon seit gut zwei Wochen in keinem Casino mehr. Ich schwöre dir: Ich bin auf dem Weg der Besserung. Versprochen!“ Und um dem Gesagten noch mehr Ausdruck zu verleihen, küsste Wyss seine Frau zärtlich auf die Lippen. Was er sich jedoch nicht zu sagen getraute, war, dass sich seine Spielschulden ins Astronomische gesteigert hatten und er sich im Casino nicht mehr blicken lassen konnte. Ostrowskys Angebot war seine einzige Chance.
Als Wyss ins Schlafzimmer kam, lag Patricia mit einem durchsichtigen Etwas von einem Nachthemd, zurückgeschlagener Decke und leicht gespreizten Beinen auf dem Bett. Das Hemd war so weit hochgeschoben, dass er ihre rötlichen Schamlöckchen und die rosaroten Lippen sehen konnte. Während er sich in diesen Anblick vertiefte, spürte er, wie es in seiner Hose eng wurde. Er öffnete sie, ließ sie zu Boden gleiten, nahm sie von dort auf und warf das gute italienische Designerstück achtlos in die Zimmerecke. Ohne die Augen von Patricias Körper zu wenden, knöpfte er langsam sein Hemd auf, warf es ebenfalls in die Ecke und entledigte sich schließlich seiner restlichen Wäsche. Er neigte sich zu Patricia hinunter und flüsterte ihr ins Ohr: “Bleib so, wie du bist, bis ich aus dem Bad zurückkomme.“ „Ja, wie du willst“, hauchte sie zurück. Sie war von seinen Worten noch mehr in Stimmung geraten. Als er aus dem Bad zurückkam, dimmte er das Licht, bis das Zimmer nur noch spärlich erleuchtet war. „Zieh dein Hemd aus und zeig mir deine Brüste.“ Wyss stand immer noch vor dem Bett und wartete darauf, seine Frau ganz nackt vor sich ausgebreitet zu sehen. Dann legte er sich über sie und ließ sein Glied ohne weiteres Vorspiel ganz langsam in ihre feuchte Scheide gleiten. Er erhöhte nach und nach die Frequenz, bis sie seine Stöße immer schneller und härter in ihrem Körper spürte. Dann brach er plötzlich ab, legte sich neben sie und wies sie an, sich auf ihn zu setzen und ihn zu Ende zu reiten. Er wusste, dass sie das mochte, weil sie dann die Bewegungen so gestalten konnte, dass sie beide gleichzeitig kamen.
Sichtlich besser gelaunt, betrat Wyss am nächsten Morgen in seinem hellen Leinenanzug und dem lichtblauen Hemd mit dem winzigen bunten Muster sein Amtszimmer und machte sich gleich an die Arbeit. Zu seiner Erleichterung war sein Büro so gut wie papierlos. Er musste also seinen Schreibtisch nicht mit Aktenordnern zumüllen und wichtiger noch: Er brauchte Regula nicht ins Archiv zu schicken, um ihm die Ordner zu bringen, die seine Argumente für den Verkauf der Wiese beinhalten sollten. Sicher wäre sie neugierig geworden und hätte Auskünfte erwartet, die er ihr nicht geben wollte. Rechtfertigungen hatte er sich noch keine zurechtgelegt. Er hatte sie lediglich darüber informiert, dass die Empfehlung erst morgen auf ihrem Tisch liegen würde.
Es war ruhig im Amt heute. Nur selten überquerte jemand den Flur. Und selbst dann schluckte der blau-grau gemusterte Teppichfußboden jegliches Geräusch. Hin und wieder hörte man jemanden ein Telefonat erledigen und das leise Klappern der PC-Tastaturen erzeugte die beruhigende Gewissheit, dass alle brav ihre Arbeit machten. Wyss gönnte sich einen Cappuccino aus seiner privaten Kaffeemaschine und ging dann die Daten durch. Bis Mittag hatte er eine Strategie entwickelt und später wollte er das Konzept formulieren. Da war er ungestört. Regula hatte sich gottlob wegen eines Arzttermins den Nachmittag freigenommen. Er fuhr seinen Computer herunter und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Paradiso, einem italienischen Restaurant in der Innenstadt. Umrahmt von vierstöckigen Betonblocks hatte der Inhaber des Paradiso auf dem kleinen asphaltierten Innenhof einen von rund geschnittenen Buchsbaumsträuchern in braunen Blumentöpfen abgetrennten Außensitzplatz kreiert, der wohl den Paradiesgarten simulieren sollte. Vor der Sonne, die sich in der Mittagszeit sogar bis zu diesem Ort vorarbeiten konnte, schützte eine braun-weiß gestreifte Markise. Dort hatte er sich mit Alfredo Bertschi, einem Segelkollegen und SVP-Gemeinderat, verabredet. Er wollte doch gerne noch erfahren, was die SVP-Leute einen 'guten Plan' für die Wiese nannten. Ihm schien, der Tanner hatte da durchaus schon Ideen entwickelt.
Bertschi saß bereits an einem der Tische im Hof und studierte das Mittagsmenü. Obwohl man ihn Alfredo nannte, war er keineswegs ein Italiener. Sein kräftiges braunes Haar, das gesunde, kantige Gesicht, nordisch blaue Augen sowie der klassische blaue Anzug mit weißem Hemd und die konventionellen schwarzen Lederschuhe ließen eher auf einen soliden Urschweizer tippen. Schwyz oder Uri vielleicht.
„Hoi, Alfredo. Wie geht's? Hast du schon was ausgesucht?“, fragte Wyss und deutete auf die Karte, die Bertschi in der Hand hielt.
„Hoi, Guido. Mir geht's super, danke. Setz dich. Ich hab schon zwei Gläser Pinot Grigio bestellt. Also ich nehme die Piccata di Vitello mit Tomatenspaghetti und einen Salat.“ Er reichte Wyss, der gegenüber Platz genommen hatte, die Karte.
„Und, warst du schon oft auf dem See in diesem Jahr?“, wollte Bertschi wissen.
„Viel Gelegenheit hatte ich noch nicht, aber ein halbes Dutzend Mal waren es schon. Und du?“
Bertschi überlegte und zählte dann an den Fingern neun ab. Wyss schaute ihn beeindruckt an.
„Ich nehme das Gleiche“, beschloss Wyss und legte die Speisekarte weg.
Während des Essens erhielt Wyss einige Informationen, die ihm gefielen. Er konnte also am Nachmittag sein Konzept beruhigt fertigstellen und abends noch die Empfehlung daraus stricken. Gut gelaunt ging er zurück in sein Büro. Unterwegs klingelte sein Handy.
Kapitel 3
Tabea Stocker betrachtete ihre rot lackierten Zehennägel, die fast kunstvoll mit den weißen Spitzen der Berge kontrastierten, die sich über dem spiegelglatten See erhoben. Sie lag ausgestreckt in ihrem blauen Bikini auf ihrem gelben Handtuch auf der Wiese beim Badeplatz Brüggli am Zugersee und fühlte sich total entspannt. Ein Gefühl, dass sie lange nicht mehr erlebt hatte. Bis vor einem Monat hatte sie bei der Polizei in Zürich gearbeitet. Dort gab es für sie praktisch nur Drecksarbeit zu erledigen. Kleinkriminelle in dunklen Seitengassen aufspüren, Drogenumschlagplätze beobachten, Schlägereien entschärfen, manchmal ging es auch um illegale Prostitution – alles Delikte, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte und mit deren Aufklärung man keinen Blumentopf gewinnen konnte. Von den Kleinkriminellen wurde man beleidigt, bespuckt, manchmal sogar verprügelt, an die großen Fische kam man sowieso nicht ran und in der Dienststelle nahm man ihre Bemühungen kaum wahr. Da gab es immer etwas Wichtigeres. Sie hatte diesen Sumpf so satt. Sie näherte sich der vierzig und wollte sich nicht länger demütigen lassen. Und wenn sie sich schon nicht beweisen durfte, dann wollte sie wenigstens ihre Ruhe haben. Deshalb war sie nach Zug gegangen. Ein Zufall eigentlich. Und ein Aufstieg gewissermaßen. Man hatte sie als Oberleutnant bei der Kriminalpolizei angestellt, um einen Kollegen zu ersetzen, der unerwartet nach Kanada ausgewandert war. Jackpot!
Heute war sie gleich nach Dienstschluss an den See gefahren, um sich abzukühlen. Es war ein anstrengender und sehr heißer Tag gewesen. Gegen Mittag war eine Vermisstenanzeige eingegangen, um die sie sich hatte kümmern müssen. Eigentlich wartete die Polizei erst einmal 24 Stunden, bevor man aktiv wurde, aber in diesem Fall war der Vermisste ein stadtbekannter Politiker und außerdem erreichte sie am frühen Nachmittag die Meldung der Wasserschutzpolizei, dass ein Segelboot ohne Besatzung auf dem Zugersee herumdümpelte. Möglicherweise das des Vermissten. Es gab also jede Menge Arbeit. Schließlich schickte man einen Trupp Taucher los, um den Mann zu suchen. Für sie war jetzt erst einmal Feierabend.
„Emily, chumm öppis go trinke. S' Mami het e feins Säftli.“
„Ja, ich chumme, Mami.“
„Weisch, Claudia, 's Emily trinkt z' wenig. Do muess i scho hinterher si.“
„Yannis, chasch ruhig scho ins Wasser go. Hesch jo d' Schwümmflügeli scho a,“ zwitscherte die andere Mami fröhlich.
„Isch guet, Mami,“ erwiderte das Büebli ebenfalls gut gelaunt vom Seeufer her.
Solche Flötentöne und das dumpfe Geräusch vom Beachvolleyballfeld beim Aufschlagen des Balls, wo man sich freundschaftlich einen Match gab, war der Soundtrack, der Tabea Stocker in ein friedliches Dösen versetzte. Entspannender als Yoga und weniger anstrengend, dachte sie erfreut bei sich. Zug war die richtige Entscheidung gewesen. Obwohl: ein bisschen sehr 'heile Welt' war das schon. Fast irreal. Träumte sie etwa schon? Oder war sie womöglich schon tot und aus einer Laune des lieben Gottes heraus im Paradies gelandet?
Sie musste tatsächlich eingeschlafen sein, denn sie wurde durch hysterische Schreie unsanft geweckt. Als sie schlagartig ihre Augen öffnete, bemerkte sie Unruhe um sich herum und sah, wie die Leute mit Kind und Kegel ans östliche Seeufer eilten und auf ein paar Stand-up-Paddler starrten, die zu den Leuten herüberriefen: „Jetzt holt schon die Polizei! Er ist wirklich tot! S' isch gruusig!!“ Wieder ging eine Schockwelle von hohen Tönen durch die kleine Gruppe am Ufer, bevor einige versuchten, die Situation organisatorisch in den Griff zu kriegen.
Na also, geht doch. Doch nicht so harmlos, dachte sich Stocker und richtete sich langsam auf. Sie klemmte sich ihr halblanges braunes Haar mit einer Spange am Hinterkopf fest, streifte sich ihr bunt gemustertes Strandkleid über und schlüpfte in ihre Flipflops. Dann fischte sie aus ihrer Tasche ihren Polizeiausweis und das Natel und schritt zielstrebig zu der aufgeregten Gruppe hin.
„Was ist hier los? Wer ruft nach der Polizei?“ Jahre der Erfahrung, in welchem Ton man mit aufgeregten Menschen reden musste, verhalfen Tabea Stocker dazu, dass sich plötzlich alle umdrehten und ruhig waren. Verblüfft sahen sie die schlanke Badenixe an. Was wollte denn die und wer war die überhaupt? Schließlich antwortete einer der 'Organisatoren', ein äußerst gutaussehender, sonnengebräunter Beachvolleyballspieler: „Die Paddler dort drüben sagen, die Taucher hätten eine Leiche aus dem Wasser gefischt. Ich rufe jetzt die Polizei und den Krankenwagen.“ Stocker betrachtete ihn beeindruckt. Er wollte gerade die Nummer in sein Telefon tippen, als sie sich zu Wort meldete:
„Ich bin die Polizei.“ Stocker zeigte ihren Dienstausweis. „Ich werde die Kollegen benachrichtigen. Vielen Dank!“
„Okay!“ Der attraktive Beachvolleyballspieler schaute etwas enttäuscht. Fast hätte Stocker ihm zum Trost über seine muskulösen Oberarme gestreichelt. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Stattdessen zog sie ihr Strandkleid über den Kopf und gab den Blick frei auf ihren durchtrainierten, wohlgeformten Körper. Achtlos ließ sie das Kleid zu Boden fallen, alarmierte ihre Kollegen, vertraute dann dem Beachvolleyballspieler ihr Natel zur Aufbewahrung an, schlüpfte aus den Flip-Flops, klemmte ihre Ausweiskarte in die Bikini-Hose und stieg schließlich vor der jetzt schockstarren Zuschauergruppe ins Wasser.
Jetzt erst sah sie die ganze Szenerie: Rund um die zwei Stand-up-Paddler schwamm eine ganze Klasse von Tauchschülern, die wie eine Schar Robben wirkte. Die Gruppe kam daher wie eine Armada auf der Heimkehr von einem erfolgreichen Feldzug. Die 'Beute' lag ausgestreckt auf einem der SUP-Bretter, wo sie vorsichtig von einer kräftigen jungen Frau im Badeanzug über das Wasser bewegt wurde. Dahinter folgte der zweite Paddler. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt. Die Stocker hatte sie schon fast erreicht und rief ihnen zu, sich nicht weiter dem Ufer zu nähern. Zu viele Neugierige. Die Kollegen würden gleich kommen. Trotzdem waren einige neugierige Gummibootkapitäne und Luftmatratzensurfer schon recht nahe gekommen. „Zurück, aber subito!“, wies sie die Strandbesucher in dem Ton an, den sie sich im Umgang mit Kleinkriminellen angeeignet hatte. Sie erntete ein empörtes Murren, aber außer einem angetrunkenen Spätjugendlichen, der meinte, sich von ihr nichts sagen lassen zu müssen, drehten alle ab. Ein Wink mit dem Polizeiausweis ließ aber auch ihn rasch wenden. Dann wandte sich Tabea Stocker wieder der Stand-up-Paddlerin mit der Leiche zu. Sie mussten warten, bis die Spurensicherung und die Forensiker kamen. Auf den ersten Blick konnte sie lediglich einen Mann mittleren Alters in dunkelblauem Poloshirt und beiger Khakihose feststellen. Er war barfuß. Sein Gesicht blass und schon etwas aufgedunsen. Er starrte sie mit offenen Augen an.





























