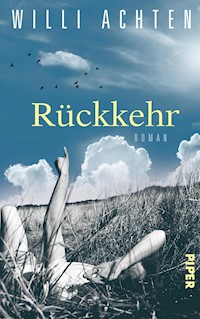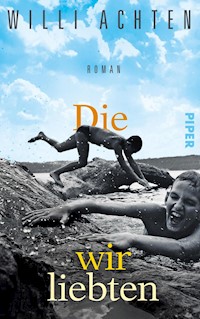
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Brüder, die 70er und ein Heim, in dem das dunkle Deutschland überdauert Die Siebziger in der westdeutschen Provinz. Ein Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Für Edgar und seinen Bruder Roman ist das Leben überschaubar und gut. Bis sich ihr Vater am Maifest in die Tierärztin verliebt und die Familie verlässt. Die Mutter zieht sich immer mehr in ihren Lotto-Laden zurück. Die Jungen sind bald sich selbst überlassen. Schließlich steht das Jugendamt vor der Tür, um Edgar und Roman in den Gnadenhof zu holen. Ein Heim, in dem die Methoden der Nazis fortbestehen. In glühenden Bildern erzählt Willi Achten von einem spannungsvollen Jahrzehnt, dem unauflösbaren Band zwischen Geschwistern und vom Aufbruch einer Generation, die dem dunklen Erbe ihrer Eltern mit aller Entschiedenheit entgegentritt. »Ein spannender Entwicklungsroman und ein Soziogramm der 70er. Willi Achten schreibt Szenen, die man nicht mehr vergisst. Diese beiden Brüder werden die Leser lange begleiten.« – Sylvie Schenk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Das Motto des Romans entstammt dem Gedicht »Vom Verschwinden meiner Schwester im Alter von 3 Jahren, 1965« von John Burnside aus dem Band »Anweisungen für eine Himmelsbestattung«. Carl Hanser Verlag München, 2016
Die Arbeit des Autors wurde gefördert von der Stiftung Literatur – begründet von Dieter Lattmann.
www.stiftung-literatur.de
© Piper Verlag GmbH, München, 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Vizerskaya / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Teil 1
1971–1972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Teil 2
1973–1975
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Teil 3
1975–1976
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
Dank
Nachweise
Zitiert wurde aus
Literatur
Den Soundtrack zu »Die wir liebten« finden Sie hier:
Widmung
»Vielleicht erkennen wir erst im Rückblick, dass wir alle Voraussetzungen für das Glück hatten.«
John Burnside
Teil 1
1971–1972
1
Das Unglück meines Bruders begann in der sechsten Klasse. Sein Unglück war auch mein Unglück. Alles fing an, weil Roman mutiger war als ich. Eine Tugend kann ein Verhängnis sein. Das ahnten wir damals nicht.
Roman riss die Tür auf, flog durch die Reihen, warf sich auf seinen Stuhl und keuchte, als hätte er einen langen Lauf absolviert. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, schaute zur Tür. Ich sah, wie blass er war. Dann hörten wir es. Das Tack-Tack des Gehstocks auf der Treppe, die von den Privaträumen Honolds runter zu den Klassenzimmern führte, das Schleifen des Schuhs über die gebohnerten Holzdielen im Flur, das schwere Atmen. Schließlich rochen wir den Zigarrengeruch, der ihn umflorte wie ein immerwährendes, schales Parfum und ihm vorauseilte, bevor er das Klassenzimmer betrat, in dem wir uns zum Silentium trafen – Schüler der Klasse 4 der Volksschule und wir, die wir schon das Gymnasium in der Kreisstadt besuchten und zweimal wöchentlich zur Nachhilfe kamen, damit wir nicht jämmerlich scheiterten, fern des Dorfs und der Obhut unseres ehemaligen Rektors. Honold war hager und groß, und sein Kopf leuchtete wie die Boje, die man vor ein paar Tagen im See befestigt hatte. Er stelzte zum Pult, stellte seinen Gehstock ab, nahm den Rohrstock und schlug sich damit in die offene Hand, dass es klatschte.
»Wer?«, fragte Honold leise. Auf der Handfläche furchten sich die Striemen in die Haut.
»Wer hat es getan?« Er blickte über uns hinweg zum Fenster hinaus, als ließe sich dort die Antwort finden. Dann legte er den Rohrstock aufs Pult, ergriff seinen Gehstock und setzte sich in Bewegung. Sein krankes Bein mit dem stumpfen Fuß zog er nach. Es mutete weich und fladderig an. Niemand von uns hatte es je gesehen. Knöchel und Wade hielt er mit einem Strumpf bekleidet. Nie trug Honold Sandalen, auch im Sommer nicht. Selbst wenn er sich am Pult niederließ und das Hosenbein nach oben rutschte, der Strumpf verdeckte alles. Keiner von uns schien sich an den Anblick des seltsam leeren Hosenbeins gewöhnt zu haben. Unsere Blicke blieben daran hängen, fanden nicht mehr zurück zur Tafel oder zu seinem Mund, aus dem die Kopfrechenaufgaben, Multiplikationen und Divisionen, in die Klasse schwirrten. Nur wenn sich einer von uns auf seinen Schoß setzen musste, weil er eine Aufgabe glänzend gelöst hatte, oder übers Knie gelegt wurde und Prügel bezog, kamen wir dem Bein nahe. Mehr als die Schläge selbst fürchteten wir nur, es zu fühlen, das nie gesehene, schlaksige Bein. War es aus Holz? Bestand es aus einem gummiartigen Material, das ihm Form und Konsistenz verlieh, hart und nachgiebig zugleich? Jeder, der übers Knie gelegt wurde, wollte und musste eine Einschätzung geben. Gerüchte waren im Umlauf. Es sei ihm im Krieg abgeschossen worden. Andere wiederum hatten vom Knochenfraß gehört, einer Krankheit, die einen über Nacht befallen konnte und die das Bein Stück für Stück aufzehrte, wie ein gefräßiger Marder.
Schlimmer als alle Vorstellungen bezüglich Substanz und Ursache der Verletzung und des Verlusts war der Gedanke, es eines Tages tatsächlich berühren zu müssen. Das wollte keiner. Selbst mein Bruder nicht. Ja, noch die Aussicht, es ohne den Blickschutz der Hose und des Strumpfes sehen zu müssen, schreckte uns. Unvorstellbar, den Rektor im Schwimmbad in der Badehose anzutreffen.
»Wer?«, zischte der Rektor. »Wer von euch?«
Er hatte den ersten Tisch erreicht. Verharrte, schaute die beiden Mädchen an, die sich duckten. Nie würde eines der Mädchen aus der ersten Reihe so etwas tun. Etwas, von dem wir nichts Näheres wussten, das aber in der Welt sein musste. Etwas, das Honold so über alle Maßen in die Wut trieb. Etwas, das Roman angerichtet haben konnte. Wer sonst?
Auch ich duckte mich jetzt, hielt den Blick auf die braunen, unterschiedlich hohen Schuhe gesenkt. Der Schuh, in dem das kranke Bein steckte, reichte über den Knöchel hinaus, glich einem Schlittschuh, freilich ohne die Kufen. Ich hielt den Rücken gekrümmt, senkte den Kopf, hörte das Aufsetzen des Stocks und das Schleifen auf dem Parkettboden. Tisch für Tisch lief Honold die Reihen ab, schaute jedem ins Gesicht, musterte uns, ob sich nicht einer verriet durch rote Flecken am Hals, durch hastiges Atmen, das die Not ahnen ließ, entdeckt und überführt zu werden. Ich hörte Roman atmen, ich sah den Schweiß auf seinen Tisch tropfen. Er saß aufrecht da, schien Honold wie selbstverständlich zu erwarten, der uns gleich erreicht haben würde, in einigen wenigen Augenblicken, die uns noch blieben, bis er so unerträglich vor uns stehen würde wie ein bissiger, zähnefletschender Hund, der ansetzt zum Sprung. Mein Bruder war verrückt. Er hätte sich ducken müssen wie alle anderen, nichts und niemand würde ihn retten können, wenn Honold es zum Äußersten kommen ließ, der Schritt für Schritt auf uns zu kam, bis er, nachdem die Zeit sich noch einmal streckte, Herzschlag um Herzschlag, Atemzug um Atemzug, in der angstsatten Luft vor uns stand und das leere Hosenbein nachflatterte, während das andere unbewegt und starr am Rand des Tisches stand. Ich wagte nicht aufzuschauen.
»Warst du das?«, bellte die Stimme des Rektors. Du konnte nur mein Bruder sein. Oder glaubte der Rektor gar, dass ich … Ich doch nicht. Ich nie!
»Sag die Wahrheit!« Noch war die Stimme gezügelt. Aus den Augenwinkeln sah ich, Roman schaute ihn an und sagte kein Wort. Sein Blick war in wutenge Schlitze versenkt. Wie ein stiller Mönch in die Weite schaut, so schaute mein Bruder in die gelben Wolfsaugen des Rektors. Plötzlich klatschte der Stock auf unseren Tisch, einmal, zweimal, dann rührte er mit der Spitze in den Schweißtropfen meines Bruders, die die Tischplatte sprenkelten. Schließlich packte Honold meinen Bruder am Ohr, riss ihn vom Stuhl und zerrte ihn zum Pult. Er setzte sich, legte Roman übers Knie, und der Stock fuhr in die Höhe, um gleich auf ihn niederzujagen wie ein Falke, der aus großer Höhe auf sein Opfer stürzt.
»War zu spät, komm von zu Haus, musste rennen, deshalb schwitze ich«, sagte mein Bruder mit fester Stimme, und der Stock verharrte über seinem Hintern.
Der Rektor stellte Roman zurück auf die Füße. Über Romans Gesicht huschte ein Lächeln. In Honolds Gesicht kochte die Wut. Die Haut hatte sich aufgeworfen, wirkte faltiger als sonst. Er stieß Roman zurück zu uns, und mein Bruder ging ab wie von einer Bühne. Sein Schritt war bestimmt, ich las keine Angst in seinen Augen, er nahm Platz, kniff mir ein Auge. Roman strich sich über die Stirn, die nun trocken war, nur das Haar glänzte feucht. Er hatte rotes Haar, ein dunkles Tizianrot, es stand ihm gut, und seine Haut war nicht die blasse, sonnenängstliche Haut anderer Rothaariger, sondern wurde im Sommer kastanienbraun.
Honold schien noch nicht genug zu haben. Wer genau hinschaute, sah, dass die Wut nicht erloschen war, sondern ungebrochen aus seinen Augen starrte. Wo Füße angstvoll scharrten, ein Gesicht aufflammte, an einem Fingernagel gekaut oder die Haut am Nagelrand abgeknibbelt wurde, verbiss sich sein Blick, zerrte er immerzu an seinem Opfer und verlangte nach einer Antwort: »Wer? Wer war das? Redet!«
Niemand sagte etwas, selbst der Ängstlichste nicht. Unser Schweigen zog teigig durch den Raum, es hatte etwas Physisches bekommen. Die Uhr tickte. Keiner rührte sich, kein Finger streckte sich in die Höhe. Ich sah das gesunde Bein des Rektors einen Schritt tun. Das andere folgte ihm in die Schlacht, zu Theo und Stefan in der zweiten Reihe, sie traf das betäubende, schmerzende Schreien des Rektors. Auf die beiden hatte er es schon immer abgesehen. Zweimal waren sie bereits sitzen geblieben, und er drohte ihnen mit der Hilfsschule oder mit dem Heim, dem Gnadenhof, der ein paar Kilometer entfernt am Rand des nächsten Dorfes lag. Ihr Vater war ein Flüchtling aus dem Osten, der hier bei uns im Dorf nach dem Krieg ein neues Leben angefangen hatte, wie Mutter sagte. Es gab vor dem Krieg, und es gab nach dem Krieg. Anders ließen sich die Zeit und das Leben nicht einteilen. Das Davor klang wehmütig und das Danach erleichtert. Bitter schmeckte allein im Krieg. Dann senkte sich die Stimme.
Honolds Gedonnere schlug in Theos und Stefans Ohren, dass ihre Körper zur Seite knickten. Ins Heim gehöre, wer sich nicht an die Regeln halte. Ein Anruf von ihm genüge. Dort würde man uns die Flötentöne schon noch beibringen. Honold kippte auf sie zu, gebadet in seinem Toben, ein Krieger, plötzlich nicht mehr kreuzalt, sondern fast jung. Bevor er mit dem Oberkörper auf dem Tisch aufschlug und von dort in die Stuhlreihe rauschen würde, riss er sich hoch, schwankte, bebte in allen Knochen und hetzte zum Nachbartisch. Er stürzte von Tisch zu Tisch – und niemand, der ihm eine Antwort auf seine Frage gab, niemand, der endlich das befreiende, uns alle befreiende Ich sagte oder es flüsterte oder es nur nickte. Niemand, auch ich nicht, sagte Ich. Und nun schoss seine Wut an unseren Tisch zurück, sie schien sich gerade bei uns noch einmal zu verdoppeln, vielleicht weil mein Bruder ihn so unverwandt anschaute, seinen Blick direkt in das Geschrei hielt.
Ein einziges Mal nahm er den Blick fort, schaute mich an und musste die Tränen, die winzigen Tränen in meinen Augen gesehen haben, und schließlich wird er das Rinnsal bemerkt haben zu meinen Füßen, vielleicht auch nur den Geruch, denn als Honold verstummte und die Nase rümpfte und ein hauchfeines Grinsen wie eine sehr dünne Maske sich auf seinem Gesicht einfand, stand mein Bruder auf, langsam, mit Bedacht, und in seinem Rücken fand ich Schutz. Es war der Rücken eines Zwölfjährigen, aber es war ein Rücken, und Honolds Kopf verschwand aus meinem Sichtfeld. Der gesunde Fuß machte einen Schritt zurück. Von meinem Platz blickte ich auf den schürfrauen Parkettboden, auf dem das versehrte Bein und der versehrte Fuß Position behielten, und genau dort, auf Höhe des Schienbeins, traf ihn der Tritt meines Bruders.
Alle sahen es und hörten das trockene, spleißende Geräusch, das keinesfalls von splitterndem Holz herrühren konnte. Kein Holzbein also, schoss es mir durch den Kopf. Der Rektor taumelte, aber er fiel nicht. Er wankte in den Schultern, ein Zittern durchfuhr seinen Körper. Alle Farbe floss aus seinem Gesicht ab, wie ein wasserlöslicher Anstrich bei einem Regenschauer von der Mauer rinnt, und darunter deckte sich die Blässe auf, die von der Nase zum Mund und über die Wangen zu den Ohren kroch. Die Zeit stand still.
Roman ließ den Stuhl zur Seite kippen und ging an Honold vorbei. Alle Augen folgten ihm, sprangen dann zum Rektor zurück, der das gesunde Bein an sich zog und meinem Bruder folgen wollte. Das andere Bein jedoch blieb, wo es war, rührte sich nicht. Allein in der Hüfte war eine Bewegung auszumachen. Er nahm seine Hände zu Hilfe, rüttelte an seinem Oberschenkel, stellte das Bein bei und wollte die Verfolgung meines Bruders aufnehmen, der bereits am Pult stand, ihn anschaute, ruhig, ohne Häme, ohne Angst. Honold machte einen Schritt und ruckte das Bein nach, das am Schienbein einknickte. Stumm schleifte er es Dezimeter um Dezimeter in Romans Richtung, der auf ihn zu warten schien. In den Tischreihen war es still, wie es stiller nicht hätte sein können und nie gewesen war. Nur das Schleifen war zu hören. Ich sah den Nacken des Rektors, schweißnass, ich sah seinen gekrümmten Rücken, hörte das mühselige Atmen. Erst als er meinen Bruder fast erreicht hatte, drehte Honold sich um und schaute mich an, als brauche er meinen Blick, um zu tun, was aus seiner Sicht zu tun war.
Er nahm auf seinem Stuhl Platz. Roman legte sich über sein Knie und ließ die Stockschläge über sich ergehen. Einige wenige, kraftlose, wäre es nicht absurd gewesen, hätte man meinen können, behutsame, zärtliche Schläge, und ich glaubte, Tränen in Honolds Augen aufschimmern zu sehen.
2
Auf dem Heimweg drängte ich Roman zu erzählen, ob er und was er getan hatte, oben in den Privaträumen des Rektors. Da war meine Hose schon getrocknet. Doch er schwieg, und die Art, wie er schwieg, verriet mir, dass er das, was er nicht aussprach, wirklich getan hatte. Er schritt stur vor sich hin durch die von Birken gesäumte Allee, verzog keine Miene. Eine Lightning vom nahen britischen Militärflughafen schoss durch die Wolkendecke. Ein Knall ließ den Himmel und den Ort erbeben, als das Flugzeug die Schallmauer durchbrach. Wir rissen die Hände zum Kopf, aber zu spät, der Knall fuhr uns in die Ohren, dass ein hohes Sirren sie füllte und die Trommelfelle schmerzten. Für einige Minuten würde ein Rauschen bleiben und sich dann verflüchtigen. Ich war geräuschempfindlich, immer schon. Wenn die Welt mich treffen wollte, war es Lärm, der mir zusetzte und auf meinen Nerven ritt. Solche Flugmanöver waren keine Seltenheit. Ohne Vorwarnung fielen sie über das Dorf her, am Tag wie in der Nacht. Verhandlungen mit den Briten waren aussichtslos. Es war Kalter Krieg, man musste Opfer bringen. Die Orte entlang der deutsch-niederländischen Grenze, in denen die Royal Air Force Germany seit Mitte der Fünfziger ihr Quartier aufgeschlagen hatte, opferten Schlaf und Gehör.
»Sag schon«, hörte ich mich wie unter Wasser sagen. »Was hast du getan?«
Mein Bruder blieb stehen, rieb sich über den Bauch, als sei der Knall auch dort eingedrungen und müsse fortmassiert werden. Er wandte sich um, schaute mich an und setzte sich auf das Gartenmäuerchen des Pastorats. Von einem Zierbusch brach er einen Zweig ab und rührte damit über das Kopfsteinpflaster.
»Sag«, legte ich nach. Würde ich ihn lange genug bedrängen, würde er reden und ich ihn noch mehr bewundern, als ich es ohnehin tat. Denn in jeder Beziehung ist einer der Stärkere und einer derjenige, der mehr liebt.
Roman sprach leise und mit belegter Stimme. »Vögel«, sagte er. »In einem Käfig. Sahen schäbig aus, ein kleiner und ein großer, und der Große pickte den Kleinen. Sein Kopf war ganz kahl und blutete. Hab sie freigelassen. Sind ins Wohnzimmer geflogen. Dann hab ich die Fenster geöffnet.«
Roman zerbrach den Zweig und stand auf. Jeder wusste von Honolds Liebe zu seinen Vögeln. Manchmal hatte er sie mit in den Unterricht gebracht und ins Fenster gestellt. Es wurde immer sehr still in der Klasse, alle schauten zum Käfig, und bisweilen sangen die Vögel. Dann legte sich ein Zauber über die Andacht im Raum, und die Augen des Rektors glänzten. Wenn er später den Käfig mit einem Tuch bedeckte und zum Unterricht zurückfand, war er sanft, als seien der Gesang der Vögel und die Stille in der Klasse ein Liebesbeweis, der ihm galt.
Wir erreichten die Metzgerei, die Luft roch nach gebratenem Hackfleisch. Der orangefarbene VW Bus des Metzgers stand mit offener Heckklappe am Straßenrand. Wir starrten ins Wageninnere. Auf eine Plastikfolie gebettet lag ein Ferkel mit blasser, borstenfreier Haut und aufgeschnittenem Bauch. Die Bauchhöhle war mit Kartoffelstreifen, Rosmarinzweigen und Zwiebelringen gefüllt sowie mit ein paar Knoblauchzehen. Niemals hätte ich in das gräuliche Fleisch greifen und es aufklappen können, um die Zutaten hineinzulegen. Das Tier sah nicht wirklich tot aus. Ihm haftete noch der typische Ferkelgeruch an, seine Augen glänzten, die Haut wirkte feucht. In seinem Maul ein Strauß Petersilie, als müsste der Tod garniert werden.
Vielleicht wollte ich es meinem Bruder ein wenig gleichtun. Vielleicht wollte ich ihm zeigen, dass das, was passiert war, die Angst, die mich in die Hose hatte pinkeln lassen, eine Ausnahme, ein einmaliges Missgeschick war. Ich tat, was ich glaubte, tun zu müssen: etwas Widerspenstiges, Mutiges. Roman war immer mutig. Er hatte etwas von Robin Hood. Ein Poster von ihm hing an der Decke über seinem Bett, und er konnte ganze Abende dort liegen, eine Kassette abspielen und den Geschichten um Robin Hood lauschen, während er zur Zimmerdecke hochschaute in das wild entschlossene Gesicht, dessen Züge der dunkle Bart nicht verdüsterte, sondern adelte.
Ich zupfte mit spitzen Fingern die Petersilie aus dem Maul des Ferkels, nahm den Schraubenzieher, der neben einem Stahlspieß auf der ausgebreiteten Folie im Wagen lag, und steckte den Schraubenzieher hinein. Es gab dem Tier etwas Geschändetes. Roman grinste, dann erstarb das Grinsen, und ich ahnte, warum. In meinem Rücken hörte ich ein Pfeifen. So pfiff nur einer: Metzger Trinkhoff. Wenn wir auf dem Heimweg von der Schule an seinem Laden vorbeikamen, konnte man ihn oft pfeifen hören. Eine helle, beschwingte Melodie. Tauchte er dann im Hof auf, mit blutiger Schürze und blau-weiß gestreiftem Schiffchen auf dem Kopf, und machte sich daran, eines der an Haken hängenden Schweine zu zerlegen, dann passte sein hageres Gesicht mit den schmalen Lippen und den gequält dreinblickenden Augen unter den kräftigen Brauen nicht zu diesem Lied.
Erschrocken trat ich zur Seite und öffnete damit für den Metzger die Sicht auf das Ferkel. Hein Trinkhoff galt als jähzornig. Wenn eine Sau beim Töten nicht spurte und Faxen machte, rammte er dem Tier schon mal das Messer in den Hals oder spaltete seinen Schädel mit der Axt. Diesmal blieb die Wut aus. Er lehnte sich in den Wagen, entfernte den Schraubenzieher und hielt uns den Stahlspieß unter die Augen.
»Den hättet ihr nehmen sollen«, sagte er. »Wenn ihr schon da seid, könnt ihr mir auch helfen.«
Ihm helfen? Wobei? Er nahm das Ferkel und wuchtete es zur Heckklappe hin. Der Kopf ragte ein Stück über die Stoßstange hinaus.
»Festhalten«, sagte er. Wir stutzten. »Haltet es fest. Einer am Kopf, einer am Hintern, oder seid ihr blöd?«
Wir schauten uns an. Trinkhoff war ein anderes Kaliber als der Rektor. Mein Bruder bückte sich und legte seine Hände auf die Hinterläufe, mir blieb, den Kopf zu halten. Der Anblick der bläulichen Augen, in denen der Widerschein des Sonnenlichts lebendig funkelte, erschreckte mich. Ich zwang meine Hand auf die kalte Haut. Ein Geruch schlug mir entgegen, wie ich ihn von Schinkenwurst kannte, nicht länger der Ferkelgeruch. Ein kalter Fleischgeruch, nicht salzig, ein wenig sauer, nicht herb, eine leicht bittere Süße. Trinkhoff ging in die Hocke und schob den Spieß in das Maul des Ferkels. Ich hörte ein Knacken, ein trockenes Schmatzen, ein Geräusch, als schneide man durch Fleisch. Immer weiter drückte er den Spieß durch das Tier hindurch, und schließlich kam die Spitze am Hintern heraus. Trinkhoff erhob sich, schob den Körper weit ins Innere des Wagens zurück und gab uns ein Zeichen, ihm zu folgen.
Wir hatten seine Metzgerei nie betreten mit Ausnahme des Hofs und des Verkaufsraums. Jetzt führte er uns in einen beige gekachelten Raum mit schwarzen Bodenfliesen, auf denen blutige Pfützen standen. In den Kübeln neben den Arbeitstischen lagen Fleischlappen, lagen Rippchen und Schweineohren, lagen Schweinefüße, kalkweiß. Die Luft roch salzig und dampfte. Er führte uns zu einer Theke mit großer Glasfront. Dort lagen bäuchlings, die Vorderpfoten ausgestreckt wie ruhende Hunde, rosige Ferkel. Schnauzen und Ohren hatten einen Rotstich, als hätte man sie angemalt – als gäbe es dafür eine Farbe, so wie für Holz und Metall. Der Metzger ging hinter die Theke, schob eine der Glasscheiben zur Seite und hieß uns, zu ihm zu kommen.
»Macht schon«, sagte er und zeigte auf die Ferkel. »Ich hab’s eilig. Ich muss zum See, zu Harry und Helene, und die Viecher dort abgeben. Der Grillverein macht da eine Sause.«
Grillverein? Wir hatten nie von einem Grillverein gehört.
Jeder von uns musste ein Ferkel nehmen und hinaus zum Wagen tragen. Anders als Roman, der es waagerecht auf seinen Unterarmen trug, hielt ich das Tier senkrecht wie eine Schultüte, sein Gesicht mir zugewandt. Ich stierte direkt auf die Schnauze, die keine zwanzig Zentimeter von mir entfernt war. Es war, als herzte ich ein kleines Kind, nur dass dieses geschlachtet und tot war und mich aus milchigen Augen ansah. Das Ferkel roch penetrant und viel stärker als das im Wagen, es drehte mir den Magen um, als ich mich bückte und es auf die Plane im Kofferraum legte. Ein Sud aus Ekel und Kummer über das Schicksal dieses Ferkels stieg in mir hoch, und ich erbrach mich über die Stoßstange, aber auch auf die Ladefläche, auf das Hinterteil der Schweine, die Roman und Trinkhoff dort abgelegt hatten – eine stinkende Soße. Ich taumelte, ich ging in die Knie, rappelte mich wieder hoch, schwankte auf Roman zu, ich konnte nicht glauben, was ich getan hatte, nie zuvor hatte ein Geruch mir so zugesetzt, es war so unvermittelt, so tief aus meinem Inneren gekommen, dass ich doch schuldlos war. Das sah Trinkhoff anders, er trat mir in den Hintern, mit voller Wucht, dass ich auf den Asphalt flog und mich vor Schreck nicht rühren konnte, bis Roman mir aufhalf.
Und erst, als er sah, dass mir weiter nichts passiert war, und erst, als der Metzger die Tiere ausgeladen hatte und im Hof mit dem Wasserschlauch abspritze, ging er zu ihm und fragte: »So, und wann genau steigt das Grillfest?«
»Halt die Schnauze«, raunzte Trinkhoff und sah nicht von den Ferkeln auf, die er nun mit kräftigem Strahl aus kurzer Distanz reinigte und inspizierte.
Mein Bruder nickte, seltsam entspannt und gefasst. Nicht kleinlaut oder ängstlich, ganz und gar nicht ängstlich. An jenem Tag wurde mir klar, dass mein Bruder sich im Griff hatte. Dass alles, was er tat, einem Plan folgte.
3
Zu Hause erwähnten wir den Vorfall nicht. Auch am nächsten Tag nicht. Wir setzten uns mittags an den Küchentisch, wo bereits die Kartoffeln in der Pfanne brieten und die panierten Schnitzel im buttergelben Sud auf uns warteten. Damals kochte meine Großmutter noch, war die Krankheit gerade erst ausgebrochen. Sie hatte dunkles, nur leicht ergrautes Haar, war rund und drall und genoss die Freuden von Schokolade und Kuchen.
Ich nahm nur Spinat und Kartoffeln, zerquetschte sie mit der Gabel und gab einen Stich Butter dazu, bis ein leicht sämiger Brei entstand. Vom Fleisch nahm ich nicht. Auch vermied ich den Blick auf die Schnitzel.
Leonhard, Großmutters Vetter, kam an den Tisch. Er bewohnte ein einliegendes Zimmer im Haus mit separatem Zugang vom Garten aus. Die Mahlzeiten, die Fernseh- und Spielabende verbrachte er bei uns in der Küche. Leonhards Zimmer war armselig. Es hatte ein Waschbecken, aber keine Dusche. Wo duschte Leonhard, fragte ich mich. Duschte oder badete er nie? Jedenfalls tat er das nicht bei uns im Haus.
Als Kind ist der Gedanke, dass nichts bleibt und alles von der Zeit radiert wird und man am Ende derjenige ist, der die Erinnerungen und die Geschichten einer Familie in sich trägt, kein Gedanke, der sich denkt. Man denkt bis zum Ferienanfang und ans Ferienende, man denkt im November an den Nikolaus und das Weihnachtsfest, an den Schnee, der hoffentlich bald fallen wird, aber nie an den Tod der Eltern, nie an das, was geschehen könnte, meinem Bruder und mir, Leonhard, der Großmutter und Großtante Mia.
Leonhard setzte sich, strich mir übers Haar.
»Wo steckt Mia?«, fragte er und schaute in die Runde.
Meist saß Mia im Wohnzimmer unter der großen Marienfigur und strickte. Ein pausenloses Stricken: Pullover und Socken, und wenn diese alle verschenkt und übergeben waren an Verwandtschaft und Nachbarn, strickte sie Überzieher für Kissen und Armlehnen, ja selbst für die Füße der Sessel und Sofas und für den Handlauf der Treppen hatte sie blau-grün karierte Wollverkleidungen gestrickt. Nur mit Mühe konnte Vater sie davon abhalten, sie dauerhaft dort anzubringen. Aus Gefahrengründen, weil der Bürgermeister es in allen Häusern verboten hätte. Eine Warnung, die für einige Zeit half. Später musste der Bundeskanzler herhalten. Kiesinger, dann Brandt. Schon bei Brandt blieb die Wirkung der Worte aus, drängte meine Großtante Mia ins Freie, auf die Straße, in den Wald und umspannte Straßenschilder und Wegweiser, Bäume und Sitzbänke mit ihren bunten Wollbezügen. Wir mussten sie auf ihren Streifzügen einfangen, Roman und ich. Manchmal wollte sie uns nicht nach Hause begleiten, da halfen auch der Bundeskanzler und der Bürgermeister nicht. Wir hassten es, schleiften sie mit uns. Jeder nahm einen Arm und zog Mia die Straße hinauf oder einen Waldweg entlang. Sie war störrisch wie eine Kuh.
Mia hatte es gut bei uns. Niemand wollte ihr die Marotte ernsthaft abgewöhnen. Nur sie eindämmen, bevor das Haus und die ganze Straße unter der Wolle verschwanden. Von Zeit zu Zeit dekorierte Mutter als Zeichen des guten Willens und als Anerkennung von Mias Arbeit ein oder zwei Meter am Ende des Handlaufs mit ihrem Strickwerk. Sie drapierte es am Morgen, wenn Mia aufstand. Jeder, der die Treppe benutzte, sah Mias Werk und griff dort nicht an den Handlauf, denn die Wolle rutschte, schlingerte auf dem Holz und bot der Hand keinen Halt. Mutter bekränzte obendrein Stuhlbeine und versprach, im Laufe des Tags weiteres blankes, unbestricktes Holz zu schmücken, weil der Wollschmuck schön aussehe, sagte Mutter zu Mia, ganz schön, so schön wie nirgendwo sonst, bei niemandem im Dorf. Das war Mia wichtig. Dass es so schön wie bei niemandem war.
Wann immer ich mich zu ihr setzte, konnte ich sie damit froh machen, im Herzen froh, dass ich ihr sagte, niemand stricke so schön wie sie. Mia hatte keine Kinder, und wie ihre vier Schwestern – mit Ausnahme meiner Großmutter – hatte sie nicht geheiratet. Es gab keine Kinder und keinen Mann, auf den sie hätte stolz sein können, nicht mal auf die eigene Schönheit konnte sie sich etwas einbilden, denn Mia war nicht schöner als andere. Sie war eine großgewachsene Frau mit länglichem, schmalgeschnittenem Gesicht und einer wohlproportionierten Nase, die wohl mein Bruder von ihr geerbt hatte.
Ich trug die große Nase meines Vaters im Gesicht, was mir mit den vollen Lippen einen Zug von Verwegenheit und Kraft verlieh, dem ich kaum gerecht wurde. Ich sah mutiger aus, als ich war. Mein Spiegelbild log. Meine Seele hatte es schwer, dagegen anzukommen, und lange versuchte ich, nicht meinen Gefühlen, sondern meinem Spiegelbild gerecht zu werden. Mein Bruder war kleiner als ich. Er hatte einen kräftigeren Körperbau, war schon als Junge muskulös, und sein Gesicht mit den roten Haaren, dem dunklen Teint und den grünblauen Augen verfehlte seine Wirkung selten. Er war hübsch, und wie allen Menschen, die gut aussehen, traute man ihm keine Grobheit, keine Gemeinheit und wohl auch keine Durchsetzungskraft zu. Doch von allem hatte mein Bruder mehr als genug. Sie hätten nicht sein Gesicht, sie hätten die kräftigen Hände, seine Statur studieren und seine immer ein wenig bebende Stimme hören sollen.
»Mia müsste im Wohnzimmer sein. Holst du sie zum Essen?«, fragte Roman, und Leonhard stand auf. Niemand schlug meinem Bruder etwas aus. Sein Wort galt.
Leonhard verließ die Küche und kehrte kurz danach mit Mia am Arm zurück. Behutsam ließ er sie auf ihren Stuhl sinken.
»Lasst uns beten«, sagte Großmutter.
Meine Eltern fehlten. Sie fehlten oft. Vater schaffte es selten, pünktlich aus der Backstube zu kommen, und Mutter noch seltener aus ihrer Lotto-Annahmestelle, die zwei Kilometer die Straße hinunter in einem Ladenlokal untergebracht war.
»Wir warten nicht länger.«
Großmutter hatte eine sanfte Stimme. Ungeduld oder Tadel klangen bei ihr weniger drängend oder brüsk. In ihrem Blick lag so etwas wie mildes Wohlwollen. Der ganzen Familie gegenüber, sicher aber galt ihre Liebe vor allem Roman und mir. Wie Mutter bemerkte sie, wenn ich bedrückt war. Manchmal, so schien es mir, sah sie es mir an, bevor ich es selbst merkte, und drückte mich an sich. Ich spürte ihren Körper. Eine Festigkeit, die mehr war als die Festigkeit der Muskeln oder des wohlverteilten Specks am Bauch und an den Hüften.
Wenn ich etwas zu beichten hatte, beichtete ich erst Mutter, dann Großmutter und am Ende Vater. Das war die unumstößliche Reihenfolge – eine Konstante für die Ewigkeit, so schien es. Hätte Großmutter einen Leitspruch besessen, so hätte er heißen müssen: Gnade vor Recht. Er galt immer. Jedenfalls für mich.
Alle bekreuzigten sich und beteten: »Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.« Mia griff mit beiden Händen in die Schüssel. Zwei Kartoffeln rutschten ihr aus der Hand und schlugen auf den Tisch. Eine in Leonhards Wasserglas. Dort lag sie nun still wie eine überdimensionale Cocktailfrucht.
»Macht nix«, sagte Leonhard und beließ die Kartoffel im Glas. Er spießte ein Stück Fleisch auf, legte es auf Mias Teller und schnitt es ihr klein. Dann häufte er zwei Löffel Spinat daneben. Mia mochte Spinat. Als ihr Mund von Fleischstücken und Kartoffeln mehr als gefüllt war, wollte sie Spinat nachnehmen, stellte fest, dass nichts mehr hineinpasste, und löffelte sich ihn ins Haar. Löffel um Löffel leerte sie den Spinat auf ihren Kopf. Leonhard war nicht reaktionsschnell genug und Großmutter an diesem Tag seltsam still und in sich gekehrt. Roman war es, der ihr den Löffel aus der Hand riss, zur Spüle lief, ein Handtuch anfeuchtete und den Spinat aus dem Haar wischte.
»Man muss sie im Auge behalten«, sagte Roman. »Immer.«
Vater kam in die Küche, wusch sich die Hände und setzte sich an den Tisch. In Bäckerkleidung, die Arbeitshose im Pfeffer-und-Salz-Muster. Die weiße Konditorjacke hatte er aufgeknöpft. Nie sah er mitgenommen aus, was bei den Arbeiten unter Zeitdruck oder in der Hitze der Backstube leicht hätte sein können. Vater wirkte wie ein Fernsehkonditor, ein Bäcker aus dem Bilderbuch, so weiß und unbekleckert.
»Entschuldigt«, sagte Vater. »Musste die Brötchen und das Gebäck für den Grillverein zusammenstellen. Günter fährt gleich raus.«
»Grillverein?«, fragte Roman.
»Ja, Grillverein. Trinkhoff hat ein paar Leuten eine fixe Idee in den Kopf gesetzt. Kurbelt sein eigenes Geschäft an. Sie treffen sich bei Harry und Helene im Restaurant.«
»Ich komm mit und helfe«, hörte ich Roman sagen.
Vater schaute von seinem Teller auf, und ich legte die Gabel aus der Hand. Es war ungewöhnlich, dass Roman sich freiwillig meldete. An einem gewöhnlichen Wochentag. Ohne Aussicht auf eine besondere Vergünstigung. Ohne Chance auf einen Fußballabend im Stadion in der Stadt, am Bökelberg.
»Gut«, sagte Vater und schaute Roman immer noch an. »Dann mach das.«
»Ich komme auch mit«, zog ich nach.
Später stiegen wir zu Günter in den Kadett und quetschten uns zu zweit auf den Beifahrersitz. Die Scheiben waren beschlagen von den Schwaden der warmen Brötchen, die Vater eben hatte backen lassen.
»Wisch mal, Edgar«, sagte Günter zu mir und startete den Motor. Ich nahm ein Tuch aus dem Handschuhfach und wischte damit über die Windschutzscheibe und die der Beifahrertür. Ich reichte das Tuch weiter. Günter preschte vom Hof und ließ die Kupplung schleifen. Vaters Mercedes durfte Günter für solche Fahrten nicht anrühren.
Günter war seit Urzeiten als Geselle bei meinem Vater angestellt. Er war beinahe ein Familienmitglied. Wir sahen ihn an allen Tagen, nur am Sonntag nicht. Günter bewohnte ein kleines Zimmer auf dem Mehlspeicher, ein Zimmer für unverheiratete Gesellen, die keinen eigenen Hausstand hatten, die bei uns frühstückten und zu Mittag aßen, die nur das Abendbrot auf ihrem Zimmer einnahmen und dort auch am Sonntag aßen, denn am Sonntag wollte Mutter, mehr noch als Vater, dass wir eine Familie waren. Schon Mia und Leonhard zählten am Sonntag nicht dazu, aber sie konnten wir nicht fortschicken. Mia würde einen Tag auf sich allein gestellt nicht überleben, und wir auch nicht, weil sie aus Versehen das Haus anstecken oder unter Wasser setzen würde. Ihre Verkalkung, so nannten die Eltern Mias Erkrankung, hatte in den letzten Jahren zugenommen. Leonhard, der in der Bäckerei am Ofen arbeitete und den Garten bewirtschaftete, durfte man ebenfalls nicht ausschließen. Er war kriegsversehrt. Im Ersten Weltkrieg hatte man ihm am Kemmelberg in Westflandern in den Kopf geschossen und im Lazarett hinter der Front abgelegt zum Sterben. Er war damals achtzehn Jahre alt, nie aus seinem Dorf herausgekommen, seine erste Reise würde seine letzte sein, wenn nicht ein Wunder geschah. In den Briefen, die er in den Monaten zuvor nach Hause geschrieben hatte, hatte es geheißen, die Menschen in Feindesland sprächen ähnlich wie wir. Ein westflämischer Dialekt, dem Niederländischen verwandt und daher für Leonhard keine fremde Sprache, war doch unser Plattdeutsch dem Flämisch-Niederländischen sehr nahe. Als ihm im Lazarett hinter dem Vorhang dämmerte, dass die Visite, die Ärzte, die Herren über Leben und Tod durch den Bettensaal schritten, da schrie er zu ihnen rüber, in ihre weißen Rücken, die sich entfernten, die ihn nicht auf der Liste hatten, die glaubten, sich davonmachen zu müssen zu anderen Köpfen, anderen Beinen, die zu operieren sich lohnte. »Nehmt mich, nehmt mich, ich will nicht sterben«, schrie er, bevor er in die Kissen sank und sich bekreuzigte. Sie erhörten ihn. Sie entfernten die Kugel aus seinem Kopf, setzten ihm eine Metallplatte ein. Er überlebte, sprach und bewegte sich wie vorher. Nur wenn Aufregung, Angst, gar Panik ihm zusetzten, begannen die Wörter zu holpern, sprangen die Laute ungeformt aus seinem Mund, dass wir erschraken, Roman und ich. Leonhard sprach dann, als bettele er um Luft, als drohe er an den Wörtern zu ersticken, bis er schließlich die Augen verdrehte, zu Boden schlug und mit zuckenden Gliedmaßen und Schaum vor dem Mund einige Minuten scheinbar mit einem unsichtbaren Feind kämpfte, und wir alle Stühle, Tische aus seiner Reichweite entfernten, damit er sich an ihnen nicht verletzen konnte.
Seine Ausbildung zum Polizisten nahm er nicht wieder auf. Seine Karriere am Ofen begann, am Schieber und am Dampfventil, ein Leben lang blieb er Hilfsarbeiter, mit einer eigenen kleinen Bibliothek: Bücher über den Krieg, national-heroische Schriften über den Jagdflieger Manfred von Richthofen, den Leonhard in Cappy an der Somme vor dessen letzten Flug gesehen hatte – Richthofen, längst zum Mythos geworden, zum König wie zum Teufel der Lüfte ernannt in seiner roten Fokker, von Deutschen wie Briten. Leonhard lehrte uns alles über Richthofen. Er führte uns zurück in die Schlachten an der Somme und an der Marne. Wir kannten Hindenburg und von Moltke. Wir kannten den Schlieffen-Plan. Wir kannten die Verlustzahlen der Franzosen und Deutschen bei Bellefontaine und Rossignol in den ersten Wochen des Krieges, und wir kannten die Zahlen derjenigen, die ab 1915 im Gaskrieg umkamen. Leonhard erzählte uns alles über die »Dicke Bertha«, eine Kanone, die 150 Tonnen wog, auf zehn Güterwaggons an die Front transportiert wurde und von zwanzig Soldaten bedient werden musste – der Stolz der Armee und der Stolz von Krupp in Essen, damals die beste Waffenschmiede der Welt, wie Leonhard sagte.
Günter steuerte den Opel aus dem Dorf hinaus, passierte die Kartoffelfelder, die endlosen Getreidefelder, die der Wind bürstete. Am Horizont die Kammlinie des Waldes. Er fuhr zum See, rumpelte den Waldweg hinunter bis zu einem kleinen Restaurant, ein Ziegelsteinbau mit rotem Dach. An manchen Sonntagen kamen wir mit den Eltern hierher, aßen zu Mittag, wenn wir ohne Mia und ohne Leonhard sein wollten und Großmutter auf Mia aufpasste.
Günter parkte vor der Küche. Auf der Terrasse flatterte eine Fahne am Mast mit dem Logo des Grillsportvereins Glutsbrüder, es zeigte eine knusprige Bratwurst und eine gekippte Flasche Ketchup, aus der ein Schwall roter Flüssigkeit durch die Luft in Richtung Wurst segelte. Roman und ich trugen die Brötchenkörbe, Günter das Blech mit den Obstfladen. Die Küche roch nach Braten und Frittenfett.
Helene, die Wirtin, nahm uns die Körbe ab und bugsierte sie auf die Ablage vor den beiden gemauerten Grills, auf denen bereits zwei der Ferkel sich in knusprige braune Fleischhaufen verwandelt hatten. Ein Grinsen huschte wie ein Schatten über Romans Gesicht. Dann holte sie ihr Portemonnaie aus der Tasche ihres Kittels und gab uns ein Trinkgeld. Helene war klein und fassrund und ihre Wangen von der Anstrengung des Tragens gerötet. Günter stand bereits an der Theke. Wir stellten uns zu ihm und investierten das Trinkgeld in eine Cola. Harry zapfte Günter ein Bier und servierte uns die Cola. Neben Helene wirkte Harry dürr wie ein ausgehungerter Vogel. Er hatte eine krähenspitze Nase, ein kantiges Kinn, große hungrige Augen und schütteres Haar, das immer nach Lavendel duftete, obwohl man dies nur wahrnahm, wenn er nicht in seinem Lokal, sondern im Dorf auftauchte.
»Jungs«, sagte Harry. »Schön, euch zu sehen.« Wir nickten, und wieder war da dieses Grinsen auf Romans Gesicht.
»Viel zu tun?«, fragte Günter und zeigte auf die an der Stange flatternde Fahne.
Harry nickte.
»Eine Sportveranstaltung also«, flötete Günter.
»Großer Sport«, stimmte Harry zu und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.
»Garantiert bewegungsarm«, sagte Günter. »Niemand kommt ins Schwitzen.«
»Da bin ich mir nicht sicher«, sagte Harry. Er zeigte auf das Bord voller Pokale. »Um die geht es heute. Gesucht wird der beste Wurstgriller, der schnellste Steakgriller, und als Königsdisziplin treten am Abend zwei Teams gegeneinander an, um die besten Spanferkelgriller zu finden. Wir grillen die Ferkel vor, den Rest übernehmen die Herren selbst, nehme mal an, dass es nur Herren sind.«
»Und das Fleisch? Was passiert damit?«, fragte Roman.
Harry sah ihn verdutzt an. »Sie haben ihre Familien eingeladen und ein Barbecue-Team vom Flughafen. Die Briten bringen auch ihre Leute mit. Den Rest verputzen Helene und ich und der Hund.«
»Ausverkauft also?«
»Ausverkauft.«
»Da werden die Kamine qualmen«, sagte Günter.
Harry nickte.
»Gut denn«, sagte Günter und trank sein Glas aus. »Fahren wir.«
»Wann geht’s los, das Ferkelgrillen, wann fällt da eine Entscheidung?«, hörte ich meinen Bruder fragen.
»Nicht vor zehn Uhr«, sagte Helene, die mit zwiebelroten Augen am Hackbrett stand.
Warum fragte er das?
4
Vielleicht war unsere Kindheit auf eine bestimmte Art glücklich, weil die Eltern keine Zeit hatten, sich um uns zu kümmern. Sie waren vereinnahmt von all ihren Verpflichtungen im Lotto-Laden und in der Bäckerei. Selbst in ihrer Freizeit und in den Ferien beaufsichtigten sie uns kaum und hinderten uns nicht daran, das zu tun, was wir liebten zu tun, was uns begeisterte und herausforderte. Sie ließen uns all die Fehltritte machen, auch jene, die an uns haften blieben und unser Leben einfärbten. Das war die Kehrseite, von der wir damals nichts ahnten.
Vater hatte die Bäckerei vor vielen Jahren von seiner Tante Mia übernommen, die kinderlos geblieben war. In den Dreißigern hatte sie ihren Meisterbrief erworben. Weit und breit war sie neben ihren Schwestern die einzige Frau in einer solchen Stellung und gab diese um keinen Deut auf, als die Nazis und ihr befremdendes Frauenbild, das Frauen kein selbstständiges Leben ohne Mann und Kinder zubilligen wollte, ihr in die Quere kamen. In den Fünfzigern, nach Abschluss der höheren Handelsschule, verließ Vater das Dorf, lernte Confiserie in Genf und Salzburg und kehrte nach ein paar Jahren zurück. Er blieb dem Ofen und der Sahne, der Mengmaschine und den Torten treu. Er baute die Firma aus, sie prosperierte, er richtete eine Filiale im Nachbarort ein. »Man muss sein Maß kennen«, sagte Vater, ohne dass ich damals wusste, was er meinte.
Mutter hatte ihr eigenes Auskommen. Sie verschwand am Morgen in ihren Laden, kehrte zum Mittagessen ins Haus zurück, um dann bis zum frühen Abend wieder in ihr Glücksinstitut zu verschwinden. Denn nichts anderes als die Hoffnung auf Glück meinten die Leute, die einen Lottoschein kauften, zu nähren. Nährte Vater die Menschen mit Brot, so fütterte Mutter sie mit Illusionen. Darüber hinaus war Mutter für Vater unersetzlich, was die Zahlen und die Buchhaltung anging. Sie jonglierte mit seinen Zahlen, mit den roten und den schwarzen. Sie hatte sie im Kopf. Egal, ob sie sie jubeln ließen oder schlaflos hielten. Sie wusste um den Gewinn und den Verlust, bevor Vater davon wusste. Sie fühlte Zahlen. Sie kannte ihre Halbwertzeit und ihre Langzeitwirkung auf das Gemüt. Erkannte am Einkauf von Milch und Zucker, von Mehl und Backmitteln, wie es um die Bäckerei stand, wie ihr Herz schlug, das vitale Herz, das von den Menschen, die dort arbeiteten, gespeist wurde. Von Günter und Leonhard, von Klara, die im Laden die Backwaren verkaufte. Mutter wusste anhand der Zahlen, wie es um Vater stand, um seinen Mut und seine Begeisterung für die Arbeit. Wie ein Arzt ein Blutbild liest, so las Mutter die Bilanz. War ihre Zeit auch begrenzt, mehr als bei anderen Müttern, so war sie mir und nicht nur mir, auch Roman, dennoch nah. Ich konnte sie besuchen, wann immer mir danach war, und in den Stunden, in denen kaum jemand ihren Laden aufsuchte, konnte ich mit ihr sprechen. »Setz dich«, sagte sie, und dann wusste ich, dass sie in meinem Gesicht, an meiner Haltung erkannt hatte, dass mir etwas auf dem Herzen lag. So nannte sie das. Ich konnte es ihr sagen oder nicht sagen. Mutter bohrte nicht nach. In solchen Momenten war sie ganz bei mir, ohne mich zu drängen. Hinterher sprach sie die Absolution aus. Meistens. Vater war anders. Ihm fehlte der Blick für uns. Ein Blick, der alles sieht. Er liebte uns, aber er kannte uns nicht. Vaters Aufmerksamkeit galt sich selbst, und an zweiter Stelle dem Betrieb. Uns begegnete er mit Langmut, wann immer wir über die Stränge schlugen.
Manchmal legte Mutter eine Schallplatte auf. Udo Jürgens, der von der Liebe sang. Ein wenig kitschig, und doch anders als die schmalzigen Schlagersänger. Das spürte ich. Mit Udo Jürgens floh Mutter hinaus in die Welt, in eine romantische Welt, in der Udo von einem Sommer sang, der zu Ende geht oder von einem letzten Brief an eine Geliebte. Lieder, die uns beide in eine wohltuende Traurigkeit versetzten, eine Melancholie, die nicht schmerzte. Dazu aßen wir Gladbacher Knööp, Nusstrüffel mit Marzipanfüllung, die Mutter von Zeit zu Zeit aus der Stadt von der Konditorei Heinemann mitbrachte, von der Konkurrenz, wie Vater schmunzelnd sagte.
Nach Udo Jürgens oder den Beatles, nach Ob-la-di, Ob-la-da, das mit seinem karibischen Flair bei Mutter für gute Laune sorgte, brachen wir zu einem Spaziergang auf, und sie schloss den Laden ab. Für ein, zwei Stunden. Vielleicht brauchte sie die Zeit mit mir, wie ich die Zeit mit ihr brauchte. Mutter fuhr oft und gerne hinaus zu einem Park, nahe dem Gnadenhof, ein schlossartiges Gebäude am Rande eines Walds. Sie liebte den Park, die großen Buchen, den Weiher und die Wege, die von dort in die Heide führten. Lange vor dem Krieg hatte ihr Vater im Auftrag des Besitzers den Park angelegt. Damals war das Schloss ein Schloss und kein Ort für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, Jungen allesamt. Eine Ziegelmauer trennte das Heim vom öffentlich zugänglichen Teil des Parks. Keines der Heimkinder sahen wir je. Sie waren uns ferner als die hungernden Kinder im Fernsehen, Kinder aus Biafra, die mit ihren Hungerbäuchen und Köpfen wie Leichenschädel seit drei Jahren immer wieder mal in der Tagesschau gezeigt wurden, dass es uns in den Blick und auf den Magen schlug. Kinder in Not gab es nur in Afrika. Sie hatten ein Gesicht. Die Kinder und Jugendlichen im Heim hatten keines. Die Mauer schien unüberwindbar. Die Jungen blieben uns verborgen. Sie waren eine eigene Spezies, die wie Zootiere eingepfercht waren. Einen Zoo konnte man besuchen, den Gnadenhof nicht.
Wann immer die Rede auf das Heim und die Nonnen kam, die die Anstalt betrieben, endeten die Gespräche schnell, versandeten, als hätten die Erwachsenen keine Worte für die abgeschlossene Welt, die niemand zu Gesicht bekommen hatte – so wie man die dunkle Seite des Mondes nicht sehen konnte. Der Anblick des Heims ließ mich die Unbeschwertheit spüren, in der ich aufwuchs. Vielleicht weil ich hinter der Mauer das Unglück wusste. Man gewöhnt sich an das Glück, wenn es nicht bedroht ist.
Unsere Runde durch den Park endete am Weiher. Wir fütterten die Enten mit altem Brot. Der Weiher war voller Entengrütze und das Brot im Wasser gesprenkelt von den kleinen grünen Blättchen, die auf der Wasseroberfläche schwammen. Das rote Ziegeldach des Anwesens schien zwischen dem Laub der Buchen hindurch. Oft schwiegen wir, saßen einfach nur da, schauten dem Lichtspiel auf den Blättern der Bäume oder auf dem Wasser zu, bevor wir zu den Heideflächen spazierten. Blühte die Heide, überzog die Landschaft ein Violett, aus dem das dunkle Grün der Wacholderbüsche herausragte. In der Dämmerung lag ein wenig von diesem schönen Schein auf unseren Gesichtern. Was ich ansprach, wurde leicht, verlor seinen Schrecken: die Schulnoten, ein Streit mit Roman, nichts Schlimmeres. Und Mutters Ängste? Sie erwähnte sie nicht, und ich kannte sie nicht. Ja, ich verstieg mich zu der Vermutung, dass keine Angst Mutter wirklich band. Weder versetzten sie Angelegenheiten und Tätigkeiten, die ihr wichtig waren, in Unruhe, noch fand die Angst ihr Ziel in denjenigen, die sie liebte und deren Verlust sie hätte fürchten können: damals, als noch nichts in unser Leben eingedrungen war, in jener Windstille, in jenen schönen milden Tagen des Frühlings, die nur jemand als endlos begreift, der das Leben nicht kennt.
Vor Feiertagen nahm das Pensum in der Bäckerei zu. Erst recht am Vorabend zum Maifeiertag. Mutter half an diesen Tagen in der Backstube und hielt ihr Lotto-Toto-Geschäft geschlossen. Sie reinigte die Tische und die Arbeitsgeräte, belegte die Mürbeteigböden mit Erdbeeren, sie schlug Sahne, rührte in der Kuvertüre, bestrich die Nusstörtchen damit, stellte Lieferungen zusammen, die Günter dann ausfuhr. Sie ließ sich von Leonhard anweisen, zum richtigen Zeitpunkt das Brot aus dem Ofen zu holen. Sie war das Mädchen für alles. Es war das Jahr 1971.
Wie viele Familien im Dorf wollten wir am Abend in der Nachbarschaft das Maifest feiern. Als die Arbeit getan war, duschten wir und zogen uns um, Mutter legte Rouge auf und schminkte ihre Lippen mit einem zarten Rosa. Ihre Haut war eher blass, und das Rouge und der dezente Lippenstift gaben ihr für ein paar Stunden einen Hauch von Frische und Erholung. Ich wusste nicht, ob Vater sie begehrte. Nie sah ich ihn sie küssen. Seine Umarmungen hatten etwas Linkisches und Kameradschaftliches. Sie schienen frei von Erotik. Nicht dass ich eine Ahnung davon hatte, aber wir sahen Filme, und darin küssten Paare einander, warfen sich Blicke zu. Nicht unsere Eltern. Keine Küsse, keine Blicke. Manchmal warf unsere Mutter sich meinem Vater an den Hals, nie im Betrieb, nicht vor anderen, nur vor uns, an Weihnachten, in den Ferien, wenn wir sonntags ins Kino gingen, in der ersten Reihe saßen, so nah an der Leinwand, dass man meinen konnte, in den Film hineinzuspringen. Vater liebte das, die erste Reihe. Wir nicht. Er ließ Mutters Küsse, die Umarmungen geschehen, nahm sie entgegen, wie man einen Geburtstagsgruß von jemandem entgegennimmt, der einem eher fremd ist, mit dem eine Umarmung nie lange dauert. Nur die Oberkörper berührten sich kurz, und mitunter klopfte seine Hand sachte auf Mutters Rücken, als wage sie nicht, dort liegen zu bleiben, als müsse sie klopfen, um aus der Intimität zu entkommen.
Wir fuhren mit den Rädern über den Marktplatz. Roman hatte darauf bestanden, dass wir sie mitnahmen.
»Lass uns später ein wenig herumfahren. Den ganzen Abend am Maibaum sitzen ist langweilig.«
Der Maibaum war geschmückt mit bunten Bändern. Die Männer tranken einen ersten Schluck, die Frauen saßen an den Tischen. Vater reichte man ein Bier, wir nahmen uns eine Cola. Mutter strich uns übers Haar, wandte sich nach Vater um, aber der war bereits im Pulk der Männer eingetaucht. Mutter setzte sich zu den Frauen, die Schnapsgläschen vor sich stehen hatten. Manchmal schaute sie zu Vater hinüber, der scherzte und lachte, auf den Fußballen wippte, was er immer tat, wenn die gute Laune anklopfte und er sie in sich hineinließ. Wir versorgten uns mit Nudelsalat, aßen Kartoffelchips aus knisternden Tüten, drehten ein paar Runden auf dem Rad und langweilten uns wie vorausgesehen. Von unseren Mitschülern waren nur ein paar Streber gekommen. Mädchen mit Zöpfen und Jungen, die Tennis statt Tischtennis, Hockey statt Fußball spielten.
Als es dunkel wurde, das Lagerfeuer brannte, die Musik erklang und Paare den Tanzboden, ein Viereck aus Spanplatten, betraten, setzten wir uns an einen Tisch und schauten zu. Vater tanzte mit Mutter. Sie hatte ihn aufgefordert. Leonhard hatte sich die Nachbarin geangelt. Er wirkte angestrengt, hielt den Blick abwechselnd auf seine Füße und in die Weite gerichtet, in die nun schwarz werdende Nacht. Auch Trinkhoff tanzte, flotte Drehungen und Hüftschwünge, und seine Frau stimmte in jeden Schritt, in jede Finte ein, sie waren eingespielt. Meine Eltern nicht. Sie tanzten uninspiriert und zugleich feierlich, als befänden sie sich in der Tanzschule, als müsste jeder Schritt durchdacht und vorbereitet werden. Sie schoben einander in quälendem Tempo übers Holz.
Die Nacht war ungewöhnlich warm, und die Musik ungewöhnlich gut, wie wir fanden, ein paar Beatles-Songs wurden gespielt, nicht nur der grausam deutschtümelnde Heino, der quäkende Bata Illic mit seinem Song Candida, der mir in den Ohren wehtat. Auch Peter Alexanders Der letzte Walzer und Hier ist ein Mensch schmetterten über den Marktplatz. Schließlich Peter Maffays Hit Du, da tanzte man eng, da verschwanden meine Eltern von der Tanzfläche. Ebenso bei Peter Orloff und dem Mädchen für immer.
Der dicke Mike schob mit seinem Rad auf uns zu. Mike hieß eigentlich Michael, aber seine Mutter hatte vor einem Jahr begonnen, ihn Mike zu nennen. Weil sie Nina und Mike, das Schlagerduo, und ihren Hit Lola unwiderstehlich fand, hatte Mike erzählt. Er war außer Atem und sein Gesicht war gerötet. Auf seinem geschorenen Kopf schimmerte im Schein des Feuers die Kopfhaut durch. Mike stellte das Rad ab und setzte sich zu uns. Er griff in die Tüte und stopfte sich eine Handvoll Chips in den Mund. Seine fleischigen Lippen glänzten vom Fett.
»Darf ich?«, fragte Mike und zeigte auf unsere Colaflaschen, die erst zur Hälfte ausgetrunken waren.
»Nein«, sagte Roman, bevor ich antworten konnte.
Mike nickte. Er hatte kein Geld für eine Cola. Er hatte auch kein Geld für einen anständigen Haarschnitt. Seine Mutter, die mit ihm alleine lebte, seit sich seine Eltern getrennt hatten, schor ihn jeden Monat mit dem alten Rasierapparat seines Vaters. Auf dem Kopf und im Nacken sah man nach dem Schnitt Fettröllchen, und das Scheren ließ hässliche Streifen auf der Kopfhaut zurück.
Mike schnappte sich ein Glas Limonade, das herrenlos auf dem Tisch stand, und trank es aus.
»Tut gut«, sagte Mike.
Wir schwiegen. Dann stierte Mike auf die Tanzfläche, wo jetzt Massachusetts lief. Vater tanzte. Nicht mit Mutter. Er tanzte mit der Tierärztin, die vor ein paar Jahren ins Dorf gezogen war und die Praxis des alten Meyer übernommen hatte. Eine sandblonde, schlanke Vierzigjährige, unverheiratet. Warum unverheiratet, fragte sich das Dorf. Mutter stand abseits. In der Hand ein Bierglas, an dem sie nippte und wie wir zum Tanzboden schaute. Vater tanzte anders, geschmeidiger als vorhin mit Mutter. Es war beunruhigend, aber der Eindruck drängte sich auf: Er tanzte beseelter. Jeder konnte das sehen. Roman sagte kein Wort. Er knibbelte an der Papiertischdecke, riss sie ein, friemelte Stückchen für Stückchen ab. Mutter kam an unseren Tisch. Setzte sich zu uns, stand wieder auf, machte einen Schritt ins Leere, setzte sich wieder, griff zu den Chips. Irgendein Idiot hatte A Whiter Shade of Pale von Procul Harum aufgelegt, der ultimative Song zum Slow, zum Klammerblues. Vater verharrte einen Augenblick, schaute zu uns herüber, seine Arme öffneten sich, er machte einen Schritt zurück, von der Aschblonden fort, und einen vor und zu ihr hin, die dort, wo Vater die Arme offen hielt, eintrat, über seinen Arm strich und seine Hand nahm und ihn, zwar noch auf Abstand, nur die Hände berührten einander, von der Mitte zum Rand des Tanzbodens dirigierte, wo das Licht uns nun ein wenig schummriger vorkam.
Vaters Gesicht brannte, als er von der Tanzfläche zu uns an den Tisch kam und die Tierärztin beim Bierstand zurückgelassen hatte. Nicht die Scham hatte sein Gesicht gerötet, man sah es an den Augen. Er spendierte uns eine weitere Cola, auch für Mike.
»Holt für eure Mutter ein Glas Sekt«, sagte Vater.
»Nein. Keinen Sekt.«
Mutter klang spröde und kleinlaut. Ihre ganze Person wirkte geschrumpft. Sie ließ sich von Roman einen Schnaps einschenken, nippte daran wie ein Vogel. Ihr Blick stahl sich zum Grill, wo die Tierärztin in eine Wurst biss und sich mit Trinkhoff unterhielt. Manchmal sah sie zu uns herüber, sondierte Mutter und uns und suchte Vaters Blick. Wieder spielten sie die Bee Gees. Die Tierärztin warf ihre Serviette in den Papierkorb und machte einen Schritt auf die Tanzfläche zu. Mutter nahm Vaters Hand, hielt sie, hielt sie fest, dass er nicht fliehen konnte. Aber wer Augen hatte, sah, dass Vaters Blicke nur ein Ziel kannten. So hatten wir Mutter nie gesehen, so angstvoll und kindlich. Sie hatte ihr Leben, verdiente in ihrem Laden eigenes Geld, und zwar nicht wenig, das wussten wir. Sie war nicht Vaters Anhängsel. Sie war das kaufmännische Gehirn hinter Vater, der zwar seinen Betrieb im Griff hatte, aber liebte er den Beruf? Was oder wen liebte Vater? Das war die Frage.
Diesmal tanzte Trinkhoff mit der Tierärztin. Seine Hand wanderte über ihren Rücken, sie bog den Kopf zurück, immer wieder straffte sie sich in den Schultern, als müsse sie vor irgendwas gewappnet sein. Roman verzog das Gesicht, vielleicht musste er an die Ferkel denken, wenn er Trinkhoff sah, an den Tritt in meinen Hintern, vielleicht dachte er an Vater und dessen Tänze mit der Tierärztin.
Er beugte sich zu Mike, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Mike schaute unbewegt zum Feuer, das unsere Gesichter und Bäuche wärmte, nur der Rücken war ein wenig nachtkalt. Schließlich nickte Mike, stand auf und nahm sein Fahrrad.
»Komm«, sagte Roman zu mir, »es wird Zeit.«
Ich nickte ebenfalls, ohne zu wissen, was er meinte. Mutter schaute auf Vater, und Vater schaute auf die Tanzfläche.
5
Wir schnappten unsere Räder, drehten eine Runde, fuhren durch den Schein des Feuers, der an den Bäumen und den Pflastersteinen leckte. Wir radelten durch das Summen der Stimmen, durch das Klimpern einer Gitarre. Die Bee Gees waren verstummt. Wie ein Taubenschwarm schwirrten wir über den Platz und flatterten dann ab in die Nacht, durch die spärlich beleuchteten Gassen, hinaus in die Felder, und eine Ahnung stieg in mir auf, verfestigte sich, als wir den Wald erreichten und in sein Schweigen fuhren. An den Beinen spürten wir die kalte Luft, die von Zeit zu Zeit aus einer Fichtenschonung, aus einem dichten jungen Buchenwald auf den Weg strömte, uns begleitete und verschwand, wenn wir an offeneren Flächen mit einzelnen hohen Bäumen vorbeirollten, jeder in seinen Gedanken gefangen, ich zumindest, denn mir war nun klar, welches Ziel wir ansteuerten.
Als der See sichtbar wurde, sein matter Glanz in der Nacht, als der Parkplatz sich aufdeckte, eine sandige blanke Fläche, und uns der Duft der Würste und Steaks in die Nase stieg, und das Säuseln der Stimmen sich unter das Surren der Reifen mischte, hielten wir an, kippten die Dynamos weg und fuhren die letzten Meter ohne Licht, bevor wir die Räder hinter Büschen versteckten. Ich war mir sicher, dass es mehr sein würde als ein bloßer Besuch beim Grillsportverein und dass Roman einen Plan, eine Idee ausgeheckt hatte, die am Ende eine Flucht nötig machte.
»Kommt«, sagte Roman und hielt auf eine kleine Baustelle am Rande des Parkplatzes zu. Sie war von einem rostigen Bauzaun eingefasst. Harry bewahrte dort Balken, Sand und Steine, eine Leiter und einen Stapel Dachziegel auf. Was wollte Roman damit? Mike sah uns an, er biss sich auf seine glänzenden Wurstlippen. Roman ging zum Zaun und stemmte eines der Gitter aus der Verankerung. Er nahm zwei Dachziegel vom Stapel, wog sie in der Hand und legte sie zurück.
»Zu schwer«, sagte er
»Zu schwer für was?«, fragte ich.
»Wirste noch sehen.«
Er fischte sich ein Brett von einem Holzstoß und versuchte, es in der Mitte durchzutreten.
»Lass mich das machen«, sagte Mike. Mike stellte zwei Kalksandsteinblöcke auf, ließ einen Abstand dazwischen und legte das Brett auf die Steine. Ein Tritt genügte.
Ich wusste noch immer nicht, was Roman vorhatte. Traute er mir nicht? Hatte er Mike vorhin am Feuer eingeweiht?
»Ihr packt euch die Leiter«, sagte er.
Mike und ich nahmen die Holzleiter und bugsierten sie durch den Spalt des Bauzauns. Wir trugen sie runter zum See, umrundeten das Haus außerhalb der Lichtfelder, die aus den Fenstern des Restaurants nach draußen schwappten. In einem großen Bogen näherten wir uns der Rückseite des Gebäudes, wo sich die Küche befand. Sie hatte ein schmales Fenster, und es blieb genug Platz, um die Leiter ein paar Meter entfernt vom Fenster am Haus aufzustellen, ohne dass man uns von der Küche aus bemerken konnte. Ich hatte begriffen. Rache ist süß. Nur dass Trinkhoff nicht unter den Gästen war. Roman kannte keine Skrupel. Hatte er einmal einen Weg beschritten, war er nicht abzuhalten, als sei in ihm eine Kompassnadel fixiert worden, die unbeirrbar die Richtung vorgab.
»Willst du das wirklich tun?«, fragte ich.
»Mach schon«, sagte er. »Mike bleibt hier unten, versteckt sich im Gebüsch und warnt uns, wenn jemand kommt. Pfeif, wenn die Tür aufgeht, Mike. Du kannst doch pfeifen?«
Mike nickte und atmete schwer. Seine Lippen schienen ein wenig schmaler geworden zu sein. Er huschte in ein Gebüsch, von dem aus sich das Dach und die Tür einsehen ließen.
Ende der Leseprobe