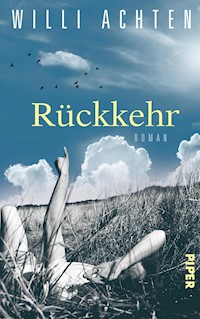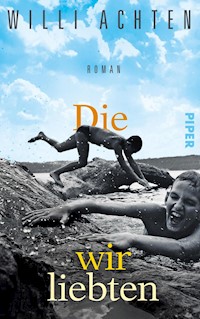Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: PendragonHörbuch-Herausgeber: PENDRAGON Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Mathys ist Kriegsfotograf. Eines seiner Fotos wurde mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. Doch er hat tiefe Zweifel und Schuldgefühle, denn er profitiert von dem Leid anderer. Mathys spürt, dass sein Leben ihm mehr und mehr entgleitet. Er zieht sich auf einen abgeschiedenen Hof im Wald zurück. Lebt dort mit seinem Vater und seinem Sohn, kommt zur Ruhe und verliebt sich. Doch die Idylle trügt. Eines Nachts schlagen zwei Männer seinen Vater brutal nieder und er muss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Mathys will die Täter finden. Der immer stärker werdende Wunsch nach Rache und die Suche nach den Männern entfremden ihn von den Menschen, die er liebt. Wird er nun alles verlieren? In einem zerklüfteten Tal in den Alpen trifft er eine einsame Entscheidung, die sein Leben kosten kann. Willi Achten lotet die Abgründe der menschlichen Psyche aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi Achten • Nichts bleibt
Willi Achten
Nichts bleibt
Für meinen Vater
Die Handlung ist frei erfanden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Pendragon Verlag
gegründet 1981
www.pendragon.de
Veröffentlicht im Pendragon Verlag
Günther Butkus, Bielefeld 2017
by Pendragon Verlag Bielefeld 2017
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Eike Birck, Johanna von Stuckrad
Umschlag und Herstellung: Uta Zeißler, Bielefeld
Umschlagfoto: time. / photocase.de
Satz: Pendragon Verlag auf Macintosh
Gesetzt aus der Adobe Garamond
ISBN 978-3-86532-576-1
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Teil 1
»Vor den Menschen,vor ihnen muss man Angst haben, immer.«
Louis-Ferdinand Céline, »Reise ans Ende der Nacht«
1
In der Nacht kam Regen auf. In den Buchen rauschte der Wind. Äste flirrten über das Dachfenster. Manchmal drang der Mond durch die Wolken, warf Licht auf die Schallplatten und CDs, die verstreut auf den Dielen, dem Sofa lagen. Ein Schimmern auf den Bildern und Fotografien. Eine Flusslandschaft. Weiden, Birken, das Wasser voll Sonnensprenkel. Franz Marcs Blaue Pferde. Der Plattenteller drehte stumm vor sich hin. Ich öffnete das Fenster. Die Luft war warm und feucht. Aus dem Wald drang das Rufen der Käuze herüber. Weit entfernt auf einem der Höfe schlug ein Hund an. Wie immer horchte ich in die Nacht. Das Surren von Fahrradreifen auf dem Waldweg blieb aus. Ich hatte es hören können, spät am Abend, wenn ich auf den Jungen gewartet hatte, müde und wütend, da er länger als vereinbart weggeblieben war. Eine Wut, die verrauchte, wenn der Fahrradständer draußen klackte und der Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Eine Müdigkeit, die verschwand, wenn die Eier im heißen Öl in der Pfanne aufzischten. Der Junge hatte Appetit. Die Fahrt vom Dorf zu uns hinaus war weit. Der Junge verließ uns vor einem Jahr.
Ich las ein paar Seiten, trank einen Schluck, manchmal fand ich Schlaf, diese Nacht nicht. Ich ging zum Schreibtisch, verglich am Computer die Grauwerte der Fotos, verlorene Orte, ein Waisenhaus in den Bergen, Mauerbögen, auf denen das Gras steht. In den Bettensaal fällt ein Winterlicht, Matratzen gepudert von Staub und Dreck, auf den Fensterbänken gedeihen Birken und Erlen, unter den Betten regenschimmelige Rechnungsbücher. Ein Chemiewerk, aufgezwirbelte Kabelstränge, die von den Decken hängen und durch die Luft zu wachsen scheinen, eine Wanduhr, die Zeiger eingerostet auf dem Stundenblatt. Ich hörte, dass Vater sich im Bett umdrehte. Die Geschossdecken waren aus Holz und nicht gedämmt. Ich hoffte, Vater fand Schlaf. Der Schlaf schützte ihn vor dem Kummer. Seit der Junge fort war, arbeitete Vater wieder, fuhr Brot für eine Bäckerei aus, die einmal seine eigene gewesen war. Er hatte sie nach dem Tod meiner Mutter verkauft, sich zu uns auf den Hof zurückgezogen. Jetzt nahm er jede Schicht an, fuhr am frühen Morgen, auch am Abend die Filialen ab, lieferte aus, nahm die Retourware an, das Brot, den Kuchen vom Vortag. Ware, die kaum jemand essen wollte. W i r aßen das alte Brot. Man wirft kein Brot weg, sagte Vater. So hatten wir es früher auch gehalten. Weniger aus Geiz, sondern weil das Brot für Vater, nicht für mich, nicht für meine Mutter, auf eine überhöhte Art kostbar gewesen war, und es immer noch war. Wieder schlug ein Hund an. Es musste der Hund vom Nachbarhof sein. Ein Blaffen, das sich steigerte, heiser wurde. Der Hund geriet außer sich. Ich stand auf, griff nach meiner Jacke.
Ein Nachtnebel lag über dem Fluss und dem Bruch. Vor Wochen war der Fluss über die Ufer getreten, war in die Altarme und Tümpel geströmt, hatte daraus ein Refugium für Kröten und Mücken gemacht, das erst der Sommer austrocknen würde. Das Quaken der Frösche füllte die Stille. Eine Bisamratte sprang ins Wasser. Ein Gluckern, Paddelbewegungen mit dem Schwanz waren zu hören. Dann nur noch meine eigenen Schritte, bis schließlich die Frösche erneut begannen.
Ich pirschte zum See. Die Schilfgürtel rauschten im Wind. Ein Reiher flog auf. Er zog flach über das Wasser. Der Wind zeichnete Wellen auf den See. Am anderen Ufer glommen zwei Zigaretten auf. Es waren Angler, die auf Aal aus waren. Ich kannte die Männer. Aber sie kannten mich nicht. Hin und wieder näherte ich mich ihnen bis auf wenige Meter. Ich sprach sie nie an. Ich hörte das Zischen der Kronkorken, das Rülpsen, ich hörte ihr Schweigen, ihr Warten auf Fische, die irgendwann bissen, die sie dann in die Kühlbox steckten und an der Fischbude weiter unten am See verkauften oder selbst aßen. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, setzte mich auf eine Bank. Seit der Borreliose, die ich mir von einem Zeckenbiss geholt hatte, bekam ich das Schwitzen nicht mehr in den Griff.
Ich dachte an den Jungen. Er fehlte mir. Ich fühlte seine Abwesenheit in allem: In der Nachtluft, im Glucksen des Sees, wenn ein Fisch aufstieg und den Kopf, die Rückenflosse aus dem Wasser schob und wieder verschwand. Der Junge kannte den Wald: Die Hitze im Sommer, die sich unter die Bäume spannte, an ihrer Rinde leckte, die aufsprang. Die Kälte im Winter, das Ächzen und Knacken der Stämme im Frost. Er mochte den Herbst, das Abendlicht im Ahorn, ein Brennen auf den Blättern. Er hatte mich begleitet, wenn die Rehe in der Dämmerung auf den Lichtungen standen. Wir hatten den Tieren beim Äsen zugeschaut. Der Junge hatte meine Hand genommen. Seine Augen hatten geglänzt – wegen all der Andacht. Schließlich hatten sie die Köpfe gehoben, uns gewittert und waren im Unterholz verschwunden, mit schnellen, nur selten hastigen Sprüngen. Ihr Spiegel, der helle Fleck am Hinterteil, im Winter weiß, im Sommer gelblich, war das Letzte, was wir sahen. Er kannte die Laute der Ricken, ihr Fiepen, während die Böcke in der Brunftzeit im Juli und im August ein kurzes, kräftiges Bellen ausstoßen. Wer sich nicht auskennt, vermutet einen Hund. Es kam vor, dass ich den Jungen suchte. Ich lief zum Fluss, in die Auwälder, die Erlen, die Buchen, deren Stämme das Licht so stark reflektieren, hinaus auf die Wiesen, ich fand ihn im Gras liegend, er schaute den Lerchen zu, die im Fliegen, eine Art Schwirrflug, singen. Er liebte die Balzflüge der Kiebitze. Die Männchen warfen sich in der Luft hin und her, wobei die Flügel wummernde Geräusche machten und in der Sonne grün und violett aufschimmerten.
Der Schuss war nah. Er zerriss die Stille. Ich sah, dass die glimmenden Zigaretten in die Höhe schossen, weil die Männer von ihren Faltstühlen hochgeschnellt sein mussten. Der Hund schlug wieder an. Erneut geriet das Tier außer sich. Hatte der Hund sich so weit vom Hof entfernt? Es war keine Jagdzeit. Nicht für Rehe. Auch die Böcke hatten noch Schonzeit. Ein zweiter Schuss. Ich machte mich auf. Wenn jemand Rehwild jagte, würde er den Tieren auf den Feuchtwiesen auflauern. Nur dort waren sie gut auszumachen. Entweder mit bloßem Auge oder einem Nachtsichtgerät. Es konnte kein Jäger sein. Jäger fuhren mit ihren Geländewagen in den Wald. Ich hätte sie in der Nacht hören müssen.
Ich war leise. Sie nicht. Sie standen auf dem Waldweg, der zu den Wiesen führte. Das Aufbranden von Stimmen, das Laden einer Waffe. Es musste ein Kipplaufgewehr sein, dessen Lauf man zum Nachladen aufklappen musste. Der Hund lag ausgestreckt vor ihnen. Seine Flanken zuckten. Sein Schwanz schlug auf den Boden. Er hielt den Kopf geduckt. Ich schlich mich seitlich an ihnen vorbei, entlang eines Schilfgürtels, der längs des Bachs verläuft und die Wiesen vom Wald trennt. Dort war ich von den Männern nicht zu sehen, und das Gras dämpfte meine Schritte. Am Rand des Schilfs lag ein Reh. Es blutete aus einer Wunde am Bauch. Das Blut floss schnell. Ich sah die Angst in den Augen. Wahrscheinlich wussten die Kerle, nachdem sie es angeschossen hatten, nichts mit dem Tier anzufangen. Ein Kitz lag an seiner Flanke. Es war keine Woche alt. Sein Schädel war eingeschlagen. Ich kehrte um, schnappte mir einen Eichenstecken. Jansen, mein Nachbar, hatte sie vor ein paar Wochen geschnitten und am Rand der Wiesen deponiert. Ich pirschte mich an die Männer heran, ihre Rücken waren mir zugewandt, der Hund kroch auf die Männer zu. Ein Labrador, den Jansen vor ein paar Monaten bei einem Züchter gekauft hatte. Die Männer verstanden ihr Handwerk nicht. Ein ums andere Mal hob das Tier den Kopf, ruderte mit den Hinterläufen, robbte weiter auf die Männer zu, was alles nur noch unerträglicher machte. Der Hund blutete aus der Brust. Ich stand nun keine drei Meter mehr hinter ihnen, konnte die Männer nicht mehr ansprechen, konnte das nicht wagen. Vielleicht würden sie vor Schreck überreagieren. Vielleicht wollte ich sie auch nicht ansprechen. Vielleicht wollte ich das, was ich tat, genau so tun, wie ich es tat. Ich schlug, bevor sie mich bemerkten. Ich schlug auf den Rücken des rechts stehenden Mannes. Traf auch den Nacken. Der erste Schlag muss sitzen. Es gibt keinen zweiten, wenn der erste fehlschlägt. Der zweite Schlag traf den anderen an der Schulter. Ein dumpfes Geräusch war zu hören. Ein Geräusch, wenn morsches Holz bricht. Er sackte zusammen, stöhnte, blutete aus dem offenen Hemdkragen. Das Blut rann über seine Brust und das Amulett an der Halskette, eine Feder aus Silberblech, deren Schaft gezackt war. Ein Bursche von vielleicht 20 Jahren. Der andere schien bewusstlos zu sein, rührte sich nicht. Er war dunkelhaarig, etwa im gleichen Alter. Der Hund winselte, hielt inne, streckte sich auf dem Boden aus. Ich sah, dass seine Augen schmaler wurden. Schließlich kroch er und quälte sich auf mich zu, als wäre ich seine Rettung, als könnte ich ungeschehen machen, was ihn nun töten würde. Seine Schnauze furchte den Boden.
Der Mann keuchte. Ich schaute ihn an und schwieg. Er schleppte sich zu einem Baum, richtete sich ein Stück auf, so, dass er sitzen konnte. Man sah, dass er Schmerzen hatte und nur mit einer, der unverletzten, Schulter am Baum lehnte. Der andere war bleich, war wie tot. Ich fühlte seinen Puls. Er ging langsam, aber regelmäßig. Dann schrie das Reh. Ich nahm das Gewehr. Was blieb mir anderes übrig. Ich hatte nie ein Reh schreien hören. Ich hatte den Mann in dem Loch in Afgoye schreien hören. Ich habe ihm nicht helfen können. Vielleicht ihm auch nicht helfen wollen. Ich kann den Blick nicht vergessen, keinen der Blicke. Den Blick des Mannes nicht, den Blick des Hundes nicht, ich spähte zu dem Reh. Es versuchte den Kopf in Richtung des erschlagenen Kitzes zu drehen. Ich wählte das Reh. Vielleicht weil ich den Hund kannte. Ich dachte an den Jungen. Ich wusste, ich würde nicht schießen können, wenn ich an den Jungen dachte, weil er die Rehe liebte. Ich sah den Mann in dem Loch vor mir. Ich war inkognito. Ich war ein Somali, war einer in der Menge. Niemand zuvor hatte eine Steinigung in Somalia fotografieren und belegen können. Vor allem: Das Foto war gut. Kein unnötiges Beiwerk. Die Details sprachen: Blut, das aus der zerschlagenen Hirnschale drang, über sein Gesicht rann, das Hemd einfärbte, auch die Steinbrocken und die Erde, in die sie den Mann bis zu den Schultern eingegraben hatten. Man hatte ihn wegen Ehebruchs verurteilt. Das Foto, das den World Press Photo Award gewann. Kein Preis ist wichtiger in der Branche bis auf den Pulitzer. Das Reh hob den Kopf, zuckte mit den Läufen, als wollte es fliehen. Ich setzte den Lauf auf die Brust. Ich hatte lange nicht mehr geschossen. Ich wandte den Kopf ab, als ich schoss. Der Stein traf ihn im Gesicht, die Lippen platzten, die Nase brach. Das Gesicht war blutüberströmt. Ein weiterer Stein traf ihn an der Schulter. Sein Hemd riss auf, auch die Haut. Ich ging einen Schritt von der Enduro weg. Wenn ich ein Foto von den Männern haben wollte, die warfen, musste ich seitlich stehen, musste mich aus dem Schutz der Menge lösen. Wenn es ein Frontalfoto von den schmächtigen Männern in Flip-Flops geben sollte, musste ich hinter den eingegrabenen Mann gelangen. Mein Herz raste. Der Schweiß tropfte in meinen Nacken, auf meine Nase. Die Paste in meinem Gesicht, der dunkle Bronzeton, würde der halten? Der Junge, der mich hierher gebracht hatte, ging nun voraus … langsam … sich wiegend in den Hüften, ein Singsang auf seinen Lippen, so wie auch die Menge sang, als ein Stein den Mann an der Stirn traf und der Kopf nach hinten in den Nacken schlug. Weitere Männer traten vor, hielten Steine in den Händen. Keiner zu groß, keiner zu klein. Keiner, der den Tod zu früh eintreten ließ, keiner, der ihn nicht näher brachte. Ein melodisches Rufen und Antworten kam aus der Menge, ein kehliger Gesang, der nun stärker wurde, anschwoll, da der Kopf des Mannes sich zur Brust neigte. Ein heißer Wind strich über die Ebene, trieb Plastiktüten und Gestrüpp vor sich her. Die Menge stampfte. Der Boden vibrierte unter meinen Füßen. Wir schoben uns weiter. Ich kopierte den Gang meines Begleiters, das Trippeln und Tänzeln, das Rollen der Schultern, das rhythmische Wiegen des Kopfes. Der Stein krachte auf den Schädel. Er sprang auf, wie eine Kokosnuss platzt. Blut und eine helle Spur Hirnwasser flossen aus. Dieses Foto, und auch das Foto noch, frontal auf die Gesichter der Männer gehalten, in keinem Wut.
Als ich auf den Waldweg zurückkehrte, war der Mann, der am Baum gelehnt hatte, verschwunden. Der Hund rutschte auf mich zu. Ich ließ das Gewehr aufschnappen. Die leere Patronenhülse fiel heraus. Die zweite Flinte fehlte. Ich musste mich entscheiden. Ich konnte dem Hund helfen zu sterben. Ich konnte dem Ohnmächtigen, der dort lag, helfen wieder zu sich zu kommen, und ich sollte mich in Sicherheit bringen. Ich hob das Tier auf. Der Hund war schwer. Ich schlug den Weg zu unserem Hof ein. Ich würde Jansen von dort anrufen. Der Hund röchelte. Ich fühlte, dass sein Gewicht in meinen Armen zunahm: Wann genau er starb, weiß ich nicht. Ich trug ihn, bis ich den Hof erreichte. Nirgendwo brannte ein Licht. Mein Vater schien von den Schüssen nicht aufgewacht zu sein. Ich legte den Kadaver neben die Tür, rief Jansen an, ich erreichte ihn nicht. Ich setzte mich an den Küchentisch, trank ein Glas Wasser. Der Schweiß lief über mein Gesicht. Ich musste zu Noeten. Wegen des Rehs, wegen des Kitzes. Wenn er nicht gesoffen hatte, würde er in der Nacht noch rauskommen. Er würde die Tiere ausnehmen und entbeinen. Ich stapfte durch die Nacht, die vollkommen still war. Der Junge hatte sie hören können, die Stille. Jedenfalls hatte er das gesagt. Sie sei nie gleich. Jetzt war die Stille zu still. Mein Vater hatte einen leichten Schlaf. Er musste die Schüsse mitbekommen haben. Auch Noeten. Auch er musste längst unterwegs sein. Er arbeitete für den Forstverwalter. Es war sein Job, in der Nacht rauszufahren, wenn er Schüsse hörte, die nicht von Jägern stammten. Die Tiere hatten Schonzeit. Kein Jäger würde derzeit jagen. Ich hielt auf Noetens Behausung zu – ein Verschlag aus Brettern, Ziegelsteinen und windschiefen Fenstern. Kein Licht brannte. Ich schlug mit der Faust gegen die schrundige Metalltür. Ein paar Reiher, die entlang der Fischteiche in den Bäumen saßen, flogen auf. Ihre Schatten schwebten über dem Wasser. Noeten erschien in der Tür, rieb sich die Augen.
Was gibt’s?, fragte er. Seine Alkoholfahne stand in der Luft.
Man hat drüben an den Wiesen ein Reh und dessen Kitz getötet. Auch Jansens Hund. Hast du die Schüsse nicht gehört?
Nein.
Kannst du …?
Ich kümmere mich drum.
Noeten zog die Tür zu, ohne abzuwarten, ob ich noch etwas sagen wollte. Alkohol schabt alle Höflichkeit von uns ab. Er macht uns so schroff, wie wir sind. Ich dachte an Vater. Er hätte längst wach sein müssen. Diesmal rannte ich. Eine Eule flog auf, kreuzte zwischen den Baumstämmen.
Vaters Zimmer war leer. Sein Bett aufgeschlagen, aber noch warm. Ich rannte zum Schuppen. Sein Wagen stand dort. Ich nahm eine Taschenlampe aus dem Regal und machte mich auf. Der Wald war immer noch still, kein Laut nirgendwo, was ungewöhnlich war, denn der Wald ist in der Nacht nie ganz still. Und in dieser Stille war noch eine andere Stille. Konnte es sein, dass mein Vater sich in den Wald aufgemacht hatte wegen der Schüsse, hatte ihn das Jaulen des Hundes aufgeschreckt, hatte er mein Fehlen bemerkt, wollte er nachschauen? Ich hätte ihm begegnen müssen, es sei denn, er hätte einen anderen Weg gewählt. Ich musste zurück zu der Stelle, wo das mit Jansens Hund geschehen war. Wieder rannte ich. Einmal noch vernahm ich ein Knacken wie von einem Ast, der brach. Erst kurz vor den Wiesen wurde ich langsamer. Ich war nun fast dort, wo der Mann liegen musste. Ich spähte in die Dunkelheit. Ich konnte den Mann, den ich niedergestreckt hatte, nicht ausmachen. Ich knipste die Taschenlampe an. Wir sind unvorbereitet – für beinahe alles, was uns widerfährt. Die beiden Männer waren es vorhin gewesen, und ich war es nun: Mein Vater lag in dem Bach, der die Wiesen entwässerte. Der Strahl meiner Taschenlampe traf ihn. Er lag mit dem Kopf im Wasser, und einer der Männer hockte über ihm, der andere seitlich daneben. Er hielt den Kopf meines Vaters. Er hatte ihn unter dem Kinn gepackt, und mit der anderen Hand schlug er in sein Gesicht, das ganz unbewegt war, in dem nur noch die Augen rollten, und der Mann schaute mich an und schlug ein weiteres Mal zu. Diesmal war es die Faust, und Vaters Kopf kippte nach hinten. Da erst, als unsere Blicke sich trafen, als hätten sie auf diesen Moment gewartet, sprangen die Männer auf; nein, sie erhoben sich, so wie man sich nach dem Knien in einer Kirchenbank erhebt. Sie kletterten aus dem Graben, nahmen das Gewehr, sprangen mit einem Satz über den Bach. Ich rührte mich nicht, sah sie über die Wiesen davongehen. Dann erst stürzte ich auf meinen Vater zu. Er blutete aus der Nase. Sein Mund hing schlaff herunter. Auch das rechte Augenlid. Sein ganzes Gesicht schien aus der Form geraten zu sein. Als hätte man aus einem Bilderrahmen alle Nägel gezogen oder allen Leim entfernt, sodass der Rahmen in sich zusammensinkt, schief wird, und schief war das Gesicht meines Vaters. Ich wollte ihn aufrichten, dass er nicht mehr mit dem Hintern im Wasser saß, aber er sackte in sich zusammen. Er hatte keine Körperspannung, die Beine schlackerten, sie waren Weichteile ohne Tonus, und mein Vater sprach nicht, er konnte nicht antworten, was immer ich sagte, womit ich ihn beruhigen wollte, obwohl er ganz ruhig zu sein schien, seine Zunge rollte nur steif im Mund, ich verstand kein Wort, nur ein seltsam heiseres Hauchen war zu hören, vielleicht ein Murmeln, ein Nuscheln, ein Blasen der Laute, die keine Laute mehr waren.
2
Ich zog Vater aus dem Bach, legte ihn ins Gras, strich ihm über die Wange, fühlte seinen Puls, ein Wagen näherte sich. Es war Noeten. Ein Blick genügte ihm. Er nahm sein Handy aus der Tasche, sagte, was zu sagen war. In der Ferne sprang ein Motor an, Räder drehten im Sand, die Räder fassten, und ein Wagen entfernte sich schnell auf einem der Waldwege. Wir hievten Vater in Noetens Auto, er fuhr zu unserem Haus und hinaus zur Straße. Ich hielt Vater auf dem Rücksitz im Arm, er war schwer. Er war schwer, wie der Hund vorhin schwer gewesen war. Wir fuhren durch die Nacht, an den Fischteichen, an Noetens Behausung vorbei. Manchmal rollte ein gebrochener Laut über Vaters Lippen, etwas ganz und gar Unverständliches. Seine linke Wange und ein Mundwinkel hingen schief herunter. Sein Blick war starr. Von Zeit zu Zeit rollte er die Augen, und das Weiß in den Augäpfeln schien auf. Einen Moment lang, als wir vielleicht schon zehn Kilometer die Straße hinuntergerast waren, und das Martinshorn ertönte, und das Blaulicht durch die Nacht riss, auf den Buchenstämmen hin und her flackerte, von Baum zu Baum sprang, sah ich Angst in seinen Augen. Es war die Angst, die ich in den Augen des Rehs gesehen hatte, aber es war eine Regung, es war der Hinweis darauf, dass das Hirn meines Vaters auf irgendeine Art noch arbeitete.
Man schob ihn in den Krankenwagen. Sofort begannen die üblichen Handgriffe. Sie drückten eine Sauerstoffmaske auf sein Gesicht, es war fahl. Ich stieg zu Noeten in den Wagen. Der Krankenwagen jagte davon. Noeten gab Gas. Seine Augen flackerten im Blaulicht. Seine Kiefer mahlten. Ich hatte es gespürt, als man meinen Vater in den Krankenwagen geschoben hatte, und ich fühlte, wie es sich nun in mir ausdehnte. Zug um Zug. Seitdem bin ich es nicht mehr losgeworden, dieses Gefühl, eine Düsternis. Sie erfasste alles. Noeten reichte mir eine Packung Zigaretten. Ich lehnte ab. Ich ahnte, was vor mir lag. Ich wollte das Rauchen noch ein wenig hinausschieben.
Wir finden sie, murmelte Noeten, als spräche er zu diesem Gefühl in mir, für das ich noch keinen Namen hatte. Ich nickte und fuhr mit dem Finger über die Schachtel.
Wenn es nicht stark regnet und wir die Reifenspuren entdecken, kriegen wir sie. Noeten sprach ruhig. Aber hinter seiner Stimme lag die Wut. Er würde es ihnen nicht verzeihen. Das mit meinem Vater nicht und das mit den Tieren nicht. Noeten mochte die Tiere mehr als er die Menschen mochte. Vielleicht ging es uns allen hier im Wald so. Dann schwieg Noeten, und seine Worte hingen im Wagen. Ich kannte ihn. Er tat, was er sagte. Er würde mir und sich keine Ruhe mehr lassen, bis wir sie aufgespürt hatten. Vielleicht beruhigte mich das, denn wir würden sie finden müssen, das stand fest.
Sie nahmen Vater Blut ab. Sein Gesicht war noch ein wenig schiefer als vorhin. Auf dem Kopf trug er einen helmartigen Aufbau. Sie schoben ihn in die Röhre des Kernspintomographen. Ein klopfendes, taktendes Geräusch machte sich breit. Man führte mich hinaus in die Wartezone zu Noeten – ein Flur voller Korbsessel. Bis auf eine Frau, sie trug ein Kopftuch und an den Füßen Latschen, waren wir die Einzigen, die sich hier aufhielten. Noeten lief unruhig den Flur auf und ab. Er hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und schaute ins Leere. Die Frau las. Manchmal fuhr der Blick von der Zeitschrift auf, flüchtete in den Flur zu Noeten und mir, verschattete schnell, schien dann nur noch ihre Füße und das Linoleum zu fassen. Als die Tür aufflog, stand sie auf, folgte dem Arzt. Die Tür wippte noch ein paar Mal nach, kam zur Ruhe. Noetens Schritte quietschten auf dem Linoleum. Es glänzte, musste frisch poliert worden sein. Ich schloss die Augen, ich sah das Reh und den Hund vor mir. Ich sah die Männer. Sie waren jung, kaum älter als 20. Ich versuchte mir ihre Gesichter vorzustellen. Ich durfte ihre Gesichter nicht in mir verlieren. Einer war dunkelhaarig, der andere blond. Sie hatten Deutsch gesprochen, akzentfrei. Wir holten uns an einem Automaten einen Kaffee, nippten an der Brühe und warteten. Niemand sprach. Noeten hatte dunkle Schatten unter den Augen. Auch ich kämpfte mit dem Schlaf. Schließlich schob man meinen Vater den Flur entlang. Ich sprang auf. Vater rührte sich nicht in seinem Bett. Ich nahm seine Hand. Sie war kühl und schweißnass. Man brachte Vater zu einem Aufzug. Ein Arzt, ein noch junger Mann mit dunkler Hornbrille und Bart, trat auf mich zu, noch bevor ich den Aufzug betreten konnte. Er führte mich zu einem Raum, zeigte auf einen der Bildschirme, er sprach ruhig, und ein leises Bedauern, ein mattes Mitgefühl war zu hören, als er auf die dunkle Stelle in meines Vaters Hirn wies, eine Blutung, groß wie eine Walnuss.
Wir bringen ihn auf eine Station hier im Haus, die spezialisiert ist auf Patienten, die einen Schlaganfall oder – wie im Falle Ihres Vaters – eine Hirnblutung erlitten haben.
Ich wollte ihn fragen, aber er kam meiner Frage zuvor. Vielleicht wird sie ihm jedes Mal gestellt in einem solchen Fall. Vielleicht lag sie auch auf meinen Lippen, und er sah sie, noch bevor ich sie auf meinen Lippen wusste.
Man muss abwarten. Für eine Prognose ist es viel zu früh. Die nächsten Stunden werden entscheiden, ob er überlebt und wie er überlebt. Er fuhr sich mit der Hand übers Kinn. Alles Weitere später. Kommen Sie.
Er brachte mich zum Aufzug zurück. Wir fuhren hinunter in den Keller. Im Flur lag Abdeckfolie auf dem Boden. Frischer Farbgeruch hing in der Luft. Bei jedem Schritt raschelte die Folie.
Warum ist meinem Vater das passiert?, fragte ich in das Rascheln.
Ein Gefäß ist geplatzt. Hatte Ihr Vater Bluthochdruck?
Nein.
Der Arzt blieb stehen, schaute mich an. Nahm seine Brille ab, putzte die Gläser mit einem Taschentuch.
Hatte Ihr Vater einmal einen Unfall, eine Verletzung am Schädel?
Hören Sie, zwei Männer haben ihn überfallen. Ich fand ihn in einem Graben. Sie saßen auf ihm. Schlugen ihn.
Der Arzt setzte seine Brille wieder auf, nickte.
Das also. Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrem Vater.
Er ging voraus.
Sie sollten mich aufklären, rief ich ihm hinterher.
Mein Ton geriet zu scharf – wie immer, wenn die Angst mich packt. Er blieb stehen, wandte sich um.
Steigt der Blutdruck plötzlich über alle Maßen, kann ein Gehirngefäß reißen – vor allem, wenn die Gefäßwand durch Ablagerungen geschwächt ist. Wir sprechen von einer hypertensiven Blutdruckkrise. Ihr Vater ist keine 30, Sie verstehen. Es war zu viel für ihn.
Einen Moment wurde mir schwindlig.
Gehen wir, sagte der Arzt und eilte schon wieder davon.
Sie sollten die Männer anzeigen, das wissen Sie.
Ich schwieg.
Wir kamen zu einer doppelflügeligen Tür. Stroke Unit las ich auf dem Schild. Er stieß die Tür auf. Wir traten in einen Flur. Die Luft roch verbraucht. Die Türen der Patientenzimmer standen offen. Aus allen drang das Piepen der Überwachungsmonitore. Der Arzt hielt auf ein Zimmer am Ende des Flurs zu. Mein Vater lag in einem Bett in der Nähe des Fensterschachts. Der Tropf lief. Weitere vier Betten waren belegt. Die Kranken waren verschwunden im Weiß der Laken.
Wir geben Ihrem Vater ein Medikament, das den Hirndruck senkt. Es darf nicht zu Nachblutungen kommen.
Vater hatte die Augen geschlossen. Sein Haar war in die Stirn gefallen. Er hatte noch immer schönes Haar. Ein Fuß schaute unter der Bettdecke hervor. Ich zog die Decke über den Fuß und setzte mich zu ihm. Ich wusste, das Warten begann. Ein Warten, das vielleicht in ein paar Stunden oder Tagen beendet sein würde, falls mein Vater sterben würde. Ein Warten, das Monate, Jahre anhalten mochte, wenn er die Hirnblutung überlebte. Es wäre ein Warten auf kleine Erfolge. Das Bewegen eines Zehs, eines Fingers, bevor die Zeit meinen Vater endgültig löschte, wie sie alles löscht. Ich nahm seine Hand. Sie war mir fremd. Ich hatte sie nie zuvor gehalten. Er mochte meine gehalten haben. An meinem Krankenbett, als man mir den Blinddarm entfernt hatte. Ich stelle mir vor, dass er sie gehalten hat. Ich habe keine Erinnerung daran. Seine Hand war kalt, aber trocken. Sie schwitzte nicht mehr. Ich strich über seinen Arm, über die weiche Haut der Innenseite. Sein Arm war nicht dicht behaart. Wir wissen kaum etwas von den Details jener Menschen, die uns nah sind. Eine Zeit lang kennen wir alles von unseren Kindern. Noch kannte ich jeden Zug im Gesicht des Jungen, den Haaransatz, die Form der Fingernägel, die Rundung der Nagelmonde, die vernarbten Schrammen an Knien und Schienbeinen, bis dieses Wissen eines Tages verloren gehen würde. Ich tat einen Schritt vom Bett weg, machte einen Schritt zur Tür hin, kehrte um, sah in sein blasses, schiefes Gesicht, machte abermals kehrt und trat hinaus auf den Gang, trieb den Flur auf und ab. Ich konnte einfach nicht sitzen. Irgendwann tauchte Noeten auf. Er brachte mich hinaus, reichte mir draußen vor dem Krankenhaus die Packung Zigaretten, und ich rauchte.
Meinen Vater hatte ich stets gemocht. Nicht wie ein Sohn seinen Vater mag, nein, als Typ, als die Sorte Mensch, die er war oder ist, hatte ich ihn gemocht. Ich erschrak, weil das Tempus schon nicht mehr sicher war. Er hatte mich, wann immer es darauf ankam, verteidigt. Ich hatte ihn vor ein paar Stunden nicht schützen können.
Es war ein extrem warmer Sommer damals. Ich hatte mein Abitur gemacht, genoss die Zeit, fuhr mit Maria ans Meer, ins Gebirge, suchte nach einem Job, war unschlüssig, ob und was ich studieren sollte. Ich fand Arbeit bei einem Fotografen. Kremer arbeitete für verschiedene Zeitungen in der Region, stellte mich als eine Art Assistent ein. Ich begleitete ihn zu den Fototerminen. Lokalpolitik, Vernissagen, Kleinkunst. Ab und zu ein Bundesligaspiel, bei dem wir am Spielfeldrand standen und Fotos schossen. Das war damals noch möglich. Heute sind die Fotografen hinter die Abgrenzungen verbannt. Nachts kehrte ich selten heim. Ich schlief bei Maria. Bisweilen machte ich Fotos von ihr. Ich war verliebt, wie ich es vielleicht nie mehr gewesen bin, ohne jede Vorsicht, ohne doppelten Boden. Auch ein paar Aktfotos. In der Halbzeitpause, jenen mehr oder weniger öden 15 Minuten, in denen der Ball ruht und die Fans sich mit Bier und Bratwurst eindecken, ließ ich mich dazu hinreißen, ihm die Fotos zu zeigen. Er legte sie an der Außenlinie aus. Es waren vielleicht 20 Fotos. Er beugte sich über sie. Studierte sie. Am Ende bat er, ihm die Fotos zu überlassen. Er würde sie prüfen. Vielleicht für einen Wettbewerb einreichen. Sie seien gut, sehr gut. Meine Eitelkeit war größer als mein Schamgefühl Maria gegenüber. Er verkaufte sie ohne mein Wissen. Ein, zwei Jahre später tauchte eines der Fotos in irgendeinem Magazin auf. Jemand hatte es Maria gesteckt. Am gleichen Tag verlor ich sie. Ihre Wut war größer als ihr Vertrauen, dass ich sie nicht belog, dass Kremer mich damals wirklich hintergangen hatte. Ich fuhr am Abend zu ihm hinaus. Ich sah Licht, schellte. Kremer öffnete nicht. Ich hatte schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu ihm, war mit Maria nach Köln gegangen. Hatte dort Ruffins kennengelernt und war oft für viele Wochen bei ihm in London. Er hatte mich eingearbeitet und mir gezeigt, worauf es beim Fotografieren ankam.
Kremer löschte das Licht. Ich hämmerte mit der Faust gegen die Tür, schrie seinen Namen. Ich zertrümmerte mit einem Stein ein Fenster, stieg ein. Er hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Ich trat die Tür ein, schlug ihn nieder, schlug immer wieder auf ihn ein. Kremer war damals in den 50ern und kein Gegner für mich. Als ich mit ihm fertig war – ich hatte ihm mehrere Rippen und die Nase gebrochen, wie ich später erfuhr –, zertrat ich seine Kamera. An meiner Wohnungstür erwartete mich Polizei. Die Maschinerie lief an. Für zwei Tage U-Haft. Später der Prozess. Eine Bewährungsstrafe. Mein Vater hatte einen Anwalt besorgt. Vater war es auch, der mit Ruffins telefonierte und ihm die Sache mit den Fotos erklärte. Ruffins verlor kaum ein Wort darüber, als ich wieder bei ihm in London auftauchte. Maria blieb für mich unerreichbar.
Gegen Mittag stieg ich zu Noeten in den Wagen. Ich konnte für meinen Vater nichts mehr tun. Noeten fuhr mich nach Hause. Auf der Fahrt sprachen wir kaum. Es gab nichts zu sagen, und das, was zu sagen wäre, wagten wir nicht auszusprechen.
Der Wind trieb Staubfahnen über den Hof. Bei jedem Schritt, den ich auf das Haus zumachte, wurde ich mutloser. Die Blätter der Eichen trugen ein violettes Grün, hatten sich gerade erst entrollt. Noeten saß regungslos hinter dem Lenkrad, schaffte es nicht, davonzufahren. Ich schaffte es nicht, ins Haus zu gehen. Die Stille dort würde ich nicht ertragen. Ich setzte mich auf die Bank vor dem Haus, fühlte die Sonne auf dem Gesicht, hörte die Stille wachsen, stocherte mit einem Stock in der Kuhle vor meinen Füßen. Noeten rauchte. Durch das offene Autofenster stieg der Qualm, kräuselte sich in der windstillen Luft, dann startete Noeten den Motor. Er streckte seine Hand durch das Fenster und winkte mir zu. Erst als er die Straße erreichte, verschwand die Hand im Wageninneren. Ich kannte die Stille. Als das mit dem Jungen geschah, war es nicht anders gewesen. Diese Stille ist immer gleich. Vater war kurz zuvor von einer Fahrt ans Mittelmeer zurückgekehrt. Er war damals nur im Winter verreist. Wegen der Tauben. Die Tauben waren sein Ein und Alles. Im Winter gab es für Vater und den Jungen im Taubenschlag nichts zu tun. Die dunkle Jahreszeit verdösten die Tauben. Erst im Frühjahr mussten Wettflüge absolviert werden. Die beiden hatten es ambitioniert aufgezogen, teure Tiere in Holland und Belgien gekauft. Zwei, drei Jahre gezüchtet, dann hatte der Erfolg bei den Wettflügen kommen sollen. Er war glücklich, dass der Junge mit ihm diese Leidenschaft teilte. Schon in seiner Kindheit hatte Vater Tauben gehalten. Ihre Tauben flogen die Strecken heim von Lüttich und Paris, sie fanden zurück von Tours und Bordeaux. Aber sie waren nicht schnell. Sie gewannen nie, obwohl der Junge und Vater alles dafür taten. Sie schulten die Tauben beharrlich, absolvierten zu den Wettflügen noch zusätzlich Trainingsflüge. Vater fuhr die Tauben, die der Junge in flache Weidenkörbe gesperrt hatte, in seinem Wagen zu einem Auflassort 30, 40 Kilometer entfernt. Dort ließ er die Tiere frei und schrieb uns eine SMS mit der Auflasszeit, während der Junge auf die Tiere wartete. Er hatte auf dem PC eine Tabelle entworfen, die Ringnummern der Tauben eingetragen, und nun schrieb er die Ankunftszeit von jeder Taube in die Tabelle, errechnete ihre Fluggeschwindigkeit, verglich diese mit den Ergebnissen weiterer Trainingsflüge und erhielt somit ein Verlaufsprofil über die Fitness der Tauben. Dieser Enthusiasmus für eine Sache. Er entsteht in der Kindheit. Manchmal trägt er einen Menschen ein Leben lang.
Der Wind ließ nicht nach, fegte Laub über den Hof. Mir wurde kalt, trotz der Sonne. Ein nasales Krakeelen klang am Himmel auf. Eine Formation Graugänse querte. Ihre Flugschatten zogen über den Wald. Sie würden gleich in den Feuchtwiesen landen. Obwohl alles schon so lange zurücklag, wanderte mein Blick über den Himmel, wenn dort ein Vogel vorüberzog. Etwas, das sich nicht abstellen ließ. Ich ging ins Haus, setzte mich an den Küchentisch, trank ein Glas Wasser, schaute hinaus in den Wald. Die Buchen reichten nahe an die Rückseite des Hauses heran. Ihre Kronen bildeten ein Gewölbe. Betrat man dieses Gewölbe, glaubte man in ein Kirchenschiff zu treten. Ich fühlte die Müdigkeit. Das Haus entspannte mich. Jedenfalls hatte es das all die Jahre bis zum Verlust des Jungen getan und vielleicht auch noch darüber hinaus. Und doch hatte ich mich oft gefragt, ob mein Leben an einem anderen Ort nicht besser zu ertragen gewesen wäre. In der ersten Zeit hatten wir oft am Küchenfenster gesessen und in den Wald geschaut, weil wir nicht vor dem Haus sitzen und auf den Garten und die Wiese mit dem zerstörten Taubenschlag und in diese leere Stille am Himmel blicken wollten. Wir hatten den Frühling, den Sommer und den Herbst kommen sehen. Als es Winter wurde, hatten wir ein wenig aufgeatmet, weil die Stille nun überall war, nicht nur in uns, nicht nur am Himmel.
Ich stand auf. Ich würde ohne Vater nicht am Küchentisch sitzen können. Ich konnte ohne den Jungen nicht auf der Bank vor dem Haus sitzen. Zum ersten Mal kam der Gedanke, dass ich das Haus verlassen musste, wenn Vater starb, dass zwei Verluste zu viel waren für das Haus und für mich. Ich bewegte mich in der Küche von einer Wand zur anderen, erst mit schleppenden Schritten, dann immer eiliger. Etwas nahm von mir Besitz. Etwas, das ich nicht mildern oder auf irgendeine Art abschwächen wollte, und dessen Existenz unabhängig davon war, ob Vater starb oder überlebte. Etwas war zu erledigen, das Zeit in Anspruch nehmen würde, das geplant sein wollte, keine blinde Wut durfte mich leiten. Etwas, das mein gutes Recht war, für das ich dankbar war, würde es doch die Stille im Haus vertreiben, würde es doch den Schmerz mildern. Es waren jene Minuten, die ich in der Küche wie ein Tier im Gehege umherlief, die mein Leben retteten. Nicht mein soziales Leben vielleicht, aber jenen inneren Strom in uns, der nicht versiegen darf und von dem ich mich nicht durch eine biedere Moral, eine bürgerliche Räson oder auch nur Feigheit abtrennen durfte. Wollte ich leben, musste ich Vater, musste ich den Hund – und der Junge hätte gesagt, auch das Reh und das Kitz – rächen.
3
In der Spüle standen die Teller von unserer letzten Mahlzeit noch gestapelt, der Geruch von Brackwasser stieg aus dem Becken auf. In den Gläsern die Lachen dahingeschwundenen Weins, die eingetrockneten Ränder auf dem Glas wie Eichstriche. Ich lief hinaus in den Wald. Der Himmel schimmerte in einem dunklen Anthrazit. Ich hatte Jansen wegen des Hundes immer noch nicht angerufen. Die Gagelsträucher entlang des Wegs dufteten. Vater hatte sie besonders gemocht. Bald würden sie blühen. Im Sand zeichneten sich die Reifenspuren von Noetens Wagen noch deutlich ab. Bis hierher, bis zu diesem Zeitpunkt, war es einfach nur ein Spaziergang gewesen. Ein Spaziergang, um die Nerven zu beruhigen, um die Gedanken zu ordnen. Ich eilte zurück zum Haus, das stiller als sonst auf der Lichtung lag. Ich füllte einen Beutel mit Gipsputz. Wir hatten einen Sack davon im Schuppen stehen. Vor ein paar Monaten hatten wir die Küchenwände neu verputzt. Ich steckte den Gips in meinen Rucksack, legte einen Spachtel und ein paar Flaschen Wasser und einen Zollstock dazu, packte einen Eimer und ein paar Plastiktüten ein. Ich nahm die Kamera.
Der Himmel war noch dunkler geworden. Ich musste mich beeilen, der Regen würde heftig werden und die Reifenspuren auf den Wegen jenseits der Wiesen verwischen. Irgendwo da musste ihr Wagen gestanden haben. In der Nähe von Jansens Hof. Wahrscheinlich wusste er noch nichts von seinem Hund, es sei denn, Noeten hatte ihn informiert. Dort, wo die Männer gegangen waren, war das Gras niedergetreten. Auf den Halmen klebte bisweilen Blut, eingetrocknet und bräunlich. Ich hielt auf ein Wäldchen zu. Über mir das Tschiah eines Bussards. Die Birken raschelten im Wind. Die Stämme glänzten vor dem dunklen Himmel. Die Reifenspuren hatten sich in den Weg gefräst, der das Wäldchen durchschnitt. Der Wagen war schnell angefahren. Bis auf die Erikabüsche war der Sand gespritzt. Ich machte mehrere Fotos, benutzte den Zoom. Das Profil war deutlich zu erkennen. Ich schüttete den Gips in den Eimer, goss Wasser dazu. Eine Pampe bildete sich, die ich mit dem Spachtel verrührte, bis sie sämig und breiig war, bevor ich sie über die Reifenspuren goss. Als der Gips in den Reifenspuren gehärtet war, hob ich ihn mit dem Spachtel an. Die Gipsfläche löste sich aus dem Sandbett. Ich drehte sie um. Das Reifenprofil hatte sich im Gips abgezeichnet. Wahrscheinlich hätte ein Polizist das nicht besser gemacht. Auch vom Hinterreifen nahm ich einen Abdruck. Ich klappte den Zollstock auf und maß im Sand den Abstand zwischen Vorder- und Hinterreifen. Anschließend maß ich die Spurweite, die Distanz zwischen beiden Vorderreifen. Aus meinem Portemonnaie klaubte ich einen Zettel hervor und notierte die Längen. Die Gipsabdrücke verstaute ich in den Plastiktüten.
Ich schlug den Weg zu Jansen ein. In den Wiesen blühte Löwenzahn, ein Gelbton, der unter dem dunklen Himmel flackerte. In der Luft das rhythmische Trillern der Lerchen. Weit entfernt am Waldsaum standen Schafe. Auf den Koppeln grasten Pferde. Als ich näher kam, hörte ich das Mahlen der Kiefer und das Peitschen der Schweife in die Fliegentrauben auf ihrer Kruppe. Jansens Haarschopf nahm sich im Kontrast zu dem dunklen Hengst heller aus als sonst. Die Muskeln des Pferdes zuckten an den Stellen, wo Jansen mit der Bürste übers Fell fuhr. Jansen löste den Strick, mit dem er den Hengst an einen Pfosten gebunden hatte, und kam zu mir an den Zaun. Das Tier trabte davon.
Fahren wir, sagte er.
Du weißt Bescheid?
Jansen nickte.
Wir stiegen in seinen Wagen. Der Wagen roch. Vielleicht war es der Pferdemist unter Jansens Gummistiefeln. Ich kurbelte das Seitenfenster herunter. Regen fiel in dünnen Stiften. Jansen steuerte den Wagen zu den Feuchtwiesen. Ein paar Graugänse flogen schnatternd auf.
Ist es hier passiert?, fragte er und ließ den Wagen zum Bach hin ausrollen. Ich wusste nicht, ob er meinen Vater oder den Hund meinte. Jansen stieg aus und nahm einen alten Teppich aus dem Kofferraum. Er stakste mit dem Teppich hinaus auf die Wiesen. Er schob das Kinn vor und starrte auf die beiden toten Tiere. Sein Blick war leer. Er packte das Reh an den Läufen und zog es auf den Teppich. Wir fassten den Teppich und trugen das Reh zum Wagen, legten es in den Kofferraum. Jansen ging zurück zu dem Kitz. Er warf es sich um die Schultern. Der Kopf baumelte, die eingeschlagene Schädeldecke glänzte speckig. Die Augen waren blutunterlaufen, auch im Maul klebten große Flecken Blut.
Jeder kriegt ein Drittel vom Fleisch. Noeten hat van Haugoldt informiert. Er ist einverstanden, sagte Jansen und legte das Kitz zu dem Reh in den Kofferraum. Van Haugoldt war alter Waldadel, seine Familie bewirtschaftete die Ländereien seit Urzeiten. Er würde als Erster informiert sein wollen. Noeten hatte das richtig gemacht.
Jetzt der Hund, sagte Jansen. Bringen wir es hinter uns.
Er sprach in einem verwaschenen Singsang, wie er in der Gegend üblich ist. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, obwohl ich dort aufgewachsen bin. Mein Ohr und der Klang der Sprache vertrugen sich nicht. Wenn ich von einer Reise zurückkehrte, kamen mir ihr Ton, ihr Fluss und Rhythmus von Neuem seltsam vor. Immer noch kam Jansen nicht auf meinen Vater zu sprechen. Er fuhr zu unserem Haus. Der Hund lag neben der Eingangstür. Jansen stieg aus, ging die paar Schritte bis zu dem Hund. Er beugte sich über das Tier, Fliegen stoben auf. Er tastete die zwei Einschusslöcher in der Brust ab. In der Ferne taktete das Balzhämmern eines Spechts, und auch der Ruf des Bussards war wieder zu hören. Jansen ging in die Hocke, schaukelte leicht, um das Gleichgewicht zu halten, und schwieg. Dann schnellte er in die Höhe, nahm den Hund und trug ihn zum Wagen. Er preschte vom Hof, ohne noch ein Wort an mich zu richten.
Als ich die Haustür öffnete, ahnte ich, dass das Haus mich nicht aufnehmen würde, jedenfalls nicht mehr auf die Art, die mir all die Jahre gutgetan hatte. Ich trank in der Küche einen Schluck Wasser, ging ins Wohnzimmer. Ich fand die CD sofort. When you think that you’ve lost every thing / You find out you can always lose a little more. Ein Irrglaube, man hätte den Bodensatz von Schmerz und Verlust erreicht. Nicht besonders originell, aber manchmal sagt ein Song die Wahrheit. Ich hatte Dylans Lied, nachdem der Junge fort war, nicht wieder gehört. Ich öffnete die Fenster. Ich drehte die Musik bis zum Anschlag auf, und erst dann weinte ich. Um den Jungen, um Vater und vielleicht auch um mich.
Am Abend, die Musik dröhnte unvermindert in den Wald, stand Noeten am Fenster. Auf seinem Gesicht lag fahles Mondlicht. Er hielt einen Joint zwischen den Fingern, reichte ihn mir zum Fenster herein. Ich nahm einen Zug. Noeten baute das Zeug irgendwo abseits seiner Fischteiche an. Ein wenig verkaufte er davon an ein paar Burschen aus dem Dorf, die ihm ab und zu Gesellschaft leisteten. Ich drehte die Musik leise und zog ein zweites Mal an dem Joint.
Van Haugoldt wär sonst rübergekommen, sagte Noeten. Aber er ist unabkömmlich, hat Besuch. Vor dem Haus stehen ein paar Autos. Auch Karens Wagen.
Mein Augenlid flatterte.
Ich soll dich zur Ruhe bringen, sagt van Haugoldt.
Ich reichte Noeten eine Hand und zog ihn zum Fenster herein. Karen hatte nicht erwähnt, dass sie zu van Haugoldt wollte. Ich musste sie endlich informieren, was mit Vater geschehen war. Die Situation hatte es nicht zugelassen, dieser Ausnahmezustand, in dem ich mich befand. Ich musste es gleich morgen früh tun. Oder ihr eine SMS schreiben. Ins Konzert hinein, in van Haugoldts goldigen Abend – sein Dilettieren am Flügel. Kam man an seinem Haus vorbei, waren im Sommer die Fenster geöffnet, und das Klavier klang hinaus in den Wald und auf die Straße, und man hatte den Eindruck, als spielte er nicht nur, sondern es schien, er konzertierte – für uns, die wir an seinem Haus vorbeifuhren, oder für den Wald, der ihm schweigend zuhörte. Manchmal engagierte er professionelle Musiker, zahlte eine gehörige Summe für einen aufstrebenden Solisten vom Konservatorium, dann war auch Prominenz aus der Stadt unter den Gästen. Nicht immer hatte ich ihm absagen können. Wegen Karen. Ich mochte klassische Musik. Aber nicht bei van Haugoldt und seiner aufgeblasenen Entourage. Karen störten die Leute nicht. Karen mochte den kurzen Weg. Sie liebte es, dass es mitten im Wald in van Haugoldts Waldvilla erstklassige Musik gab.
Noeten holte ein Päckchen Tabak hervor und begann, eine Zigarette zu drehen. Aus der Hosentasche fingerte er einen Plastikbeutel. Grünbraune faserige Blütenköpfe befanden sich darin. Er nahm einen der Köpfe heraus, zerbröselte ihn in der Hand und streute das Marihuana auf den Tabak. Er rollte das Zeug in den Tabak ein, feuchtete den Kleberand des Blättchens an, drückte die Ränder aufeinander und zündete den Joint an. Noeten nahm ein paar Züge und sank in den Sessel. Ich hatte lange kein Gras mehr geraucht. Ich mochte den würzigen Geruch, ich mochte die Wirkung, aber jetzt war nicht die Zeit für einen weiteren Joint. Ich drehte die Musik auf. Noeten ließ mich gewähren. Dylan hatte mich immer begleitet. Seine reibende, näselnde Stimme, die in Zungen spricht, die die Mythen eines scheinbar nur privaten Lebens besingt, füllte den Raum.
Ich schloss die Augen und hörte Noeten sagen: Jagen wir sie! Sie haben es verdient. Ich sagte nichts. Ich schaute hinaus in den Wald. Immer war Dylan radikal gewesen, seinen Stimmen gefolgt und hatte meinen Stimmen seine Stimme gegeben, auch jetzt war er der Zeremonienmeister dessen, was kommen würde. Ich drehte die Musik leise. Dylans Gesang war nur noch ein Wispern, das zum Fenster hinausflog. Aus der Tiefe des Waldes war das Quieken eines Wildschweins zu hören, und kurz darauf, nahe am Haus, setzte im Laub das Getrappel von Hufen ein.
Glaub mir, sagte er, sie werden wünschen, es hätte diese Nacht nicht gegeben. Keinen Hund. Kein Reh, kein Kitz und auch die Sache mit deinem Vater nicht. Ich nickte. Noeten galt als jähzornig und als fanatischer Tierliebhaber. Vor ein paar Jahren hatte es einen Zwischenfall mit einem Jäger gegeben. Noetens Hund hatte abseits der Spazierwege im Wald gepirscht und das Wild vertrieben. Ein Jäger, der Noeten in die Quere kam, als Noeten nach seinem Hund suchte, tönte, er würde den Hund ohne Vorwarnung erschießen, sollte er ihn noch einmal unangeleint im Wald erwischen. Noeten geriet in Wut, schlug den Mann nieder und nahm ihm die Flinte weg. Dann musste der Mann sich ausziehen. Noeten verbrannte die Kleidung an Ort und Stelle, anschließend trieb er ihn nackt durch den Wald bis zur Straße, dort ließ er den Mann zurück und zerschlug dessen Flinte am nächsten Baum. Sechs Monate musste Noeten dafür sitzen, erhielt keine Bewährung. Während der Verhandlung hatte er keinerlei Reue gezeigt. Zudem war er bereits vorbestraft gewesen, hatte Jahre zuvor einem Mann in den Fuß geschossen. Mit Absicht. Auf einer Treibjagd waren sie aneinandergeraten. Damals hatte Noeten sich noch an Treibjagden beteiligt, für ein wenig Fleisch, einen Hasen, einen Fasan. Der Mann war aus dem Dorf gewesen. Ein Treiber wie er.
Noeten stand auf, stellte sich zu mir ans Fenster. Einen Augenblick legte er wie zum Trost seine Hand auf meine Schulter, schaute zum Fenster hinaus und schwieg. Noeten mochte Vater. Vater hatte ihm damals einen Job bei van Haugoldt besorgt, nachdem Noeten seine Arbeit in der Kartonagenfabrik verloren hatte. Noeten arbeitete sich schnell ein, lernte Bäume zu fällen und Bäume zu pflanzen, er mähte Gras und befestigte die Uferböschung des Flusses, er schnitt Hecken und Sträucher, hielt van Haugoldts Maschinen und den Fuhrpark instand, pachtete die Fischteiche und begann schließlich, ohne van Haugoldt einzuweihen, in dessen Wäldern hin und wieder einen Baum zu schlagen, um genügend Brennholz für den Winter zu haben. Bei einem Baum hatte Noeten wohl die Fällkerbe falsch gesetzt. Der Baum kippte anders als erwartet. Noeten konnte sich nicht in Sicherheit bringen, und der Baum hieb ihm das Schienbein entzwei – zu einem Zeitpunkt, da er seine Krankenversicherung aus Kostengründen schon längst gekündigt hatte. Vater übernahm die Arztkosten. Noeten bestand darauf, die entstandenen Ausgaben zurückzuzahlen, aber Vater lehnte dies ab. Es reiche, wenn er ihm ab und zu bei Arbeiten am Haus, im Garten oder am Taubenschlag zur Hand ging. Schon Noetens Vater hatte nach seiner Flucht aus der DDR, aus einem winzigen Dorf jenseits der Elbe, für Vater gearbeitet. Arbeit am Ofen, die hart und schweißtreibend war, die niemand der Gesellen mochte. Arbeit, die zuverlässig und punktgenau ausgeführt werden musste.
Aus Noetens Kleidern stieg ein Geruch auf. Der Geruch des Schmuddels: Kleidung, die getragen, dann tagelang zusammengeknüllt auf einem Haufen lag, hervorgezogen und wieder angezogen wurde. Ich roch den Mief seiner Behausung. Die Feuchtigkeit der Räume, Küchendünste, das Aroma eines Ofens, dessen Schwaden schlecht abzogen, dazu Schweiß. Männer verkommen mitunter auf so eine Art, wenn sie allein leben, erst recht, wenn sie alleine im Wald leben. Noeten lebte nach seiner Scheidung schon lange alleine. Ein, zwei Mal war er Beziehungen zu Frauen aus Osteuropa eingegangen, Frauen aus dem Katalog, hatte er uns gestanden, aber die Frauen waren geflohen vor dem Dreck in Noetens Behausung und vor der Einsamkeit im Wald.
Ein Windzug strich durchs Fenster. Es war eine der ersten wärmeren Frühlingsnächte. Die Luft roch nach dem Harz der Kiefern. Eine Luft, die die Lungen füllte. Beinahe konnte man den Harz schmecken. Er legte sich auf die Zunge. Er füllte die Nacht. Das Gras ließ uns stumm bleiben. Ich drehte den Lautstärkeregler ganz herunter. Stille hüllte uns ein. Die winzige Leuchte des Plattenspielers warf ein schwaches Punktlicht. Manchmal hörte man einen spitzen Schrei im Wald – wie von einem kleinen Kind oder einem kleinen Tier, einem Kaninchen oder einem Eichhörnchen vielleicht.
Dann begann der Wald zu rauschen. Wir fühlten den Wind, der über den Wald zog und zum Fenster hereinstrich. Wir spürten ihn auf der Haut, am Gesicht, an den Händen, in den Haaren, bis wir ein leises Fächern und Falten, ein Schwingen und Sirren hörten, ein Flügelschlagen, als zöge ein großer Schwarm Vögel über uns hinweg. Grau- und Blessgänse auf ihrem Heimflug von Sibirien. Ganz schwach drehte ich die Musik wieder auf. Noeten hatte die Augen geschlossen. Kaum merklich wippte sein Fuß. Auch mir fielen die Augen zu. Wollte ich schlafen, musste ich diesen Augenblick nutzen. Würde ich aufstehen, um mein Handy zu holen und endlich Karen eine SMS zu senden, würde der Schlaf sich wieder verflüchtigen. Wahrscheinlich war sie längst von van Haugoldt informiert worden und würde gleich zu mir kommen. Ich streckte mich auf dem Sofa aus. Dylan sang, und später in der Nacht hörte ich Noeten durchs Fenster hinaussteigen.
4
Ein Bursche von vielleicht 18 Jahren, vielleicht auch jünger, warf den ersten Stein. Es ist schwer, das Alter der Männer zu schätzen. Hunger, Elend, Verrohung lassen Gesichter anders altern als in Europa. Zudem waren es Schwarze. Mit eigenen Gesetzen des Alterns. Typographien, die ein Fremder nicht kennt. Der Stein traf den Mann am Ohr. Das Ohr riss auf, blutete. Die Männer warteten. Der Mann schrie. Er wusste, wenn er sie nicht besänftigte, würde er sterben. Nie war eine Steinigung abgebrochen worden. Auch die von vorhin nicht. Nie hatte man innegehalten. Dieses Mal, dieses eine Mal vielleicht. Er schüttelte den Kopf, rollte die Augen, brauchte die Arme zum Schutz, wollte die Hände heben und um Gnade flehen. Man sah, dass dort, wo er bis zu den Schultern eingegraben war, der Sand zitterte, sich häufelte, Furchen bildete, als würde eine Schlange sich ihren Weg unter dem Sand bahnen. Er bekam die Hände, die Arme nicht frei. Wie der Mann vor ihm nicht. Ins gleiche Loch hatten sie ihn gesteckt, nachdem man den Leichnam herausgezogen hatte. Sie warteten, schauten ihm ins Gesicht, jetzt flehte die Stimme des Mannes, hob ein anderer einen Stein auf, faustgroß, alle Steine waren etwa faustgroß, mussten es sein, denn wären sie zu groß, töteten sie den Mann sofort, wäre das Schauspiel vorbei, zu schnell und zu mild wäre die Strafe. Einer, der am Rand der Menge gestanden hatte, trat vor, machte ein paar Schritte auf das Opfer zu, bückte sich, auch er griff einen Stein und wog ihn in der Hand. Die Stimme des Eingegrabenen überschlug sich. Er bot Geld, bot sein Haus, seine Kinder, seine Frau an. Sie sollten ihn verschonen. Noch näher kamen sie an ihn heran. Zwei weitere Männer. Sie schauten ihn an, lange, mit prüfenden Blicken und maßen seine Angst. Ich hätte ihnen in den Arm fallen können. Ich tat nichts als mich zu tarnen. Mit einer Sonnenbrille, den Litham hatte ich bis weit über die Nase gezogen, die Hände geschwärzt wie in alten Filmen, als Schwarze oder Indianer von Weißen gespielt wurden, kostümiert und geschminkt. Ich saß auf meiner Enduro, ein kleines geländegängiges Motorrad. Eine Hand am Gas, die andere am Auslöser der Kamera, einen Fuß am Anlasser. Mein Mittelsmann, 600 Dollar für ihn, die meine Agentur zahlte, raunte mir ins Ohr, nur er würde, wenn es darauf ankam, mit den Männern sprechen. Ich solle nur nicken. Als verstünde ich jedes Wort, als sei ich einer von ihnen. Als sei sie mir vertraut, die Scharia, das islamische Rechtssystem.
Aschschaichu wa- ‘schschaichatu idhā zanayā fa- ‘rdschumūhumā albattata nakālan mina ‘llāhi wa- ‘llāhu ‘azīzun wa-hakīmun.
Wenn ein bejahrter Mann und eine bejahrte Frau Unzucht treiben, so steinigt sie auf jeden Fall, als Strafe Gottes. Und Gott ist gütig und weise.
Der Steinigungsvers soll ursprünglich schon Bestandteil von Sure 33 des Korans gewesen sein und sieht die Steinigung von Ehebrechern vor, berichtete mein Kontaktmann bei Amnesty International. Dennoch: Seine Authentizität ist umstritten. Vermutet wird, dass er die Praxis der Steinigung nachträglich legitimieren sollte und erst nach dem Tod Mohammeds in die Lehre eingeführt wurde, sagen Islamwissenschaftler. Seine Wirkung ist stabil. Alle Handlanger, die diese Art zu töten praktizieren, beziehen sich auf ihn. Wenige Monate zuvor war in Somalia ein 13-jähriges Mädchen gesteinigt worden. Sie war von drei Männern vergewaltigt worden. Die Hisb-al-Islam-Miliz verurteilte sie wegen außerehelichen Sexualverkehrs. Es gäbe keine Beweise für ihre Tötung. Kein einziges verdammtes Foto. Nur ein Foto würde ein unumstößlicher und belastbarer Beweis sein. Auch die vier anderen Steinigungen binnen eines Jahres seien nicht fotografiert worden. Ob ich mir das zutrauen würde? Ich wäre auf mich allein gestellt. Im Fall einer Notlage fehlten staatliche Stellen, die Hilfe leisten könnten. Die Gewährung konsularischen Schutzes sei nicht möglich. In Somalia gäbe es keine deutsche Auslandsvertretung. Auch Botschaften anderer westlicher Länder existierten dort seit Jahren nicht mehr.