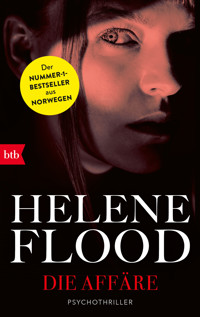9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine gutbürgerliche Nachbarschaft in Oslo: Auf offener Straße bricht Erling zusammen und stirbt. Allein im großen gemeinsamen Haus sitzt Evy, seine Frau, mit der er seit fünfundvierzig Jahren verheiratet war. Irgendetwas – das wird ihr immer klarer – stimmt nicht mit dem Tod ihres Mannes. Gegenstände verschwinden aus dem Haus, die drei erwachsenen Kinder verbergen Dinge vor ihr, und die Kellertür, die immer verschlossen ist, steht plötzlich offen. Nach vielen Jahren taucht ein alter Freund aus Erlings Jugend auf, und teilt Evy Unglaubliches mit. Wer wollte Erling schaden? Und verfolgt derjenige, der ihm nach dem Leben trachtete, nun auch Evy?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Eine gutbürgerliche Nachbarschaft in Oslo: Auf offener Straße bricht Erling zusammen und stirbt. Allein im großen gemeinsamen Haus sitzt Evy, seine Frau, mit der er seit 45 Jahren verheiratet war. Irgendetwas – das wird ihr immer klarer – stimmt nicht mit dem Tod ihres Mannes. Gegenstände verschwinden aus dem Haus, die drei erwachsenen Kinder verbergen Dinge vor ihr, und die Kellertür, die immer verschlossen ist, steht plötzlich offen. Nach vielen Jahren taucht ein alter Freund aus Erlings Jugend auf und teilt Evy Unglaubliches mit. Wer wollte Erling schaden? Und verfolgt derjenige, der ihm nach dem Leben trachtete, nun auch Evy?
Zur Autorin
Helene Flood ist Psychologin und lebt mit ihrer Familie in Oslo. Ihr erster Roman wurde bereits vor Erscheinen in Norwegen in 28 Länder verkauft. Er stand monatelang auf der Bestsellerliste. Auch ihre nächsten Psychothriller »Die Affäre« und »Die Witwe« wurden von Publikum und Presse begeistert aufgenommen.
Helene Flood
DIE WITWE
Psychothriller
Aus dem Norwegischen von Sylvia Kall
Die norwegische Ausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Enken« bei Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Helene Flood
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Published in Agreement with Oslo Literary Agency
Umschlaggestaltung: semper smile, München
unter Verwendung von Bildmaterial von Jane Morley/Trevillion Images und Shutterstock/Yarlander, mayk.75
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26397-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten?
Alexander Solschenizyn
Fuck you, I won’t do what you tell me
Rage Against the Machine
FÜNFUNDZWANZIG TAGE DANACH
Kurz bevor sie kommen, zünde ich alle Kerzen an. Die auf dem Esstisch, die auf der Anrichte, die im Regal. Ich mache mir Mühe. Mit all diesen offenen Flammen an einem so hellen Juniabend möchte ich ihnen wohl etwas beweisen. Vielleicht, dass ich keine Angst habe.
Doch entspricht das der Wahrheit? Die Kerzen flackern auf dem Tisch. Hinter mir im Wohnzimmer höre ich das Ticken der Großvateruhr, es klingt wie langsam aufeinanderfolgende Seufzer. Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Ich bin angespannt. Das ja. Vielleicht ein wenig nervös. Aber vor allem bin ich bereit.
Draußen ist es bedeckt, neblig. Ich öffne die Doppelflügeltür zum Korridor, und im selben Moment schlägt mir der Brandgeruch entgegen. Er ist beißend und unangenehm, stinkt nach bitterer Asche und saurer Milch. Diesen Gestank hinterlassen die Flammen. Nichts anderes riecht so. Er setzt sich in der Nase fest, ein Geruch, den man nie mehr vergisst.
Teile des Treppengeländers sind schwarz, die Wandverkleidung ist beschädigt. Die Tür zu Erlings Arbeitszimmer steht halb offen. Dort drinnen ist alles zerstört. Ich gehe an der Türöffnung vorbei, ohne hinzusehen.
Vom Fenster im Korridor aus kann ich die Straße sehen. Tatsächlich hat man von hier einen guten Ausblick auf die gesamte Nachbarschaft und bis hinunter zum Fjord. Das Meer, das man gewöhnlich zwischen den Baumkronen erahnen kann, ist heute Abend im Nebel verschwunden. Aber das spielt keine Rolle. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Straße. Spähe nach Autos, die anhalten. Nach Scheinwerfern, die sich dem Haus nähern.
Sie werden kommen. Sie sind auf dem Weg, bald sind sie hier. Und ich habe keine Angst. Ich bin bereit.
VIER TAGE DANACH
Da ist ein Echo in meinen Ohren, obwohl es still ist. Als hätte jemand einen Lautsprecher, aus dem stundenlang Musik in voller Lautstärke dröhnte, abgestellt, und der Ton klänge immer noch nach. Ich sitze auf dem Sofa und lausche dem Ton, der nicht da ist. Meine Hände zittern. Ich hätte jetzt gern etwas, um die Nerven zu beruhigen, bleibe aber standhaft. Ich sitze hier und konzentriere mich auf das einzige hörbare Geräusch im Haus: das Ticken der Großvateruhr im Wohnzimmer.
Eigentlich sollte ich nicht allein sein. Das hat man mir nicht direkt gesagt. Glaube ich zumindest, allerdings muss ich zugeben, dass ich dazu neige, bei Gesprächen den Faden zu verlieren. Die Ärztin, die an jenem Tag im Krankenhaus mit uns sprach, bat mich um ein Gespräch, und ich erinnere mich an außerordentlich wenig von dem, was sie gesagt hat. Sie war vielleicht fünfzig und hatte diese Falten seitlich am Mund, Vertiefungen in der Haut, die sich nach Jahrzehnten des Lächelns und Lachens und Schimpfens und Schreiens nicht mehr austilgen lassen. Ich betrachtete diese Falten und fragte mich, wann meine eigenen aufgetaucht waren. War ich da älter oder jünger als sie gewesen? Ich hatte sie gar nicht kommen sehen. Als sie mir zum ersten Mal auffielen, schienen sie schon immer da gewesen zu sein. Darüber dachte ich nach, während die Ärztin redete. In ihrem stressigen Arbeitstag hatte sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen. Es ist davon auszugehen, dass das, was sie sagte, wichtig war.
Meine Kinder haben entschieden, dass ich nicht allein sein sollte. Ich habe aufgeschnappt, wie meine Töchter darüber sprachen. Es war an einem der letzten Tage, gestern oder vielleicht auch vorgestern. Sie standen in Erlings Arbeitszimmer, ich habe im Korridor davor mitgehört. Hanne hat geredet, mit insistierender Stimme. Sie redet immer am meisten.
»Das hier wird eine Mordsarbeit«, sagte sie. »Papa hat bestimmt fünf volle Kisten davon.«
Silje antwortete nicht. Oder vielleicht hörte ich ihre Antwort bloß nicht. Hanne redete über all seine Sachen. Sie fühlte sich für sie verantwortlich, das erkannte ich. Sie wollte dafür sorgen, dass sie durchgesehen und sortiert oder sogar weggeworfen werden. Das war neu für mich. Erlings Sachen stehen überall in diesem Haus, und warum auch nicht? Es ist schließlich unser Haus.
Und jetzt müssten sie auf mich aufpassen, sagte Hanne. Silje gab einen zustimmenden Laut von sich. Hanne fuhr fort: »Das muss so schwer für sie sein, Mama darf nicht allein sein.« Ach so, dachte ich, darf ich das nicht? Ich bin immer gern allein gewesen.
Die Tür stand halb offen, und ich schaute hinein. Sie standen am Schreibtisch, sortierten einige Papiere. Sein Terminkalender lag aufgeschlagen auf der Tischplatte. Vermutlich war er voller Verabredungen, aus denen nun nichts mehr werden würde. Meine Töchter kehrten dem Korridor, in dem ich stand, den Rücken zu, keine von ihnen sah mich.
Heute will Bård vorbeikommen. Er hat gerade angerufen und Bescheid gegeben, dass er auf dem Weg ist. Erst muss er noch zu einem Kunden, in einen Ort, an den ich mich nicht erinnern kann, war es Drammen, war es Tønsberg? Ich hatte wieder einen dieser Momente, bin einfach aus dem Gespräch gefallen. Das ist in diesen Tagen mehrfach passiert. Liegt es an dem, was passiert ist, ist es eine Nebenwirkung des Schocks? Bis jetzt bin ich von großen Verlusten verschont geblieben, abgesehen davon, dass ich vor vielen Jahren meinen Vater verloren habe. Doch man hört ja so einiges. Über andere Menschen. Über deren Verluste. Hat jemand etwas in der Art erwähnt? Diese mangelnde Fähigkeit, sich auf ein Gespräch zu konzentrieren. Das Phänomen, dass die Aufmerksamkeit einfach weggleitet und an dem hängen bleibt, worauf der Blick fällt, ganz egal, worum es sich handelt, auf das Erste, das man sieht. Als wäre das Gehirn nicht mehr in der Lage, Prioritäten zu setzen.
Draußen liegt die Veranda verlassen da. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Momentaufnahmen von jenem Tag: Maria Berger, die den Nordheimbakken heraufgerannt kommt und nach mir ruft. Die Plastikschnalle, die den Fahrradhelm unter Erlings Kinn festhält, der weiße Rand des Augapfels, der unter den Lidern gerade eben sichtbar ist. Die auf dem Asphalt liegende Hand mit dem Ehering, mir genauso vertraut wie meine eigene. Die überraschend unbequemen Stühle im Warteraum des Krankenhauses, Hannes klackernde Absätze im Flur, als sie angelaufen kam. Die Falten um den Mund der Ärztin. Das Lied, das im Radio lief, als Bård mich später nach Hause fuhr, oh, baby, baby, it’s a wild world. Der Moment, als ich dieses Haus aufschloss und es allein betrat. Der Entschluss, keine Schlaftablette zu nehmen, denn was wäre, wenn Erling doch nach Hause käme, dann müsste ich wach sein, um ihn hereinlassen zu können. Ich wusste ja, dass er nicht kommen würde. Schließlich war ich nicht völlig unzurechnungsfähig. Er ist nicht mehr hier, dieses Wissen bebt im Körper und knistert in den Fingern: Erling ist tot.
Das weiß ich. Wusste es schon da. Lag trotzdem dort, allein im Bett und dachte: Wenn er heimkommt, werde ich es hören.
Vor der Esszimmerwand nehme ich die Papierspitze des eingepackten Blumenstraußes wahr. Wann habe ich ihn dorthin gelegt? Vielleicht, kurz bevor ich mich aufs Sofa gesetzt habe? Ich weiß es nicht, ich bin unsicher, wie lange ich schon hier sitze. Der Strauß hing an der Haustür, als ich vorhin vom Einkaufen kam. Ich habe mich nicht um ihn gekümmert. Habe ihn noch nicht einmal geöffnet, um nachzusehen, von wem er ist. Eine ganze Weile habe ich einfach am Esstisch gesessen und ihn betrachtet.
Merkwürdig, was alles von einem erwartet wird, dachte ich, all diese Aufgaben, die mit einem Blumenstrauß verbunden sind. Zuerst muss er ausgepackt werden, das Papier muss weggeworfen, die Stiele angeschnitten werden, eine Vase muss aus den Tiefen des Schranks hervorgekramt und mit Wasser und Schnittblumennahrung gefüllt werden. Danach verlangen die Blumen weiterhin ständig Aufmerksamkeit: Das Wasser muss gewechselt, tote Blumen müssen herausgenommen und die verbliebenen umgruppiert werden. Früher oder später sterben sie natürlich alle, und dann muss der ganze Krempel entsorgt, die Vase gespült und abgetrocknet, der Müll hinausgetragen werden. Wie kommt man bloß auf so etwas? Dein Mann ist gestorben, also bitte schön, hier hast du zwanzig einzelne Pflanzen, an der Wurzel abgeschnitten und damit selbst am Rand des Grabes; jetzt ist es deine Aufgabe, sie zu versorgen und dein Möglichstes zu tun, um das Unausweichliche hinauszuzögern, bis sie schließlich doch dahinwelken und sterben, sodass du deine Unzulänglichkeit erkennen musst. Andererseits ist es ja bloß eine Gepflogenheit, und vielleicht ist es nicht vernünftig, zu viel darüber nachzudenken. Erling war Vernunft wichtig. Sie ist eine vernünftige Frau, sagte er beispielsweise. Oder: Er hat sich vernünftig verhalten. Das war sein größtes Kompliment. Das Gegenteil war sein größtes Verdikt.
Die Großvateruhr schlägt. Anschließend setzt das Ticken wieder ein, tick, tack, der Puls des Hauses. Ich sitze auf dem Sofa und betrachte die Spitze des eingepackten Straußes. Eine vernünftige Frau hätte ihn ausgepackt. Ich lasse ihn einfach dort vor der Esszimmerwand liegen und begebe mich in Gedanken in den ersten Stock, ins Bad. Dort öffne ich unser Medizinschränkchen und hole die Packung mit dem Etikett, auf das mein Name in hübschen schwarzen Buchstaben aufgedruckt ist, heraus: Evy Krogh, gegen Schlaflosigkeit und Unruhe. Wie lange mag es her sein, dass ich die Tabletten das letzte Mal genommen habe?
Aber das, was ich im Moment empfinde, ist eigentlich keine Unruhe. Ich weiß nicht, was es ist. Ich wünschte nur, dass es mir erspart bliebe, mich mit all dem auseinanderzusetzen.
Heute Vormittag stand ein junger Mann von der Umweltschutzorganisation vor der Tür. Er kondolierte, hatte eine Pflanze dabei. »Mein Gott, es ist tragisch«, sagte er, und dann schwächte er ab: »Oder zumindest sehr traurig.« Im Nachhinein habe ich über diese Abschwächung nachgedacht. Erling ist achtundsechzig. War. Vermutlich erheblich älter als die Eltern dieses jungen Mannes. Ich sagte nichts dazu. Wenigstens handelte es sich bei seinem Mitbringsel um eine Topfpflanze.
Gestern ist Synne vorbeigekommen. Olav war schon am Tag danach hier, ebenso Erlings Schwester, die für einen Blitzbesuch aus Bergen anreiste. Wie ich hier so sitze, versuche ich, den Überblick über alle zu behalten. Wir leben ziemlich ruhig, Erling und ich. Haben nicht viel Besuch. Normalerweise sind nur wir zwei hier, und in den letzten Tagen herrschte Hochbetrieb.
Ein durchdringender Ton schrillt durch den Raum. Die Türklingel hört sich an wie ein Fliegeralarm, sie zerhackt die Luft, verlangt Handlung. Diese Klingel gab es schon, als wir das Haus von Erlings Eltern übernommen haben. Bestimmt hat mein Schwiegervater sie installieren lassen, das hätte zu ihm gepasst. Sie hat nichts Einladendes an sich, sie fordert einen zum Strammstehen auf, und an allen anderen Tagen der über dreißig Jahre, die ich in diesem Haus lebe, habe ich ihre Strenge gehasst. Aber jetzt finde ich sie beruhigend. Hoch mit dir, sagt sie, und meine Beine, die ich sonst nicht ganz unter Kontrolle zu haben scheine, gehorchen.
»Mama«, ruft Bård.
Offenbar war ich ihm nicht schnell genug, er hat sich selbst die Tür aufgeschlossen. Er hat sich die Schuhe nicht ausgezogen. So war er schon als Kind, er vergaß sich und trampelte mit Schuhen herein. Es presst mir das Herz zusammen, als ich es sehe.
Jetzt ist er größer als ich. Auch nicht mehr ganz jung. Er umarmt mich, und ich sehe, dass sein Haar am Hinterkopf dünn wird, dass die hellbraunen Locken allmählich ausfallen. Er hat die gleiche Haarfarbe wie ich, als ich jünger war, genau wie Hanne, aber seine Locken werden langsam grau. Hanne hat ihre Farbe noch, vermutlich mithilfe von sündhaft teuren Friseurbesuchen. Bård riecht nach Auto und Kaffee, er trägt ein gut verarbeitetes hellblaues Hemd. Ich lasse ihn los und schaue ihn an. Seine Haut ist grau, und um die Augen flattert sie leicht.
»Wie geht es dir?«, fragt er, und ich verkneife mir einen Kommentar zu den Schuhen.
»Geht so«, antworte ich. »Und dir?«
Er streicht sich mit der Hand über die Stirn, als wolle er die Müdigkeit wegwischen. Er lächelt schwach.
»Geht so.«
Bård ist mein Erstgeborener. Ich war dreiundzwanzig, als er rot und strampelnd zur Welt kam. Er war ein sensibles Kind, schüchtern. Meistens war er ausgeglichen, aber wenn man ihn provozierte, konnte ihn das zur Raserei bringen. Man soll keine Rangfolge seiner Kinder erstellen, und ich liebe sie gleichermaßen, das tue ich wirklich. Aber Bård stehe ich am nächsten. Ihn kann ich leichter einschätzen als die Mädchen. Ich empfinde auch eine besondere Zuneigung zu ihm. Jetzt essen wir schweigend. Ich stelle fest, dass ich die Tischsets vergessen habe. Der alte Mahagonitisch im Esszimmer gehörte Erlings Eltern, er bekommt schon Kratzer, wenn man ihn bloß ansieht. Und nun habe ich die fettige Schale mit dem Hähnchen-Wok, den Bård mitgebracht hat, direkt auf den Tisch gestellt.
Bård starrt mit glasigem Blick vor sich hin, er ist weit weg. Denkt er an seinen Vater? Schmerzt ihn der frische Verlust? Aber nein, das ist es nicht. Jedenfalls nicht nur. Ein Teil von ihm ist immer noch bei der Arbeit, denke ich, und grübelt über den letzten Termin nach.
Er schaut auf, sieht, dass ich ihn betrachte. Lächelt. Gut aussehend ist er auch, mein Junge. Schlank, mit klaren, ebenmäßigen Gesichtszügen.
»Was hast du denn heute so gemacht, Mama?«, fragt er.
»Nichts«, sage ich. »Hier gesessen.«
Das überrascht ihn. Er selbst kann sich bestimmt nicht mehr erinnern, wann er zuletzt einen Tag hatte, an dem er nichts tun musste. Er und seine Frau wohnen in einem alten Haus, das sie renovieren, und haben zwei Söhne, die alle möglichen Arten von Sport treiben. Jedes Wochenende sind sie bei Sportveranstaltungen, Spielen oder Wettkämpfen, sie verkaufen Waffeln, wachsen Ski und feuern die Mannschaft an, und wenn sie einmal nichts davon tun, streichen sie Holzleisten oder arbeiten im Garten.
»Den ganzen Tag?«
»Was hätte ich schon tun sollen?«
Er stutzt. Dann stiehlt sich ein zaghaftes Lächeln auf seine Lippen.
»Tja«, sagt er.
Während er die Hand nach der Schale mit dem mitgebrachten Essen ausstreckt, sodass der Ölfleck auf der spiegelblanken Tischplatte sichtbar wird, fragt er nach dem Packpapierpäckchen auf der Anrichte.
»Es hingen Blumen an der Haustür«, sage ich. »Ich habe es noch nicht geschafft, sie auszupacken.«
»Du hast es nicht geschafft?«
Er runzelt die Stirn, das Lächeln verschwindet.
»Ich kann das machen«, sagt er.
Die Schere liegt im Arbeitszimmer. Der riesige Schreibtisch stammt von Erlings Vater, Professor Dr. jur. Krogh, Richter am Obersten Gerichtshof. Er ist massiv, aus dunkler Eiche, mit verschnörkelten Ornamenten, in denen sich Staub ansammelt, der sich kaum entfernen lässt. Der Tisch hat mir nie gefallen. Wir haben viele Möbel geerbt, als wir das Haus übernahmen, dieses dunkelbraun gebeizte Einfamilienhaus auf einer Hügelkuppe in Montebello. Die Möbel gab es dazu. In Regalen an den Wänden steht Erlings gesamte Bibliothek. Die Schreibtischplatte liegt leer und offen da, bereit für die Arbeit.
Aber etwas hier drin ist anders. Oder nicht? Ich kann es nicht greifen. Die glatte Schreibtischplatte, dahinter der Stuhl mit der hohen Lehne. Ich nehme die Schere aus dem Stiftehalter. In der Tür drehe ich mich noch einmal um und lasse den Blick schweifen. Ja, hier stimmt etwas nicht.
Aber vielleicht ist das nur natürlich. Er fehlt ja, und vielleicht ist es nur das.
»Hier«, sagt Bård, als er die erste Schicht Papier vom Strauß gerissen hat, er reicht mir die Karte.
Der Umschlag ist blütenweiß und sauber, unbesudelt, das Papier darin ist cremeweiß mit Textur. Liebe Evy, steht da. Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Erling war ein guter Freund, und du bist es auch. Beste Grüße, Edvard Weimer.
Unter dem Papier ist Plastikfolie. Bård seufzt, die ganze Verpackung. Ich reagiere nicht. Lese die Karte noch einmal. Ein guter Freund.
»Wie kann man bloß so viel Gedöns um einen einzigen Strauß wickeln«, murmelt Bård. »Papa wäre die Wände hochgegangen.«
Und du bist es auch.
In der Plastikfolie befindet sich ein Strauß aus zwanzig langstieligen weißen Rosen. Mutter hatte einen Spruch zur Bedeutung der Farbe von Rosen. Rot ist fürs Herz, Gelb für einen Freund. Weiß ist für … Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist viele Jahrzehnte her, seit ich zuletzt mit Edvard Weimer gesprochen habe, aber etwas sagt mir, dass er ein Mann ist, der so etwas weiß.
»Von wem sind die?«, fragt Bård.
»Von einem Mann namens Edvard«, sage ich. »Er ist ein alter Freund von Papa.«
Bård wirft einen Blick auf die Karte und runzelt die Stirn.
»Nie von ihm gehört.«
Auch an diesem Abend nehme ich keine Schlaftablette. Daher liege ich wach, wälze mich im Bett herum. Gegen zwei Uhr stehe ich auf und gehe hinunter ins Erdgeschoss.
Im Korridor ist es dunkel. Ich sehe lediglich das schwache Licht von draußen, das in Erlings Arbeitszimmer fällt und durch die offene Tür zu mir herüberschimmert. Ich selbst stehe im Schatten. Auf nackten Füßen tappe ich zur Türöffnung, schaue hinein.
Hier drin stimmt etwas nicht. Etwas ist entfernt worden. Etwas, das hier sein sollte, ist weg.
Aber was? Dinge werden entfernt, das passiert andauernd. Die Nacht verwirrt die Gedanken. Die Dunkelheit und die Stille verleihen der Umgebung eine andere Bedeutung. Sie lassen Kleinigkeiten zu Warnungen, Bagatellen zu düsteren Vorboten werden. Ich sollte wieder hochgehen, mich hinlegen, dafür sorgen, dass ich ein paar Stunden Schlaf bekomme.
Trotzdem bleibe ich stehen. Zähle Sekunden, blicke mich um.
FÜNF TAGE DANACH
Sie stehen auf der obersten Stufe der Eingangstreppe, als ich die Haustür öffne, ein Mann und eine Frau. Der Mann ist hochgewachsen und sehnig. Er hat einen buschigen Bart im Gesicht. Ich habe Bärte und Schnäuzer nie gemocht, das habe ich von meiner Mutter, die der Meinung war, Gesichtsbehaarung sei unanständig. Die Frau neben ihm trägt eine Lederjacke und hat ihre rotbraunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Der große Bärtige ist mit Jeans und Outdoorjacke bekleidet. Allem Anschein nach hat er die Klingel betätigt.
»Sind Sie Frau Krogh?«, fragt er. »Evy Krogh?«
»Ja bitte?«
»Mein Name ist Gundersen, ich bin von der Polizei. Das ist meine Kollegin Ingvild Fredly. Unser aufrichtiges Beileid zum Tod Ihres Mannes.«
Ich nicke. Ich weiß nicht, was für eine Antwort sie von mir erwarten.
»In diesem Zusammenhang haben wir einige Fragen. Dürfen wir hereinkommen?«
Der Mann, der sich als Gundersen vorgestellt hat, ragt in meinem Wohnzimmer empor. Erling war ebenfalls groß, aber mit den Jahren waren seine Schultern etwas zusammengesunken. Gundersens Schultern sind unverschämt gerade, und sein Körper ist leicht nach vorn gelehnt, als könne er es nicht erwarten, das, was kommt, zu fassen zu bekommen. Er ist schnell, wie mir scheint, uns anderen bereits mehrere Schritte voraus.
»Ist es okay, wenn ich mich ein wenig umsehe?«, fragt Ingvild Fredly.
Ich schaue sie bloß an. Ist es okay? Ich möchte nicht, dass sie in unseren Sachen herumstöbert, wirklich nicht, aber man schlägt der Polizei doch nichts ab. Jedenfalls nicht, wenn man aus gutem Hause kommt und mit autoritätsgläubigen Eltern aufgewachsen ist, die ihre Pflicht getan, ihre Steuern gezahlt und kaum einmal einen Strafzettel bekommen haben.
»Ja«, sage ich.
Sie hat markante Züge, dichte Augenbrauen und ein kräftiges Kinn, aber freundliche Augen.
Ich führe sie in den Flur. Öffne die schwere Doppelflügeltür, die schon immer da gewesen ist. Sie war eine Idee meiner Schwiegermutter, könnte ich mir vorstellen. Wenn sie geschlossen ist, was immer der Fall ist, trennt sie den frei zugänglichen Teil des Hauses vom privaten: vom ersten Stock mit seinen Schlafzimmern, vom Arbeitszimmer, von der Kellertür. Bevor wir hier eingezogen sind, habe ich das für altmodisch gehalten, doch ohne dass ich genau weiß, wie es dazu gekommen ist, haben wir diese Gewohnheit beibehalten.
Wenn wir Gäste haben, selbst wenn es sich dabei um unsere eigenen Kinder handelt, schließen wir die Doppelflügeltür. Was dahinter liegt, ist Erling und mir vorbehalten. Aber innerhalb weniger Tage ist alles auf den Kopf gestellt worden, meine Töchter durchschreiten ohne Weiteres die Doppelflügeltür und dringen ins Arbeitszimmer vor. Auch Fredly lasse ich hindurch. Vielleicht ist es aus der Mode gekommen, etwas als privat zu betrachten und es verbergen zu wollen, denke ich, während ich der Polizistin nachschaue, die zur Treppe eilt.
Als ich zurückkomme, steht Gundersen noch im Wohnzimmer und schaut sich um.
»Können wir uns irgendwohin setzen?«, fragt er.
Er verlagert das Gewicht jetzt auf die Fersen, beobachtet. Es hat den Anschein, als ließe er sich Zeit, aber ich sehe, wie sein Blick mit rasender Geschwindigkeit hierhin und dorthin springt und alles registriert.
Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Ich nehme das Sofa, er entscheidet sich für den Sessel. Er stützt die Ellbogen auf die Knie, beugt sich vor.
»Nun«, sagt er. »Sie fragen sich vielleicht, warum wir hier sind.«
Ich nicke.
»Wie Sie wissen, ist Ihr Mann ja obduziert worden.«
Ist er das? Die Ärztin mit den Lachfältchen. Die Dinge, die sie gesagt hat, die ich nicht mitbekommen habe. Meine auf den Oberschenkeln liegenden Hände zittern leicht, weshalb ich sie zusammengefaltet in den Schoß lege, sie verstecke. Der Polizist bemerkt wohl mein Zögern, denn er blättert in seinen Papieren, sagt etwas über die Information, die ich im Krankenhaus erhalten habe.
»Na ja, das war ja noch am selben Tag«, sage ich. »An einige Dinge erinnere ich mich nicht mehr richtig.«
»Verständlich.«
In seinem Blick liegt Mitgefühl, aber auch nicht allzu viel, und das gefällt mir. Jetzt sehe ich, dass er ebenfalls freundliche Augen hat.
»Es ist nun so, dass einige Unregelmäßigkeiten entdeckt worden sind, die unserer Meinung nach eine genauere Untersuchung verdienen.«
Er blättert wieder in seinen Papieren.
»In Erlings Krankenakte steht, dass er regelmäßig Tabletten genommen hat. Herzmedikamente und so etwas. Stimmt das?«
»Ja«, antworte ich. »Täglich.«
Gundersen zählt auf, Digoxin, Metoprolol, Simvastatin und so weiter und so fort, die ihm vor einigen Jahren wegen Herzbeschwerden von seiner Ärztin verschrieben worden seien. Ich nicke brav. Die Namen habe ich auf Schachteln und Gläsern in dem Schränkchen im Badezimmer gelesen, erinnere mich jedoch nicht, was wann und mit welcher Absicht verordnet worden war.
»Der Pathologe hat sich darüber gewundert, dass sich keine Spuren davon in seinem Körper fanden«, sagt Gundersen.
Es kommt mir vor, als hörte ich ihn nur bruchstückhaft. Wieder ist da dieses Gefühl, als hätte ich stundenlang ohrenbetäubende Musik gehört, die gerade jemand abgestellt hat.
»Es hat also den Anschein, als hätte er seine Tabletten nicht genommen. Seit Wochen nicht.«
»Das ist seltsam.«
»Hat er vielleicht etwas darüber gesagt, dass er aufgehört hat, sie zu nehmen? Dass er Angst vor Nebenwirkungen habe, lieber Sport treiben wolle, statt Pillen zu schlucken? Sich gesund ernähren oder zum Homöopathen gehen oder etwas Ähnliches?«
Ich kichere. Das Geräusch ist deplatziert, es überrascht ihn ebenso wie mich.
»Sie kennen Erling nicht. Wenn seine Ärztin gesagt hat, er soll etwas tun, dann hat er es getan. Hätte sie ihn aufgefordert, in der nächsten Saison einen Marathon zu laufen, hätte er sofort mit dem Training begonnen. Und für Alternativmedizin hatte er nur Verachtung übrig.«
Gundersen lächelt.
»Solche Leute kenne ich. Umso verwunderlicher. Wissen Sie vielleicht, wo er seine Medikamente aufbewahrt hat?«
»Ja, natürlich. Im Medizinschrank oben im Bad.«
Vor meinem geistigen Auge sehe ich Fredlys Hände in dem Schrank. Und meine eigene Schachtel, gegen Schlaflosigkeit und Unruhe.
»Gut«, sagt er, macht aber keine Anstalten, sich zu erheben.
Stattdessen lehnt er sich auf seinen auf die Oberschenkel gestützten Oberarmen vor und schaut mich an.
»Aber wie erklären Sie sich das dann, Evy? Erling befolgt die Anweisungen seiner Ärztin bis ins Detail, die Ärztin hat ihm sowohl Herzmedikamente als auch Cholesterinsenker verschrieben, und trotzdem finden wir keine Spuren davon in seinem Körper.«
»Ich weiß nicht. Ich habe keine Erklärung dafür.«
Ich höre meine Stimme wie ein Echo. Ich bin so schläfrig, so teilnahmslos, obwohl ich gestern keine Tablette genommen habe. Es kommt mir vor, als betrachtete ich uns aus einiger Entfernung. Als ginge mich nichts davon wirklich etwas an. Oder als wäre es ein Traum. Erling ist tot, und jetzt sitzt ein Polizist in unserem Wohnzimmer.
»Gundersen«, ruft die Polizistin aus dem ersten Stock.
»Moment«, sagt er und steht auf.
Die Großvateruhr tickt sich durch zähe Sekunden, bis er wiederkommt. Ich zähle zweihundertneunundsiebzig.
»In dem Schrank im Bad sind keine Tablettenschachteln«, sagt er bei seiner Rückkehr.
»Dort bewahrt er sie auf. Neben dem Spiegel, in dem Hängeschränkchen an der Wand.«
»Darin haben wir nachgesehen. Da sind gewöhnliche Schmerzmittel, zwei Packungen mit Ihrem Namen und ein Glas Lebertrankapseln. Nichts, was Erling gehört.«
Und ich bin immer noch weit weg, als betrachtete ich uns durch das falsche Ende eines Fernrohrs. Ich verspüre ein unangenehmes Kratzen hinter dem Ohr: Habe ich diese Tablettenschachteln nicht gerade noch gesehen, erst vor Kurzem?
Das erste Rezept hat er vor vielleicht drei Jahren bekommen. Er wurde immer kurzatmiger, beklagte sich darüber, und ich sagte: »Geh zum Arzt.« »Ach«, antwortete er, »ist das wirklich nötig?« Es vergingen ein paar Wochen. Ich erzählte Hanne davon, Hanne rief unsere Hausärztin an und vereinbarte einen Termin, dann rief sie Erling an und sagte: »Du hast am Mittwoch einen Termin, würdest du da jetzt bitte hingehen?«
Die Ärztin hörte zu, untersuchte ihn und war beunruhigt. Erling wurde zum Durchchecken ins Krankenhaus geschickt, und als er wieder nach Hause kam, hatte er Rezepte dabei. In der Apotheke gab man ihm zwei Schachteln mit Tablettenblistern und ein Pillenglas. Er legte alles auf den abgenutzten Wohnzimmertisch.
»Die tägliche Dosis«, sagte er, wobei er etwas blass war. »Jetzt bin ich für den Rest meines Lebens auf Medikamente angewiesen.«
Wir betrachteten sie beide, die Schachteln und das Pillenglas. Erling sah zu mir hoch, mit dem schiefen Lächeln, das sich hin und wieder auf sein Gesicht stahl.
»Niemand lebt ewig, Evy.«
Ich blinzelte ein paarmal, empfand eine seltsame Rührung. Dachte: So fängt es an, das Alter. Ich glaube, an dem Tag hatte ich ein Glas Wein zum Mittagessen getrunken, weshalb ich mich fragen muss: Hat er es wirklich genau so ausgedrückt – für den Rest meines Lebens auf Medikamente angewiesen?
Gundersen setzt sich wieder hin. Der Sessel wirkt etwas zu niedrig für ihn, seine langen Beine stehen hervor, die Knie ragen wie Berggipfel in die Höhe.
»Wie war Ihre Ehe?«, fragt er.
»Gut«, antworte ich.
Mein Hals schnürt sich zusammen, denn ist die Situation nicht absurd? Ein Teil von mir denkt: Erling wird so verwundert sein, wenn ich ihm davon erzähle. Als mir aufgeht, dass das nicht der Fall sein wird, weil ich ihm nie wieder etwas erzählen kann, legt sich etwas Schweres auf meine Brust und drückt darauf, presst meine Lunge zusammen. Für einige Hundertstelsekunden bekomme ich absolut keine Luft mehr. Die Luftröhre ist leer, der Hals steif und eiskalt, die Erkenntnis dieses Verlustes, Erling verloren zu haben und alles, was mit ihm verschwunden ist, macht mich blind und taub. Dann vergeht diese Empfindung, Seh- und Hörvermögen kehren zurück, es ist, als wäre nichts geschehen. Es geht so schnell, ich glaube nicht, dass der Polizist es merkt.
»Und sonst Ihr Familienleben? Sie haben Kinder, nicht wahr?«
»Ja, drei. Sie sind alle erwachsen.«
»Und sind sie verheiratet und haben selbst Kinder?«
»Die beiden ältesten sind verheiratet und haben Kinder. Ich habe drei Enkelkinder.«
»Und wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern? Gibt es Reibereien, Auseinandersetzungen oder so etwas?«
»Nein.«
»Ich denke dabei nicht notwendigerweise an große Konflikte, sondern an ganz alltägliche Spannungen, Sie wissen schon.«
Langsam und abwesend sage ich: »So etwas gibt es bei uns nicht. Wir verstehen uns gut.«
»Ja, natürlich«, sagt Gundersen mit einem Nicken. »Nun, das ist ja nicht überall so. Und wie steht es mit dem Rest der Familie?«
»Genauso. Meine Schwiegereltern sind tot, meine Schwägerin lebt in Bergen. Meinen Bruder und seine Familie treffen wir ab und zu. Und meine Mutter lebt im Heim, ich besuche sie ein paarmal die Woche.«
Er nickt. Im Kopf rechne ich nach: Wie oft bin ich bei meiner Mutter? Wirklich jede Woche?
»Wer hat Zugang zum Haus?«, fragt er.
»Zugang?«
»Ich meine, wer war hier? In, sagen wir, den letzten vier Wochen vor Erlings Tod.«
»Vier Wochen? Mal überlegen.«
Mein Gehirn ist wie Brei, es arbeitet so unendlich langsam.
»Ich und er. Vielleicht unsere Kinder. Ich meine, sie waren zu Besuch. Wann war das noch gleich?«
Aber es fällt mir so schwer, mich zu erinnern. Waren sie vielleicht anlässlich unseres Osteressens zum letzten Mal hier?
»Es tut mir leid«, sage ich mit heiserer Stimme. »Normalerweise bin ich nicht so. Mein Kopf …«
Ich räuspere mich, was wie ein Schluchzen klingt. Er sagt nichts, gibt mir Zeit, mich zu sammeln, und ich atme tief ein, ziehe die Luft bis ganz in den Bauch.
»Die Familie ist Karsamstag zum Essen hier gewesen. Das muss wohl so drei Wochen her sein. Das Wetter war schön, zuerst haben wir auf der Veranda etwas getrunken und dann im Esszimmer Lammbraten gegessen.«
»Wen meinen Sie mit Familie? Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder?«
»Mein Sohn Bård mit seiner Frau und ihre zwei Söhne. Hanne und ihr Mann mit dem Fünfjährigen. Und dann Silje, meine jüngste Tochter. Außerdem war Olav hier. Olav ist mein Bruder. Seine Frau war dabei, und sie haben Mutter mitgebracht. Also ja, die Großfamilie.«
Er schreibt sich nichts auf, aber ich kann sehen, dass er es sich merkt, es in seinem Gedächtnis abspeichert.
»Und wer war nach Erlings Tod hier?«
»Nun. Die Kinder. Olav und seine Frau. Erlings Schwester. Eben die engste Familie, und ja, meine Freundin Synne ist vorbeigekommen, sie wohnt ganz in der Nähe, in Røa.«
Ich denke nach, und gerade, als er Atem holt, um etwas zu sagen, füge ich hinzu: »Und der Chef von Grüne Agenten. Das ist die Organisation, für die Erling bis zu seiner Pensionierung im Mai letzten Jahres gearbeitet hat. Er war hier, lassen Sie mich nachdenken, ich glaube, es war gestern. Wie hieß er noch gleich? Kalle, oder nein, ich erinnere mich nicht.«
Gundersen hebt eine Augenbraue. Er schaut rasch in seine Papiere. Ich sehe den Mann mit der Topfpflanze vor mir. Tragisch, oder zumindest sehr traurig. Ich sehe auch vor mir, wie er dastand, an den Rahmen der Arbeitszimmertür gelehnt. Gundersen notiert etwas an den Rand eines seiner Blätter und klappt die Mappe zu, ehe ich entziffern kann, was er geschrieben hat.
»Und sonst?«, fragt er weiter. »Wer hatte die Möglichkeit, hier hereinzukommen? Beispielsweise, wenn Sie unterwegs waren? Schließen Sie die Tür ab? Hat jemand einen Schlüssel?«
Ich sage: »Unsere Kinder haben Schlüssel, und wir haben einen Ersatzschlüssel in der Garage versteckt.«
Über uns sind Schritte zu hören. Die Polizistin dort oben durchsucht bestimmt unsere Sachen, betrachtet sie mit professionellem Blick. Erlings Toilettenartikel, und meine auch. Sie bemerkt seinen Schlafanzug, zusammengefaltet auf seiner Seite des Bettes, weil ich es nicht über mich gebracht habe, ihn anzurühren. Die nach Wasser dürstenden Pflanzen. Das Bild auf der Kommode, von den Kindern, als sie klein waren: Silje auf Hannes Schoß, Bård, der mit ernstem Blick hinter ihnen steht. Sie registriert den Staub auf dem Rahmen. Die schmutzige Wäsche, um die ich mich seit voriger Woche nicht gekümmert habe. Vielleicht durchwühlt sie die Schublade mit der Unterwäsche, findet die Tablettenschachtel, die ich in Reserve habe, versteckt hinter Slips und BHs. Versucht, ein Leben zusammenzusetzen.
Jetzt geht sie in den Korridor. Ihre Schritte sind rhythmisch, erzeugen einen erstaunlich gleichmäßigen Takt.
»Da ist noch etwas«, sagt Gundersen. »Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es noch einen anderen Fahrradunfall gegeben, oder? Und zwar einige Monate vor Erlings Tod?«
»Was? Ach, Sie meinen seinen Sturz? Nun. Er war auf dem Weg zu einer Besprechung bei den Grünen Agenten. Er war ja schon in Rente, aber trotzdem noch ein paarmal in der Woche dort. Er fuhr also mit dem Rad den Nordheimbakken entlang, doch dann bremste er, weil ihm einfiel, dass er irgendwelche Unterlagen hatte mitnehmen wollen. Die Bremsen funktionierten nicht, er konnte nicht anhalten und landete im Straßengraben. Er verletzte sich nicht schwer, hatte nur ein paar Schürfwunden. Es war ja ein Glück, dass er dort anhalten wollte. Wären ihm die Unterlagen nicht in den Sinn gekommen, hätte er vermutlich erst im Husebybakken gebremst, und dort wäre es viel schlimmer ausgegangen.«
»Ja, da hatte er Glück. Hat er herausgefunden, was passiert ist?«
»Nicht, dass ich wüsste. Es lag wohl bloß an den Bremsen. Es ist ein altes Fahrrad, wissen Sie. Erling repariert viel selbst. Manchmal macht er dabei Fehler.«
»Und gab es noch andere Unfälle?«
»Nein.«
»War da nicht ein Zwischenfall bei der Arbeit, mit einer Lampe, die einen Kurzschluss hatte?«
»Daran kann ich mich nicht erinnern. Und so etwas hätte er mir erzählt.«
Gundersen sagt nichts. Er nickt, aber langsam. Als würde er meine Behauptung abwägen und sie nicht ohne Weiteres gelten lassen. Ich denke nach. Hat Erling es vielleicht doch erwähnt? Mir dämmert etwas.
»Warum fragen Sie?«, hake ich nach.
Er zuckt mit den Schultern. Seine Kollegin ist auf der Treppe.
»Warum haben Sie Erling eigentlich obduziert?«
Er zögert.
»Reine Routine.«
Seine Hände sammeln die Papiere zusammen, stecken sie zurück in die Mappe.
»Die Todesursache scheint ein Herzinfarkt gewesen zu sein«, sagt er, ohne mich anzuschauen. »Und aus medizinischer Sicht ist daran ja nichts Schockierendes. Unser Pathologe meint, dass er noch viele Jahre hätte leben können, wenn er seine Medikamente genommen hätte. Aber das hat er nun einmal nicht. Und er gehörte zur Risikogruppe.«
Er schaut hoch, richtet seine Augen fest auf mich. Sein Blick ist ruhig.
»Eines frage ich mich trotzdem. Interpretieren Sie nicht zu viel hinein, Evy, aber können Sie sich vorstellen, dass es jemanden gibt, der Erling schaden wollte?«
Am äußersten Rand meines Blickfelds flimmert es. Das hier kann nicht real sein. Wie meine Töchter gesagt haben: Mama darf nicht allein sein.
»Nein«, sage ich. »Wir führen ein ruhiges Leben. Niemand hat etwas gegen uns.«
Ein Jahr bevor er das Rentenalter erreicht hatte, kündigte Erling ohne Vorwarnung seinen Job beim Staatlichen Straßenbauamt und nahm eine Stelle bei Grüne Agenten an. Jahrelang hatte er über Klimawandel, Nachhaltigkeit und menschliche Idiotie gesprochen, in allmählich schärfer werdendem Ton. Er fuhr mehr Fahrrad, achtete verstärkt aufs Müllrecycling. Unterwarf uns immer rigideren Normen in Bezug auf das, was wir kauften, was wir wegwarfen, was wir aßen. Er kommentierte den Konsum anderer Leute, manchmal auf eine Art und Weise, die mir peinlich war. Trotzdem kam der Jobwechsel überraschend. Papas etwas vorgezogenen Ruhestand, so nannte ich es, wenn ich mit Hanne sprach. Ich dachte wohl wirklich, dass es sich dabei um genau das handelte: Erling war achtunddreißig Jahre lang beim selben Arbeitgeber beschäftigt gewesen, erschien pünktlich um acht zur Arbeit, aß um halb zwölf zu Mittag, versah seinen täglichen Dienst. Vielleicht war er zum guten Schluss dann doch erschöpft von der Monotonie des Ganzen.
Sich an die neue Stelle anzupassen, verlangte ihm viel ab. Sein Chef war der blutjunge Mann, der hier gewesen war, Kyrre Jonassen heißt er, jetzt erinnere ich mich wieder. Keiner der Kollegen war älter als fünfundvierzig. Erling war hoffnungslos altmodisch, was ihm bewusst war. Hanne pflegte zu sagen: »Papa ist eine Generation zu früh geboren.« Die Väter ihrer Freundinnen machten Skitouren mit ihren Kumpels und waren bei Facebook.
Erling muss sich bei den Grünen Agenten unwohl gefühlt haben, muss den Eindruck gehabt haben, nicht in seinem Element zu sein. Er sprach über die Faulheit und den fehlenden Durchblick seiner Kollegen: Sie planten Kampagnen in den sozialen Medien, während Erling den Staat verklagen wollte.
»Wollen sie die Welt etwa mit ihren Handys verändern?«, fragte er.
»Da draußen ist eine neue Welt, Erling«, antwortete ich.
Er schnaubte. »Die Welt ist die gleiche wie immer. Bloß wärmer und mit geringerer Biodiversität.«
Er muss enttäuscht gewesen sein. Aber er redete wenig darüber, wie es ihm ging. Dafür umso mehr über Erderwärmung, Emissionskurven und Veränderungen der Biosphäre. Und mich ermüdete es, ihm zuzuhören. Immer wieder ertappte ich mich dabei, dass ich an andere Dinge dachte, wenn er redete.
All das erzähle ich Gundersen, während wir hinaus zur Garage gehen. Vielleicht hat er gefragt, ich bin mir nicht ganz sicher. Während ich rede, nickt er und gibt kurze, zustimmende Laute von sich. Er ist ein guter Zuhörer, denke ich. Man bekommt Lust, mehr zu erzählen.
Das Garagentor ist schwer, es lässt sich nicht so leicht öffnen. Gundersen fasst mit an und hilft mir, legt seine Hand auf den Griff, neben meine. Sie ist stark, aber nicht sonderlich groß. Sein Handrücken ist von feinen blonden Härchen bedeckt, und seine Finger wirken feinfühlig. Er spannt die Faust an, und zusammen ziehen wir das Tor hoch.
»Tut mir leid«, sage ich und lächle ihn an. »Es ist ziemlich alt.«
An einer der Längswände neben dem Auto steht Erlings Werkbank. Ich zeige Gundersen den Ersatzschlüssel, der in einer der Schubladen der Bank liegt. Dann geleite ich ihn wieder hinaus, zeige ihm den Stellplatz des Fahrrads auf der anderen Seite der Garage. Aber die Wand ist leer. Erlings aus den Neunzigerjahren stammendes Fahrrad der Marke DBS mit dem Klebeband um den Lenker ist nicht da.
»Merkwürdig«, sage ich.
Gundersen sagt nichts. Ich gehe zur Rückseite der Garage, für den Fall, dass das Rad dorthin abgerutscht sein sollte, aber dort ist nichts zu sehen, das Fahrrad ist verschwunden.
An jenem Tag lag das Fahrrad neben Erling am Straßenrand im Sondrevegen. Eines der Räder hing über dem Asphalt in der Luft. Als ich an dem Abend nach Hause kam, als Bård am Straßenrand anhielt und mich aussteigen ließ, während im Radio »Wild World« gespielt wurde, lehnte es an der Garagenwand. Jemand muss es hinaufgeschoben haben, dachte ich damals, und seitdem hatte ich keinen Gedanken mehr daran verloren.
»Ich bin mir sicher, dass es hier gestanden hat.«
Aber in meinem Kopf geht alles durcheinander, ich bin mir bei rein gar nichts mehr sicher. Kann ich überhaupt wissen, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es nach seinem Tod hier war?
»Wann haben Sie es zuletzt gesehen?«, fragt Gundersen.
»Ich weiß es nicht genau«, antworte ich. »Ich erinnere mich nicht.«
NEUNUNDVIERZIG JAHRE DAVOR
»Ist er das?«, fragte Synne und nahm die Plattenhülle von meinem Nachttisch. »Er sieht ja fast aus wie eine Frau.«
Die Sonne schickte einen schlanken Strahl in mein Zimmer im Røaveien, er fiel direkt auf die weiße Wand und über Synnes Körper, die sich auf der Tagesdecke ausgestreckt hatte. Wir lauschten der Musik, die bald den Raum erfüllte. Ich hatte den ganzen Weg von der Schule nach Hause davon geschwärmt: »Es ist so gut, wart’s nur ab!«
Synne streckte sich. Das Fenster stand auf Kipp, wir konnten den Verkehr draußen hören. Der Essensgeruch zog die Treppe herauf und stahl sich durch den Spalt unter der Tür ins Zimmer, gebratene Zwiebeln, gekochte Möhren. Die ersten Töne erklangen, dann erhöhte sich der Puls, der wogende Beat füllte den Raum. Schließlich setzte die Stimme ein, dünn, träge.
Der Bruder meines Vaters hatte mir die Platte gekauft. Vor seiner Londonreise hatte ich ihn einen Monat lang bekniet, »bitte«, sagte ich, »bitte. David Bowie. Hunky Dory. Ich kann es dir aufschreiben, schau.«
»Hör dir das an«, sagte ich und erhob Aufmerksamkeit heischend die Hände.
Synne zuckte mit den Schultern.
»Wie soll man dazu tanzen?«
Von draußen waren Stimmen zu hören, junge Männer, die sich laut und angeregt unterhielten.
»Ist das Olav?«, fragte sie.
Sie warf die Plattenhülle auf die Tagesdecke und stand auf, lief zum Fenster. Ich hob die Hülle auf, strich mit dem Finger über das Preisschild in Pfund, auf dem auch der Name des Schallplattenladens stand: His Master’s Voice.
»Da ist Olav mit seinen Freunden. Komm, Evy.«
Unten vor der Haustür stand mein großer Bruder mit einer Gruppe Jungs in seinem Alter. Olav wies nach oben, wollte ihnen etwas zeigen, sein Zimmer vielleicht. Die anderen folgten seinem Finger mit den Augen und erblickten Synne und mich am Fenster. In diesem Moment passierte etwas in ihren Gesichtern, ihren Körpern. Sie strafften die Schultern, schoben den Brustkorb vor. Ich sah, wie es passierte. Und ich wusste und wusste zugleich nicht, was es zu bedeuten hatte. Synne winkte ihnen zu. Sie winkten zurück. Dann gingen sie hinein, wir hörten das Klicken der Haustür.
Der Größte betrat das Haus zuletzt. Er hatte dunkle Haare und breite, dunkle Augenbrauen. Bevor er eintrat, schaute er nach oben und sah mich an, sein Blick hielt meinen für eine oder zwei Sekunden fest.
An einem Herbstnachmittag im selben Jahr blieb er an meiner Tür stehen. Ich saß an meinem Schreibtisch, die Tür stand offen. Er grüßte, und ich drehte mich auf meinem Stuhl um.
»Was machst du?«, fragte er.
»Hausaufgaben.«
Es wurde still.
»Norwegisch?«
»Mathe.«
»Darf ich reinkommen?«
Ich zuckte mit den Schultern. Mit dem Gesichtsausdruck eines Entdeckers auf dem Weg in ein unbekanntes Territorium trat er über die Schwelle. Er war so groß, dass sein Körper bei jedem Schritt hin- und herpendelte, was beinahe komisch wirkte. Er kam zu mir herüber, schaute mir über die Schulter. Eine Weile stand er einfach so da, las in meinem Heft.
»Das stimmt«, sagte er.
Seine Stimme klang überrascht, sicher überraschter, als er es beabsichtigt hatte, und das brachte mich zum Lachen.
»Natürlich stimmt es.«
»Ich wollte auch nichts anderes sagen«, erwiderte er errötend.
»Das weiß ich.«
Aber ich war mir nicht sicher, ob ich es wirklich wusste. Ich fühlte mich ein wenig geschmeichelt. Er war ein paar Jahre älter als ich, ging zur Uni, wo er zusammen mit meinem Bruder Jura studierte. Die Mädchen, die er sonst traf, waren bestimmt viel weltgewandter als ich. Vermutlich auch als er selbst.
»Oh, sieh mal da«, sagte er und deutete in mein Heft. »Da ist ein Fehler. Du hast die Dezimalstelle abgerundet.«
Ich sah hin. Er hatte recht, aber ich wollte ihm nicht die Genugtuung geben, dass ich den Fehler korrigierte. Also drehte ich mich zu ihm um.
»Bist du bei der Hausaufgabenhilfe, oder was?«
»Ich heiße Erling«, sagte er.
»Ich bin Evy.«
Er reichte mir die Hand, sehr formell. Ich bekam wieder Lust zu lachen, tat es dann aber nicht. Um ihm ein erneutes Erröten zu ersparen? Oder weil ich nur ein Schulmädchen war, und was wusste ich schon darüber, wie man sich an der Uni grüßte?
Von da an ließ er sich das zur Gewohnheit werden. Immer wenn er vorbeiging und die Tür offen stand, blieb er stehen. Er lehnte seine lange Gestalt an den Türrahmen, stellte Fragen: Wie es in der Schule laufe, ob es mir in der Oberstufe gefalle. Was ich danach machen wolle, ob ich weiterlernen wolle, was ich werden wolle. Ich konnte hören, wie Olav und die anderen ihn wegen des Interesses, das er an mir zeigte, aufzogen. »Erling gibt sich mit kleinen Mädchen ab«, sagte einer von ihnen. Olav, oder vielleicht der, der Edvard hieß. Es versetzte mir einen Stich in den Magen: So sahen sie mich also? Ich wusste nicht genau, was ich von Erling halten sollte. Er war linkisch, etwas umständlich, wenn er redete, und so ernst.
»Er erinnert mich an meinen Vater«, seufzte Synne. »Würde es ihn umbringen, hin und wieder mal zu lächeln?«
Aber sein Ernst gefiel mir auch. Es gefiel mir, dass er mir zuhörte, wenn ich redete, dass er vernünftig antwortete, ohne sich aufzuspielen. Es gefiel mir, dass er mit Synne nicht auf die gleiche Weise sprach. Manchmal öffnete ich die Tür, wenn ich Olav und seine Freunde kommen hörte.
Irgendwann im Frühling klopfte er an. Meine Tür war geschlossen, ich lernte fürs Abitur, musste mich konzentrieren.
»Ja«, rief ich; ich dachte, es wäre meine Mutter, doch dann öffnete er die Tür, pendelte seinen langen Körper herein.
»Stör ich?«
Er war blasser als gewöhnlich.
»Aber nein«, sagte ich und legte den Bleistift hin. »Hallo, Erling.«
Er lächelte, befeuchtete die Lippen mit der Zunge.
»Hallo. Was machst du?«
Beide schauten wir auf meine Schulbücher.
»Lernen«, sagte ich überflüssigerweise.
»Wann sind die Abiturprüfungen?«
»Im Mai.«
Er nickte. Sein Blick schweifte umher.
»David Bowie«, sagte er und nickte zu der Plattenhülle auf meinem Nachttisch hinüber.
»Ja. Magst du ihn?«
»Nein«, antwortete er, als täte es ihm weh, das zuzugeben, und als er meinen Gesichtsausdruck sah, setzte er hinzu: »Aber vielleicht würde ich ihn mehr mögen, wenn ich mehr von ihm hören würde.«
»Das ist schon okay.«
»Evy«, sagte er. »Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
Seine Hände waren groß, man bekam das Gefühl, sie wären ihm im Weg. Jetzt schob er sie in die Hosentaschen, als wolle er sie loswerden.
»Genauer gesagt möchte ich dir etwas zeigen. Da draußen.«
Er nickte zum Fenster. Ich stand auf und ging zu ihm, sodass wir nebeneinanderstanden und hinaussahen.
»Die Birkenknospen sind kurz davor, aufzuspringen«, sagte er und wies darauf.
Ich fing an zu lachen.
»Willst du mir die Birkenknospen zeigen?«
Er war rot geworden. Aber er lächelte.
»Eigentlich nicht«, räumte er ein. »Es ging mir vor allem darum, dich zum Aufstehen zu bewegen.«
Ich lachte wieder, wie Synne gelacht hätte.
»Und warum?«
Ich trat weitaus mutiger auf, als ich war.
»Damit ich das hier tun kann.«
Er hob die Hand zu meinem Gesicht und strich meine Haare zurück. Er schaute mich an, tastete sich quasi vor, würde ich ihn wegstoßen? Ich verspürte einen Druck im Magen, jetzt passiert es, jetzt passiert es, ich hatte schon so lange damit gerechnet, dass es passieren würde, und jetzt war der Moment gekommen. Wann hatte ich mir zuletzt die Zähne geputzt? Roch ich gut? Würde er merken, dass es mein erster Kuss war, weil ich nicht wusste, was ich mit den Lippen, mit der Zunge anstellen sollte?
Er küsste mich. Ich dachte: So ist das also. Davon sprechen sie alle, Synne und die anderen, die sich mit so was auskennen.
»War es gut?«, fragte er.
»Ja«, sagte ich.
Ich war so unheimlich stolz, es getan zu haben.
Man hätte an so vielen Stellen beginnen können. Beim Geruch der Zigaretten, die Mama und Papa eine nach der anderen rauchten, wenn wir ins Gebirge fuhren. Bei den kleinen Porzellantassen, die Oma uns zum Beerensammeln gab, gesprungen und uralt, mit feinen schwarzen Linien, die Blutadern glichen, und mit Fruchtkorbmotiven, die fast völlig weggewaschen waren. Beim Geräusch, das zu hören war, wenn wir die reifen roten Himbeeren in die Tassen fallen ließen. Warum sollte alles mit Erling beginnen?
»Das ist der Anfang«, sagten Synne und ich zueinander, als wir an jenem Abend auf dem Zaun am Fußballplatz saßen und Eis aßen. Der erste Junge. Vermutlich von vielen. All die Jungs, die es gab, in der Schule, Olavs Freunde und alle Jungs, die auf der Straße herumliefen, im Bus saßen, im Laden oder sonst wo unterwegs waren. Erling war der Erste, danach würden sie sich die Klinke in die Hand geben. Es war wie mit den Himbeeren in der Tasse, man musste sie einfach einsammeln.
SECHS TAGE DANACH
Silje hat einen Kohl-Lamm-Eintopf dabei. Sie habe ihn selbst gekocht, sagt sie, habe Gott weiß wie lange in der Küche gestanden. Ich soll jetzt bestimmt beeindruckt sein. Sie schüttet den Inhalt der mitgebrachten Tupperdosen in einen Topf, während sie redet: Am wichtigsten sei es, den Eintopf lange kochen zu lassen, viel länger, als man zunächst meint, damit das Fleisch die richtige Konsistenz bekomme. Ich bin außerstande, die Situation zu erfassen: Wie meine Kinder in meine Küche kommen und die Kontrolle übernehmen, als wäre ich nicht in der Lage, mich selbst zu versorgen. Habe ich euch nicht Nase und Po abgewischt?, würde ich gern sagen. Habe ich euch nicht Jahr für Jahr jeden Tag Pausenbrote geschmiert, für Mittagessen, Frühstück und Abendbrot gesorgt? Glaubt ihr, ich schaffe es nicht, einen simplen Eintopf aufzuwärmen?
Aber das ist wohl Fürsorge. Sicher ist es gut gemeint. Es gibt eine Zeit für alles, eine zum Geben und eine zum Nehmen. Ist die Zeit zum Nehmen gekommen? Ich bin sechsundsechzig. Bin ich nicht viel zu jung?
Außerdem macht sie es falsch. Sie hat so viel Zeit darauf verwendet, das Essen zu kochen, aber sie wärmt es auf höchster Stufe auf, sodass das Fleisch außen anbrennt und innen kalt bleibt. So war sie schon immer. Sie verfolgt große Projekte, findet extravagante Lösungen und investiert enorm viel Zeit und Energie in Dinge, bei denen uns anderen nicht ersichtlich ist,