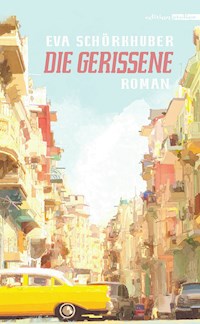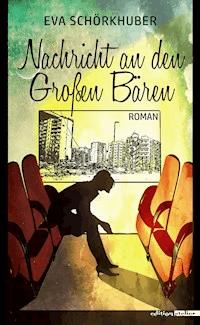Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wunderbare Insel ist ein Ort voller Magie, unglaublicher Tiere und prachtvoller Pflanzen. Was es hier nicht gibt, ist der Tod. Und das machte sie für Eva Schörkhuber als Kind zu einer tröstlichen Erzählung. Als viele Jahre später innerhalb kurzer Zeit ihr Vater und ein enger Freund sterben, ändert sich ihre Perspektive auf den Tod. Sie denkt ebenso über individuelle Begegnungen mit dem Tod nach wie über seine Bedeutung in weiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Welche Vorstellungen liegen dem Begriff »Trauerarbeit« zugrunde? Wie verändern sich unsere Beziehungen zum Tod, wenn wir das Ende der Welt, wie wir sie kennen, in Betracht ziehen? Eva Schörkhuber erinnert mit großem sprachlichen Feingefühl daran, dass der Tod kein metaphysisches Ungeheuer ist, vor dem wir uns so lange wie möglich verstecken müssen, sondern dass unser Nachdenken darüber sich lohnen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Mutter, die mit dem Tod ihres Partners zu leben hat und sich so mutigen Schrittes in ein verändertes Leben wagt.
Über den Tod nachzudenken heißt, über alle nachzudenken.
Anne Boyer
BEGEGNUNGEN
1.
Ich erinnere mich genau, als ich den Tod zum ersten Mal wahrgenommen habe. Er ist mir weder erschienen noch hat er kurz davor jemanden aus meinem Leben genommen. Und doch hat der Moment, in dem ich ihn erkannt habe, einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Zwischen den Zeilen eines Liedes ist mir plötzlich das unlösbare Ende jedes Lebens vor Augen gestanden wie ein dunkler Fleck, der immer schon da gewesen war, der nur bislang mein Gesichtsfeld nicht berührt hatte. »Und er wird auf-, auferstehen« hallte es durch das Kirchenschiff, und ich konnte nicht mehr an mich halten. Da halfen weder das erdbeerrote Jeansgilet, das ich an diesem Ostersamstag unbedingt tragen wollte und das ich gegen die Vorstellungen meiner Mutter von einer angemessenen Festtagskleidung durchgesetzt hatte, noch der blaue Drache mit dem glitzernden Blick, der mit einer Anstecknadel befestigt auf meiner Brusttasche saß. Ich konnte nicht mehr an mich halten und brach in Tränen aus. Es waren keine heißen, stillen Tränen, die meine Wange hinunterliefen, mein ganzer Körper versuchte den Eindruck, den der dunkle Fleck hinterließ, abzuschütteln. Ich schluchzte und bebte. Meine Mutter, die neben mir saß, nahm mich an der Hand, und wir verließen die österliche Kindermette.
In den darauffolgenden Tagen fanden meine Eltern und ich einen Namen für dieses beklemmende Gefühl, wir nannten es »Magendrücken«. Sobald die Angst vor dem Tod, die kurz nach diesem ersten Eindruck einsetzte, heranschlich, konnte ich zu ihnen gehen, immer, zu jeder Zeit. Ich sagte: »Mama, Papa, ich habe wieder Magendrücken.« Sie brachten mir warme Milch mit Honig und versuchten, mich zumindest an diesem Morgen, an diesem Nachmittag oder Abend zu beruhigen. Sie ahnten wohl, dass es gar nicht möglich und vielleicht auch nicht richtig gewesen wäre, mir diese Angst zu nehmen. Was hätten sie auch gegen den Tod ausrichten können? Dass es ihn gibt, ist unbestreitbar. Sein Gewicht ist ebenso wenig zu leugnen wie der Umstand, dass niemand etwas Bestimmtes über ihn sagen kann. Er ist im gleichen Maße gewiss, wie alle Spekulationen darüber, wie das Ende eines Lebens aussehen mag, ungewiss sind.
Meine Eltern waren damals wenige Jahre jünger als ich heute. Sie standen mitten im Leben. Mein Vater arbeitete im chemischen Labor eines Unternehmens, das Lacke, Farben und Klebstoffe produzierte. Meine Mutter war Hausfrau und kümmerte sich um meinen jüngeren Bruder und mich. Fünf und acht Jahre waren wir alt. Im Kindergarten und in der Grundschule gab es keine Nachmittagsbetreuung, zu Mittag spazierten wir nach Hause und verbrachten den restlichen Tag damit, Hausaufgaben zu machen, im Garten zu spielen oder über die Felder zu streunen. Ein paar Jahre zuvor waren meine Eltern mit uns von einer Kleinstadt in dieses Dorf gezogen, wo sie gute nachbarschaftliche Beziehungen unterhielten. Wahrscheinlich trugen sie sich damals schon mit dem Gedanken, ein Grundstück zu kaufen und ein Haus darauf zu bauen.
Mit dem Tod hatten sie zu dieser Zeit nichts zu schaffen. Ihre Aufmerksamkeit galt der Gegenwart, in der sie sich immer besser einrichten wollten, und der Zukunft, die sie für sich und ihre Kinder in Anspruch nahmen.
2.
Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Mutter über diese Zeit gesprochen, in der mich die Angst vor dem Tod so fest im Griff hatte. Sie hat mir erzählt, wie hilflos sie sich damals fühlten, Papa und sie, und dass sie gerne gewusst hätten, was der Auslöser dafür gewesen sei. »Wir konnten uns nicht erklären, woher diese Angst plötzlich kam.«
Damals, nach der Kindermette, hat sie mich gebeten, ihr zu sagen, was in mir vorging, es wenigstens zu versuchen. Es ist mir nicht gelungen. Den Tod habe ich zwar benannt, doch vollkommen zusammenhangslos, und meiner Mutter ist nichts anderes übrig geblieben, als meine Beklemmung darauf zurückzuführen, dass mir die katholische Ostergeschichte mit ihren Folter- und Hinrichtungselementen zu nahe gegangen sei. »Aber schließlich hat Jesus doch den Tod besiegt.«
Meine Großmutter mütterlicherseits war zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre tot. Meine Mutter hat mich immer wieder gefragt, ob nicht ihre Reaktion auf die Nachricht vom Tod ihrer Mutter der Auslöser für meine Angst gewesen sein könnte. Sie war damals Anfang dreißig, ich war vier Jahre alt. Erinnern kann ich mich an das grüne Telefon, das im Flur der Wohnung in der Kleinstadt stand, auf einer Kommode mit geschwungenen Holzmaserungen, die ich so gerne mit den Fingern entlangfuhr. Über dieses Telefon gebeugt sehe ich in meiner Erinnerung meine Mutter, in Tränen aufgelöst. Ich muss in der Tür des Kinderzimmers gestanden und sie beobachtet haben.
Meine Oma war kurz nach ihrer Krebsdiagnose an Herzversagen gestorben. Niemand hatte, trotz der schweren Erkrankung, mit einem so plötzlichen Ende ihres Lebens gerechnet. Was mir meine Eltern damals vom Tod erzählt hatten, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass es beängstigend gewesen war. Ich glaube auch nicht, dass der Schmerz, der aus meiner Mutter herausbrach, als sie am Telefon erfuhr, dass ihre Mutter verstorben war, der Auslöser für eine Angst gewesen sein konnte, die vier Jahre später in mein Leben trat. Genauso wenig glaube ich, dass die brutale Leidensgeschichte, die zu Ostern in den Kirchen zelebriert wird, als Auslöser infrage kommt. Schließlich kannte ich diese Geschichte von der Kreuzigung und der Auferstehung schon lange. In einem katholisch geprägten Land war ich mit diesen Bildern aufgewachsen. Überall, in den Klassenzimmern und Stuben, hing der gepeinigte Leib eines halbnackten Mannes. Im Gegensatz zu meiner Großmutter und meiner Mutter allerdings wurde mir der Glaube an Gott, Jesus und den Heiligen Geist nicht durch Drohungen und Schreckensszenarien in den Kopf zu setzen versucht, sondern durch Erzählungen von Wundertaten und Nächstenliebe.
Meiner Großmutter wurde in ihren Mädchenjahren in einem katholischen Internat noch eingebläut, dass selbst ein einmaliger Besuch in einer protestantischen Kirche eine schwere Sünde sei, die sie, wolle sie nicht in der Hölle schmoren, umgehend abzubüßen habe. Meine Mutter hatte sich aus Angst, auch nur eine »Sünde« bei ihrer ersten Beichte zu vergessen, eine Liste mit all ihren Vergehen geschrieben – eine Achtjährige, die auf Punkt und Beistrich Buch darüber führte, was sie im Laufe ihres kurzen Lebens »verbrochen« hat. Die Liste mit ihren »Sünden« verlor sie auf dem Weg zum Beichtstuhl. Dass sie sich nicht mehr dafür verbürgen konnte, wirklich alles in das Ohr des Priesters gelegt zu haben, quälte sie lange.
Trotz – oder vielleicht auch: wegen – dieser rigorosen Glaubenskur, der sich meine Mutter und zuvor ihre Mutter unterziehen mussten, wurden mein Bruder und ich nicht besonders religiös erzogen. Die Kirchgänge beschränkten sich zumeist auf die hohen Feiertage und nahmen im Laufe der Jahre immer mehr ab, bis zu jenem Zeitpunkt, an dem wir schließlich alle unsere Taufscheine zurückgaben.
Zu wissen, was der Auslöser für meine plötzlich aufgetretene Angst gewesen war, hätte etwas Beruhigendes gehabt: In Anbetracht einer Ursache wäre es meinen Eltern einfacher erschienen, mit den Auswirkungen umzugehen. Sie hätten den Anstoß abfedern, ihn mir auseinandersetzen, die Zündkapsel entschärfen können. Da der Auslöser aber in der Schwebe blieb, mussten wir uns dem Grund meiner Angst, ihrem Gegenstand, widmen, der zugleich bodenlos und sehr konkret war. Zum ersten Mal ist der Tod unmittelbar in mein Blickfeld geraten und hat sich dort für die kommenden Monate festgesetzt. Ich konnte kaum mehr etwas anderes in Betracht ziehen.
Wenn ich heute darüber nachdenke, scheint mir der dunkle Fleck, als den ich den Tod zuerst wahrgenommen habe, von ausschlaggebender Bedeutung zu sein. All die Umstände, von denen als mögliche Ursachen die Rede war, verdichten sich darin. Mit vereinten Kräften drängen sie ihn an den äußersten Rand unseres Gesichtsfeldes. Sie verdrängen ihn. Die schamhafte Einsamkeit der Trauer und ihres Schmerzes, mit dem, wenn irgendwie möglich, niemand anderer behelligt und in seinem Alltag gestört werden soll; die Reden von einem ewigen Leben, in dem das eigentliche Ziel unserer irdischen Existenz bestehen soll, das aber nur von den Guten, den Gläubigen und Braven erreicht werden kann; schließlich die Vorstellung davon, nicht nur den Tod, sondern auch die Trauer besiegen zu können: Was mich von meinen Jugendjahren an bis heute bei christlichen Beerdigungen zur Weißglut treibt, sind die priesterlichen Beteuerungen, die Hinterbliebenen müssten dankbar dafür sein, dass »der Herrgott« die Verstorbenen zu sich gerufen habe. Die schmerzhafte Trauer darüber, eine Freundin, einen Ehemann, ein Kind, eine Mutter oder einen Großvater verloren zu haben, wird schlicht und einfach übergangen. Wie durch Zauberhand soll sie sich, wenn schon nicht in Frohmut, so doch und vielleicht schlimmer noch in Dankbarkeit verwandeln.
Doch Schmerz, Trauer, Wut und Zorn, die mit den ersten beiden einhergehen, verschwinden nicht einfach. Sie lagern sich ein in den Köpfen und Herzen, unter der Haut und in den Knochen. Eines Tages, wenn niemand mit ihnen rechnet, quellen sie hervor und verursachen viel größere Schäden, als sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einem Trauerfall hätten anrichten können.
3.
Ich nehme den Tod also in mein Gesichtsfeld und setze mich an den Küchentisch. Küchen sind Orte des Lebens, des Austauschs von Worten, Gerüchen und Geschmäckern. Sie geben Vermengungen und Unklarheiten, aus denen Fantastisches entsteht, ihren Raum. Hier möchte ich über den Tod nachdenken. Schließlich gehört er zum Leben wie der grobe Schiffsboden, auf dem der Tisch und die Stühle stehen. Zwischen seinen Planken nimmt er großzügig Staubflusen, Tabakbrösel und Krumen auf, er bewahrt die kleinen Spuren, die von meinen täglichen Verrichtungen abfallen. Am Fensterbrett, hinter dem Tisch, stehen die Pflanzen und Kräuter, um die ich mich leidenschaftlich kümmere. Da ich aber auch leidenschaftlich gerne verreise, ist es immer wieder vorgekommen, dass das eine oder andere Gewächs dran glauben musste, dass nicht alle mit seiner Versorgung Betrauten ihrer recht zeitaufwendigen Aufgabe gewachsen waren.
An manchen Pflanzen hänge ich besonders: Den Rosmarinstock hat mein Vater vor fünfzehn Jahren in einen Tontopf gesetzt und mir mitgebracht; den Avocadobaum habe ich vor zehn Jahren aus einem Kern selbst gezogen; der Feigenbaum, der bis vor einem halben Jahr noch das Küchenfenster verdeckt hat, steht mittlerweile in einem großen Topf in meinem Arbeitszimmer. Erst wenn ich mich durchringen kann, ihn ins Freie zu setzen, wird er Früchte tragen.
Es kann fruchtbar sein, sich auszusetzen, sich einer Angst, einer Sorge, einer bedrohlichen Situation zu stellen. Ein Standpunktwechsel ist dafür unabdingbar. Viele Jahre lang habe ich mich verkrochen, ich habe den Tod inbrünstig gehasst, ihn in ein Eck gestellt in der Hoffnung, nichts mit ihm zu tun haben zu müssen. Mir ist das freilich so wenig geglückt wie allen anderen, die es versuchen. Heute denke ich nicht mehr, dass es wirklich glücklich wäre, ihn über weite Strecken meines Lebens für unberührbar zu erklären. Die Dunkelheit, die ihn umgibt, ist die des dunklen Flecks, das Schaudern der Netzhaut, wenn sie etwas streift, das außerhalb ihrer Reichweite liegen sollte.
DIE GANZ-OHNE-MICH-ANGST
1.
Seltsam ist, dass ich mir den Tod nie in einer bestimmten Gestalt vorgestellt habe: heute, wenn ich an meinem Küchentisch sitze, so wenig wie damals, als ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe. Dazwischen liegen viele Jahre, in denen ich von seinen unterschiedlichen Namen, Figurationen und Geschlechtern gelesen und gehört habe. In den romanischen Sprachen ist er weiblich, so wie das Leben, à la vie à la mort. Im deutschsprachigen Raum tritt er als Gevatter, als Freund Hein, als Sensenmann oder knöcherner Ritter auf, je nach sozialem Titel in karger, zerschlissener Kleidung oder hoch zu Ross mit Hut und Feder. Nein, der Tod ist in der Tat nicht für alle gleich. In Liedern aus unterschiedlichen Sprachregionen nimmt er die Gestalt von Tieren, häufig von Vögeln, an. In Kinderbüchern wird er zum freundlichen Skelett, das in Geisterbahnen und in Horrorfilmen mit furchterregenden Zügen versehen wird.
Damals, als mich die Angst vor ihm gepackt hat, habe ich mir kein Bild von ihm gemacht. Ich kannte zwar die in unseren Breiten üblichen Darstellungen, aber er kam nie in einer bestimmten Gestalt, weder in meine Alpträume noch in meine bangen Tagesfantasien. Er war groß und unbegreiflich, und dennoch habe ich ihn nicht zu einem konkreten Feind stilisiert, den ich bekämpfen konnte oder wollte. Meine Angst vor ihm war keine Furcht vor einem gespenstischen Knochenmann oder einem Vogel mit riesigen Schwingen. Vor ihnen hätte ich mich verstecken, ich hätte mir vorstellen können, in den Kampf gegen sie zu ziehen, mit Schwert und Zaubertrank bewaffnet. Die Angst, mit der ich es zu tun hatte, war nicht die vor einem furchteinflößenden Gegner. Sie befiel mich plötzlich, hinterrücks in den vertrautesten Momenten. Sie suchte mich heim.
Während ich mit meinem Bruder in unserem Zimmer saß und zusah, wie er mit seinen Dinosauriern spielte, konnte sie mich befallen, diese Angst. Es begann mit einem rührenden Gefühl im Bauch, mit einem surrenden Kreisel, der sich in meiner Magengrube drehte und der das, was ich unmittelbar vor mir hatte, in ein besonders warmes und anheimelndes Licht tauchte. Ein paar Augenblicke lang betrachtete ich mit tiefer Zuneigung meinen Bruder, wie er die gelbe Brontosaurierdame, der wir den Namen Duna gegeben hatten, zur imaginären Wasserstelle führte. Für den kleinen Menschen, der vor mir saß, die tapsigen Hände auf dem Rücken der schwerfälligen Echse, empfand ich die gleiche ausufernde Zärtlichkeit wie für all diese Tiere aus Plastik, die verstreut auf dem Boden lagen. Mit einem Schlag aber wurde mir klar, dass all das ein Ende hatte und dass dieses Ende schon nah war, denn ich würde sterben. Der Kreisel in meinem Bauch wurde größer, er bohrte sich in meinen Magen, schlug Löcher, in denen sich meine Gedanken verfingen. Was würde aus meinem Bruder, aus seinen Dinosauriern, aus diesem Zimmer werden, wenn ich nicht mehr da war? Was würde mit dem Stockbett geschehen, wenn … ich … nicht mehr … war? Sobald sich diese Frage in mir festgesetzt hatte, kam die Verzweiflung. Ich versuchte, sie zu bezähmen, die Tränen zurückzuhalten, um meinen Bruder nicht zu erschrecken, um nicht schon wieder zu meinen Eltern zu laufen. Vergeblich. »Mama, Papa, ich habe wieder Magendrücken.«
In dieser Zeit habe ich unzählige Male ein letztes Mal erlebt: ein letztes Mal, an dem ich Duna über den Rücken streichelte; ein letztes Mal, an dem mir mein Bruder erzählte, wie viele Tonnen Pflanzen Brontosaurier täglich fraßen; ein letztes Mal, an dem mein Vater am Morgen die Tasse mit dem schaukelnden Pumuckl darauf vor mich auf den Küchentisch stellte; ein letztes Mal, an dem meine Mutter im Auto ein Lied mit uns sang; ein letztes Mal vor dem Weihnachtsbaum; ein letztes Mal Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. All diese Momente, in denen der Kreisel in mir zu surren begann, wollte ich bewahren. Ich wollte sie aufheben, sie in meine Tasche stecken. Sie sollten mich begleiten auf meiner letzten Reise, die ich, davon war ich überzeugt, schon bald antreten würde.
Es handelte sich dabei um keine konkrete Todesahnung. Ein paar Jahre später hatte ich durchaus böse Ahnungen davon, dass mich eine tödliche Krankheit befallen könnte. Ich beobachtete meine Muttermale mit Argusaugen, fühlte in meinen wachsenden Brüsten die Krebszellen wuchern, roch mit Entsetzen den fremden Geruch auf meiner Haut. Die Krankheiten, die ich mir damals einbildete, standen in Zusammenhang mit den Veränderungen, die sich zu Beginn der Adoleszenz in meinem Körper vollzogen. Ich war, wie man damals sagte, »früh dran«. Meine erste Regelblutung bekam ich mit neun, und ich war sehr gut darauf vorbereitet. Meine Mutter hatte mir zuvor erklärt, was es mit diesen Blutungen auf sich habe, und im Gegensatz zu ihr selbst hatte ich, als ich zum ersten Mal das Blut im Höschen entdeckte, keine Angst davor, zu verbluten.
Meiner Mutter war es anders ergangen. Niemand hatte sie darauf vorbereitet. Ihre Mutter war, als sie ihr von dem Blut, das zwischen ihren Beinen floss, berichtete, in Tränen ausgebrochen, woraufhin meine Mutter davon überzeugt war, dass sie nun sterben müsse. Warum sonst sollte ihre Mutter so reagieren, wenn diese Blutung nicht ein Zeichen für eine tödliche Erkrankung war? Ja, warum denn sonst?
Damals, ein, zwei Jahre vor dem Beginn meiner Pubertät, hing meine Angst vor dem Tod nicht an konkreten Krankheitsbildern. Sie war umfassend. Ich stürzte in sie wie in einen tiefen Brunnen. So sehr ich auch strampelte, ich gewann keinen Boden mehr unter den Füßen. Weder konnte ich Halt finden an den kalten Wänden noch kam der Aufprall, der mich meiner selbst wieder vergewissert hätte. Ich hing in der Luft, baumelte im Auge eines Gedankenorkans, der sich um nichts anderes drehte als um mich selbst. Ich konnte mir nicht vorstellen, was mit all den Menschen und Dingen geschehen würde, wenn ich nicht mehr auf der Welt, wenn ich nicht mehr bei ihnen wäre. Das Entsetzen, das mich packte, bestand darin, dass die anderen: meine Eltern, mein Bruder, Duna, das Stockbett, ganz ohne mich sein würden – ganz, auch ohne mich.
Dabei ging es nicht um jene narzisstischen Kränkungen, die ich Jahre später durchexerziert habe, wenn ich mir aus einer boshaften Mischung aus Trotz und Seelenschmerz heraus vorstellte, wie sehr gerade jene Menschen meinen plötzlichen Tod betrauern würden, die mich, absichtlich oder nicht, verletzt hatten. Vor meinem Grab würden sie stehen und es bitter bereuen, mich nicht eingeladen, mich nicht beachtet, mir ihre Zuneigung nicht gezeigt zu haben. Sie wären eben nicht mehr ganz gewesen ohne mich. Ein Bestandteil ihres Lebens, dessen Bedeutung sie nicht rechtzeitig erkannt hatten, wäre durch mein Ableben unwiderruflich verloren gegangen.
Mit acht Jahren habe ich mir nicht vorgestellt, wie meine Eltern, mein Bruder mit Duna auf dem Arm, meine Großmutter und meine beiden Großväter in tiefster Trauer vor meinem Sarg standen. Zu diesem Bild bin ich nicht vorgedrungen. Ich konnte keinen zeremoniell-rachsüchtigen Schleier über meinen Tod legen. Mein Entsetzen verfing sich in den alltäglichen Situationen, die mein Leben ausmachten. Aus ihnen herausgesprengt oder, weniger dramatisch, ihnen für alle Ewigkeit entzogen zu werden, berührte die Grenze meiner Vorstellungskraft, hinter der ein erdrückender Schmerz lag.
Die Frage, was mit den Lebewesen und Dingen passiert, die ohne uns zurückbleiben, ist mir vor zwei Jahren in einem Kinderbuch wiederbegegnet. Meine Freundin Ilse hat Wolf Erlbruchs Ente, Tod und Tulpe zweimal auf dem Postweg zu mir geschickt: Einmal, da sie mir schon so viel davon erzählt hatte und es endlich Zeit wurde, dass ich es kennenlernte. Und noch einmal, nachdem mein Vater gestorben war, als tröstende Begleiterin.
In diesem illustrierten Büchlein blickt die Ente auf den Teich, in dem sie gerne schwimmt, und bemerkt, dass er, sobald sie gestorben wäre, wohl immer so verlassen daliegen würde, ganz ohne sie. Die Beziehung zwischen dem Tod und der Ente ist eine freundschaftliche, in manchen Momenten ist sie sogar richtig liebevoll, etwa wenn die Ente ihn wärmt, nachdem er mit ihr im Teich geschwommen ist. Seine Anwesenheit ist eine begleitende und keine bedrohliche, die über den Köpfen der Lebenden schwebt. Er tritt auch nicht allwissend oder gar belehrend auf, er beantwortet die Fragen der Ente so gut er kann, wobei er manchmal in Verlegenheit gerät. Der Tod ist in diesem Kinderbuch menschlich, auf allen Ebenen, und zugänglich: Niemand muss zu ihm vorauseilen, sich ihm stellen oder sich vor ihm verstecken.
Die Stelle mit dem Teich ist es, worüber Ilse und ich am meisten gesprochen haben, über diese Sorge um alles, das zurückgelassen wird, wenn eine stirbt. Darin habe ich meine Angst als Kind wiedererkannt, diese Angst davor, alles ganz zurücklassen zu müssen.
Maria Stepanova beschreibt zu Beginn ihres Essays Nach dem Gedächtnis, wie die Dinge nach dem Tod ihrer Tante Galja augenblicklich verwaisten. »Die Wohnung wirkte perplex, geschrumpft, voller plötzlich entwerteter Dinge.« Ohne den Zusammenhang ihres alltäglichen Gebrauches hatten sie ihre Bedeutung verloren. Und dennoch waren sie ganz. Sie bildeten eine Hinterlassenschaft, aus der sich jene Fäden ziehen ließen, in denen sich die Lebensgeschichten der Verstorbenen und ihrer Zugehörigen1 verstrickten. Die Bedeutung, die sie dadurch erhielten, war eine andere, verwoben zwar mit dem Leben, das eben vorübergegangen war, und trotzdem ein für alle Mal abgelöst von dem Menschen, der sie verwendet hatte. Sie verwandelten sich in Statthalter eines Lebens, das sie in Erinnerung riefen und von dessen unwiderruflichem Ende sie zugleich zeugten.
2.
Mein Vater hat seine Hinterlassenschaft vor der Operation geregelt. Er hat die Lebensversicherungspolizzen in den Ordner mit seinem Testament gesteckt und die Zugangsdaten zu seinen Bank- und E-Mail-Konten aufgeschrieben. Meine Mutter, mein Bruder und ich sollten im Falle des Falles alles Nötige so schnell und unkompliziert wie möglich in die Wege leiten können. Wir sollten auch ohne ihn zurechtkommen.
Die Operation hatte eine längere Vorlaufzeit. Zwischen der Diagnose, dass die Lungenfibrose, mit der er schon jahrzehntelang gelebt hatte, nun ein progressives Stadium erreicht hatte, bei dem nur noch eine Organtransplantation Besserung beziehungsweise sogar Heilung bewirken konnte, und der Mitteilung, dass ein passendes Spenderorgan gefunden worden sei, lagen fünfzehn Monate. Der Operation selbst gingen zahlreiche Untersuchungen voran: Zuerst musste seine physische und psychische Eignung geprüft werden, dann die Schwere der Erkrankung und somit die Dringlichkeit, mit der er auf die Warteliste für die Organspende gesetzt wurde. In all diesen Monaten konnte sich mein Vater darüber Gedanken machen, wie er uns, sollte bei der Operation etwas passieren, zurücklassen würde. Abgesehen von der Kurzatmigkeit, die seinen Bewegungsradius massiv einschränkte und die trotz der Sauerstoffflasche, die er Tag und Nacht tragen musste, stetig zunahm, war er in einer so guten Verfassung, dass er all das, woran ihm gelegen war, regeln konnte.
Am Tag der Operation ist er guter Dinge gewesen. Voll Zuversicht hat er die bangen Stunden verbracht, in denen vor Ort, im Krankenhaus, noch geklärt werden musste, ob die entnommene Lunge tatsächlich transplantiert werden konnte. Meine Mutter und ich sind bei ihm im Zimmer gesessen. Niemand von uns ist auf die Idee gekommen, ihm zu versichern, dass wir ohne ihn zurechtkämen. Wir sprachen über alltägliche Dinge, darüber, was wir gefrühstückt hatten, über die frühmorgendliche Fahrt ins Krankenhaus, die meine Eltern im Rettungswagen unternommen hatten, über den ausgesprochen schönen Sommertag und auch darüber, wie es nach der Transplantation weitergehen würde.
Mein Vater hat die Operation gut überstanden. Als er eineinhalb Jahre später indirekt an den Folgen der Lungentransplantation starb, war die Hinterlassenschaft längst geregelt. Er hat mich, als ich am letzten Tag, an dem er noch bei Bewusstsein war, bei ihm gesessen hatte, nicht darum gebeten, meine Mutter zu unterstützen. Ich habe es ihm zwei Tage später, während seiner letzten Atemzüge, dennoch versprochen.
Mein Freund Leo2 hat, unmittelbar bevor er sich aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Stockwerk stürzte, eine geplante Reise storniert, seiner Frau Geld überwiesen, eine Liste mit den Zugangsdaten zu seinen Bank- und E-Mail-Konten geschrieben und auf seinem Schreibtisch hinterlegt. Die Verzweiflung, die ihn veranlasst haben musste, auf diese Weise seinem Leben ein Ende zu setzen, konnte ihn nicht davon abhalten, an diejenigen zu denken, die er zurücklassen würde: an seine Frau, an seine Kolleginnen und Kollegen, die mit seiner Anwesenheit bei einer Tagung in naher Zukunft gerechnet hatten, an das Leben, das er als zuverlässiger Kollege, Ehemann, Freund geführt hatte.
Leo ist wenige Monate nach meinem Vater gestorben. Den Augenblick, in dem er das Fenster vielleicht schon geöffnet hat und in dem er noch ein Blatt Papier zur Hand nimmt, um seine Passwörter aufzuschreiben, versuche ich mir immer wieder vorzustellen. Wie stark dieser Beweggrund gewesen sein muss, an ein Danach zu denken, das er doch mit ganzer Kraft und unter Preisgabe seines Lebens ausschließen wollte. Das Ganz-ohne-Sich, das er für sich wollte, wollte er nicht für seine Hinterbliebenen.
Leos Liste habe ich nie zu Gesicht bekommen. Eine gemeinsame Freundin hat mir davon erzählt. Mein Vater hat die Zugangsdaten zu seinen elektronischen Postfächern, zu einer Onlinefotoplattform, zu den Abrechnungsaccounts der Energiegesellschaften, die mein Elternhaus mit Strom und Gas belieferten, zum E-Banking, zu Paypal und einigen anderen Diensten zweimal aufgeschrieben. Die Liste, die er vor seiner Transplantation verfasst hat, steckte in einer orangenen Flügelmappe, die sich in der Schreibtischschublade im sogenannten »Computerzimmer« befand.
In diesem kleinen Raum im ersten Stock des Hauses verbrachte mein Vater seit seiner Pensionierung viele Stunden damit, die Fotos zu bearbeiten und über eine Onlineplattform zu teilen, die er früher auf Reisen und später im Garten oder vom Fenster des Zimmers aus aufgenommen hatte. Der alte Schreibtisch mit der Schublade steht im Eck neben dem Fenster, unter dem ein Sommerfliederbusch wächst. Sitzt man am Tisch, blickt man schräg links auf den Computerbildschirm und geradeaus auf die Wand, an der eine Magnettafel hängt. Notizzettel mit Mailadressen und Briefe mit verschiedenen Angeboten für Reparaturarbeiten im Haus sind darauf befestigt. Eine halbe Drehung mit dem Stuhl, und vor einer steht auf schlanken Holzbeinen ein Küchentisch aus den Siebzigern. Auf der hellen Resopalplatte stapelten sich die Medikamente, die mein Vater vor und vor allem nach der Lungentransplantation einnehmen musste. Die Entwässerungsmittel, die Magenschoner und, immer im großen Vorrat, jene Tabletten, die sein Immunsystem davon abhielten, das transplantierte Organ wieder abzustoßen. Die Schachteln mit den Medikamenten waren das Erste, das meine Mutter nach dem Tod meines Vaters entsorgte.
Mein Bruder, meine Mutter und ich wussten von der ersten Liste in der Schublade. Die zweite, die ganz offen am Schreibtisch unter der Computertastatur lag, haben wir bis zu seinem Tod nicht wahrgenommen.
Während der Pandemiezeit blieben mein Bruder und ich nur selten über Nacht bei unseren Eltern. Wir wollten meinen Vater nicht noch einer zusätzlichen Gefahr aussetzen. Besuchten wir unsere Eltern tageweise, hielten wir uns entweder im Garten oder, wenn es witterungsbedingt nicht möglich war, im Wohnzimmer auf, wo wir ausreichend Abstand halten konnten. Meine Mutter betrat das »Computerzimmer« nur selten. Sie vermied es so gut es ging, am Computer zu arbeiten. Alle Onlinegeschäfte und -erledigungen blieben meinem Vater überlassen.
Die zweite Liste musste er wenige Monate vor seinem Tod geschrieben haben. Vielleicht hatten sich einige Daten geändert, vielleicht waren weitere Onlinedienste, die er in Anspruch nahm, hinzugekommen. Heute denke ich, dass ihn die Krebsdiagnose dazu veranlasst hatte, die Liste neu zu schreiben. Ich weiß nicht, wie lange er schon wusste, dass die ständige Unterdrückung der Immunreaktion ein horrendes Wachstum von Krebszellen in seinem Körper begünstigt hatte. Wir haben erst davon erfahren, als er wegen akuter Atemnot zum letzten Mal in seinem Leben ins Krankenhaus kam.