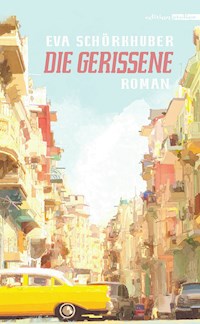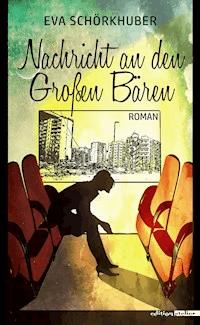Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der blauen Morgendämmerung hängt eine Leuchtschrift: »Aufstehen!« Vor den verdutzten Augen der Morgen- und der Spätnachtmenschen verwandelt sich die Schrift. Unzählige leuchtende Punkte wirbeln durcheinander und formieren sich neu. »Aufstand!« schwebt jetzt in der morgenfrischen Luft über dem Höchstädtplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk. Die Menschen reiben sich die versandeten Träume und den letzten Schnaps aus den Augen. Was soll das heißen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EVA SCHÖRKHUBER
QUECKSILBERTAGE
ROMAN
Verlier’ ihn nicht, den Taschentraum,der im abgetragenen Mantel steckt,pass gut auf darauf, dass in jedem Manteleine Tasche ist für einen Traum.
frei nach den Playbackdolls, »Pocket-Dream«
Inhalt
ZUKUNFTSZAUBERER
SCHERENSCHNITTE
FAHRRADKLINGEL
EIN STADTLIED
NEBELHORN
GLASGLOCKE
FREIZEICHEN
KOMMUNIQUÉS ZUM 8. MAI
NOCH EIN STADTLIED
TRIANGEL
EIN DRITTES STADTLIED
SINGENDE SÄGE
MAUERSPECHT
INSTITUT FÜR DIE NACHHALTIGE KOMMUNIKATION MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT
KLINGELBEUTEL
EIN WEITERES STADTLIED
EINE SAITE, DIE ANGESCHLAGEN
EINE SAITE, DIE REISST
WINDSPIEL
STADTLIED NUMMER FÜNF
FLÜGELSCHLÄGE
UND NOCH EIN STADTLIED
KREISSÄGE
EIN SIEBTES STADTLIED
PAPIERTIGER
MUSIKBOX
TÜRANGEL
SCHERENSCHNITTE
FLASCHENFLÖTISTIN
INSTITUT FÜR DIE NACHHALTIGE KOMMUNIKATION MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT
EIN WEITERES STADTLIED
Anmerkungen
ZUKUNFTSZAUBERER
Schon von Weitem war er zu sehen, wie er da stand, mitten auf der Wiese, auf dieser Lichtung zwischen den Schießbuden und dem Karussell. Er stand da: eine dünne, verknitterte Gestalt im abgewetzten Frack, einen schwarzen, zerknautschten Zylinder auf dem Kopf, so stand er da, und die Menschen zogen an ihm vorüber, zogen an ihm vorbei, hin zu den Schießbuden, hin zum Karussell. Näherte man sich ihm, schienen die herabhängenden Arme wie Flügel, leicht gespannt wie kurz vor dem Abflug – noch ein paar weitere Schritte auf ihn zu, und die kirschrote Mundgerade wurde zur Saite, die, eben angeschlagen, leicht und leise vibrierte, ein Tremolo ankündigend, das jetzt – jetzt gleich! – einsetzen würde.
»Meine seeeehr – meine sehr … verehrten … meine sehr verehrten Damen und Herren! Kommen Sie, kommen Sie! Kommen Sie und treten Sie näher. Ich werde Sie in Erstaunen versetzen – ja!, Sie und Sie auch, ich werde Sie so in Erstaunen versetzen, dass sich Ihre Schnurrbärte aufzwirbeln, dass sich Ihre Hüte wie Tellerchen auf Ihren Köpfen drehen werden. Zögern Sie nicht! Nicht länger! Kommen Sie, kommen Sie! Sehen Sie diesen Hut hier? Ja!, diesen Hut hier, hier auf meinem Kopf. Aus ihm, diesem Hut, werde ich die Zukunft zaubern, ich werde Ihre Zukunft aus diesem Hut zaubern. Und die aus dem Hut gezauberte Zukunft werde ich Ihnen, meine seeeehr – meine sehr … verehrten … meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Füßen legen, wie ein gehäutetes Kaninchen werde ich Ihnen Ihre Zukunft zu Füßen legen, ich werde sie Ihnen aufsetzen wie einen zerbeulten Schnellkochtopf, vor den Latz werde ich sie Ihnen knallen wie einen Straußenfederball. Kommen Sie! Treten Sie näher! Zögern Sie nicht! Nicht länger! Nehmen Sie Ihre Zukunft entgegen! Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand! Gnädigste, Verehrteste, was habe ich denn für Sie? Mal sehen, mal sehen … Ah! Eine Prise Salz, mit der Sie das Süppchen kräftig versalzen können. Ob Ihr Süppchen oder das Süppchen der anderen, das bleibt ganz Ihnen überlassen, meine Gnädigste, meine Verehrteste. Was habe ich da noch? Oh, eine Bettfeder, eine wundervolle Bettfeder, die quietscht. Und für Sie, mein Herr, was habe ich für Sie? Was zaubere ich für Sie hervor, hervor aus meinem Hut? Ah! Einen Federhalter, den Federhalter, mit dem Sie unterzeichnen, mit dem Sie Ihre Pleite unterzeichnen, Sie, Sie selbst werden der Prokurist Ihres Versagens sein. Und was noch? Was habe ich noch für Sie? Oh, ein Glasauge, das Glasauge, mit dem Sie sich versehen werden nach einem Ihrer Abenteuer, wunderbar, wundervoll. Und Sie, mein Fräulein? Oh schönes Fräulein, darf ich’s wagen, Ihnen Ihre Zukunft anzutragen? Na sehen Sie, was ich da hab’, für Sie hab’ ich ein Fernrohr, mit dem Sie Ausschau halten können nach den Feigen, den Feigen, die da baumeln an den Zweigen über Ihrem Kopf. Und einen Anker hab’ ich auch für Sie, den Anker, mit dem Sie sich verankern werden in der Zwischenwelt, in der Unterwelt, wo’s Ihnen auch beliebt. Meine Damen, meine Herren – seeeehr vereeeehrt, so wie Sie sind –, kommen Sie, kommen Sie und nehmen Sie alles Mögliche entgegen, nehmen Sie, was Ihnen zukommt, nehmen Sie sie, nehmen Sie sie an, nehmen Sie sie entgegen, die Zukunft, die ich aus meinem Hut zaubere, nehmen Sie davon so viel wie möglich! Lesen Sie sie auf, sammeln Sie sie, Ihre Zukunft, je mehr Zukunft, desto besser! Tragen Sie Ihre Zukunft vor sich her, versammeln Sie Ihre Zukunft zu einem Bauchladen, trödeln Sie nicht, vertrödeln Sie sich nicht, werden Sie lieber selbst zum Trödler, zur Trödlerin Ihrer eigenen Zukunft. Die Zunft der Zukunftströdler ist eine goldene, meine seeeehr – meine sehr … verehrten … meine sehr verehrten Damen und Herren, bereichern Sie sich mit Ihrer Zukunft, bereichern Sie sich an der Zukunft, die ich, ja! ich!, für Sie aus meinem Hut gezaubert habe, dem Hut, der …«
Der Hut, der in seinen Händen tanzte, der schwarze, zerknautschte Zylinder, schwoll an, blähte sich auf, stülpte sich über die Gestalt im abgewetzten Frack, verschlang die Menschenmenge, die sich um den Zukunftszauberer versammelt hatte. Nur die Stimme, die blieb – im dunklen Zauberhut-Schlund aber war sie gedämpfter, ein leiser Singsang, Stimmmurmeln, die hinunterrollten, die aneinanderschlugen. Körperlos nun, diese Stimme, verteilt über die Gestalten, über die Regalfluchten der Marktstände, zerstäubt wie das Licht, gnadenlos gleichmäßig, unerbittlich eintönig. »Und welche Zukunft kannst du dir leisten?« Dieser Satz schwebte über den Stellagen, über den Regalfluchten hing er wie in den Neonlichtnebel geschrieben.
In der blauen Morgendämmerung hängt eine Leuchtschrift: »Aufstehen!« Vor den verdutzten Augen der Morgen- und der Spätnachtmenschen verwandelt sich die Schrift. Unzählige leuchtende Punkte wirbeln durcheinander und formieren sich neu. »Aufstand!« schwebt jetzt in der morgenfrischen Luft über dem Höchstädtplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk. Die Menschen reiben sich die versandeten Träume und den letzten Schnaps aus den Augen. Was soll das heißen?
SCHERENSCHNITTE
Ziemlich verwickelt das Ganze. Wie sie da stand, in dieser Nacht, vor der Fassade des Gemeindebaus, am Rande des orangenen Lichtkegels. So stand sie da: eine schlanke, mittelgroße Gestalt in hellen Jeans und dunklem Shirt, in Betrachtungen vertieft, in Gedanken versunken. Der Abend, den sie hinter sich hatte, war nicht nur in ihrem Kopf, sie trug ihn auch auf ihrem Kopf, diesen Abend, an dem sie die vielen Schnitte gesetzt hatte. Schnitt für Schnitt für Schnitt waren sie gefallen, die langen braunen Haare, und herausgekommen war dieser Kopf mit den kurzen, borstigen Haarbüscheln. Ein einziges nur war lang und glatt geblieben. Und dieses hatte sie hierhergetragen, vor die Fassade des Winarskyhofes, der nur wenige Schritte von ihrer Wohnung entfernt lag. Hier stand Valerie nun. Sie stand da wie angewurzelt und drehte die eine Haarsträhne, die ihr noch verblieben, durch die sie noch verbunden war mit der Welt da draußen, da drinnen, so viel Welt, so viele Welten, die sich trafen, die sich kreuzten mit der Zeit, die vergangen war, mit der Zeit, die vor ihr lag wie ein toter Fisch. Ausnehmen konnte sie ihn nun, diesen Fisch, der die Zeit war, ausnehmen konnte sie ihn, entweder um ihn zu verzehren oder um in seinen Eingeweiden zu lesen, um aus ihnen herauszulesen, was noch kommen, was noch auf sie zukommen würde.
Ziemlich verwickelt das Ganze. Die Sache mit der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, die Sache mit der toten, kalten Zeit. Einmal war es die Gegenwart, einmal die Zukunft, das andere Mal wiederum die Vergangenheit, mit der Valerie nichts anfangen, zu der sie keinen Zugang finden konnte. Wenn sich die Lebenszeit ausnahm wie ein kleines, mehrfach zusammengefaltetes Stück Papier, an dem sich die Zeit vergangen hatte, an dem sie sich verging, in das die Zeit ihre Zähne, ihre Krallen und Kerben schlug, und dieses kleine Stück Lebenszeit schließlich ausgebreitet, aufgefaltet würde, dann würden die Muster sichtbar werden, die durch die Schnitte, die Einschnitte entstanden waren. Wie ein Scherenschnitt würde dann das kleine Stück Lebenszeit vor einer liegen. Die nachfolgenden Generationen könnten daraus ablesen, wie sich die Zeit an den Vorfahren vergangen hat, welche Einschnitte, welche Verwundungen dazu geführt haben, dass … Sie könnten dann auch ablesen, wie sich die Zeit an ihnen selbst vergangen hat, an ihnen, die aufgewachsen sind in der Zeit, die vergangen war, die sich an ihren Eltern und Großeltern vergangen hatte. Wie nun, wie würde wohl Valeries kleines Stück Lebenszeit aussehen, so ausgebreitet, so aufgefaltet – welche der Schnitte und Einschnitte, welche der Verwundungen würden wohl später als symptomatisch für diese Zeit, für ihre Zeit betrachtet werden?
Ziemlich verwickelt das Ganze. Noch immer stand Valerie da, vor der Fassade des Winarskyhofes, die eine Hand in der Hosentasche, die andere mit der letzten langen Haarsträhne befasst. Die Schnitte und Einschnitte ihrer Zeit, wütend und willkürlich müssten diese gesetzt sein, kreuz und quer über das Ganze, das ganze Blatt verteilt, und in dem Muster, in dem Scherenschnittmuster müssten sich die Brüche, die Unstetigkeiten, müsste sich das Halbfertige, das Unausgegorene zeigen. Aber wer konnte das schon wissen, wer konnte wissen, was daraus zu lesen, was herauszulesen sein würde aus den Einschnitten und Eingriffen dieser Zeit, die ihre Zähne, ihre Krallen und Kerben gerade in ihre Lebenszeit schlug. Valeries Haarschnitt zum Beispiel: Die meisten würden das wohl als eine Reaktion, eine Überreaktion auf ihre Trennung von Roland betrachten. Ein neues Leben. Eine neue Freiheit. Whatever. Dass es eine Art Fluch, eine Art Voodoo-Zauber hatte sein sollen, darauf würde niemand kommen, wie denn auch, wozu denn auch, schließlich ist sie doch eine aufgeklärte, eine gut ausgebildete junge Frau, die ihr Leben schon machen, die ihr Leben schon in den Griff bekommen würde, wenn – wenn sie endlich aufhören würde, sich selbst im Weg zu stehen (so Georg), wenn sie sich endlich aufraffen würde, sich einen angemessenen Job zu suchen (so die Eltern), wenn sie nur ein wenig ehrgeiziger wäre (so Doris und in ihrem Windschatten auch Evelyn), wenn sie nur ein wenig anschlussfähiger wäre (so Rita und Fred). Und Roland? Der hatte sich kaum Gedanken über ihre Zukunft gemacht, der wollte etwas aus sich machen, und in seinem Gefolge, als seine Gefährtin, hatte er auch sie ein wenig mitbedacht, miteingerechnet. Was der wohl gerade? Wo der wohl gerade? Wahrscheinlich war er in Salzburg, bei einem Meeting, einem Vernetzungstreffen, schließlich gehe es ja jetzt um alles, um alles, was ihm möglich sei nach dieser Ausbildung. Fünf Männer im Anzug, alle jung und dynamisch und ehrgeizig, und eine Frau im Kostüm, die am jüngsten, am dynamischsten, am ehrgeizigsten war, da sie schon eine Ahnung von der gläsernen Decke hatte und Erfahrung mit den informellen Bierglas-Absprachen unter den Kollegen. Und wenn Valerie jetzt einfach so stehen blieb? Hier, vor dem Winarskyhof, unter dem Leintuchtransparent, und sich ausmalen würde, wohin das alles führen würde, das ›Alles‹, was zu tun wäre, wenn sie sich eine Tat überlegen und in allen Details mit allen Konsequenzen ausmalen würde, dann würde sie den Rest ihres Lebens einfach hier stehen bleiben und sich überlegen, was zu tun, wie das zu tun, wohin das, was zu tun wäre, führen würde. Jede kleinste Bewegung, jeder kleinste Schritt hätte eine unüberschaubare Anzahl an möglichen Konsequenzen. Auch der Entschluss, hier stehen zu bleiben, würde vieles mit sich bringen, würde vieles nach sich ziehen. Valerie könnte verhungern, sie könnte erfrieren dabei, bei dieser Aufgabe, dieser Lebensaufgabe, wenn sich nicht Menschen finden würden, die ihr etwas zu essen bringen würden, zum Beispiel Wurstsemmeln, wie in dieser Geschichte, die sie einmal gelesen hatte, diese Geschichte, in der eine junge Frau am Karlsplatz gesessen war und nicht mehr von ihrem Hintern hochkommen wollte. Auch wenn sie nicht verhungern würde, sondern bis in ein hohes Alter hinein einfach stehen blieb, so stehen blieb, selbst dann würden sie wahrscheinlich in ihren Grabstein diesen Satz meißeln, den Satz mit allen Möglichkeiten: »So schade um sie, ihr wäre doch wirklich alles möglich gewesen. Talent hatte sie zwar keines, aber eine gute Ausbildung und ein solide gebildetes Elternhaus.« So oder so ähnlich. Sie aber würde in ihrem Testament darauf bestehen, dass dieser Scherenschnitt, der in ihre Lebenszeit schon eingelassen war, auch in den Grabstein eingelassen werden würde, als Zeichen, als Ausdruck dafür, wie diese Zeit, in der ihr angeblich so vieles möglich gewesen, mit ihr verfahren war, wie diese Zeit sich an ihr vergangen hatte.
Und überhaupt! Was sollte das alles hier? Betrunken war sie und selbstmitleidig. Und desorientiert, obwohl nur wenige Schritte von ihrer Wohnung entfernt. Was machte sie hier? Valerie stand da wie angewurzelt und starrte auf dieses Transparent, auf dieses Leintuchtransparent, das nichts zu sagen, das ihr nichts zu sagen hatte. Was tun! Sie, sie tat ja gar nichts. Sie stand hier seit geraumer Zeit und ließ sich alles Mögliche durch den Kopf gehen. Oder nein. Nicht alles Mögliche. Nur Fragmente, Bruchstücke aus dem Leben, aus den Leben, die vor ihr, die hinter ihr lagen. Was wusste sie. Was wusste sie denn schon. Aber. Wäre das nicht der Ort, wäre das nicht der Moment, um endlich – endlich! – alles Mögliche zu begraben? Wie wäre es, wenn. Wenn sie sich jetzt, hier, endgültig von der Welt abnabeln würde. So viele Schnitte heute schon. So viel Zauber, fauler Zauber. Warum denn nicht. Warum nicht hier, unter diesem Leintuchtransparent, die Nabelschnur begraben? Kein geeignetes Werkzeug war in ihrer Tasche. Was tun also? Ein paar Schritte zur Seite. Dort stand diese Frau mit dem Hunde-Schatzi. Wie lange redete die schon auf dieses Schatzi ein. Egal. Sie rauchte. Hatte also wahrscheinlich ein Feuerzeug. Oder Zündhölzer. »Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht Feuer?« Der mürrische Griff in die Rocktasche. »Da habn S’!« »Ich bring’s gleich zurück.« Schnell weg. Wohin, damit die Hunde-Schatzi-Frau nicht sah, wie sie verschwand. Dorthin, ins Dunkle, ganz nah an die Mauer. Ein blinder Fleck. Sehr gut. Mit der linken Hand die Haarsträhne hochgezogen, mit der rechten das Feuerzeug bedient. Die Flamme groß genug. Hier ungefähr die Stelle. Mit dem Daumen und dem Zeigefinger diese Stelle festhalten. Die Flamme direkt darunter ansetzen. Nur nicht die Finger verbrennen, nur nicht die Finger verbrennen. Wie das stank. Versengtes Haar. Mit den Fingerspitzen die Ränder abtasten, die Glut ausdämpfen. Schon vorbei. In der einen Hand die lose Haarsträhne, in der anderen das Feuerzeug. Das Feuerzeug der Frau zurückgeben. »Danke.« Dieser Blick. Verständnislos. Misstrauisch. Wofür die wohl das Feuerzeug gebraucht hatte. Rauchte ja gar nicht, et cetera et cetera. Was kümmert’s sie. Und nun. Direkt unter das Fenster mit dem Leintuchtransparent. Was tun! Ja. Die Erde ein wenig aufwühlen. Hoffentlich kein Hundedreck. Nein. Nur das trockene Gras. Mit den Fingernägeln in den Boden. Trockene, steinige Erde in der Hand, unter den Nägeln. Die Haarsträhne hineinlegen in die kleine Grube. Die Erdbrösel darüber. Festklopfen. Fertig. Begraben, die Nabelschnur. Vielleicht sollte Valerie jetzt ein Lied singen, oder pfeifen. Nur so. Als Zeremoniell. Die erste Melodie, die ansetzte in ihrem Kopf, das war doch – ja, das war so ein Vogellied, ein Kindervogellied. Wie hieß das doch? – »Alle Vöglein, alle Vöglein …« Egal. Sie würde einfach darauf pfeifen.
Die Menschen, die am Morgen aus den Wohnblöcken und Gemeindebauten auf die Straße tröpfeln, werfen viele Blicke auf ihre Armbanduhren. Nicht zu spät, nur nicht zu spät in die Arbeit kommen, schwirrt und singt es in ihren Köpfen, ihren Armen und Beinen. Heute aber sind ihre Stundengläser zerbrochen. Durch die gesprungenen Gläser hindurch können sie die Zeit nicht mehr ablesen. Hilflos stehen sie an den Straßenrändern und heben unentschlossen die Arme, an denen die Uhren hängen, die sie nicht mehr entziffern können. Alleen aus nach vorn gestreckten Armen säumen die Straßen der Schlafstadt. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät!
Georg, der ausgesprochen »zufrieden« war mit ihrer Arbeit in seiner Kanzlei, der sie aber aus »strukturellen« Gründen nicht unmittelbar nach dem Praktikum hatte anstellen, hatte »behalten« können: Zu seinem eigenen »größten Bedauern« hatte er ihr mitteilen müssen, dass das nicht gehe, dass er das momentan nicht könne, der »schwierigen Zeiten« wegen. Ein Volontariat hatte er ihr anbieten können. Und Evelyn, die mit Georg »etwas« begonnen hatte, so zumindest hatte sie das angedeutet, vorsichtig, vielleicht um herauszufinden, was zwischen Valerie und Georg war, Evelyn, die mit Georg also irgendetwas laufen hatte, die vielleicht auch schon ein Volontariat bei ihm begonnen hatte, mit den besten Aussichten beruflicher und privater Natur, so würde sie das, so würde sie sich wohl ausgedrückt haben Doris gegenüber, die ja schon dabei war, ihren Weg zu machen. Diese Doris. Die wohnte doch mitten im Zweiten, im Karmeliterviertel wohnte sie jetzt. Doris, die auf ihre Zukunft spekulierte, die in ihre Zukunftsspekulationen investierte und sich mit so viel Zukunft, so viel Zukunft auf Zeit umgab. Ob sie es wirklich zu etwas bringen würde, diese Doris. Doris, die sich als beruflich erfolgreich betrachtete mit ihrem unbefristeten Praktikum im Heeresgeschichtlichen Museum, die irgendwie stolz darauf war, Single zu sein, denn sie, sie habe ja hohe Ansprüche. Roland, der noch immer mit seiner Bundesheer-Tasche reiste, der damit anreiste an den Wochenenden. Roland kam alle zwei, drei Wochenenden auf Besuch nach Wien, wenn es sich ausging und er keine samstäglichen Verpflichtungen an der Fachhochschule in Salzburg hatte. Die Flasche mit dem Segelschiff, mit dem im Wind liegenden Segelschiff, blaue Konturen und ein roter Schriftzug, diese Flasche stand bei ihr im Badezimmer immer dann, wenn Roland am Wochenende zu Besuch war. Rolands Old-Spice-Geruch, sein Körper mit dieser Duftnote, ein Duftkörper, der aus dem Bad an den Frühstückstisch trat. Am Frühstückstisch dann umgeben von Kaffeegeruch, Butter- und Marmeladenoten, der Old-Spice-Duftkörper im Frühstücksmantel. Roland, frisch rasiert, mit der Zeitung in der Hand. Rolands Augen – gläserne Puppenaugen. Roland, der nach dem Nachmittagskaffee in die U-Bahn stieg, zum Bahnhof fuhr und nach Salzburg zurück. Und Roland auch eher ein Einzelgänger. Das »solide gebildete Elternhaus«. Wenn sie zu ihren Eltern nach Gramastetten fuhr. Die Eltern kamen so gut wie nie nach Wien. Höchstens ein, zwei Mal im Jahr. Um sich etwas anzusehen. Ins Theater zu gehen, ins Musical. In eine Ausstellung, meistens in der Albertina. Von dem angebotenen Volontariat hatte sie den Eltern nichts erzählt. Zu schwierig war es abzuschätzen gewesen, wie sie reagieren würden. Auf jeden Fall ungehalten. Aufgebracht. Zornig. Doch gegen wen sich dieser Zorn gerichtet hätte, war nicht abzusehen gewesen. Gegen sie, weil sie »so was« mit sich machen ließ. Oder gegen Georg, der »hochqualifizierte« Leute ausbeutete. Der Job bei Fred und Rita war furchtbar langweilig, ein Sekretärinnenjob, nicht mehr, eigentlich war kein Studium dafür notwendig. Fred und Rita, zu denen sie nicht richtig Kontakt hatte. Immer nur am Institut, und auch dort eher distanziert. Die Stimme Ritas, die ebenso elastisch und anschmiegsam war wie ihr Lächeln. Korallenrot, dieses Lächeln. Fred, der sich immer aus allem raushielt. Nicht, dass es ihn nichts anginge. Mit sich selbst war er beschäftigt, immer nur mit sich selbst, und die anderen, die blieben irgendwo, die blieben außen vor, die blieben auf den Papieren, die er für sie, die er über sie verfasste. Die aufgekrempelten Hemdsärmel, die randlose Brille.
FAHRRADKLINGEL
Auf das grüne Signal hatte Valerie gewartet, um den Franz-Josefs-Kai zu überqueren, als die Radfahrerin daherkam. Das Klingeln war aggressiv gewesen und der Schritt zurück auf den Gehsteig sprunghaft. Erschrocken. Im Weg war sie gestanden, auf dem Fahrradweg, und darauf war sie durch das Klingeln aufmerksam gemacht geworden. Mit einem schnellen Schritt, einem Satz, war Valerie zurück auf den Gehsteig gesprungen, und von dort aus hatte sie dann den Weg über den Franz-Josefs-Kai angetreten. Dieser Satz, wie er damals in ihren Ohren geklungen, wie es damals in ihren Ohren geklingelt hatte, als Georg ihn ausgespuckt hatte, diesen Satz. »Hör doch auf, hör auf, dir immer selbst im Weg zu stehen.« Das musste hier ganz in der Nähe gewesen sein. Sie wollten essen gehen in die damals gerade neu eröffnete Schiffstation Wien/City. Hier am Donaukanal. Ein Abschlussessen hätte es werden sollen, den Abschluss ihres Praktikums hatten sie feiern wollen. Als sie zusammen Richtung Schiffstation Wien/ City gegangen waren, hatte Georg Valerie eröffnet, dass er ihr anbieten könne, weiterhin in der Kanzlei mitzuarbeiten, ein paar Stunden in der Woche nur, um den »Anschluss« nicht zu verlieren. Eine Art vorübergehendes Volontariat mit guten Aussichten auf eine spätere Anstellung. Zögernd hatte sie eingewandt, dass sie es sich momentan nicht leisten könne, »gratis« zu arbeiten, und auf diesen Einwand hin war der Satz dann gefallen, hatte Georg diesen Satz ausgespuckt, hatte er ihr diesen Satz ins Gesicht gespuckt. Daher wahrscheinlich das Klingeln in den Ohren. Was unmittelbar danach passiert war, daran konnte Valerie sich auch heute nicht erinnern. Sie hatte, wie sie es später nannte, einen Aussetzer gehabt, einen Aussetzer, der dazu geführt hatte, dass Georg am Boden lag und sie anschrie. Auf und davon war sie gerannt, zum Donaukanal hinunter und Richtung Urania. Dann die Rampe hinauf zur Straßenbahnstation und in die Straßenbahn Linie 2 Richtung Friedrich-Engels-Platz.
Aus einer der Straßenbahnen der Linie 2 war Valerie auch vorhin ausgestiegen, am Schwedenplatz war sie ausgestiegen, ohne genau zu wissen, warum. Warum eigentlich? Und jetzt war sie wieder auf dem Weg hinunter, hinunter zum Donaukanal. Die Stiegen und die Wände mit den Graffiti. Die Farben im Nachmittagssonnenlicht. Die dünnen Betonpfeiler, auf denen das Restaurant der Schiffstation Wien/City stand. Valerie hielt sich am Rand des Uferweges, um nicht im Weg zu sein, um den Radfahrern nicht im Weg zu sein. Eine schnelle Handbewegung, um die einfallenden Haarsträhnen hinter das Ohr zu streichen. Diese Sache mit dem Im-Wege-Stehen. Sich-und-anderen-im-Weg-Stehen. Auch sie hatte diesen Satz schon ausgespuckt, hatte ihn Menschen ins Gesicht gespuckt, nicht direkt in das Gesicht eines bestimmten Menschen, aber in die Gesichter einer bestimmten Gruppe von Menschen, die in ihren Augen zu einem einzigen Gesicht geronnen waren, einem Gesicht mit scharfen Zügen. »Die stehen sich doch alle selber im Weg.« Das hatte sie sich zum Beispiel gesagt, als sie wieder einmal auf der Suche nach einer Rechtfertigung gewesen war, warum sie dieser Bettlerin in der U4-Station am Naschmarkt nichts gegeben hatte. Sie hatte ihr nichts gegeben, obwohl sie, wenn sie ihr nur eine kleine Münze in den Blechnapf gelegt hätte, dieses Bild von der so geduldig, so demütig knienden Frau, das sie verstört, das sie angewidert hatte, leichter losgeworden wäre. Sie hatte sich diesen Satz halblaut vorgesagt und war erschrocken, erschrocken über die Mehrdeutigkeit der Formulierung. Die standen sich ja auch gegenseitig im Weg, diese bettelnden Gestalten; an den Ein- und Ausgängen der Stationen standen und knieten sie, auf den Bahnsteigen gingen sie herum, und manchmal streunten sie auch noch durch die Waggons der U-Bahnen. Vor allem aber standen sie sich selbst im Weg, als ob es keine anderen Möglichkeiten gäbe, hier, in Europa. In den reichen Teilen Europas. Als ob sie sich wirklich unbedingt ausbeuten lassen müssten von den Chefs der Bettelorganisationen, die sie auf die Straße schickten und ihnen den Großteil ihres Tages…, nun, was? …lohnes? …satzes? abnahmen. Als ob sie nicht etwas anderes machen könnten. Als ob. Georg hatte diesen Satz natürlich anders gemeint. Eindeutiger. Mit einer ganz bestimmten Absicht. An sie adressiert hatte er diesen Satz. Bei ihr hatte ankommen sollen, dass er ihr etwas zu bieten, etwas anzubieten habe. Sogar in diesen Zeiten. Trotz der allgemeinen Krise. Und dass beide Seiten flexibler zu sein hätten. Dass sie eine echte Chance bekäme. Das war schon angekommen bei ihr. Das hatte sie verstanden, noch bevor Georg diesen Satz ausgespuckt, bevor dieser Satz in ihren Ohren geklingelt hatte. Dass sie es sich nicht hatte leisten können, war eine andere Sache, ein anderes Problem, im Grunde allein ihr Problem gewesen. Was Valerie aber nicht verstanden hatte, war, was nachher, nach dem Klingeln, in den Ohren passiert war. Irgendetwas hatte ausgesetzt. Irgendetwas hatte den Rhythmus, in dem dieser Abend hätte verlaufen sollen, verändert, gestört. Hatte sie aus dem Takt kommen lassen. Eine Art Schlaganfall vielleicht. Eine Art Schlaganfall, der entweder sie oder Georg getroffen hatte. Oder beide. Gleichzeitig. Nach diesem Satz. Mit diesem Satz, der auf ihrem Weg zum Abendessen, zum Abschiedsessen plötzlich zwischen ihnen gefallen war. Der zwischen sie gefallen war.
Ein halbherziger Versuch, nach dem Studium in Wien zu arbeiten, jederzeit bereit, zurück aufs Land zu ziehen, falls der Freund dort eine einzigartige berufliche Chance geboten bekommen sollte. Die mit präzisen Zukunftsaussichten abgewickelten Bewerbungen, von denen etwa die achte erfolgreich sein und die Tür sowohl zum weiteren, hartnäckig verfolgten beruflichen Aufstieg als auch zur Wohnung im 7. Bezirk aufschließen soll. Als Kind hatte ihre Arbeitswelt aus lehrenden, helfenden und geheimnisvollen Berufen bestanden. Ein White-Collar-Spektrum, ausschließlich. Sie hatte abwechselnd Krankenschwester oder Lehrerin werden wollen. Der geheimnisvolle Beruf war der ihres Vaters gewesen. Der hatte das Haus meistens im Anzug verlassen und war am Abend abgespannt zurückgekommen. Von seiner Arbeit hatte er nur dann etwas erzählt, wenn sich etwas besonders Unangenehmes zugetragen hatte, wenn einer von »seinen Leuten« etwas zerstört oder sich während der Arbeitszeit betrunken hatte. Was ihr Vater genau machte, wusste sie damals nicht. Er verdiente das Geld, und seine Arbeit war sehr ernst und sehr verantwortungsvoll. Und ihre Arbeit jetzt? Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin war gesucht worden. Sie hätten nach einer akademischen Blue-Collar-Kraft suchen müssen. Die ganze Nacht vor dem Bildschirm. Die Aussendungen Korrektur lesen und in der Früh dann rausschicken. Der wöchentliche Newsletter. Kommentiert. Von Fred und Rita kommentiert. Sie, die Koordinatorin. Menschen und Texte koordinieren. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie sich dann beworben? Wahrscheinlich. Hauptsache »Institut«. Ein Institut, das Kommunikationstrainings konzipiert und verkauft. Vor allem an Polit-Kaderschmieden, an Partei-Akademien und Bildungswerkstätten. Gleich welcher couleur. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am neu gegründeten »Institut für die nachhaltige Kommunikation mit der Zivilgesellschaft«. Irgendwas, wofür dieser Studienabschluss gut sein musste, dieses Studium der Rechtswissenschaften und der Japanologie. Die Japanologie, um etwas anderes zu lernen. Die Rechtswissenschaften als Kompromiss. Mit der Welt. Mit dem Vater. Beides durchgezogen. Verhältnismäßig schnell, dafür, dass sie eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Schrift, eine ganz andere Kultur – was? studiert, gelernt hatte? Kein einziges Mal war sie in Japan gewesen. Schrift, Sprache, Kultur: nur auf dem Papier. Trockenschwimmen. Unberührt von allen Wassern. Eine Entscheidung, ihre Entscheidung. Trotzdem diese vage Sehnsucht. Etwas anderes. Irgendetwas anderes. Aber eben nur: irgendwas. Die vom Institut waren begeistert von der Japanologie. So schwierig, so mutig, so ein Orchideenfach. Und der so erweiterte Horizont. Eine ganz andere Kultur. Etwas ganz anderes. Das ganz andere trug sie jetzt vor sich her, wenn sie japanisch essen oder am Naschmarkt Tee kaufen ging. Wie sie in der Straßenbahn Linie 2 saß auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ins Institut, an ihren Schreibtisch, an dem sie Menschen und Texte koordinieren würde. Auf alle Fälle wäre die Zusammenarbeit ausgezeichnet. Auf die tüchtige Mitarbeiterin, auf die weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit. Für sie als Mitarbeiterin. Ein spezielles Angebot für sie als Mitarbeiterin. Keine Präzisionsarbeit möglich. Nur Grobmaschiges. Nur Ungefähres. Das mit der 20-Stunden-Pauschale und den 24 Stunden Arbeit. Anfangsschwierigkeiten. Sachzwänge. Natürlich. In Gedanken versunken, diese junge Frau, die sich auf dem Rückweg von der Arbeit befand. Arbeitsgeschichten, eventuell ein paar Männergeschichten. So wie die, die gut gekleidet und abgearbeitet durch die Passage ihrem Feierabend entgegeneilten. Die Umstellungen. Die Ausgliederungen. Mehr und mehr Zeitarbeiter. Für den Betrieb rentabler, für die Arbeiter schwieriger. Aber in Zeiten wie diesen müssten alle – und so weiter.
Ein grüner Mantel passiert die große Werbefläche auf dem Gebäude in der Dresdner Straße. Ein leichter Luftzug rüttelt an dem Plakat, auf dem eben noch der Satz »Den Realitätssinn schärfen, Wachstumsphantasien folgen« in den Spätsommermorgen gestrahlt hat. Jetzt aber überwuchern Schlinggewächse die Werbefläche. Undurchsichtig, undurchdringlich, dieses Grün.
EIN STADTLIED
In den frühen Morgenstunden scheint sich die Stadt immer zu improvisieren, sich in verschiedenen, gleichzeitig durchgespielten Szenen auszuprobieren, von denen im weiteren Verlauf des Tages die einen fortgesetzt, in den alltäglichen, nicht weiter bemerkenswerten Ablauf überführt werden, während die anderen von der Oberfläche, von der Bühne verschwinden, um vielleicht an uneinsichtigeren Orten oder an anderen Tagen fortgeführt und weiterentwickelt zu werden. Ein frisch rasierter Mensch im Anzug, der die Ringstraße entlang zur Arbeit schreitet, in der einen Hand die Laptop-Tasche, in der anderen das Kipferl. Kurz bleibt er stehen, um sich die Brösel vom Jackett zu wischen. Ein seit Langem unrasierter Mensch, der sich gerade auf der Bank niederlässt, auf der er einen Teil seines Tages verbringen wird. Aus einem der drei Plastiksäcke zieht er eine Flasche und öffnet sie. Der erste Schluck mit geschlossenen Augen. Zwei Menschen, die über die Marienbrücke torkeln, der eine stützt den anderen. Jung sind sie, und die Nacht haben sie sich zusammen um die Ohren geschlagen. Der eine küsst den anderen auf die Wange und weint. Ein Mensch in Stützstrümpfen, der mit kleinen Schritten durch die Taborstraße geht, die Handtasche fest unter den rechten Arm geklemmt. Er bleibt stehen und späht misstrauisch in alle Richtungen. Zu keiner Tageszeit sicher in dieser Stadt. Ein Mensch im Trainingsanzug, der Richtung Handelskai joggt, die Unterarme halten Schritt, der schwarze Zopf baumelt rhythmisch vom Hinterkopf zwischen den Schulterblättern. Kurz bleibt er stehen, um etwas vom Boden aufzuheben. Über alle Straßen verstreut sind sie, die Strandgüter des Lebens.
NEBELHORN
Und diese Sehnsucht. Unabhängig sein von den Gezeiten, den An- und Ablegestellen. Unbehelligt von Strömungen, von Windrichtungen, von Niederschlägen. Und alles um sich herum beobachten. Immer außen vor bleiben. Wie in diesen frühen Morgenstunden in der Straßenbahn. Bei diesem Stationentheater. Ein Stationentheater war es, das Valerie vor Augen hatte, wenn sie mit der Straßenbahn Linie 2 zu dieser Zeit nach Hause oder in die Arbeit fuhr, wenn sie in diesen frühen Morgenstunden auf dem Weg war zurück in den 20. oder hinauf in den 8. Bezirk. Zwischen der Stadt und ihr die Scheibe, die Fensterscheibe, durch die hindurch sie den Szenen, den Begebenheiten auf den Straßen, an ihren Rändern und Kreuzungen, folgen konnte. Die Szenen am Nachmittag schon eingespielt, eingespannt in den Bogen einer Alltagsdramaturgie. Die Szenen in der Früh verfahrener, unabsehbarer, die Pantomimen eines eben angebrochenen Tages. Hinter ihr, im Straßenbahnwaggon, eine Nebelwand, aus der kein Ton, kein Wort, keine Geste hindurchdringen konnte zu ihr, die so ganz aus sich herausgestülpt an der Scheibe klebte, sich festgesogen hatte an der glatten, durchsichtigen Fläche. In einer dieser frühen Morgenstunden aber hatte Valerie plötzlich den Halt verloren und war auf sich selbst zurückgefallen. Neben der Ringstraße, vor dem Museum für Angewandte Kunst, standen und saßen in einvernehmlicher Zwietracht zwei Menschen. Der eine Mensch mit in Dauerwellen gelegtem grauen Haar und Hornbrille im Rollstuhl, der andere mit dunkelbraunen, schon etwas fadenscheinigen Schlaghosen und Hut daneben. Zuerst die gekrümmte Haltung des einen, des im Rollstuhl sitzenden Menschen: abwartend, beinahe demütig, der andere sehr aufrecht und mit erhobener, beinahe schlagfertiger Rechter auf ihn einredend. Dann der Rollenwechsel. Der im Rollstuhl