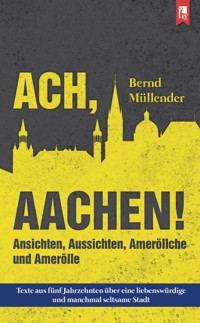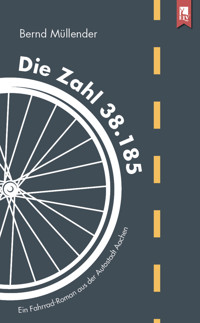
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aachen in den frühen 2020er Jahren: Der leidenschaftliche Biker Damian und die Sportwagenfahrerin Ariane lernen sich auf merkwürdige Weise kennen. Zeit gleich nehmen die Auseinandersetzungen um den Radentscheid vehement an Schärfe zu: Mehr Radwege, die sichere Umverteilung der Verkehrsräume, eine lebenswertere Stadt? Politisch ist das verbindlich beschlossen, aber es hakt überall, die Umsetzung stockt, der Widerstand wächst. Wie soll Aachen das schaffen? Autofahrer treffen sich heimlich, sorgen sich um Parkplätze, sehen ihr Blech als Schutz vor Blech, nehmen Bäume als Geiseln und starten die erste Critical Mass für Vierräder. Die Radler kämpfen verbissen um jeden Meter Bike Lane und die Verkehrswende, manche geraten dabei als Wege-Blockwarte in Verfolgungswahn. Und emsige Stadtplanerinnen setzen ausgebufft auf den ersten Bürgerdialog ohne Bürger. Eine Stadt ist in Aufruhr!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bernd Müllender
Die Zahl 38.185
Bernd Müllender
Die Zahl 38.185
Ein Fahrrad-Roman aus der Autostadt Aachen
Die Ereignisse rund um den Radentscheid
wirklichkeitsnah weitergedacht
Eifeler Literaturverlag 2021
1. Auflage 2021
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Umschlaggestaltung: Dietrich Betcher
E-Book:ISBN-10: 3-96123-028-5
ISBN-13: 978-3-96123-028-0Print:ISBN-10: 3-96123-018-8
ISBN-13: 978-3-96123-018-1
Fast alle Namen sind erfunden; Ähnlichkeiten mit existierenden Personen, Firmen, Institutionen und einem Fußballklub sind meist nicht beabsichtigt.
Verkehrswende? Daraus ist in Deutschland allerorten Straßenkampf um jeden Quadratmeter Asphalt geworden.
Dieses Buch spielt beispielhaft in Aachen. In anderen Städten ist die Situation ähnlich.
Alles ist gendergerecht gedacht. An markanten Stellen gibt es sachdienliche Hinweise.
Radmenschen
Damian Vermeer, Lebenskünstler und verliebter Held
Filip Heinen, fülliger Mathelehrer
Franziska Vallet-Byaruhanga, redefreudige
Krankenpflegerin
Esther von Essen, giftige Steuerfachgehilfin
Dr. Erik Kerken, der Gelassene
Camilla Maaß, die Korrekte
Lynn Ayneburg, die Abwägende
ChrisTina Weckstein, Schauspielerin und Visionärin
Adel Trabelsi, IT-Fachmann auf der Jagd
Tine Wimmer, gemächliche Seniorin
Tim Schwoll, Technikfreak
Thomas Kulle, Optiker
Sabine Limb(o)urg, Inhaberin Modegeschäft
Leonora Terzi, junge Stadtplanerin aus der Schweiz
dazu Astrid, Waltraud, Davide, Marcel, Rory,
Paul, Harry, Heino, Janusz, Henryk samt seiner
virtuellen Marek-Brigade und andere
Im Liebesland
Ariane Colling, Damians Alemannia-Liebe,
Werbeagentur Tu et
Toni Kirsch, Damians weiser Freund
Pam, Arianes Freundin und Anbahnungsberaterin
Automenschen
Dr. Hannes und Wera Kügler, Gastgeber
Habsburgerallee
Jupp und Frieda Bangemach, Metzgersleut
Marlene und Theo Veit, Pensionäre
Irmgard (»et Irm«) und Heinrich Schneiders,
Pensionäre
Verena und Prof. Viktor Jütmann, Agentterroristen
Ron Rekceb, forscher ASEAG-Busfahrer, Kelmis
Carl und Arnhild Wallmann, Alt-Richterich
Helmut und Elvira Alt, Neu-Richterich
Anja und Joachim Sucker-Kulergy, im Autokampf
mit Pedelec
Cornelius Schaffrath, Träumer
Cengiz Alkin und Fatih Üslümürlüçü, türkische
Geschäftsleute
Dr. Gregor Müllejans, zweifelnder Dozent und Gattin
Gerhild Snalins-Müllejans
Zwei smarte Rechtsanwälte ohne Namen
Dietmar Zimta, Ex-Polizist
Caroline Egyptien, Hausfrau, Zahnarztgattin
Claire Delnoye, alleinerziehendes ostbelgisches
Stiefmütterchen
Marlene, Irm, Franzi, Bernadette, Walburga, Mia,
Claudi als die 7 Grazien auf Radtour
Verwaltungsfachleute der Stadt Aachen
Gaby Kobranic
Ute Wegmann
Dr. Thomas Mölders
Ilka Glaske
Dr. Hans-Lothar Kurtz
Umberto Zimetmann
Dr. Paul Umweeg
Franz-Ferdinand Königshöfer, Baudirektor
Arno Blicknauser
Elfriede Jahn
Herr Subotnik, Archivar
Elly Schulte-Baumkötter, Städteregion
Die Chefin
Und sonst
Dr. Friedensreich Darjahn, Psychotherapeut
Petra Birmes, Darjahns Kollegin
Angelo Vermeulen, Supervision
namenloser Fahrer eines Junior-SUV
zwei namenlose Drittsemester E-Technik
Cees van Zwaben, Compliance-Forscher
das Fräuleinschen, Teuven
Armin Laschet, Politiker, Burtscheid
Lieke Overmars, Notfallschwester Klinikum
Hans Noppeney, Platzwart, Breslauer Straße
Manni Schmitz-Körrmann, Kriminalpolizei
Prof. Bastian Schacht, Verkehrspsychologe
Dr. Renate Peitsch, Domina im Hintergrund
die Hündinnen Wotana, Emma und Jule, sowie ein
Kater mit Namen Maus
Kapitel 1
Prolog: Erwachen im Herbst
Herbst. Da war er wieder, der Herbst. Zumindest war es der erste Vorbote.
Eine fiese frische Brise blies durch den Aachener Talkessel. Damian Vermeer döste noch vor sich hin und hörte die Glocken von Herz Jesu bimmeln. Doch, Kirchen hatten auch in der heutigen Zeit noch ihre Berechtigung: Man konnte, vor allem wenn man etwas verkatert war wie er jetzt, bequem die Uhrzeit hören statt sie irgendwo mühevoll ablesen zu müssen. Zudem blieb Damian noch Muße, in den warmen Tiefen der Federn mit geschlossenen Augen Kräfte zu sammeln. Er zählte also mit: »… sechs … sieben …«, weiter bitte, na also: »acht …«, allmählich wurde es spannend, » …neun«. Ja, sehr gut. Weiter bitte mit dem Count-Up, mindestens einmal noch wäre gut. Aber: Nichts mehr. Nach neun Schlägen war Schluss.
Ganz schön früh war das noch. Früh, weil es tags zuvor halt spät geworden war, sehr spät, erst im Exil, dann im Dumont‘s. Freitagnacht halt, sein Ausgehabend einmal im Monat mit den Kumpels. Und oftmals auch, so wie gestern, sein sehr langer Wegbleibabend.
Oder hatte er den ersten Schlag überhört? Die Augen ließen sich schon öffnen. Blick zur Uhr: Mist, wo ist die Brille? Doch, es war wirklich erst 9.
Die Dusche hatte dann einigermaßen erfrischt. Jetzt blubberte die alte Kaffeemaschine. Das betagte Brot ließ sich noch auftoasten, und Käse nahm erst im fortschreitenden Alter so richtig Würze an, kurz bevor der Schimmel an ihm nagen wollte. Zwei Apfelschnitze dazu gaben Damian das gute Gefühl von ausgewogener, gesunder Ernährung. All das gehörte mit Mitte fünfzig zu seiner kulinarischen Lebenserfahrung.
Vor seinem Fenster sah Damian Vermeer die ersten Blätter herumwirbeln. Ein kleiner Schauer kam hinterher. Herbst, dieser Mistherbst. Damian dachte an Hanns Dieter Hüsch: Das mit den Jahreszeiten sei ja nun mal so vorgegeben, hatte der große niederrheinische Kabarettist mal gesagt. Für Damian hatte der banale Satz mit der Vorgegebenheit eine große, selbstverständliche Kraft. Ja, immer schön der Reihe nach, ohne Ausnahme, es gibt eben Dinge, die kann man nicht erzwingen. So ist das mit dem Leben, mit der Liebe und mit den Jahreszeiten. Auch der heißeste Glutsommer wie in diesem Jahr wird irgendwann zielsicher vom Herbst abgelöst. So war das schon bei den Glutsommern davor gewesen.
Aber wie vorgegeben der Herbst auch sein mochte, Damian mochte ihn nicht. Er konnte nicht verstehen, wie ihn überhaupt jemand mochte. Herbst stand für die usselige Phase des Vergehens, des Welkens, der Traurigkeit, der monatelangen Deprimiertheit. Herbst! Schon die Aussprache, fand er, klingt so verkniffen in ihrer Konsonantenkatastrophe: Herbst, dass Zunge und Lippen sich leicht verheddern könnten. »Herbst ist, wenn du sterbst.« So sagt man doch. Kein Zweifel: Herbst war eine Scheißjahreszeit und gleichzeitig ein Scheißwort. Weswegen ihn der lebenskluge Öcher lieber zum Hervs verkürzt und zungenfreundlich zweisilbig ein bisschen wie Herrevs ausspricht. Als sanfter Herrevs, sagte sich Damian, ließe sich auch ein harter Herbst besser aushalten. Und mit solchen Fantasien konnte er sich die drohende Niedergeschlagenheit der nächsten Monate ein bisschen schöndenken. Damian holte den dicken Pullover aus dem Schrank; ach ja: so sah der aus.
Jetzt aber los. Damian zog die Regenjacke über, setzte den Helm auf und sich auf sein schnelles Pedelec, das er gern »meine kleine Rakete« nannte. Damian war leidenschaftlicher Radfahrer. Routiniert schnellen Tritts machte er sich von seiner Wohnung am Frankenberger Park auf zum Tivoli, wo die ersten Fans gerade zum nächsten Mittelfeld-Großduell in der glorreichen Regionalliga West pilgerten. Fußball ja, das war auch sein Leben, besonders die Alemannia. Aber heute war Fußball Mittel zum Zweck. Doch, das wusste selbst er: Es gab Wichtigeres als die Alemannia. Jedenfalls manchmal. Aber warum nicht mal die angenehmen und die wichtigen Dinge des Daseins verknüpfen!?
Damian traf sich am Südost-Eingang mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen zum Unterschriftensammeln für den Radentscheid, gut anderthalb Stunden vor Anpfiff. Die anderen drei standen schon da, neben der großen bunten Radentscheid-Beachflag, die auf dem grauen Asphalt gut befestigt im Wind flatterte. Und kaum hatte er Hallo gesagt, kaum waren die Unterlagen verteilt, die Jagdgebiete aufgeteilt, ein paar Dinge knapp besprochen, da passierte das kleine Unglück schon. Ein einsames Blatt fiel ihm herunter. Ein Unterschriftenblatt, – – –
– – – Halt!, fährt es dem Autor dieses Buches durch den Kopf. Er nimmt die Finger von der Tastatur, halt! Das ist doch eine wirklich billige Nummer. Erst Herbstblätter, dann – haha – Unterschriftenblätter … also nee.
Und auch der Auftakt mit dem Herbst, Jahreszeit der Depressionen. Abschreckender kann man doch kaum ein Buch anfangen, nicht mal als Hervs. Wie viel zauberhafter wäre doch Frühling, aah und ooh, mit allen lockenden Assoziationen wie Knospen, Verheißung, Jahreszeit des Aufbruchs, ja, auch der Liebe und des Glücks. Bei diesen Herbstblättern würde sicher auch der Verlagslektor so humorlos dazwischengrätschen wie einst Alemannias Zweimeter-Zweizentner-Zweitligabriegel Günter Delzepich in die Aufbauversuche des Gegners.
Zu Beginn eines Romans gehört doch ein Knaller, etwas Schönes, Lockendes. Ein großer erster Satz, gern eine Spur geheimnisvoll. So wie bei Isabel Allendes Geisterhaus: Barrabas kam auf dem Seeweg in die Familie … Oder das hier: Ilsebill salzte nach …, mit dem Günter Grass seinen Butt losschwimmen ließ. Da wollte man doch umgehend wissen, ob dieser Barrabas der Held der Geschichte werden würde und ob diese Frau komisch-klingenden Namens wohl gerade beim Fischdinner am Butt knabberte. Längst gab es ja Webseiten, die berühmte Romananfänge sammelten und bewerteten. Also, herbstliche Unterschriftenblätter würden dort sicher nie hin geweht. Da wäre eine Anlehnung an George Orwells 1984 schon passender, da war es zwar kühl wie in diesem Aachen, aber immerhin Frühling: Es war ein strahlender, kalter Tag im April und die Uhren schlugen Dreizehn … Mag sein, aber Herz Jesu, von den Aachenern gern auch Frankenberger Dom genannt oder sogar Öcher Sacré-Coeur, hatte nun mal nur 9 geschlagen.
Der Scheibereikollege Wim van Achteren aus Vaals hatte mal erzählt, dass es Autoren gebe, die Wochen am ersten Romansatz feilen, Dutzende Anfänge bauen, verwerfen, variieren, konstruieren, um sie alle im Papierkorb zu beerdigen. Dass es Agenturen gebe, sogenannte Roman-Start-Ups, die gegen Entgelt nichts anderes tun, als Anfänge zu komponieren und Ideen von Autoren einzudampfen oder aufzupimpen. So ein Unfug, nicht mit mir, denkt sich der Autor. Ich will doch nur vorausschauend und gewissenhaft protokollieren, was in der Radentscheidstadt Aachen passierte und was noch Ungeheuerliches passieren wird.
Und es war ja auch Herbst. Das war Fakt. Sie waren ja an einem Herbsttag am Tivoli. Es wäre unredlich, einen Herbsttag einfach in den Frühling zu verlegen. Also: Herbst bleibt! Und die Blätter bleiben auch! Sie sind ja ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte, die diese Stadt gerade umtreibt und in den nächsten Jahren noch umtreiben wird.
Und sie dem Wahnsinn nahebringen wird.
Mir redet hier keiner rein! Sonst schlüge es wirklich nicht 9, sondern 13, mindestens. Und wer weiß, nachher meldet sich noch der arme Tropf zu Wort, dem das Blatt aus der Hand gefallen ist, er möchte nicht gleich am Anfang als unausgeschlafener Depp auftauchen. Wie heißt er nochmal, ach ja: Damian, Damian Vermeer.
Doch zu diesem Zeitpunkt weiß der Autor noch nicht, zu welch autonomem, ja stellenhaft aufbegehrendem Eigenleben Romanfiguren heutzutage fähig sind. Oder dass ihnen Dinge passieren können, die so nicht geplant waren. – – –
Das Unterschriftenblatt für den Radentscheid jedenfalls trudelte genau in Richtung einer Pfütze. Es tanzte fast schon hernieder, schelmisch, schmiegte sich in den Wind und gab sich mit aller Leichtigkeit der Schwerkraft hin. Aber wie poetisch man die Bewegung auch beschreiben würde, es ging bergab. Erdanziehung war ebenfalls vorgegeben. Pflatsch!
Damian hatte noch erfolglos nachgesetzt. »Mist«, grummelte der Mann mit den Wuschelhaaren und der sanften, tiefen Stimme. Er zog das tropfende Papier aus der Lache. »Wartet einen Moment«, brummte er zu seinen Mitstreitern, »ich trockne es schnell ab. Hoffentlich bleibt alles leserlich.« Das sollte es allerdings, sagte Mitstreiterin Esther von Essen, »sonst zählt dat vielleicht nich. Sind ja schon drei Autogramme drauf.« Die vier befürchteten, das Rechtsamt der Stadt würde womöglich unerbittlich sein und Blätter mit kleinsten formalen Verstößen, womöglich schon Verschmutzungen, trophäenhaft aussortieren. Weil etwa ein Tom Reissen auch Tom Reisser hätte heißen können. Dann wäre er keinem der wahlberechtigten 195.000 Printenstädter eindeutig zuzuordnen – also ungültig! Damian tupfte das Pfützenblatt ab und legte es vorsichtig in seine Mappe.
»Auf geht’s. Sammeln wir.«
Kapitel 2
Der Widerstand
Drei Jahre später hatte sich Aachen sehr verändert.
Der Radentscheid war beschlossen. Längst begehrten Autofahrer und Autofahrerinnen auf. Immer wütender waren sie geworden.
Die Stadt hatte vereinzelt begonnen, neue Radwege zu bauen. Den Autos wurden so tatsächlich die ersten Habitate genommen, Parkplätze, gewohnte Strecken und Spuren, wenn auch bislang nur stellenweise. Andere Wegstücke aber standen längst auf der Todesliste. Wo soll man denn noch mit dem Auto fahren? Alles für diese Radfahrer, von denen es doch überhaupt nur sehr wenige gibt. Unverschämtheit! Nichts als Privilegien für Minderheiten. »Eine links-grün versiffte Bande von Rad-Ideologen«, so sagten sie, wolle das schöne Aachen zerstören.
Das wollte sich die Mehrheit auf vier Rädern nicht länger gefallen lassen. Leserbriefe, Proteste und all ihre Argumente in Dialogveranstaltungen, ob online oder beim Bürgerforum, hatten wenig genutzt.
Jetzt wollten sie ernst machen.
Wochenlang hatten sie sich unerkannt auf ihre aufrüttelnde Aktion vorbereitet, eine Aktion, wie sie Aachen noch nicht erlebt hatte. Darüber würde man noch Jahre später sprechen. Ihr Spektakel würde, nach all den Schikane-Planungen um eine Verkehrswende, in die Geschichtsbücher »als Tag der Halse« eingehen, wie eine sagte, eine begeisterte Seglerin vom Rursee. Ein anderer prophezeite: »Das wird der Anfang vom Ende dieser Radautobahnen sein.«
Kapitel 3
Die Sammlung am Tivoli, Teil I
»Radautobahnen« – dieser wunderbar absurde Begriff war den Unterschriften-Sammlern am Tivoli, damals im Herbst 2019, noch unbekannt. Mit großem Eifer waren sie bei der Sache. Vor allem die resolute Franziska Vallet-Byaruhanga, Krankenpflegerin von Beruf, schien geradezu gierig, mit allen Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. »Wir wollen sichere Radwege und Kreuzungen … umbauen, ausbauen … getrennte Busspuren, abgetrennte Radwege. Keine schmalen Streifen zwischen parkenden Autos rechts, eng vorbeirasenden Autos links und davor manchmal noch Karossen, die mal eben abgestellt worden sind …« Schließlich das Joker-Argument: »Würden Sie Ihr Kind auf die jetzigen Pisten des Grauens lassen?«
»Naja, nein«, hörte sie dann meist, und es gab die nächste Unterschrift.
Häufig hörte sie jedoch Sätze wie: »… aber die Radfahrer müssen sich auch mal an die Verkehrsregeln halten.« Franziska kannte das: Schnell das Thema umdeuten. So machten es viele, immer wieder. Dann musste man immer eine Tirade von schrecklichen Erlebnissen über sich ergehen lassen, mal von sogenannten Radrüpeln ohne Licht, mal von angeblich unverschämten Manövern auf Fußwegen, von Rotlichtabbiegern, von Radfahrern, die überhaupt immer und überall machten, was sie wollen, die nicht klingelten und man sich dann so erschreckte, wenn sie plötzlich ganz eng neben einem auftauchten …
Klar, das gab es. Die einen sagten: vereinzelt, die anderen sagten: dauernd. Solches Rüpeltum war auch nicht weiter zu verteidigen. Aber machte es Sinn, das aufzurechnen? Natürlich nicht.
Franziska war sich zudem sicher, dass insbesondere der Anklagepunkt mit dem Nichtklingeln andere Gründe haben konnte: Der Überholte, gern im Rentneralter, hatte halt vergessen, sein Hörgerät einzuschalten. Sie selbst, die jeden Tag mit dem Pedelec nach Stolberg zur Arbeit fuhr, hatte sich schon mehrfach die Finger wund gebimmelt und vor ihr: Keine Reaktion.
Aber das sagte sie jetzt natürlich nicht. Ihr Langmut hatte Franziska während solcher Empörungsmonologe jedes Mal über alle Hürden hinweggeholfen. Immer hatte sie einfach freundlich gelächelt: »Einverstanden, nicht jeder Radfahrer hält sich immer eisern an alle Regeln. Das findet niemand gut, das kann nerven. Aber sagen Sie das auch mal den beiden Radfahrerinnen, die dieses Jahr in Aachen getötet wurden. Die würden ihre Wünsche sicher liebend gern befolgen.«
Das saß immer.
Gerade hatte sie wieder jemanden ins Gespräch verwickelt. Und das hieß, er oder sie würde nicht entkommen, nicht bei Franziska, ohne den Stift zu zücken, selbst wenn es sich um einen SUV-Fahrer mit bescheidenem Hirnhintergrund handelte. Hier am Stadion aber stieß selbst Franziska manchmal an ihre Grenzen: »Ich hatte auch schon einige, wie soll ich sagen, interessante Begegnungen«, erzählte sie in einer kleinen Pause, »einer hat gesagt ›Ich bin kein Fahrradfahrer, ich bin Alkoholiker.‹«
»Hmmm«, sagte Filip, der vierte im Bunde, und bemühte sich ernst zu bleiben.
»Eine andere Frau hat mich auch ganz geschickt abgewimmelt.« Franziska machte eine Kunstpause, bis Esther endlich fragte: »Wie denn?«
»Die sagte ›Geht nicht, Kind. Ich kann nicht schreiben.‹ Und ich muss ehrlich sagen, ich hab es ihr geglaubt.«
Die Menschen strömten derweil weiter in den Tivoli, einige tausend, so wie sie es immer tun, alle vierzehn Tage. Es war ja auch sehr wichtig, ob es dem einstmals dreifachen FC-Bayern-Serienbezwinger (2004, 2006, 2007), der damit zum Rekordpokalsiegerrekordrauswerfer geworden war, gelingen würde, auch den heutigen Gegner SV Rödinghausen zu schlagen? Zuletzt war das gegen andere Liga-Giganten wie Bergisch Gladbach 09 oder den SC Wiedenbrück fast gelungen.
»Kein leichter Termin hier«, sagte Damian nach einer guten halben Stunde. Kaum zwei Dutzend Unterschriften waren es bislang bei allen vier zusammen. Bei vergleichbarem Andrang kam man woanders, bei Konzerten oder Bürgerfesten, zu zweit locker auf die doppelte oder dreifache Zahl. Vielleicht weil beim Fußball nicht so viel radaffines Publikum auftaucht?
Mit dem Rad fahren ohnehin nur wenige zu einem Fußballstadion. Das hat mehrere Gründe. Da ist zunächst das rituelle Vorglühen. Das findet seit Erfindung von Verbrennungsmotor und Ball auf der Fahrt zum Stadion im Automobil oder im Bus statt. Das Leeren erster Bierportionen funktioniert auf dem Rad deutlich schlechter. Von solchen Vorbedingungen wussten auch die Radenthusiasten. Und sie sahen sich am Stadion um. Hier vorne an der Krefelder Straße gab es ganze sechs Radbügel. Sechs – bei einem Stadion für fast 33.000 Menschen. »Ist das nicht herrlich lächerlich?«, sagte der Mathematik-Lehrer Filip Heinen. Außerdem, meinte er, wenn man ein solches Monsterparkhaus in die Wiesen setze wie hier, das über 300 Tage im Jahr fast ungenutzt herumsteht, »fahren viele sicher auch aus Mitleid mit dem Auto«.
Tatsächlich gab es hinten am Parkhaus auch noch eine Menge Abstellplätze für Räder, wenn auch eher von der Sorte Speichenbrecher. Die sind halt billiger, und Sparen muss man einem klammen Club wie der Alemannia nach zwei Insolvenzen zugestehen, entschuldigte Damian seinen Herzensverein. Kurz vor 14 Uhr, also fast zur Anstoßzeit, kam Franziska schließlich von dort zurück. Sie wedelte mit ein paar Unterschriftenlisten.
Kapitel 4
Vorbereitungen zur weltersten
Critical Car Mass
Über ein Jahr lang hatten sich die Empörten in der »Initiative Autoentscheid: Die 157.000 Aufrechten« getroffen und um ihr Aachen gekämpft. Hier waren Menschen aus der ganzen Stadt versammelt, ob Studierende, Handwerker, Lehrerinnen, Geschäftsleute, Juristen, Pensionäre. Die Gruppe war hervorgegangen aus den vielen kleinen Nachbarschaftsinitiativen in Straßen, wo wieder wertvoller Parkraum vernichtet werden sollte, Fahrbahnen eingeengt und, wie perfide, sogar Bäume geschlagen werden sollten. Die Autoaktivisten hatten Netzwerke geknüpft, auch in die Verwaltung, bisweilen in die Politik hinein. »Es sind nicht alle in Aachen radhörig«, hatte einer geunkt, »wir haben Verbündete, wichtige Verbündete, auch ganz weit oben«.
Ihre Idee: Eine Critical Car Mass. Sie wollten im Verband durch Aachen fahren, viele Autos in Kolonne, kreuz und quer, ringsherum und längsherum, eine massive Demonstration des Widerstands. Und immer nur eine Person pro Auto – das hieße mehr Autos; so würde das Ganze noch mehr Eindruck machen. Viele dutzend Mitstreiter und Mitstreiterinnen hatten schon vor Wochen spontan zugesagt, jetzt waren es schon deutlich über hundert, vielleicht auch zwei- oder dreihundert, denn alle hatten noch Nachbarn und Nachbarsnachbarn begeistern können. »Wir werden immer mehr. Und niemand hält uns auf«, frohlockte einer der Aufständischen.
Eine war die Zahnarztgattin Caroline Egyptien. Sie hatte aus den jüngsten Liquidationserlösen ihres Mannes für private Mundhöhlensanierungsdienstleistungen noch eine geheimnisvolle Zeitungsanzeige für den Tag X vorbereitet: eine halbe Seite, schwarz-rot-gold umrandet, augenfällig groß stand da: »Gegen die Radpflicht! Heute Innenstadt 11 Uhr, überall. Für ein lebendiges Aachen.«
Caroline Egyptien erinnerte nicht nur wegen des Vornamens an Caroline Reinartz, die 2017 verstorbene Aachener Immobilienmaklerin: Zu allem was sagen, gern im Öcher Slang, sich vehement einmischen, mahnende Leserbriefe in Serie schreiben, Bürgerfragestunden mit Antragsfluten fast sprengen und die happigen Courtagen als Maklerin auch mal in eine aufrüttelnd gedachte Anzeige in den Zeitungen investieren – so wie hier. Alles immer in großer Sorge um Oche wie Oche immer war und ewig sein sollte. Amen.
Einer der Wortführer, Busfahrer bei der ASEAG, wollte sogar mit einem Linienbus (»Dienstfahrt. Nicht einsteigen.«) an der Kolonnen-Demo teilnehmen, hatte dann aber einsehen müssen, dass das nicht umzusetzen war. »Die Disponenten bei der ASEAG sind wahrscheinlich auch heimliche Radfahrer«, versuchte er das Scheitern seiner besonderen Idee schließlich anderen in die Schuhe zu schieben. Die Opferrolle – sehr bewährt für das innere Gleichgewicht. Und sie gab Extrakraft im Straßenkampf.
Beim letzten Vorbereitungstreffen waren noch rechtliche Fragen aufgetaucht. Einer der beiden smarten Anwälte der Initiative hatte Paragraph 27 Straßenverkehrsordnung zitiert: »Bei Kraftfahrzeugverbänden muss dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum Verband gehörig gekennzeichnet sein.« Kennzeichnen? Die naheliegende Idee: Transparente und Plakate in die Seitenscheiben, aus Fenstern und Schiebedächern wehen lassen. Das sollte reichen. Und der Anwalt hatte gesagt, man dürfe höchstens mit 99 Fahrzeugen teilnehmen, sonst sei die Aktion genehmigungspflichtig. »Wir sind bestimmt mehr«, merkte jemand an, »aber dann fahren wir eben mit drei oder vier Critical Massen hintereinander.«
»Du bist ja ein ganz Ausgekochter«, hatte ihn seine Frau gelobt. Ja, es gab für alles eine Lösung.
Die meisten hatten tatsächlich Plakate gemalt oder kleine Transparente gebastelt. Auf den Losungen war alle Kraft ihrer Argumente versammelt:
»Schluß mit der Fahrrad-Diktatur.«
»Autos möchten auch nur leben.«
»Stoppt die Zweirad-Heinis.«
»Stopt die Radautobahnen.«
»Speichenterroristen raus aus unserer Stadt.«
»Auch wir haben Rechte.«
Ein türkischer Geschäftsmann vom Adalbertsteinweg (Obst und Gemüse) hatte die Mitstreiter und Mitstreiterinnen noch mit landsmannschaftlichen Kenntnissen briefen können. »Wir Türken haben eine große kulturelle Erfahrung. So eine Automasse mit Hintereinanderherfahren in der Kolonne machen wir ja oft, neulich noch die Hochzeit meines kleinen Bruders. Alle waren da: Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, meine anderen Brüder, Onkels, Cousins, Schwager, viele Nachbarn, gute Freunde, auch meine kleine Schwester und die Cousinen. Alle Autos waren richtig fett geschmückt, mit Blumen und Luftballons. Und ganz wichtig ist: immer hupen. Hupen ist doch auch eine Form von Kennzeichnung, wie sie der Anwalt vorgeschlagen hat, oder?« Hupen gefiel allen sehr gut.
So waren alle bereit. Und der Treffpunkt? Einer meldete sich noch zu Wort: »Wir können auch Anlauf nehmen.« Das gab irritierte Blicke.
»Laufen? Wie jetzt?«
»Also, wir treffen uns vielleicht Aachen-Ost an der Autobahnraststätte und fahren dann in einer Kolonne in die Stadt – mit großem Hupkonzert.« Der Anwalt riet ab: »Das gefällt der Polizei nicht, wer weiß, was da passiert. Lieber einsickern in die Stadt und dann: Crescendo!« Einsickern klang auch mehr nach Guerilla, nach Anarchie – eine Welt, die den Autoaufständischen eo ipso nicht so geläufig war, hier aber als sehr zielführend angesehen wurde.
Sie einigten sich auf den Treffpunkt Bendplatz, von allen Seiten gut erreichbar, um von dort in wirkmächtiger Kolonne die Stadt zu durchqueren und zu umfahren, überall, unaufhaltsam. So viele Autos! Blinkend. Türkisch hupend! Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Straßen klaut!
Kurz: Ein Fanal stand bevor. Aachen würde dank der womöglich weltersten Critical Car Mass endlich aufwachen. Schluss mit den Radautobahnen! Es darf nie so werden, wie diese egoistischen Speichenheinis es gern hätten.
Kapitel 5
Die Sammlung am Tivoli, Teil II
Franziska Vallet-Byaruhanga von den Speichenheinis kam also mit neuen Unterschriften vom Tivoli-Parkhaus zurück.
»Das sind noch mal 23.«
»23?«, sagte Filip, »das war Reghecampf«.
»Bitte?«
»Ein ehemaliger großer Spieler der Alemannia. Laurențiu Aurelian Reghecampf, Rumäne, Rückennummer 23, zweifacher Torschütze beim 4:2 gegen die Bayern, 2006. Der Öcher sagte Rejelkamps für ihm.«
»Meinetwegen. Weißt du, wo Damian ist?«
»Drin.«
»Wie drin?«
»Im Stadion.«
»Was will er da? Im Stadion zu sammeln hat die Alemannia doch verboten.«
»Er will das Spiel sehen.«
Franziska überlegte einen Moment. »Warum?«
»Vermutlich interessiert es ihn?«
»Ich werde nie verstehen, was Menschen am Fußball so gut finden.«
Diesen Satz kannte Filip zur Genüge. »Sie gehen dahin, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Hat Herberger mal gesagt. Für dich: Das war ein früherer Bundestrainer.«
»Herr Berger? Aber ich weiß auch nicht, wie es ausgeht und gehe trotzdem nicht rein.«
Eine beeindruckende Logik, das musste Filip anerkennen. Nur, hier ging es um die Unlogik des Fußballs.
»Er kann doch Sportschau gucken«, setzte Franziska nach, »dann erfährt er, wie es ausgegangen ist.«
»In der Sportschau ist die Alemannia schon lange nicht mehr.«
»Ach.«
»Das ist ja das Traurige, und nicht nur aus sportlichen Gründen.« Filip versuchte, Franziska die große soziale Kraft des Fußballs zu erklären: »Fußball verbindet die Menschen, im Stadion, im Geiste, in Gedanken. Ein Freund von mir aus dem tiefsten Bayern hat vor vielen Jahren mal gesagt, immer wenn er im Fernsehen was von Alemannia Aachen hört, würde er an mich denken, weil ich ja in Aachen lebe. Das fand ich rührend. Schön, oder?«
»Naja …«
»Und das gilt natürlich für alle, überall. Bei Kickers Offenbach denke ich an meinen Studienfreund Säggel Kunter aus der KBW-Gruppe an der Uni Frankfurt, beim VfB Stuttgart an die wunderbare Sara Samtle, eine Weile meine schwäbische Geliebte, lange her, hach …« Er atmete einmal hörbar durch. »Wer weiß, vielleicht hast du auch einen heimlichen Verehrer, irgendwo, der schmachtend an dich denkt, wenn er Alemannia Aachen liest oder hört.«
Franziska lachte auf: »Nicht, dass ich wüsste. Und ich brauche auch keinen weißen Mann.«
Wie schade, dachte Filip, keine Romantik, keine Fantasie bei den Frauen. Und: war ihre Bemerkung mit dem weißen Mann jetzt umgekehrter Rassismus? Oder bei ihm eine angstbesetzte klassische Fehldeutung? Franziska war seit vielen Jahren, allem Anschein nach sehr glücklich, mit Dr. Erias Byaruhanga aus Kampala, Uganda verheiratet, Oberarzt an ihrem Klinikum.
»Ich sagte doch: heimlich. Aber egal: Ich hab noch ein Beispiel. Mein Freund Thomas Tron, ein ganz komischer Vogel. Der lebt in Hamburg, ist aber, eine völlig unlogische Kombination und wahrscheinlich einmalig: glühender Fan der italienischen Nationalelf und von Hertha. Und immer, wenn ich …«
»Hertha?« Wenigstens hatte Franziska nicht gefragt, ob Hertha seine heimliche Verehrerin ist.
Filip gab auf. »Hertha BSC, ein Fußballklub aus Berlin.« Aber, wo er schon von ihm redete, den Thomas müsste er unbedingt mal wieder anrufen. Und was aus dem dünnen Säggel wohl geworden ist?
Nach gut anderthalb Stunden gab es eine nur einigermaßen erfolgreiche Bilanz: »100,5 Unterschriften haben wir zusammen«, bilanzierte Franziska.
»Warum Komma 5?«
»Weil eine ziemlich unleserlich ist. Weiß nicht, ob die zählt.«
»Das sollte dann wohl ein kleiner Scherz sein, mit den 100,5?«, fragte Esther angriffslustiger als die Alemannia zuletzt je gespielt hatte.
»Äh, ja, nicht gut?«
»Mich macht dieser Auto-Sender 100,5 aggressiv, genauso wie diese Antenne AC. Da wird das Brumm ergo sum dermaßen hofiert, jeder Cent Steuererhöhung auf Benzin zur Abzocke hochgejammert und rauf und runter nur Staumeldungen verlesen und diese fürchterlichen Blitzerwarnungen durchgegeben. Wahrscheinlich senden die längst herumfahrend von einer Autobahn. Ich warte noch drauf, dass die mal davon sprechen, ein Auto sei bei einem Unfall verletzt worden. Und wenn du bei denen auf Facebook die Kommentare zum Radentscheid liest, kriegst du Angst, dass da bald Jagd auf uns gemacht wird. Es ist dermaßen e-kel-haft!«
»Hmmm, wahrscheinlich hast du Recht. Also hundert Unterschriften und vielleicht eine dazu. Aber, sag mal, Filip, wie viele Leute passen eigentlich in das gelbe Ding?« Franziska meinte das Stadion. 32.900, wusste Filip sofort.
»Das wäre doch ein gutes Ziel am Ende, Radentscheid füllt den Tivoli.«
»Tolle Idee«, meinte Esther. »Ob wir das schaffen?« Bei der letzten Zählung vor ein paar Wochen waren es erst knapp 25.000.
Aus dem Stadion hörte man den ewigen Moonen die Aufstellungen verlesen. Robert Moonen ist Stadionsprecher seit 1973, als die Sportschau noch kaum erfunden gewesen war.
»Alemannia hurra – wir sind wieder da«, schepperte es aus den Lautsprechern.
»Noch«, dachte Filip, »immerhin noch da«.
Kapitel 6
Der Entscheid: Euphorie,
Tristesse und Hungersnot
Seit dem Herbst 2019 war die Stadt Aachen eine andere geworden. Erst hatten hunderte Menschen Unterschriften gesammelt wie zum Beispiel am Tivoli, 38.185 Autogramme waren bis November zusammengekommen, danach hatte der Stadtrat den Radentscheid beschlossen. Es war der erfolgreichste in ganz Deutschland geworden. Fast zwanzig Prozent aller AachenerInnen hatten unterschrieben.
Doch bald waren die Verhältnisse aus dem Ruder gelaufen. Die Stadt war gespalten.
Eben noch Freie Fahrt für Freie Bürger, jetzt die nackte Angst, dass Autofahren unverschämt erschwert wird. Wenn nicht sogar, wer weiß, dass es bald gar nicht mehr geht.
Eben noch Euphorie um eine nahende Verkehrswende, jetzt die große Ernüchterung, weil die Umsetzung so überaus stockend lief. Eben noch Aufbruch, jetzt Tristesse.
Eben noch die schöne Gewohnheit, jetzt Wut. Wegewut.
Je mehr Verwaltung und Politik von Dialog sprachen, desto giftiger wurde das Klima.
Längst herrschte Straßenkampf, ein Kampf um jeden Quadratmeter Öcher Asphalt.
Filip Heinen saß am Schreibtisch in seiner Wohnung in der Burtscheider Gregorstraße, kramte in alten Unterlagen und überlegte, wie es dazu hatte kommen können. Waren wir zu naiv? Warum ist das nicht eine akzeptable Selbstverständlichkeit: eine bessere Radinfrastruktur, eine gerechtere Aufteilung der Verkehrsflächen, vorneweg geschützte Radwege von zusammen vierzig Kilometern Länge an Hauptverkehrsstraßen, sicherer Umbau von Kreuzungen, dazu tausende Radbügel für ein sicheres Abschließen? Weniger Autoverkehr, weniger Parkblech. Eine lebenswertere Stadt sollte allmählich entstehen. So was muss doch möglich sein, sagte er sich. Zumal in Zeiten, in denen viel von Verkehrswende die Rede ist und von zwingend notwendiger Klimaneutralität.
Filip war schon dabei gewesen, als sie 2018 mit einem Dutzend Leuten begannen, über ein Bürgerbegehren nachzudenken, so wie es in einzelnen anderen Städten auch passiert war. Ab Mai 2019 hatten sie sechs Monate lang Unterschriften gesammelt: auf der Straße, bei Konzerten und Lesungen, bei Freunden und Freundinnen, und einmal eben auch am Tivoli. In 330 Sammelstellen lagen Unterschriftenmappen aus: Kneipen, Arztpraxen, Apotheken, Bioläden, kirchliche Einrichtungen von Misereor über die Evangelische Studierendengemeinde bis zur Moschee in der Elsassstraße, von der Eisdiele Delzepich bis zum Golfclub in Belgien. Firmen wie die AachenMünchener oder der Softwareriese Inform in Oberforstbach legten hausintern die Listen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus. Beide Unternehmen hatte Filip angesprochen, darauf war er stolz. Zusammen waren alleine dort an die 400 Unterschriften zusammengekommen.
Seine Frau und er hatten maßgeblich mitformuliert an den Wünschen, wie sie auf den Unterschriftenlisten standen. Filip kramte einen alten Flyer hervor: »Wir wollen eine lebenswerte Stadt, in der sich jeder Mensch sicher und konfliktfrei bewegen kann. Dafür brauchen wir einen zügigen Ausbau der Rad-Infrastruktur. Bessere Infrastruktur für Radfahrende sorgt für weniger Stau, Stress, Lärm und Abgase im öffentlichen Raum. Sicherheit für Rad- und Fußverkehr muss dabei stets vor Leistungsfähigkeit gehen. Angst und Unsicherheit hält viele vom Radfahren ab. Wir erwarten vom Radentscheid Aachen ein entspannteres Miteinander, gesünderes Stadtklima, bezahlbare Mobilität und mehr Lebensqualität für alle.«
Zwei Dutzend vollgepackte Ordner hatten sie dem Oberbürgermeister übergeben. Das Rechtsamt der Stadt hatte die Unterschriftenlisten akribisch geprüft, bis das erforderliche Quorum von knapp 8.000 Stimmen bestätigt war. Mit der fast einstimmigen Zustimmung des Stadtrates war der Radentscheid ein festgeschriebener Bestandteil der Aachener Stadtpolitik geworden und Verpflichtung, die Forderungen bis 2027 umzusetzen. Bislang passiert: fast nichts.
Filip erinnerte sich genau an die »fast schon heilige Stimmung im Ratssaal«, wie seine Frau direkt danach so verblüfft wie angetan gesagt hatte. Selbst Ratsleute aus SPD und CDU, die damals noch gemeinsam die Mehrheit hatten, hatten das Bürgerbegehren geradezu frenetisch gefeiert und von einem historischen Tag gesprochen. Die Stadt war froh, dass ihr ein klares Mandat gegeben war, um der notwendigen Verkehrswende einen richtigen Schub zu geben. Von Verkehrswende war ständig die Rede, vom Umbau einer sterbenden City. Aachen sollte nachhaltig zukunftssicher gemacht werden, klimaneutral, umweltfreundlicher. Schließlich hatte die Stadt schon im Juni 2019 den Klimanotstand ausgerufen.
Die »lebenswerte Stadt« anstelle der vorherrschenden Autowüsteneien war ein zentraler Begriff. Aber es ging noch besser. Damian hatte das Interview in der Süddeutschen Zeitung mit Prof. Agnes Förster entdeckt, der Inhaberin des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH. Sie hatte gesagt: »Wir sehnen uns nach der sinnlichen Stadt.«
Entspannteres Miteinander, sinnliche Stadt? Die schnöde Wirklichkeit war widerständisch und hartnäckig. Einerseits erwartbar im Alltag: Was schert mich der Klimanotstand, ich muss noch schnell mit dem Wagen in die Stadt, Besorgungen machen. Ich auch, ich auch, sagten viele andere. Zum Beispiel Sonnenschirme und Ventilatoren gegen die Hitze kaufen. Oder einen Rasensprenger gegen die Trockenheit. Andere posten dröhnend herum, bis sie wieder zur Tankstelle mussten. Oder sie sagten: Ich fliege nach Malle, das ist gut fürs Öcher Klima, denn dann fahre ich in Aachen ja kein Auto. Wir sind doch alle für den Klimaschutz! Wir auch, wir auch, riefen die Stadtbediensteten im Chor, aber die Vorschriften, die Politik, die Eitelkeiten von Bezirksfürsten, die Rücksichtnahmen. Es ging nicht voran. Anfangs hieß es noch: Anlaufschwierigkeiten. Aber die schienen nie zu enden.
Denn kaum war der Radentscheid beschlossen, hatten die erbitterten Streitereien begonnen. Viele AutonutzerInnen machten mobil: Sie witterten ideologische Bevormundung und eine Attacke auf ihre gewohnte Lebenswelt. Anwohner rebellierten, weil sie Parkplätze und Fahrspuren gefährdet sahen, vermeintlich angestammte Rechte also der heilen Autowelt, die über Jahrzehnte alimentiert worden war. Wie oft allein er Nachbarn, Exkollegen und notorischen Autolenkerinnen das demokratische Instrument eines Bürgerbegehrens erklären musste, dachte Filip Heinen. Manche konterten, lächelte der Mathematiker jetzt, als emsige Schnellrechner, dann hätten ja achtzig Prozent nicht unterschrieben! Die Mehrheit!
Leserbriefe in den Aachener Zeitungen erschienen, unzählige Posts in sozialen Netzwerken. Sie hatten manchmal durchaus Niveau und Argumente, ob pro oder contra. Oft gerieten sie aber zu absurden Verdrehungen oder Verdächtigungen. Plumpe Verschwörungen waren dabei, etwa, dass jetzt alle zu Radfahrern umerzogen werden sollten. Einer schrieb von »Radfahrunsinn«, einer von »blinder Fahrradgeilheit«. Eine Melange aus Spekulationen, Mutmaßungen (»Profilierungssucht Einzelner«), Fake News und Alternativen Nichtnews wurde zusammengebraut.
Gut, dachte Filip, das sind heutzutage Üblichkeiten im modernen Meinungsbildungsprozess. Man glaubt etwas zu wissen oder zu ahnen, zieht seine Schlussfolgerungen (»So geht Aachen kaputt«) – und schreit es hinaus. Argumente? Nebensache. Likes und Retweets gibt es trotzdem oder gerade wegen der Lautstärke. »Nur Bill Gates wurde als Drahtzieher für Aachens nahendes Ende nicht enttarnt, noch jedenfalls nicht, soweit bekannt. Und Corona ist auch nicht wegen Radfahrern ins Land gekommen. Oder, wer weiß!?«, so hatte es neulich noch eine Mitstreiterin beim Radentscheid-Treffen spöttisch formuliert.
38.185 Unterschriften, das hieß tatsächlich: Tivoli ausverkauft und gut 5.000 stehen noch vor dem Stadion. Ein paar Tage nach dem Ratsbeschluss, erinnerte sich Filip, hatten sie beim Bier herumgealbert und mit schneller Netzrecherche festgestellt, welche Wichtigkeit die Zahl 38.185 hatte, weltweit sogar. 38185, hatte Esther herausgefunden, ist die Postleitzahl der litauischen Gemeinde Panevėžys – vielleicht aus numerischen Gründen Aachens neue Partnerstadt, hatte der Zahlenmensch Filip angeregt. Andere feierten Funde wie diese: 38185 ist die Typenbezeichnung eines Edelstahl-Sparschälers oder für den Turnbeutel Refresh. Und 38185 hat sogar mehrfach Autobezug: als Koppelstange für eine Vorderachse, bei Renault für ein Reparaturset.
Und, ganz unter uns: Seit dem allerersten Tastenhieb spekulierte der Autor auf 38.185 als Mindestverkaufszahl dieses Buches. Er wusste, der Titel ist schon heute ein Gruß an die UnterschreiberInnen, denn ohne jeden einzelnen und jede einzelne hieße das Buch anders. Und, war der Autor sicher, mindestens 38.185 Autobesitzer und -besitzerinnen würden nach Lektüre des Buches wahrscheinlich beschämt ihren Wagen abschaffen.
Doch nicht herumträumen, der Blick sei auf die Dokumentation der Ereignisse gerichtet: Filip und seine MitstreiterInnen hatten schnell die Mühen der Ebene kennengelernt. So ein Bürgerbegehren Radentscheid leiert man nicht an, führt es durch, bringt es erfolgreich zu Ende, es wird Teil der Politik und fertig ist man. Vielmehr fing die Arbeit erst an. Es ging an die Umsetzung, und das war und ist zunächst Aufgabe der Verwaltung: Strecken aussuchen und qualifizieren, Pläne ausarbeiten, alles im Spinnennetz von Paragrafen, Verordnungen und der eigenen Gewohnheit. Acht neue Stellen für Radwegbau wurden ausgeschrieben. Aber es hakte. Es hatte noch kurz vor Corona gehakt, es hakte während Corona, und es hakte auch nach Corona. Bei den nächsten Viren würde es wahrscheinlich auch haken. Und ohne Pandemie auch.
Das hatte zunächst quasi historische Gründe, wie Mitstreiterin Lynn mit ihrer Erfahrung aus politischen Gremien wusste: Wer jahrzehntelang fast nur Straßen gebaut und am Rand ein paar Pflastersteine zu Fußwegen zusammenfügt hatte, musste Radwegbau in vielen Details erst lernen – zum Beispiel über Designelemente für den radsicheren Kreuzungsumbau, über Aufschwellungen, sinnvolle Asphaltsorten oder die Rillenstruktur von abtrennenden Radwegplatten. Dabei konnte man gerade im Dreiländereck doch von den Nachbarn lernen: Von der Radfahrnation Niederlande sowieso, auch mit den Drempeln, die dort so vorbildlich zahlreich zur Temporeduktion verbaut sind. Und in Kombination auch von Belgien: Filip hatte nach der Umgestaltung des Dörfchens Gemmenich nebenan abgeflachte Längs-Drempel in der Mitte von Kurven entdeckt: Sie verhindern sehr wirkungsvoll das Schneiden von Kurven. Sogar die Belgier sind also im Straßenbau Vorbild, hatte Filip zu seiner Frau Gabriela gesagt. Deren Antwort: »Passt doch, Liebling, ein Belgier hat ja auch den Asphalt erfunden.«
So hatten die Spezialisten vom Radentscheid einiges an Expertise zusammengetragen. Und apropos Niederlande: Die Fachgruppe Wegebau des Radentscheids hatte der Stadt sogar Lieferadressen vorgeschlagen, wo man, in Holland natürlich, die besten und griffigsten, rot gefärbten Harzgummi-Asphaltmischungen zum Wegebau bekommt. Und das auch noch preisgünstig. So sparte die stets klamme Stadt dank Radentscheid-Engagements bares Geld!
Wie man es nicht machen sollte (und lassen durfte), wusste ja jeder Radwegüberlebende in Aachen: groteske Wackelstrecken wie stadteinwärts Schanz hoch, unnötig glatte Pisten bei Regen wie Boxgraben bergab, mit Ampelmasten zugebaute Wege, dank Bodenwellen durch Wurzelwuchs designte Abenteuerstrecken überall. Und als besondere Groteske aufgepinselte Radwege, die plötzlich einfach endeten und sich in die Straße ergossen, wie auf dem Adalbertsteinweg, in Burtscheid in der Viehhofstraße oder bergab in der Zollernstraße. Dort hatte lange ein selbstgebasteltes Schild mit der lakonischen Aufschrift gestanden: »Dieser Radweg endet hier. Viel Glück bei der Weiterfahrt«. Filip hatte dieses Schild geliebt, weil es vieles über die Realität erzählte. Im Frühjahr 2021 war es plötzlich weg gewesen. »Sicher ein Auto«, hatte Esther geätzt.
Aachens toxisches Tohuwabohu hielt viele Menschen vom Radfahren ab, das wussten alle. An vielen Hauptstraßen gab es zudem gar keine Radwege, dahin trauten sich ohnehin nur nervenstarke Velo-Routiniers, und die auch nie mit dem Gefühl, einigermaßen entspannt fahren zu können. Jeder, der Aachens Straßennetz unverletzt queren wollte, musste immer, jeden Moment, das Verhalten von Autofahrern antizipieren, immer mitzudenken versuchen, was die wohl gerade denken oder mal wieder nicht denken in ihren Kabinen, was sie tun oder nicht tun: Sieht der mich? Weiß die, dass sie keine Vorfahrt hat? Biegt der da ab ohne zu blinken? Bremst der vor mir gleich einfach ab und bleibt zum Parken stehen? Wieder eine, die links blinkt und zum anderen links abbiegt, also nach rechts? Oder wieder jemand, der links blinkt und nach rechts erst mal ausholt für einen größeren Radius? Geht die Autotür da rechts gleich mit Schwung auf, oder die oder die oder die? Immer Finger am Bremsgriff, immer!
Dazu kommen als Gefahrenherd die FußgängerInnen auf den nicht abgetrennten Parallelwegen: Rrumms öffnet sich die Bustür und ein Schwall ergießt sich quer, wie Blinde ohne Blindenstock. Und zack, hechtet wieder einer aus dem Hauseingang, zack, steht wieder eine vor dir. Wusch, baumelt die Einkaufstüte in deinen Speichen. Um dann zu hören: »Was rasen Sie hier so!?« Hatte auch Filip nicht nur einmal gehört. Rasen, mit Tempo 20.
Dabei ist die Logik eigentlich ganz simpel: Mit mehr geschützten, sicheren, vor allem abgetrennten Wegen würde die Zahl der RadlerInnen bald steigen. Das erlebte man überall auf der Welt wie ein Naturgesetz. Und in Aachen funktioniert es auf der rege genutzten Vennbahn auch schon seit einigen Jahren. Ein gutes Radnetz gäbe weniger Autokilometer, was den Blechpiloten wiederum mehr Platz böte und Staus ersparen würde. Zudem wären diese Zweirad-Hindernisse weg von ihren Pisten. Also Win-win für alle.
Nur: das zu verstehen, schien für viele, um es vorsichtig zu nennen, nicht ganz leicht. Von den Leserbriefen zum Radentscheid hatten es Filip zwei besonders angetan: Ein Schreiber behauptete, Leute seien zur Unterschrift genötigt und gezwungen worden. Ein Skandal! Alles illegal!
Wie mag so was gehen? Das offenbarte er nicht. Filip hatte zusammen Gabriela überlegt, wie bei »Wer wird Millionär?« die entsprechende Frage vielleicht gelautet hätte. Filip kramte in den Unterlagen. Er fand den Zettel. Das war ihre Frage:
»In Aachen wurden 2019 viele Menschen zur Unterschrift beim Radentscheid gezwungen. Mit welcher Drohung am häufigsten?«
A) »Sonst mach ich dich kalt, Alter.«
B) »Kriegst einen Eintrag ins Klassenbuch/wirst exmatrikuliert/ fristlos gekündigt.«
C) »Schreib, sonst lass ich mich scheiden.«
D) »Ich weiß, wo dein Auto steht.«
Die schönsten Zuschriften in den Aachener Blättern wurden zu Realsatire. Filips No 1 war diese: Eine Schreiberin meinte, mit den geplanten Radwegen fielen so viele Autostraßen weg, dass die Stadt bald nicht mehr erreichbar sei, die Folge: die Innenstadt werde zur Bronx, Einzelhandel ade, Trostlosigkeit allerorten und dann: »… alle Geschäfte bleiben leer, dann haben wir zwar gute Luft in der Stadt, aber nix zu fressen.«
Bislang blieb eine Hungersnot aus. Man kann aber sagen, Aachen war nervös geworden, sehr nervös. Und »zunehmend ruppig«, wie Gabriele das neulich noch genannt hatte, erinnerte sich Filip.
An diesem Abend im September 2021 lud sich Filip die Online-Ausgabe der gelben Tageszeitung herunter. Er las den Text über den neuen Verwaltungsvorschlag zum Umbau der Lintertstraße in Forst. Filip traute seinen Augen nicht. Er las noch einmal. »Schatz, komm doch mal, das ist jetzt der endgültige Irrsinn«, rief er. Gabriela las mit. Als gelegentliche Radlerin unterstützte sie das Engagement ihres Mannes, auch wenn sie manchmal fand, er denke ja kaum mehr an etwas anderes als an Radpolitik.
»Guck mal, die wollen jetzt offenbar allen Ernstes nach all den giftigen Protesten der Auto-Anwohner einen Teil der Straße so lassen wie er ist, nennen das aber nicht Kapitulation, sondern ›duale Führung‹. Sie konzipieren seit Jahren eine Radvorrangroute, bejubeln sich ständig selbst und jetzt sollen Radfahrer und Radfahrerinnen dort wie immer schon unverändert ungeschützt mitten auf der Straße fahren, eng umkuschelt von den Autos, bergab auch noch, oder halt durch Nebenstraßen kurven. Das ist weder dual noch Führung, sondern ein einziger feiger Humbug. Ein Nichts. Eine Null. Ein Blaumilchkanal … Das ist Satire … Das ist Schöne Neue Welt in Aachen. Das …« Filip bekam sich nicht mehr ein. Gabriela war ebenfalls erstaunt, widersprach ihrem empörten Gatten aber: »Das ist durchaus dual, mein werter Herr Mathematiker, weil doppelter Unsinn.«
Zweifellos: Ein neuer Höhepunkt an städtischer Groteske. Aber auch Filip ahnte kaum, dass das nur der Anfang war. Bald sollten sich immer seltsamere Dinge ereignen, von denen nun schonungslos die Rede sein soll.
Schauen wir nach vorn. Wir schreiben das Jahr 2022. Oder sogar schon 2023? Jedenfalls in eine Stadt, die sich erhebt und die bebt. Von wegen sinnlich.
Kapitel 7
Bei den Automenschen 1
Das konstituierende Geheimtreffen
»Hat dich jemand gesehen?«
»Nein, alles sauber.«
»Dann komm doch rein.«
Dr. Hannes Kügler schloss gleich hinter seinem Nachbarn wieder die Haustür an seinem Wohnhaus in der Habsburgerallee, nicht ohne noch mal kurz nach links und rechts zu gucken. Wen er da hätte entdecken können, wusste er auch nicht. Aber es konnte der Spannung und der Ernsthaftigkeit des heutigen Abends nur guttun, wenn man sich von Feinden umstellt wähnte, zumindest in der Fantasie. Vielleicht spähte einen auch jemand von dieser unsäglichen Initiative Radentscheid aus. Denen traute er alles zu, alles.
Es war das erste stadtweite Treffen der Initiative Autoentscheid, durchaus mit geheimen Vorzeichen. Man hatte sich über eine geschlossene WhatsApp-Gruppe verabredet. Ohne öffentlichen Aufruf. Manche kannten sich aus der Nachbarschaft, einzelne hatte man über Mund-zu-Mund-Propaganda eingeladen. Man war entschlossen, sehr entschlossen.
»Hannes, ich muss wirklich meinen Respekt für dich aussprechen.«
»Oh, Respekt, danke. Wie kommt´s?«
»Mein Mann hat mir neulich im Archiv noch mal deinen Leserbrief aus dem Frühjahr 2021 gezeigt. Chapeau! Da war alles drin über den ganzen Irrsinn, der unserer schönen Stadt angetan wird. Zudem eine dezidiert sachliche Analyse, wirklich.« Marlene Veit hatte ihn so gelobt. Sie war mit ihrem Mann Theo hier und mit den Eheleuten Schneiders, Heinrich und et Irm, Marlenes bester Freundin.
Hannes Kügler, Dr. im Maschinenbau, Geschäftsführer einer kleinen Firma für Fahrzeugkomponenten und zusammen mit seiner Gattin Wera der heutige Gastgeber, freute sich. Nur, zeigen musste er das ja nicht sofort und offensichtlich. »Danke, Frau Veit, aber das waren doch über diese links-grünen Weltverbesserer nur ein paar Fakten.« Seine Faktensammlung in der Zeitung hatte sich so gelesen: »Von der Minderheit, die diesen Radentscheid wahrscheinlich zum großen Teil gutgläubig und leichtfertig unterschrieben hat, gibt es nun einige, die ein böses Erwachen erleben: Die Anlieger all der Straßen, wo zu Ehren der wenigen Radfahrer Bäume gefällt werden und Parkplätze weichen müssen. Man könnte schadenfroh sein, aber es trifft uns alle. Es ist unser aller Geld, das für den Umbau verschwendet wird.« Genau das wollten sie mit dem heutigen Abend zu verhindern beginnen, und das stadtweit.
Gut drei Dutzend Leute waren im ausladenden Partykeller der Küglers zusammengekommen. Bei Schnittchen (Weras Werk) und kühlen Getränken (sein Beitrag) saß man im weiten Kreis rund um die Bar und den Kellertisch aus edler Eiche. Endlich machte der Raum mal wieder Sinn, freute sich Hannes. Er dachte kurz an ihre großen Partys hier, die damals noch Feten geheißen hatten. Wie ausgelassen und feuchtfröhlich man gefeiert hatte. Lange her, das war nichts mehr für ihn und seine Wera zu Beginn des letzten Lebensdrittels, womöglich realistischerweise -viertels, aber egal. Er ließ seinen Blick über die liebevoll gebastelten Bilderrahmen (ebenfalls Weras Werk) schweifen, die die Fotografien (sein Beitrag) von den großen Oldtimer-Rallyes zeigten, die der Aachener Karnevals-Verein früher so würdevoll veranstaltet hatte. Einmal war er, Dr. Hannes Kügler, nach einem waghalsigen Endspurt und einem kühnen Überholmanöver auf der Vaalser Straße Dritter geworden. Sein Name hatte sogar in der Zeitung gestanden und er war auf dem Bild im Lokalteil zu erkennen gewesen. Eine Spur Wehmut umspielte seine Seele.
Aber weg mit den blöden Abschweifungen in die Vergangenheit, jetzt ging es darum, Aachens Zukunft zu retten. »Ein Bier, lieber Herr Sucker-Kulergy? Wir können uns übrigens auch duzen, oder? Ich bin der Hannes.«
»Joachim, angenehm.«
Joachim fragte, wie man an ein so schönes Anwesen komme. »Das ist mein Elternhaus. Als Wera und ich Eltern wurden, sind wir nach ein paar Jahren wieder mit den Kindern hier eingezogen, Platz ist ja genug. Erst lebten wir hier mit Oma und Opa. Dann sind die beiden irgendwann allein in was Kleineres gezogen, seniorengerecht, oben auf der Hörn.«
»Sehr vernünftig«, sagte Joachim. Und Hannes erinnerte sich beim Blick in die Kellerrunde auch an die Feten, vor allem zu Fastelovvend, die seine Eltern hier in den 60er Jahren gefeiert hatten, damals, als Feten noch Partys hießen.
Ein illustrer Kreis hatte sich versammelt. Einige waren noch aus der ersten Widerstandsgruppe rund um die Bürgerinitiative Lütticher Straße dabei, vorneweg Metzgermeister Jupp Bangemach und Metzgermeisterin Frieda Bangemach sowie die Veits, die besonders allergisch auf den Radwegneubau vor ihrer Haustür nahe des Couven-Gymnasiums reagierten. Dazu eine Forster Delegation rund um die dortige Aktivistin Elsa Brunn, ansonsten aus ganz Aachen Handwerker, Pensionäre, Einzelhändler, eine Apothekerin, auch ein Lehrerpaar und zwei junge, smarte Anwälte, von denen einer gleich in der Vorstellungsrunde sagte: »Wenn es juristisch wird, stehen wir mit allen Paragrafen bereit.«
An Gastgeber Kügler war es, die Versammlung offiziell zu eröffnen. »Werte Autofreunde, liebe Nachbarn. Ich habe schon einen Namen für uns: Wir sind die 220.000 Aufrechten.« Erwartungsgemäß setzte es einige irritierte Blicke. »Ich erkläre es euch und Ihnen. Wenn diesen unsäglichen Radentscheid tatsächlich 38.000 Aachener unterschrieben haben, woran es ja erhebliche Zweifel gibt, ob die das alle freiwillig getan haben oder sich zumindest der Folgen bewusst waren, aber selbst wenn: dann haben ihn 220.000 nicht unterschrieben. Ist ja einfaches Rechnen bei einer Einwohnerzahl in Aachen von 258.000.«
Jetzt setzte es viele strahlende Blicke. »220.000 – und gegen uns alle, gegen die breite Mehrheit in dieser Stadt, wird hier Politik gemacht, unglaublich!«, sagte Elsa Brunn.
Der Kampfname der Initiative war sofort rundum akzeptiert: »Vereinigte Bürgerinitiativen Autoentscheid: Die 220.000 Aufrechten«. Das würde »doch kesseln«, sagte Anja Sucker-Kulergy.
Auch zwei junge türkische Geschäftsleute vom Adalbertsteinweg waren gekommen. Ihrer Straßen drohte, so das jüngste Gerücht, wegen neuer Radspuren tatsächlich und das auch noch beidseitig, das Schicksal der Fahrbahn-Halbierung. Und das obwohl doch damals, Ende 2020, bei diesem sinnlosen kurzen Test mit einer exklusiven Radspur nichts herausgekommen war außer Staus, zumindest ab und zu. Die beiden stellten sich als Cengiz Alkin und Fatih Üslümürlüçü vor; der eine hatte ein Gemüsegeschäft, der andere machte in Shisha-Gastronomie, Fast Food und Immobilien. »Wir wollen kein Fahrrad fahren müssen. Der Türke fährt kein Fahrrad«, gab Üslümürlüçü mit größtmöglichem Stolz kund.
Die scheinbar merkwürdige Aussage hatte durchaus einigen Wahrheitsgehalt, zumal der Geschäftsmann vom Adalbertsteinweg, sicher ohne es zu wissen, seinen Landsmann Deniz Yücel fast exakt zitiert hatte. »Wir Türken fahren nie Fahrrad«, hatte der Journalist und Schriftsteller mal gesagt, der im Erdogan-Regime unter dem Vorwurf »Agentterrorist« fast ein Jahr inhaftiert gewesen war. Die Abneigung zum Zweirad habe in der Türkei historische Gründe, erklärte Üslümürlüçü. Früher ging man dort allenthalben fast nur zu Fuß oder fuhr Bus, Autos hatte nur die ganz ferne Oberschicht. Dann kamen die ersten Gastarbeiter nach Deutschland zu etwas Geld und damit zum ersten eigenen Auto, oft eine schöne große alte Karre. Die bescherte höchstes Statusgefühl, spätestens wenn man, vollgepackt mit dem Konsumglück des Westens auf dem Dach, über den auto put