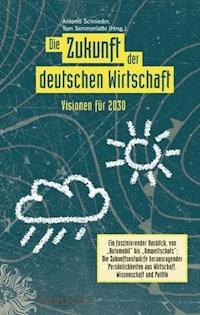Die Zukunft der deutschen Wirtschaft
Visionen für 2030
von Antonio Schnieder und Tom Sommerlatte
www.publicis-books.de
Vollständige ePub-Ausgabe von Antonio Schnieder,Tom Sommerlatte (Hrsg.), „Die Zukunft der deutschen Wirtschaft“,ISBN 978-3-89578-350-0, (Printausgabe)
ISBN 978-3-89578-703-4
Verlag: Publicis Publishing© Publicis Erlangen, Zweigniederlassung der PWW GmbH
Inhalt
Einführung
Antonio Schnieder, Tom Sommerlatte
Gedanken, Fragen, Fakten
Klassische Industrien
Elektrotechnik
Gerald Gerlach
Miniaturisierung – kein Thema mehr
Maschinenbau
Volker Bellersheim, Volker Kirchgeorg, Christopher Ulrich
Spitzenposition durch Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit
Pkw
Jürgen Hubbert
Immer noch die Nummer 1
Pkw
Henning Wallentowitz
Vom Statussymbol zum Gebrauchsgegenstand
Lkw
Andreas Renschler
Der Lkw 2.0 – Wandel für Wachstum
Verkehr
Dr. Bernd Malmström
Straßentransport und Schienengüterverkehr – Konkurrenten und Partner
Chemie
Karl-Gerhard Seifert
Ein Rückblick im Zorn
Pharma
Wolfgang Plischke
Eine Frage der Rahmenbedingungen
Energie
Christoph Wollny
Kopenhagen 450
Energie
Ralf Christian
Aufbruch in ein neues Energiezeitalter
Energie
Gerhard Knies
DESERTEC & ein zu strategischem Denken neigender Verteidigungsminister
Energie
Jörg Adolf
Harte Fakten und Szenarien
Landwirtschaft
Carl-Albrecht Bartmer
Renaissance durch Innovation und Verantwortung
Zukunftsbranchen
Umwelttechnik
Marion A. Weissenberger-Eibl, Sebastian Ziegaus
Umweltschutz adieu!
Biotechnologie
Ulrich Schriek, Marc Reinhardt, Thomas Theuringer, Ralf Emmerich
Was ein Großvater seinem Enkel heute erzählt
Nanotechnologie
Jürgen Valentin
Ein Leben in der verborgenen Welt
Medizintechnik
Meinrad Lugan
Technik, die dem Menschen nutzt
Informationstechnik und Kommunikation
August-Wilhelm Scheer
100 mal 100
Informationstechnik
Matthias K. Hartmann
IT hat die Welt lebenswerter und die Unternehmen klüger gemacht
Internet
Stefan Groß-Selbeck
Zeitreise durchs Web
Consumerbranchen
Gesundheitswirtschaft
Manfred Dietel
Wachstumsmotor mit Personalmangel
Einzelhandel
Thomas Gutberlet
Handel bleibt Wandel
Tourismus
Michael Frenzel
Erlebnisse und Emotionen: Schlüssel zum Erfolg
Geldwirtschaft
Banken
Falko Fecht
Ein Nachruf
Banken
Mark Wahrenburg
Ein solides System
Versicherungen
Michael Diekmann
Es bleibt spannend
Medien
Printmedien
Bernd Ziesemer
Vom Luxus einer gepflegten Lektüre
Werbung
Gerhard Seitfudem
Logoplexe, Slots und Wisdom
Übergreifende Betrachtungen und Rahmenbedingungen
Werte
Hartmut Kreikebaum
Plädoyer für einen gezähmten Kapitalismus
Familienunternehmen
Stefan Heidbreder
Stark in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Kommunen
Jörg Lennardt
Eine reale Fantasie
Technologie
Hans-Jörg Bullinger
Effizienzrevolution, Technologiekonvergenz, Komplexitätsmanagement
Infrastruktur
Markus Hofmann, Andreas Knie
Ein neues WIR-Gefühl
Klimaschutz
Claudia Kemfert
Spät erkannt: Die Ökonomie des Klimaschutzes
BDI
Werner Schnappauf
Wir sind und bleiben ein Industriestaat
Die Sicht der Politik
CDU
Kurt J. Lauk
Deutschland als Teil Europas im Zeitalter der Globalität – eine Tischrede
FDP
Rainer Brüderle
Zukunft in Freiheit
SPD
Sigmar Gabriel
Am Scheideweg
Die Sicht unserer Nachbarn
Frankreich
Jean-Pierre Dubois
Ein Blick über den Rhein
Großbritannien
Lord John Eatwell
Erfolgsdynamik 2010 – das deutsche Paradoxon
Nachwort
Tom Sommerlatte
Diagnose: Tendenz positiv
Vitae
Herausgeber
Autoren
Einführung
Antonio Schnieder, Tom Sommerlatte
Gedanken, Fragen, Fakten
„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, polterte Helmut Schmidt laut Spiegel 1980 im Bundestagswahlkampf, in dem er sich dank Koalition mit der FDP als Bundeskanzler gegen Franz-Josef Strauß behauptete. Dass die FDP zwei Jahre später die Koalition verließ und Helmut Kohl als Bundeskanzler einer CDU/CSU/FDP-Regierung in den Sattel verhalf, wird beim Zitieren der Schmidt-Aussage meistens unterschlagen. Vielleicht hätte eine Vision zu einer anderen politischen Entwicklung geführt.
Es gibt in der Tat sehr unterschiedliche Meinungen zur Bedeutung von Visionen (allein bei Google findet man mehrere Hunderttausend Einträge zur „Notwendigkeit von Visionen“!).
„Der einzig wahre Realist ist der Visionär“, war die Sicht von Regisseur Federico Fellini.
„Vitalität ist das Resultat einer Vision. Wenn es keine Vision mehr gibt von etwas Großem, Schönem, Wichtigem, dann reduziert sich die Vitalität und der Mensch wird lebensschwächer“, befand der Psychologe Erich Fromm.
Der ehemalige Chef von McKinsey Deutschland gibt zu bedenken, dass „eine überzeugende Vision die Bündelung des Ideenpotenzials und die Freisetzung zielgerichteter Energien bewirken kann“, und Wernher von Braun vertrat die These, dass „alles, von dem sich der Mensch eine Vorstellung machen kann, auch machbar ist“.
Über Visionen kann man nicht reden, ohne Antoine Saint Exupéry zitiert zu haben: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Warum beginnen wir dieses Buch mit einer solchen Auseinandersetzung zur Bedeutung von Visionen?
Weil in Zeiten des sich abspielenden Paradigmenwechsels in der Weltwirtschaft und Weltkultur, den wir alle erleben, etwas zu fehlen scheint: Wie der Schweizer Theologe und Philosoph Hans Küng, aber auch die große Publizistin Gräfin Marion Dönhoff feststellten, „fehlt allenthalben eine realistische, zukunftsweisende Vision für die heutige Welt“.
Es geht nicht um Fortschrittsideologien und nicht um visionäre Exzesse, wie sie mit apokalyptischen Angstbildern der Zukunft oder aber utopischen Luftschlössern gehandelt werden. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, in den sich um uns ereignenden Entwicklungen Muster zu erkennen und darin wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge zu sehen, die perspektivisch zu einem Spektrum von möglichen Zukunftsbildern führen, dann sind wir auch nicht in der Lage, Strategien zu entwerfen, um auf den Gang der Dinge im Sinne einer längerfristig wünschenswerten Entwicklung einzuwirken.
Grundsätzlich erwarten muss man diese Auseinandersetzung von Führungskräften: „Unternehmenslenker ohne Vision sind wie Grubenarbeiter ohne Lampe, die die Anforderungen nicht erfüllen können, die an sie gestellt werden. Ein gutes Bild, um den Weg, den ein Unternehmen im Laufe der Zeit zurücklegt, zu verdeutlichen, ist eine Landkarte. Als erstes muss man wissen, wo man herkommt, welchen Weg man bereits zurückgelegt hat und wo man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. Dann kann man ein Ziel haben und auf der Landkarte den oder die möglichen Wege suchen, die zum Ziel zu führen versprechen“, so das Bild von Vision Tank. Der Vergleich hinkt allerdings, denn die Zukunft ist keine deutlich erkennbare Landkarte. Das Ziel und der Weg dahin liegen im Nebel der Unberechenbarkeit. Und der Nebel ist in den letzten Jahren zweifellos dichter geworden.
Aber visionäre Unternehmen wie Apple oder Audi florieren über längere Zeiträume, sind leistungsfähiger und erfolgreicher als ihre weniger visionären Konkurrenten und erzielen eine bessere Kapitalrendite. Sie ziehen die besseren Mitarbeiter an, denn Visionen üben eine Anziehungskraft aus, sie faszinieren, weil sie Sinn stiften.
Aber Visionen fallen nicht vom Himmel, sie bedeuten, wenn sie nicht utopische Luftschlösser oder apokalyptische Angstbilder der Zukunft sein sollen, Anstrengung und Durchhaltevermögen.
Den Versuch, realistische, zukunftsweisende Visionen für 2030 zu entwikkeln, haben wir, die Herausgeber, der Verlag und viele kompetente Autoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in diesem Buch gewagt. Es soll nicht verschwiegen werden, dass einige (wenige) der angesprochenen Persönlichkeiten es abgelehnt haben, ihre Vision beizusteuern, weil sie entweder angaben, über keine Vision zu verfügen, oder weil sie eine Vision angesichts der Dynamik unseres Umfeldes für unangebracht halten. Einer befürchtete sogar, dass die Vision 2030 reine „Lyrik“ werden würde.
Wir wissen auch, dass in den meisten Unternehmen die strategischen Planungshorizonte kürzer geworden sind, manchmal kürzer als die Laufzeiten von F&E-Vorhaben, so konsternierend das erscheinen mag.
Der von uns bewusst gewählte Horizont von 20 Jahren in der Zukunft überschreitet absichtlich fast alles, was an Planungs- und Projektvorhaben in der Wirtschaft läuft. Fast alles, denn Abschreibungszeiten so mancher heutiger Investitionen betragen ohne weiteres 20 Jahre.
Aber gleichzeitig sind 20 Jahre kein unvorstellbarer Zeitrahmen. Denken wir doch einmal 20 Jahre zurück. Die meisten von uns können sich noch sehr genau an die Verhältnisse im Jahr 1990 erinnern. Wäre es damals, also nach der Wiedervereinigung, nach der Etablierung von PCs, Laptops, Mobiltelefongeräten und Internet, eine Überforderung gewesen, eine Vision für das Jahr 2010 zu formulieren, also für die Welt, in der wir heute leben?
Ebenso werden sich viele von uns im Jahr 2030 die Frage stellen, ob es denn 2010 so herausfordernd gewesen wäre, sich die Zustände der dann entstandenen Wirklichkeit auszumalen.
Vielleicht wird daraus sogar der Vorwurf resultieren, negative Entwicklungen nicht vorausgesehen, benannt und rechtzeitig verhindert zu haben, beispielsweise auf den Gebieten Klimaschutz, Energieversorgung und Infrastruktur.
Auch wenn es nicht immer Spaß macht: Betrachten wir dazu einige Zahlen. Sie machen für viele Aspekte deutlich, warum sich die Dinge in eine ganz bestimmte Richtung entwickeln, denn vieles von dem, was bis 2030 Wirklichkeit werden wird, ist heute schon mehr oder weniger deutlich vorprogrammiert.1
Die Bevölkerung
Das gilt naturgemäß besonders für die Bevölkerungsentwicklung. Alle Menschen, die 2030 leben werden und dann älter als 20 Jahre sind, leben heute schon. Neue kommen nicht hinzu.
So wissen wir, dass die in Deutschland lebende Bevölkerung, die 1990 noch rund 80 Millionen Menschen betrug und dank Zuwanderung bis heute auf 82 Millionen Menschen anwuchs, im Jahr 2030 nur noch 77 Millionen Menschen betragen wird. Spürbarer als der Bevölkerungsschwund wird aber die veränderte Bevölkerungsstruktur sein:
•
Die Zahl der unter 20-Jährigen wird von 17,3 Millionen vor 20 Jahren und 15,6 Millionen heute auf rund 13 Millionen im Jahr 2030 (von 21,7 % auf etwa 16,7 % der Gesamtbevölkerung) zurückgehen.
•
Die Zahl der über 60-Jährigen wird von 16,3 Millionen vor 20 Jahren und 21,0 Millionen heute auf 28,5 Millionen (von 20,4 % auf etwa 37 % der Gesamtbevölkerung) ansteigen.
Die 20- bis 60-Jährigen, die 1990 noch 57,3 % der Gesamtbevölkerung darstellten, werden im Jahr 2030 nur noch 46 % ausmachen.
Für diese Vorhersage bedarf es keiner visionären Fähigkeiten, denn das ist mehr oder weniger vorprogrammiert (Variationsmöglichkeiten bietet in begrenztem Maß die Ein- und Auswanderungsstatistik, die im Augenblick aber ein Defizit ausweist – und eine radikale Veränderung der Ab- oder Zuwanderung ist relativ unwahrscheinlich).
Eine Vision erfordert es dagegen, die Auswirkungen einzuschätzen.
Schauen wir uns die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten an. Ihre Zahl stieg von 38,6 Millionen im Jahr 1990 auf heute 40,2 Millionen, wobei der Anteil der im Dienstleistungssektor Beschäftigten von 60,0 % im Jahr 1990 auf heute 73,1 % anstieg.
Wie wird es im Jahr 2030 aussehen?
Der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung (heute 49,0 %, 1990 waren es 48,4 %) wird bis 2030 wahrscheinlich auf etwa 50 % steigen, aber fast 82 % der Beschäftigten (etwa 32 Millionen) werden im Dienstleistungssektor arbeiten, nur noch 6,7 Millionen in Landwirtschaft, Forst und im produzierenden Gewerbe. Was heißt das für die herstellende Industrie? Hier ist Vision gefragt!
Und dabei spielt die Ausbildung eine besondere Rolle.
Die Zahl der Studenten liegt heute mit rund 2,0 Millionen bei 2,4 % der Gesamtbevölkerung. Bis 2030 müsste die Zahl der Studierenden auf mindestens 3,9 % der Gesamtbevölkerung angestiegen sein (rund 3,0 Millionen), eher auf 5,2 % (rund 4,0 Millionen, eine Verdoppelung gegenüber heute!), um den Anforderungen der sich verändernden Wirtschaftsstrukturen gerecht werden zu können.
Was heißt das für unsere Universitäten und Hochschulen, für unsere Forschung und Entwicklung? Vor allen Dingen: Was heißt das für die Ausbildung nach Fachbereichen?
Während heute 56 % der Studierenden Sprach- und Kulturwissenschaften, Recht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften und nur 35 % Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften (inklusive Informatik) studieren, muss sich das Verhältnis bis 2030 umkehren, wenn Deutschland eine exportfähige Wirtschaft bleiben soll. Das bedeutet mehr als die Verdoppelung der Studierenden in den Fachgebieten Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften.
Öffentliche Einnahmen und Ausgaben
Die Finanzierung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der letzten 20 Jahre wurde durch einen Anstieg des Steuervolumens von rund 640 Milliarden Euro in 1992 auf 910 Milliarden Euro in 2009 ermöglicht, das entspricht einer Steigerung um fast 50 %. Wie wird es aber bis 2030 weitergehen?
Die Lohnsteuer dürfte angesichts der rückläufigen Beschäftigtenzahl kaum mehr als 2 % Wachstum pro Jahr erbringen. Daher stellt sich die Frage: Können Körperschafts- und Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer und andere Bundes- und Landessteuern zukünftig ein stärkeres Wachstum aufweisen als in den letzten 20 Jahren?
Der Blick auf die Entwicklung des Bruttoinlandprodukts (BIP) zeigt das Potenzial auf. Es lag 1991 bei 1.500 Milliarden Euro (auf Euro umgerechnet) und stieg bis 2010 auf 2.550 Milliarden Euro (31 TEuro pro Kopf). Zukunftsschätzungen extrapolieren (ohne rechtfertigende Untermauerung), dass das BIP im Jahr 2030 bei 3.100 Milliarden Euro landen könnte (39 TEuro pro Kopf).
Die öffentlichen Haushalte gaben 1990 585 Milliarden Euro aus und wiesen dabei ein Defizit von 27 Milliarden Euro aus, was den öffentlichen Schuldenstand auf 536 Milliarden Euro ansteigen ließ (das waren 35,7 % des damaligen BIP bzw. 191 % des damaligen jährlichen Steuervolumens).
Im Jahr 2009 verausgabten die öffentlichen Haushalte 1.127 Milliarden Euro und erwirtschafteten dabei ein Defizit von 113 Milliarden Euro, wodurch die öffentlichen Schulden die Schwindel erregende Höhe von 1.515 Milliarden Euro erreichten (72,0 % des BIP bzw. 330 % des Steuervolumens von 2009).
Für 2030 liegen keine Schätzungen, Ahnungen oder Fantasiezahlen der öffentlichen Haushalte vor. Aber man kann getrost sagen, dass es schlecht aussehen würde, wenn sich bis dahin die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte nicht weitgehend angenähert haben und die öffentlichen Schulden nicht unter 50 % des BIP gesenkt werden konnten.
Wird das machbar sein?
Wir wagen die Vision, dass es gehen kann, wenn die Leistungs- und die Handelsbilanz sich weiterhin positiv entwikkeln. Hier liegt der Motor des gesamten wirtschaftlichen und sozialen Modells der Bundesrepublik Deutschland.
Eine Horrorvision bestünde darin, dass die Sozialpartner an diesem Motor herumpfuschen, sei es durch überzogene Lohnforderungen und Streiks seitens der Arbeitnehmer, sei es durch Investitionsverweigerung und -verlagerung seitens der Arbeitgeber, Wir sitzen alle auf dem selben Ast. An dem Ast kann man auf vielerlei Weise sägen, herunterfallen würden wir alle.
Wie kann also die Leistungs- und Handelsbilanz weiter im Sinne einer gesunden und erreichbaren Vision entwickelt werden?
Innovationskraft
Die entscheidende Triebfeder wird die Innovationsleistung der Wirtschaft sein.
Nicht alle innovativen Unternehmen sind visionär, aber visionäre Unternehmen verfügen über eine höhere Innovationskraft als nicht-visionäre Unternehmen.
Ein Maß der Innovationsleistung sind die Patentanmeldungen.
Deutschland lag 2003 mit etwa 110.000 Patentanmeldungen und rund 53.000 erteilten Patenten in der Spitzengruppe der Industrieländer (weltweit gab es 2003 mehr als 1.500.000 Patentgesuche und rund 620.000 erteilte Patente. Während die Zahl der deutschen Patentanmeldungen bis 2007 und wahrscheinlich bis heute nahezu konstant blieb, stieg die Zahl der erteilten Patente deutlich an.
Die Herausforderung für die nächsten 20 Jahre besteht darin, weltweit weiterhin zu den führenden Ländern auf dem Patentgebiet zu gehören und dazu auf die Größenordnung von jährlich 85.000 bis 110.000 erteilten Patenten zu kommen. Bei der zuvor aufgezeigten anzustrebenden Zahl von Universitäts- und Hochschulabsolventen der Fachbereiche Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften wäre das genannte Ziel von erteilten Patenten pro Jahr durchaus erreichbar. Man kann sich aber vorstellen, welche Innovationskultur dazu in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft entstehen muss. Eine realistische Vision?
Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung läuft es in die richtige Richtung. 1990 gab die Privatwirtschaft in Deutschland über 32,3 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus, die öffentliche Hand 5,5 Milliarden Euro, zusammen waren es 37,8 Milliarden Euro. 2007 waren es zusammen schon 61,5 Milliarden Euro, davon 53 Milliarden durch die Privatwirtschaft und 8,5 Milliarden Euro durch die öffentliche Hand. Bis zum Jahr 2030 müssen es mindestens 120 Milliarden Euro an gesamten jährlichen F&E-Aufwendungen werden, 20 Milliarden davon durch die öffentliche Hand, also an den Universitäten und Hochschulen, in den öffentlichen Forschungseinrichtungen, in öffentlichen Unternehmen und durch F&E-Förderung privatwirtschaftlicher Vorhaben, besonders im Mittelstand.
So greift eins ins andere. Man muss es nur sehen, um Visionen realisierbar zu machen, und entsprechend an allen relevanten Rädern drehen.
Wie wird sich bei all diesen Herausforderungen die Gesellschaft verändern?
Betrachten wir dazu zunächst einmal einige reale Entwicklungen.
Informationstechnik und Kommunikation
Von 1990 bis 2010 spielte sich eine rasante Penetration der IT-Nutzung ab. 1990 gab es schon alles – PC, Laptop, Mobiltelefon und Internet – aber heute haben fast alle alles: 78,2 % der Bürger verfügen über einen PC und/oder Laptop, 86,3 % haben ein Mobiltelefon, 73 % nutzen das Internet, 58,3 % haben eine Digitalkamera. Hier kann die Vision nicht in einer starken weiteren Zunahme der Nutzung bestehen, sondern nur in einem revolutionären Wandel der Systeme, der durch die unaufhaltsam scheinende Leistungssteigerung der IT- und Kommunikationssysteme ermöglicht werden wird. Wie wird dieser Wandel aussehen? Die Autoren der Beiträge im Buch geben ihre Antwort darauf.
Verkehr
Heute gibt es über 44 Millionen Pkw in Deutschland, die auf 12.400 Kilometern Autobahn fahren (1990: 10.700 km), und mehr als 2,6 Millionen Lkw.
Bis 2030 wird sich hier keine größere Steigerung der Zahlen ergeben, wohl aber eine durchgreifende Änderung des Fahrzeugparks und der Steuerung des gesamten Verkehrssystems. Auch dazu finden Sie in diesem Buch entsprechende Beiträge.
Transport, Logistik und Verkehrsinfrastruktur werden eine entscheidende und aller Voraussicht nach limitierende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands haben.
Auffälligerweise hat sich die Kilometerlänge der Schienenwege seit 1990 nicht mehr nennenswert erhöht, 2008 waren es 38.000 km, dreimal so viel wie Autobahnkilometer. Aber das Transportvolumen auf der Straße ist viermal so groß wie das auf der Schiene.
Insgesamt stieg das Transportvolumen in Deutschland von 515 Milliarden Tonnenkilometern (tkm) im Jahr 2002 (360 Milliarden tkm auf der Straße, 79 Milliarden tkm auf der Schiene, 59 Milliarden tkm in der Binnenschifffahrt, 2,3 Milliarden tkm in der Luft und 15,5 Milliarden tkm durch Rohrleitungen) bis 2008 auf insgesamt 675 Milliarden tkm (475 Milliarden tkm auf der Straße, 117 Milliarden tkm auf der Schiene, 64 Milliarden tkm in der Binnenschiffahrt, 3,5 Milliarden tkm in der Luft und 15,8 Milliarden tkm durch Rohrleitungen). Bis 2030 werden die Transport- und Logistikanforderungen in einer Weise weiter rasant ansteigen, der der Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen nur mit größten Anstrengungen gerecht werden kann. Wie soll die sich – nach aktuellen Prognosen – anbahnende Verdoppelung des Lkw-Verkehrs und des Schienenverkehrs bewältigt werden, wo doch die Planungen und Projektierungen, die heute laufen und deren Realisierung bis 2030 dauern wird, bei weitem nicht ausreichen?
An dieser Stelle hilft auch keine Vision, dazu ist es angesichts der langen Umsetzungszeiten im Infrastrukturbereich zu spät. Hier werden Krisenmanagement und dramatische Innovationen bei den Verkehrsträgern erforderlich werden, wenn Deutschland nicht am Verkehr ersticken will.
Ressourcen
Visionen der Ressourcenvernichtung und des Klimawandels gibt es zuhauf, es sind mahnende Visionen, oft bis hin zu apokalyptischen Angstbildern der Zukunft. Temperaturanstieg infolge des weltweit durch immer weiter wachsenden CO2-Ausstoß entstandenen Treibhauseffekts, dadurch Zunahme von Extremwetter, Überschwemmungen und Artensterben werden zunehmend ernst genommen und stehen auf der Agenda internationaler Klimaschutz-Konferenzen. Man erinnert sich kaum noch an die Vision eines allgemeinen Waldsterbens durch sauren Regen, die bis 1990 en vogue war und dazu geführt hat, dass die Abgase von Automobilen und Verbrennungsanlagen durch katalytische Filter stickstoff- und schwefelfrei gemacht wurden. Auch bleifreies Benzin für alle Motoren war bis 1990 erst eine Vision. Die Visionen von damals und die damals ergriffenen Gegenmaßnahmen haben bewirkt, dass die damaligen Themen heute in den Hintergrund getreten sind. Die Bedrohung eines durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf der Erde um 2 °C erfordert ganz andere Gegenmaßnahmen, die die zuständigen Autoren dieses Buches in ihrer Vision 2030 charakterisieren. Besonders betroffen davon werden der Energiesektor und die Automobilindustrie sein.
So ist der Energiesektor in einem sich beschleunigenden Änderungsprozess begriffen.
Der Energieverbrauch in Deutschland wird sich bis 2030 nicht proportional zum Wirtschaftswachstum steigern, da die Energieeffizienz stark zunehmen wird.
Aber von 1990 bis 2008 hat schon eine deutliche Verschiebung der Energieträger stattgefunden, mit einem Rückgang der Kohle auf jetzt nur noch 43 % und der Kernkraft auf nur noch 22,6 % Anteil an der Summe aller Energieträger, während der Anteil von Gas auf 13 % gestiegen ist und Solarenergie heute 1 %, Biomasse 4,3 % und Windkraft 6,3 % ausmachen – die letzten drei waren 1990 noch vernachlässigbar.
So gibt es heute über 20.000 Windenergie-Mühlen (1990: 800) und Solarzellen-Anlagen, die 1.400 MW Spitzenleistung aufweisen (1990: 16 MW).
Da ist enorme Bewegung entstanden, und Visionen sind hier verständlicherweise besonders virulent. Aber sie sind auch besonders kontrovers, weil sie auf der einen Seite von dem Bestreben motiviert sind, so schnell wie möglich Umweltschäden und Gefahren durch Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu reduzieren, und auf der anderen Seite von dem Verantwortungsgefühl, eine verlässliche und ökonomische Energieversorgung zu gewährleisten. Beides „unter einen Hut zu bekommen“, wird eine ideologiefreie Analyse der treibenden Kräfte, der Beharrungskräfte und der noch zu überwindenden technischen Hindernisse erfordern.
Das globale Umfeld
Seit 1998 arbeiten Wissenschaftler im internationalen Millennium-Projekt2 daran, die großen weltweiten Zukunftsherausforderungen zu benennen und zu beschreiben. Das Millennium-Projekt ist ein weltweit organisierter Think Tank, dessen Ziel darin besteht, durch umfangreiche Befragung von Zukunftsforschern, Wissenschaftlern, Unternehmensplanern und politischen Entscheidungsträgern den Wandel der Welt zu verstehen und Wege zur nachhaltigen Gestaltung der Zukunft aufzuzeigen. Ein jährlicher Report liefert Informationen zu aktuellen globalen Fragen und Trends, die in mittel- bis langfristig vorausschauenden Szenarien aufbereitet werden.
Im letzten Report „State of the Future 2030“3 werden die wichtigsten Herausforderungen an die Menschheit aufgezeigt. An erster Stelle steht der Klimawandel mit seinen wachsenden Auswirkungen auf politische, wirtschaftliche und ökologische Migration. Weitere globale Herausforderungen sind die Energieversorgung, die zunehmende Urbanisierung, die effiziente Nutzung von Ressourcen und im Zuge der Entwicklung von Megastädten die Sauberkeit der Luft und die Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem Wasser.
Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern wird größer. Die Hälfte der Welt sieht sich der Gefahr gesellschaftlicher Unruhen und Ausschreitungen ausgesetzt. Dort herrschen weiterhin Bevölkerungswachstum und eine sich verschlechternde Pro-Kopf-Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Energie (so sind rund 3 Milliarden Menschen unzureichend mit Wasser versorgt).
Während Deutschland 1990 noch 1,5 % der Weltbevölkerung von 5,3 Milliarden Menschen stellte, ging der Anteil im Jahr 2010 auf 1,2 % von nunmehr weltweit 6,9 Milliarden Menschen zurück. Bis 2030 wird er auf 0,9 % der dann 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde schrumpfen. Das 57 %ige Wachstum der Weltbevölkerung von 1990 bis 2030 spielt sich fast ausschließlich außerhalb der traditionellen Industrieländer ab und führt zu einer radikalen Verlagerung der Märkte.
Schon heute ist die frühere „erste“ Welt eine überalterte Welt. Aber auch Chinas Bevölkerung altert als Folge der Ein-Kind-Politik vor fünfzig Jahren dramatisch, doppelt so schnell wie die der USA: 380 Millionen Chinesen sind über 65 Jahre alt.
In den armen Regionen nehmen Hunger und Krankheiten zu. Der daraus resultierende Migrationsdruck auf die reichen Länder führt zu umfassenden Kontroll- und Überwachungssystemen.
Der Bericht hebt auch die zunehmende Bedrohung durch transnationale organisierte Kriminalität hervor. Ihre weltweiten Einnahmen werden auf etwa 9 Billionen US-Dollar geschätzt, das ist doppelt so viel wie sämtliche Militärhaushalte der Welt zusammen. Außerdem kommt es zu einer zunehmenden Verflechtung von Terrorismus und organisierter Kriminalität.
Der globale Strukturwandel mit der Deindustrialisierung der alten Industrieländer und der Verlagerung des weltwirtschaftlichen Schwergewichts nach Asien wird sich weiter fortsetzen und gravierende Auswirkungen für Europa und die USA haben. China und Indien bestimmen immer stärker den Takt der globalisierten Märkte. Europa verliert trotz Steigerung der Investitionen in Bildung und Forschung an Gewicht, denn die USA und die BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien und China) investieren deutlich mehr in ihr Humankapital. Die indischen Informatiker und chinesischen Ingenieure sind nicht nur an Zahl überlegen, sondern können auch fachlich mit den europäischen Kollegen mithalten.
Während die globale Wirtschaftsdynamik in der Vergangenheit immer von drei geoökonomischen Zentren geprägt gewesen ist – dem „Europäischen Quadrat“ mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, dem „Amerikanischen Dreieck“ mit Kanada, Mexiko und den USA und dem „Asiatischen Quadrat“ mit China, Indien, Japan und Korea – und das Verhältnis der drei Zentren von 1970 bis etwa 2010 relativ stabil geblieben ist, wird es sich in den nächsten 20 Jahren dramatisch in Richtung des Asiatischen Quadrats verschieben. Nach Kaufkraft bewertet, hat sich das Bruttoinlandprodukt Europas, der USA und Japans dann von 59 % des Welt-Bruttoinlandprodukts von rund 25.000 Milliarden $ im Jahr 1990 auf heute 48 % des Welt-Bruttoinlandprodukts von nunmehr 73.000 Milliarden $ reduziert; es wird dann im Jahr 2030 aller Voraussicht nach nur noch ein Drittel des Welt-Bruttoinlandprodukts von dann über 150.000 Milliarden $ (heutige Währungsrelationen zu Grunde gelegt) darstellen. Das hat enorme Auswirkungen auf die Handelsströme.
Diese Umwälzungen, die zunehmend mit heftigen Krisen verbunden sind, werden im selben Tempo und mit denselben Turbulenzen weitergehen.
Deutschland ist immer enger mit Europa und mit der ganzen Welt vernetzt, davon abhängig und herausgefordert.
Um ihren Platz in diesem globalen Umfeld zu behaupten, muss die deutsche Wirtschaft auch in den nächsten 20 Jahren Waren, Ausrüstungen und immer stärker Dienstleistungen parat haben, die einen Kosten-Nutzen-Vorsprung bieten und mit denen ein hoher Anteil an den Importen der Wachstumsländer sowie an ihrer lokalen Produktion und Dienstleistungsnutzung gehalten werden kann.
So wird die weltweite Automobilproduktion, die von 53 Millionen Einheiten im Jahr 1990 auf 71 Millionen Einheiten im Jahr 2008 gewachsen ist, bis 2030 wahrscheinlich auf mindestens 150 Millionen Einheiten pro Jahr ansteigen, allerdings mit völlig anderen Modellen und Antriebstechniken als heute. Der Bestand an Automobilen (Pkw, Lkw) könnte von heute weltweit 950 Millionen auf über 2 Milliarden im Jahr 2030 anwachsen.
Der Absatz von PCs, Laptops und anderen Computertypen wird von heute weltweit 300 Millionen Geräten pro Jahr auf eher 600 Millionen Geräte in 2030 ansteigen, der von Mobiltelefongeräten und Organizern von heute 1,5 Milliarden Geräten pro Jahr auf eher 3,0 Milliarden Geräte in 2030. Wobei diese Zahlen nicht berücksichtigen, dass der technologische Wandel und die Netzentwicklung dazu führen werden, dass die heutigen Kategorien von Geräten und Nutzungsvorstellungen völlig über den Haufen geworfen werden dürften und sich eine ganz anders geartete IT- und Kommunikationswelt entwickeln wird. Die Zahl der Internet-Nutzer von heute etwa 1,4 Milliarden dürfte bis 2030 spielend die 3-Milliarden-Grenze überschritten haben.
Statistiken sind keine Visionen
Soweit die quantitativen Aspekte, anhand derer der Eindruck entsteht, dass der Sprung von 1990 bis 2010, den wir nahezu hinter uns gebracht haben, uns in die Lage versetzen sollte, auch für die vor uns liegenden 20 Jahre eine realitätsnahe Zukunftsvorstellung zu entwickeln. Zumal viele der quantitativen Veränderungen gar keine Spekulation mehr sind.
Zu einer Vision gehört aber mehr als ein quantitatives Gerüst. Schon dass die verschiedenen Elemente dieses Gerüsts, also beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung, die Entwicklung der Infrastrukturen und der darauf zu betreibenden Vehikel und Informations- und Kommunikationsvorgänge, zusammenpassen müssen, dass Finanzen und Technologien gravierende Engpässe zu werden drohen, stellt Anforderungen an die Visionsbildung.
Noch stärker sind die Anforderungen an die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte, die in wirklichen und umfassenden Visionen beinhaltet sein müssen, ganz abgesehen von den politischen Konstellationen und Veränderungen, die den Lauf der Dinge in den nächsten 20 Jahren in unvorhersehbarer Weise in Diskontinuitäten stürzen können.
So hatte der 11. September 2001 sicher eine viel größere Auswirkung auf die globale Entwicklung als viele der Innovationen, die vorher und hinterher hervorgebracht wurden. Der Fundamentalismus mit seinen terroristischen Auswüchsen, linke und rechte Ideologien, Internet-Kriminalität, Finanz- und Wirtschaftskrisen globalen Ausmaßes werden, dazu braucht man kein Prophet zu sein, auch die kommenden 20 Jahre überschatten.
Das aber, so meinen Verlag und Herausgeber, sollte uns nicht davon abhalten, die „Normal-Visionen“ für die deutsche Wirtschaft (d. h. ohne Weltkatastrophen) niederzuschreiben, um ihre Kompatibilität untereinander und mit unseren Wertvorstellungen überprüfen zu können.
Lassen Sie uns nun einsteigen in die Visionen. Wir beginnen mit den „klassischen Industrien“, gehen weiter zu den Zukunftsbranchen und den Consumerbranchen, betrachten dann Geldwirtschaft und Medien, lassen Experten für industrieübergreifende Themen und Rahmenbedingungen zu Wort kommen und vergessen auch nicht die Politik. Den Abschluss bildet die Sicht unserer Nachbarn Frankreich und England, die unsere besondere Situation in Deutschland logisch nachvollziehbar verdeutlicht.
1
Die in diesem Beitrag aufgeführten Zahlen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere aus Daten des Statistischen Bundesamts sowie aus Recherchen von Capgemini Consulting.
2
Das Millenium Project ist ein weltweiter Think Tank in Form einer Non-Government Organization (NGO), der sich der Erkundung globaler Zukünfte verschrieben hat. Durch die Befragung von Einzelpersonen und Umfragen in Konzernen, Universitäten, NGOs, Organisationen der Uno und Regierungen sollen der Wandel der Welt verstanden und Wege zur nachhaltigen Gestaltung der Zukunft aufgezeigt werden. Das Millenium Project veröffentlicht jedes Jahr den State of the Future Report, der Informationen über aktuelle globale Fragen und über gegenwärtige und zukünftige Trends liefert, die in normativen wie explorativen mittel- bis langfristigen Szenarien aufbereitet werden. Zu den Sponsoren gehören die Rockefeller Foundation, die Weltbank, zahlreiche Forschungsinstitute in der ganzen Welt, internationale Konzerne (z. B. Ford Motor Company, General Motors, Hughes Space and Communications, Monsanto Company, Motorola Corporation, Shell International), die UNESCO, die United Nations University (UNU), das Smithonian Institute u. a.
3
C. Glenn, T.J. Gordon, E. Florescu, 2009 State of the Future, ISBN: 978-0-9818941-2-6, 2009
Klassische Industrien
Gerald Gerlach
Miniaturisierung – kein Thema mehr
Fünf Jahre eher als prognostiziert war nun eingetreten, was Fachleute seit mehr als sechs Jahrzehnten diskutiert hatten:
Das Ende des Moore’schen Gesetzes
1965 hatte Gordon Moore, damals CEO des Halbleiterchipherstellers Intel, festgestellt, dass sich die Speicherdichte bei Halbleiterspeichern alle drei Jahre verdoppelt. Lange war gerätselt worden, welche physikalischen Grenzen dazu führen würden, diese Entwicklung zu stoppen. Man hatte vermutet, dass sich etwa 2030 die Strukturgrößen so verringert haben würden, dass die Einzelkomponenten integrierter Schaltungen (ICs) jeweils gerade noch aus einem einzelnen Atom bestünden. Doch nun hatte bereits fünf Jahre früher auch der zweite der beiden verbliebenen Speicherschaltkreishersteller erklärt, dass er die letzte Technologiegeneration nicht einführen würde, da die Investitionen für eine solche neue Chipfabrik nicht mehr finanzierbar seien. Die Entscheidung war nachvollziehbar, weil die Kosten das Bruttoinlandsprodukt Koreas deutlich überstiegen hätten. Außerdem hatte der Übergang von 300 mm großen Siliziumwafern auf 450 mm in den letzten Jahren zu einem ähnlichen Preisverfall im Speichermarkt geführt, wie er schon einmal vor 25 Jahren beim Übergang von 200 mm auf 300 mm große Wafer eingetreten war. Damals hatte der letzte Speicher-IC-Hersteller in Deutschland seine Produktion eingestellt.
Dezentrale Prozesse
In den 10 Jahren seit 2010, als klar geworden war, dass die Herstellung von Speicherschaltkreisen in Deutschland keine Chance mehr hatte, wurde die hiesige Halbleiterindustrie völlig umgebaut. Diese Neuausrichtung war durch zwei unabhängige Entwicklungen angestoßen worden. Zuerst hatte sich gezeigt, dass viele Prozesse am besten dezentral vor Ort zu regeln sind. Lichtschalter zum Beispiel sind seitdem mit Sensoren ausgestattet, die die Beleuchtung ungenutzter Raumbereiche vermeiden. Netzteile für elektronische Geräte besitzen intelligente Regler, die Wirkungsgrade von fast 100 % sichern.
Anfang der 2020er Jahre kam dann ein zweiter Effekt dazu. Aus Klimaschutzgründen wurden Serverfarmen ab einer bestimmten Größe verboten, nachdem der Energieanteil für ihre Kühlung die 50-%-Marke überstiegen hatte. Daten- und Informationsverarbeitung mussten daher immer stärker dezentralisiert werden. Weltweite Forschungsinitiativen führten zu völlig neuen Verfahren der Datenfusion und -kompaktierung mit flexibel anpassbaren Schaltkreisen für unzählige Anwendungen im privaten und im industriellen Bereich.
Mess- und Automatisierungstechnik boomen weiterhin
Diese Entwicklungen, auf die sich auch die deutsche Mikroelektronikindustrie einstellte, hatten einen überaus positiven Einfluss auf die Mess- und Automatisierungsindustrie in Deutschland. Schon früher war klar gewesen, dass die Leistungsfähigkeit der Gebrauchsgegenstände im täglichen Leben, genauso wie die industrieller Produktionsanlagen, nur durch den massiven Einsatz von Sensoren und Regelungs- und Automatisierungslösungen verbessert werden konnte. Es ist heute kaum noch vorstellbar, dass zu Beginn des Jahrtausends ein Automobil gerade einmal ein Dutzend Sensoren enthielt. 10 Jahre später waren es dann schon etwa 50, die für Motormanagement, Fahrstabilisierung und Komfortverbesserungen benötigt wurden. Fahrerassistenzsysteme, das Powermanagement bei Elektro- und Hybridfahrzeugen und erweiterte Sicherheitseinrichtungen haben die Zahl der Sensoren während der nächsten 10 Jahre auf nunmehr über 500 pro Fahrzeug ansteigen lassen. Die Sensoren sind Teil eingebetteter Systeme mit verteilten Regelungsfunktionen.
Die gleiche Entwicklung trat in vielen anderen Bereichen ein, zum Beispiel in der Fertigungsautomatisierung, in der Medizintechnik und in der Gebäudetechnik, wo Sensornetze dafür sorgen, dass alle Funktionen, von Heizung und Klimatisierung über Wasser- und Elektroinstallation bis hin zur Lichtdurchlässigkeit der Fensterscheiben, individuell für jeden Raum, teilweise sogar für separate Raumbereiche geregelt werden können, um die Energieeffizienz von Gebäuden weiter zu verbessern.
Ähnlich dem Moore’schen Gesetz erkannte man, dass die Zahl der weltweit hergestellten Sensoren alle zwei Jahre um den Faktor 3 steigt. Der Anteil der siliziumbasierten Sensoren am gesamten Sensormarkt hat sich dabei in den letzten 20 Jahren von ca. 30 % auf ca. 60 % verdoppelt. Längst spekulieren Fachleute, wie lange dieses „Moore’sche“ Gesetz der Sensorik gültig und durch welche Effekte es begrenzt sein wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Branchenverband für die deutsche Sensorindustrie erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass das jährliche Umsatzwachstum in diesem Bereich seit 1980 nun schon zum fünfzigsten Mal in Folge den 5-%-Wert überschritten hat und in diesem Zeitraum ein durchschnittliches Wachstum von fast 8 % pro Jahr zu verzeichnen war.
Denken in Systemen
Die Mess- und Automatisierungstechnik wird seit einigen Jahren als Flaggschiff der industriellen Produktion in Deutschland angesehen. Noch vor wenigen Jahren hatten Maschinenbau und Automobilindustrie diesen Ruf. Dies änderte sich aber schlagartig, als die Bundesregierung das Jahr 2023 zum „Jahr der Hidden Champions“ erklärte und ein umfangreiches Förderprogramm der für Deutschland bedeutsamsten „Hidden Technologies“ verabschiedete. Schlagartig wurde der Öffentlichkeit bewusst, dass elektrotechnische und elektronische Komponenten in Maschinen und Automobilen bereits mehr als die Hälfte des Wertes ausmachten und dieser Anteil nach wie vor stetig steigt. Dies bewirkt allerdings auch, dass die Komplexität der Systeme immer weiter zunimmt. Klein- und mittelständische Unternehmen mit ihrer Innovationskraft und Flexibilität haben sich dafür als hervorragend angepasst erwiesen, so dass sich ihr Anteil gegenüber den Großunternehmen im letzten Jahrzehnt erheblich erweitert hat. Ihre Systemkompetenz im Engineering verstärkt immer mehr ihre internationale Marktstellung im Bereich Systemlösungen, wie sie zum Beispiel gerade für Maschinen und den Automobilbau immer wichtiger werden, während die Fertigung von einfachen Systemkomponenten inzwischen nahezu vollständig aus Deutschland verschwunden ist.
Die neue Mikroelektronik
Viele Jahrzehnte lang hatte die Wissenschaft nach Alternativen geforscht, mit denen die Siliziummikroelektronik einmal abgelöst werden könnte. Nun war die Entwicklung entsprechend dem Moore’schen Gesetz zumindest hinsichtlich der Miniaturisierung zum Stehen gekommen, ohne dass eine der in den vergangenen Jahren angekündigten Technologien die in sie gesetzten Hoffnungen hatte erfüllen können. Die Forschung im Bereich der molekularen Elektronik war vor Kurzem ebenso eingestellt worden wie die für Quantenpunktbauelemente und die Spin-Elektronik. Letztendlich unterlagen alle neuen Technologien im Hinblick auf die Bauelemente-Miniaturisierung der gleichen Beschränkung der atomaren Auflösung. Dreidimensionale Selbstassemblierungstechniken, die wenigstens annähernd die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Komplexität von CMOS-Schaltkreisen erreichen, konnten bisher nicht zur Großserientauglichkeit gebracht werden. Nachdem sich dies seit geraumer Zeit mehr und mehr angedeutet hatte, gründeten einige findige Wissenschaftler aus diesen Forschungsbereichen Firmen aus, die mit dem Know-how der neuen Technologien nicht mehr den Ersatz der Silizium-Mikroelektronik anstrebten, sondern ganz auf neue Anwendungsgebiete setzten. Mehrere spektakuläre Entwicklungen haben sich inzwischen weltweit durchgesetzt. Eines der frühesten und bekanntesten Beispiele sind die organischen LED-, die OLED-Beleuchtungen. Heute kann sich keiner mehr vorstellen, dass noch vor wenigen Jahrzehnten Glühlampen den Hauptteil an Beleuchtungsquellen ausmachten. Die OLED-Technologie nutzt geschickt aus, dass Leuchtdioden nicht mehr auf platzbegrenzten Siliziumscheiben abgeschieden werden müssen, sondern sich auch auf großflächigen Substraten und Folien aufbringen lassen. Eingebettete Steuerungen erlauben seit einigen Jahren, Farbe und Helligkeit zu regeln. Leuchtfolien für die Heimbeleuchtung sind gegenwärtig einer der größten Umsatzrenner in den Baumärkten. Inzwischen ist die Technologie weiter entwickelt worden. Es gibt neuerdings Heiztapeten, bei denen großflächig infrarot strahlende Polymerschichten auf thermisch isolierende Kunststofffolien gedruckt werden. Förderprogramme setzen hier auf den Effekt, dass die Heizung von Räumen direkt den Anforderungen angepasst werden kann, so dass keine Zeitverzögerungen wie bei Fußbodenheizungen auftreten und sich auch die Energieeffizienz noch einmal um etwa ein Drittel steigern lässt.
Einen großen Hype hatte vor zwei Jahren die Einführung von i-Print (sprich „Ei-Print“) ausgelöst. i-Print ist ein tintenstrahlbasiertes Drucksystem, mit dem sich beliebige elektronische Schaltungen drucken lassen. Konnte man früher nur Apps als kleine Softwareprogramme im Apps-Store herunterladen, kann man nun auch seine Elektronikgeräte hardwaremäßig ständig verbessern und erweitern und somit technisch entsprechend seinen persönlichen Wünschen auf dem höchsten technischen Stand halten. In den zwei Jahren seit Einführung dieser Technologie sind allein in Deutschland bereits 100 Millionen Schaltungen für Geräteerweiterungen heruntergeladen und dann auf den Druckern der Kunden und Anwender ausgedruckt worden.
Gerätebedienung „seniorenleicht“
Vor Kurzem ist eingetreten, was in der Gesellschaft bereits seit mehreren Jahrzehnten diskutiert worden war: Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung hat die 50-%-Marke überschritten. Bedingt durch diese Entwicklung ist die Zahl der Unfälle in privaten Haushalten durch Fehlbedienung elektronischer Haushaltssysteme (durch deren Komplexität spricht niemand mehr von Haushaltsgeräten) drastisch gestiegen. Die Bundesregierung hat unter dem Druck von Bürgerinitiativen und Seniorenverbänden ein umfangreiches Förderprogramm für neue Methoden und Technologien der Bedienung elektronischer und elektrischer Geräte aufgelegt. Unter dem Namen „Mensch-Maschine-Kommunikation“ hatte es früher schon wiederholt Initiativen in dieser Richtung gegeben. Der Bewusstseinswandel bei Bevölkerung und bei den Herstellern zeigt sich beispielsweise darin, dass innerhalb der letzten Jahre der Begriff „kinderleicht“ fast völlig aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist und stattdessen von „seniorenleichter Bedienung“ gesprochen wird. Tastaturen sind inzwischen verpönt, Touchpads selten geworden. Bei „Palmpads“ werden gedankengesteuerte Befehle über Funktechnologien in Handpotenzialänderungen umgewandelt und so auf die Geräte übertragen. Auch im Displaybereich haben sich große Änderungen ergeben. Das verbreitetste Betriebssystem verzichtet bei der Programmoberfläche immer mehr auf überladene Grafiken und Animationen. Wegen seiner Einfachheit und Klarheit im Bauhaus-Stil wird es seit Neuestem unter dem Namen „Bauhaus-Windows“ vertrieben. Aktuelle Systemvergleiche zeigen, dass sich mit diesem Betriebssystem etwa 50 % % der Rechenleistung einsparen lassen.
Der Mensch als elektrisches System
Der Beginn des 21. Jahrhunderts war durch einen immensen Fortschritt in der Entwicklung der Biotechnologie und der Zellbiologie charakterisiert. Es war gelungen, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Die Biophysik hatte geholfen, die physikalisch-chemischen Prozesse, die in den Zellen ablaufen, zu verstehen und zu beeinflussen. Immer stärker wurde klar, dass sich viele Vorgänge durch Ionenströme und elektrische Potentiale beeinflussen lassen. Viele daraus resultierende Erkenntnisse sind inzwischen in neue Therapiemethoden eingeflossen, die dann in den letzten zehn Jahren zu einem weiteren imposanten Wachstum der Biomedizintechnik geführt haben. Zum Beispiel gibt es nun elektronische Pflaster zur Wundheilung oder Geräte zum schnellen Verheilen von Knochenbrüchen. Völlig neue Anwendungen und Therapien stehen kurz vor der Einführung. Damit verzeichnet die Biomedizintechnik bereits den zweiten Boom in den vergangenen beiden Jahrzehnten, nachdem in den Jahren 2010 bis 2020 durch das Ambient-assisted Living (AAL) schon einmal ein dramatisches Umsatzwachstum stattgefunden hatte. Damals war klar geworden, dass Assistenzsysteme älteren Menschen erlauben, ihr Leben im eigenen Heim aktiv und selbstbewusst zu gestalten. Ausschlaggebend für den Erfolg war letztendlich aber die Tatsache, dass dank gesetzlicher Regelungen solche Assistenzsysteme durch die Kranken- und Pflegekassen unterstützt wurden und sich so eine große Nachfrage nach AAL-Systemen ergab.
Was bringt die Zukunft?
Auch wenn in den ersten drei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts viele neue technische Entwicklungen die Elektrotechnik zu einem der wichtigsten Industriezweige der deutschen Wirtschaft gemacht haben, wird weiter intensiv an der Lösung von Problemen gearbeitet, die der Elektrotechnik eine neue, noch höhere wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung zu eröffnen versprechen:
•
an Systemen der elektrischen Energiespeicherung mit hoher Speicherkapazität,
•
an autarken elektronischen Systemen, die ihre Energie vollständig aus der Umgebung entnehmen können und damit keine eigene Energiequelle brauchen,
•
an Systemen zur sicheren Übertragung von Daten, die nur der adressierte Empfänger decodieren kann,
•
an neuen Rechnerarchitekturen und Softwarelösungen, die trotz Erreichen der Miniaturisierungsgrenzen in der Mikroelektronik zu höheren Rechnerleistungen führen,
•
an flächenhaften Elektromotoren mit geringer Bautiefe und großer Leistung für neue gerätetechnische und mechatronische Anwendungen.
Der Fachkräftemangel bei Ingenieuren und Technikern der Elektrotechnik in Deutschland steht baldigen Lösungen allerdings ziemlich gravierend im Wege.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!