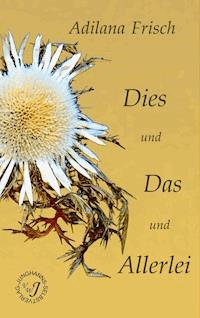
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält wahre Geschichten, welche zum Teil von der Autorin selbst erlebt oder welche ihr von Seiten Dritter zur Veröffentlichung überlassen wurden. Einige Gedichte am Schluss runden das Ganze ab. Die eine oder andere Geschichte wurde aus persönlichen Gründen mit einer "dichterischen Freiheit" abgeändert. Viele Dinge, die im Leben passieren, tragen zu übermäßiger Freude, zu Ernüchterung oder zu tiefer Traurigkeit bei. Es passiert dies, das oder allerlei anderes. So ist das Leben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten aus dem Leben
Einen besonderen Dank an alle, die mir ihre Geschichten für mein Buch überlassen haben.
Lieber Leser: Suchen Sie nicht nach Fehlern,
Inhaltsverzeichnis
De Binska Mare
Akkordeon
Geisterstunde
Geschwister
Diskriminierung
Kreuz am Himmel
Nächtlicher Besucher
Enttäuschtes Vertrauen
Ein Tag voller Angst
Schwangerschaft
Eine Geschichte zum Schmunzeln
Mein Hund Foxi
Die Überraschung
Ferien auf dem Bauernhof
Urlaub mit Freunden
Unser Malteser Hund Liberty
2. Hundeattacke
Liberty und Lady
Die Pipischale
Kontrolle vor dem Check-in
Der Piepton
Der tägliche Security-Check
Die „so da“-Schleuse
Überflüssig
Flughafen-Milieu
Falsche Menschenkenntnis
Allerlei Erwähnenswertes
Handsondenklaps
Ansteckungsgefahr
Durchhalten
Kleinflieger-Terminal
Praktikum
So ist das Leben
D´ Vawandschaft
Die Zeit mit uns
Die Suche
Die Silberdistel
De Binska Mare
Man schrieb das Jahr 1950 und es war Sommer. Lisa, die sechs Geschwister und ihre Eltern, wohnten in einem Auffanglager in der Nähe von Ganacker bei Landau an der Isar. In diesem Lager hatten viele Unterschlupf gefunden, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Für die Kinder war es ein wunderbarer Ort. Ein riesengroßer Sportplatz, umringt von vielen Bäumen, eine Schule, ein Kindergarten, eine Kirche, ein Lebensmittelgeschäft und jede Menge Freunde, die alle zu Fuß erreichbar waren. Für die Kinder tat man dort sehr viel. Jeder passte auf sie auf, auch wenn sie einem nicht gehörten. Die Zusammengehörigkeit zeigte sich von Anfang an. Trotzdem gab es den einen oder anderen, dem es nicht gefiel, so eng aufeinander leben zu müssen. Viele waren es gewohnt, für sich zu sein. Das blieb auch so. Jeder in diesem Ort, nahm auf diese Personen Rücksicht. Auch den Eltern von Lisa gefiel es nicht so gut. Viele hatten ihre Heimat verlassen müssen. Nur das Nötigste durften sie damals bei der Vertreibung mitnehmen. Sie mussten zurücklassen, was ihnen einmal lieb und teuer war. Lisas Eltern hatten ja in ihrer Heimat in der ehemaligen Tschechei ein kleines Sägewerk. Den Betrieb sollten einmal die beiden Brüder von Lisa weiterführen, wenn sich ihr Vater einmal zur Ruhe setzen wollte. Andere im Ort hatten einen Bauernhof und wieder andere ein Lebensmittelgeschäft. Die Eltern von Lisas Freundin hatten eine gutgehende Schneiderei. Ja, so mancher war richtig unglücklich. Geld hatten diese Leute auch nicht mehr. Vom Staat bekam zwar jeder Vertriebene eine kleine Unterstützung, aber das reichte nur für das Nötigste. So manch eine Familie musste den Gürtel schon enger schnallen. Dieses Auffanglager, wie die einheimischen Leute es nannten, war ein Militärstützpunkt gewesen. Man konnte noch Überreste einer zerbombten Offizierskantine erkennen. Ein zerstörter Militärflieger und sogar scharfe Bomben in der Größe eines liegenden Kindes im Alter von 6 bis 10 Jahren lagen achtlos herum. Zwei abgestürzte Hubschrauber waren für die Kinder ein toller Spielplatz. Nach und nach wurden diese Überreste des Krieges abgeholt, um Schaden an den dort lebenden Menschen zu vermeiden. So mancher war sichtlich erleichtert. Die Kinder aber nicht, die wollten solche Dinge gern als ihren persönlichen Abenteuerspielplatz behalten. Man lernte sich kennen, achten und verstehen. Einige hatten in diesem Ort die Liebe fürs Leben gefunden, andere fanden bald eine bessere Unterkunft und zogen wieder weg. Manch einer verließ den Ort, weil er eine neue Arbeit gefunden hatte. Ja, es war ein Kommen und Gehen. Auch der Vater von Lisa und zwei ihrer Brüder fanden Arbeit in Landshut, Landau und in Dingolfing. Die große Schwester von Lisa bekam eine Lehrstelle in einer Konditorei, denn sie backte mit Leidenschaft Kuchen, Torten und Plätzchen. Das Verzieren der Köstlichkeiten war ihr schon in die Wiege gelegt, denn ihre Oma hatte auch eine Bäckerei und Konditorei. Lisa war 6 Jahre alt, ihre beiden Schwestern 3 und 5. Kurz vor Weihnachten bekam ihr Vater von seinem neuen Chef einen Fernseher geschenkt. Die ganze Familie war in höchster Aufregung. Sogar alle Nachbarn freuten sich sehr darüber. Das hatte auch seinen Grund, wie sich bald herausstellen sollte. Jeder wollte in den Genuss kommen, auch einen Film anschauen zu dürfen. Nachdem ja keiner der Nachbarn einen eigenen Fernseher hatte, ließ die Familie von Lisa es gerne zu. Eine Frau aus der unmittelbaren Nachbarschaft kam zweimal in der Woche, um den einen oder anderen Film zu sehen. Diese Frau hieß Maria Binsker. Bei den Lagerbewohnern nannte man sie liebevoll „de Binska Mare“. Maria war sehr dick und konnte oft das Wasser nicht mehr halten. Es lief einfach auf den Boden. So beschloss Lisas Mama, einfach Zeitungen auf Marias Platz auszulegen. Maria benötigte wegen ihrer Leibesfülle auch 2 Stühle. Für Lisas Mutter war das immer ein großer Aufwand, da ja jeder mal einen Film sehen wollte. Allabendlich machte sie aus der Wohnküche eine Art Kino, nur mit dem Unterschied, dass sie kein Geld dafür bekam. Alles aus reiner Nachbarschaftsliebe, wie es die Mutter von Lisa immer nannte. Ihr Vater machte aus zwei Stühlen eine Art Bank, indem er ein Brett darauf legte. Also ein Stuhl, das Brett, ein Stuhl und schon hatten mehr Leute Platz. Einige brachten sogar eigene Stühle mit. Am Ende des Filmes wurde gemeinsam aufgeräumt und irgendjemand wischte sogar den Fußboden. Die Kinder durften am Abend nicht Fernsehen.
Eines Tages brachte ein Bruder von Lisa, der ja nur manchmal zu Besuch kam, eine tolle Sache mit nach Hause. Eine Farbplatte für den Fernseher. Diese wurde einfach innen vor den Bildschirm geschoben und alles erschien in Farbe. Das war eine Freude. Darüber freute sich jeder Besucher.
Der Winter verging, genauso der Frühling. Eines Tages gab es im Ort eine große Aufregung. Es hieß: „De Binska Mare is gstorm“ (die Binsker Maria ist gestorben). Jeder vom Ort, ob Kind oder Erwachsener, traf sich auf der Straße vor Marias Wohnung. Es war mucksmäuschenstill. Alle waren in sich gekehrt. Jeder wusste, dass sie nicht mehr ganz gesund war, aber dass es so schnell vorbei sein würde, das dachte keiner.
Maria war beliebt, bei Jung und Alt. Ganz besonders wegen ihrer Art sich zu kleiden. Sie kam aus Polen, war aber deutschstämmig. Maria war ungefähr 55 Jahre alt. Wegen ihres starken Körperumfanges und ihrer Krankheit wirkte sie älter. Sie half gerne bei den Bauern am Feld mit, wenn diese Heu einfuhren. Wenn sie auf den Heuwagen rauf wollte, um mit der Heugabel das Heu zu verteilen, hatte sie allein so ihre Probleme, da raufzukommen. Die Anwesenden jungen Burschen halfen ihr ganz gern auf den Wagen. Maria trug immer mehrere lange Röcke übereinander. Ihre Unterhose war knielang und im Schritt war ein Schlitz. Beim Wasserlassen war das für sie immer ganz praktisch. So konnte sie im Stehen ihr Wasser lassen. Dabei hielt sie mit beiden Händen ihre vielen Röcke einfach nach vorne von sich weg. Die jungen Burschen machten sich immer einen Spaß daraus, Maria auf den Wagen zu hieven. Sie wusste ganz genau, warum und ließ ihnen die Freude daran. Wenn Maria des Öfteren schrill und laut loslachte, wusste jeder, dass sie wieder Einblick in ihre Unterhose zuließ. Ihr war dies egal, Hauptsache die Kerle halfen ihr auf den Wagen und auch wieder herunter. Ja, das war Maria.
So standen sie alle, den Kopf nach unten geneigt vor Marias Hauseingang. Jeder ließ seinen Gedanken freien Lauf. Alle waren voller Trauer. Irgendwann vernahmen sie ein klapperndes Geräusch und ein kurzes Wiehern. Worauf alle in die Richtung, wovon die Geräusche zu vernehmen waren, sahen. Man erkannte einen Leiterwagen, der von vier weißen Pferden gezogen wurde. Ein Mann in schwarzer Bekleidung und einem schwarzen Hut lenkte dieses Gespann und kam immer näher heran. Auf dem Wagen stand ein hellbrauner Sarg. Wie selbstverständlich, sprangen ein paar der umstehenden Männer auf den Leiterwagen, um den Sarg herunterzuheben. Da war sich keiner zu schade, jeder half mit. Sie trugen den Sarg in die Wohnung von Maria. Ein Arzt und eine Leichenbestatterin aus dem benachbartem Dorf verschwanden ebenfalls in der Wohnung der Verstorbenen. Die vier Männer, die den Sarg zur Maria brachten, standen längst wieder bei den Anderen. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Lenker des Pferdegespannes herauskam, um wieder nach freiwilligen Helfern zu suchen. Vier der umstehenden jungen, kräftigen Männer gingen mit. Nach einer Weile kamen sie heraus und verstauten den schweren Sarg auf dem Wagen. Als der letzte Mann vom Wagen heruntersprang, machte eines der Pferde einen kleinen Ruck nach vorn. Plötzlich sprang der Deckel des Sarges auf. Alle Umstehenden, Kinder und Erwachsene ließen vor Schreck einen lauten Schrei los. Der Mann in Schwarz sprang auf den Wagen, um nachzusehen, warum dies passieren konnte. Er fragte ein wenig mit erhobener Stimme, ob jemand eine lange Stricknadel besorgen könnte. Eine Frau lief los und kam gleich darauf auch schon wieder. Sie übergab die Stricknadel dem Mann auf dem Wagen. Dieser bedankte sich und ging zu dem Sarg, in dem Maria lag. Er stach ein paar Mal mit der Nadel in Marias Körper. Einige hielten sich mit der Hand den Mund zu, um ja nicht laut loszuschreien. Aus Marias Körper kam ein Zischen. Es hörte sich an, als ob ein Fahrradschlauch geplatzt sei. Danach stank es so fürchterlich, dass so manchem richtig übel wurde. Die Kinder wichen vor Schreck und Ekel mehrere Schritte zurück. Die Anderen blieben wie angewurzelt stehen oder wie vor Schreck erstarrt. Der Kutscher versuchte erneut den Deckel zu schließen. Beim zweiten Versuch legte er sich mit dem Bauch voran auf den Sargdeckel und verriegelte ihn an mehreren Stellen. Lisa stand mit geschlossenen Augen da. Sie öffnete sie erst, als der Pferdekutscher sie fragte: „Magst du das weiße Kreuz bis zum Ende des Ortes tragen?“ Nachdem sowieso alle den Trauerzug ein Stück begleiten wollten, war Lisas Mutter einverstanden. Mit beiden Händen hielt nun Lisa das Kreuz dicht vor ihrem Gesicht und war dabei stolz und andächtig zugleich. So ging sie dicht neben dem Pferdegespann und ihre Mutter war immer neben ihr. Am Ende des Ortes angekommen, blieb der Trauerzug stehen und der Kutscher kam zu Lisa. Er bedankte sich bei ihr und nahm ihr das kleine, weiße Kreuz wieder ab und verstaute es auf dem Wagen. Einige standen noch lange am Weg und sahen dem Gespann hinterher, bis es ihnen an einer Wegbiegung aus den Augen verloren ging.
Maria erwähnte des Öfteren, wenn sie einmal gestorben sei, sollte ein weißes Pferdegespann ihren Sarg zur letzten Ruhestätte bringen. Außerdem solle ein Kind mit einem weißen Kreuz neben ihr gehen.
Marias Wunsch wurde erfüllt.
Akkordeon
Man schrieb das Jahr 1955. Das Aussiedlerlager bei Ganacker, im Landkreis Landau an der Isar, war ein Ort, an dem Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden oder die selbst ausgewandert sind, einen Unterschlupf fanden, bis diese sich etwas Besseres gefunden hatten. So mancher verbrachte dort mehrere Jahre. Dieser kleine Ort hatte schon seinen besonderen Reiz. Er war von so vielen Laubbäumen umgeben, dass wohl heute jeder Städter von so einem Idyll träumen würde. Für so manch einen war dies eine neue Heimat geworden. Viele hatten dort das Licht der Welt erblickt. Deshalb waren auch einige sehr traurig, als dieser Ort nach fünfzehn Jahren aufgelöst wurde. Es war aber auch nicht alles immer eitler Sonnenschein. Der eine oder andere hatte auch seinen letzten Atemzug dort getan oder seinem Leben freiwillig ein Ende gesetzt. Aus Verzweiflung, Einsamkeit und Trauer hatte sich einmal ein Mann über seinem Bett aufgehängt, weil seine Frau an einer schweren Krankheit verstorben war. Eine junge alleinstehende Frau wurde von der Männerwelt belagert, ob jung, ob alt, ledig oder verheiratet. Jeder wollte mit dieser Frau Streicheleinheiten austauschen. Als sie dann schwanger wurde, hatte sie aber plötzlich keinen der Männer, der ihr zur Seite stand. Mit ihren knapp 25 Jahren war sie Freiwild, und das nicht nur von diesem Ort. Aus den umliegenden Ortschaften schlich so mancher bei ihr rein und wieder raus. Wie die Schmalzfliegen (Schmeißfliegen) waren sie alle hinter ihr her. Jeder machte ihr vor, dass er, ja genau er, der Richtige sei. Weil diese junge Frau einsam und allein war, fiel sie immer wieder auf solche Hallodris herein. Ja, das merkten die Männer bald und deuteten die Signale der Frau falsch, so mancher wohl sogar zu seinen Gunsten. Als dann eines Tages die Polizei vor Ort war und ein kleines neugeborenes Baby aus der Jauchegrube fischte, taten alle so, als ob keiner etwas wüsste. Als man dann auf die junge Frau zu sprechen kam, wollte sie keiner, ich betone ausdrücklich, keiner richtig gekannt haben. Lügner und Pharisäer. Die junge Frau war und blieb verschwunden, niemand hatte je wieder von ihr etwas gehört. Gesehen wurde sie auch nicht mehr!
Diebstahl, Rauferei und Schlägerei war genauso vertreten, wie andern Orts auch. Die Leute waren jedoch aufeinander angewiesen und so wurde meist das eine oder andere Problem schnell wieder unter sich aus der Welt geschaffen. In diesem Ort gab es sogar eine kleine Kirche, eine Schule, eine Sporthalle, ein kleines Geschäft, ja sogar ein großer Sportplatz war vorhanden. In dieser kleinen Gemeinschaft lebte einst ein junges Mädchen mit dem schönen Namen Julia. Sie war etwa neun Jahre alt. Als sie zwei Jahre alt war, kam sie mit ihren Eltern und Geschwistern in diesen Ort und ging auch dort zur Schule. Sie spielte in einer Theatergruppe mit und war sehr begeistert von Sport und besonders von Hula-Hoop-Ringe kreisen. Fünf oder sechs Ringe konnte sie ohne Mühe vom Hals hinunter bis zu den Beinen, dann wieder rauf zur Taille schwingen, um sie dann über die ausgestreckten Arme hoch über den Kopf hinaus wieder zurück zur Taille zu drehen. Mit diesem Spiel konnte sie schon so einige begeistern. Das Radschlagen auf einer Wiese war für sie eine schnelle Fortbewegungsart. Ja, sie konnte schneller Radschlagen, als so mancher laufen konnte, aber wenn einmal ein Akkordeonspieler in diesen Ort kam, da konnte sie stundenlang still stehen und zuhören. Die Begeisterung an diesen Klängen war auch Julias Eltern nicht verborgen geblieben. Eines Tages bekam sie von ihrem Vater ein nagelneues Akkordeon geschenkt. Allerdings machte er ihr zur Auflage, sie müsse dafür Unterricht nehmen. Der Vater sagte ihr auch, sollte sie nicht teilnehmen, würde er ihr das Instrument wieder wegnehmen. Solange bis er einen geeigneten Lehrer gefunden habe, dürfte sie sich mit dem Schifferklavier, so nannte es Julias Vater, vertraut machen. Ja, sie war begeistert. Sie hatte dem Musikanten schon so oft auf die Finger gesehen. Julia war überzeugt, das könne sie auch. Sie sang und spielte alle Kinderlieder, die sie kannte, immer und immer wieder. Eines Tages spielte sie sogar einen ihrer Lieblingsschlager „Ramona“. Ihr Vater war ebenfalls begeistert und bat Julia immer öfter, sie möge ihm doch etwas vorspielen. Wenn Besuch im Hause war, durfte sie immer ihr Bestes geben.
Es war ein schöner warmer Sommertag. Julia saß vor dem Haus und sang und spielte. Ihr Vater ließ sie fertig spielen, dann sagte er: „Julia, ich habe in Haidlfing, etwa sechs Kilometer entfernt, einen Polizeibeamten im Ruhestand kennengelernt. Der wird dich in Musik und Noten lesen unterrichten.“ Julia war nicht sonderlich begeistert. Da musste sie hin, ob sie wollte oder nicht. Sonst würde ihr Vater von der Drohung Gebrauch machen und ihr das Akkordeon wieder abnehmen. Ihre Eltern luden den Mann zu sich nach Hause ein. Als Julia ihn kennenlernte, fand sie diesen Mann sehr nett. Der Vater und der Polizist wurden sich rasch über den Preis einig, den er für den Unterricht bekommen sollte. Man hatte sich sogar schon zwei Nachmittage ausgesucht, an denen Julia mit dem Fahrrad in den Nachbarort fahren sollte. Ihre anfängliche Begeisterung hielt sich in Grenzen. Sie hatte so ein eigenartiges Gefühl bei der ganzen Sache, aber ihr Vater hatte es so bestimmt. Also musste sie es auch befolgen. Zwei Tage später, es war ein Mittwoch, sollte Julia um fünfzehn Uhr bei ihrem ersten Unterricht erscheinen. Sie schnallte sich ihr Akkordeon auf den Rücken und fuhr mit dem Rad in den nächsten Ort. Sie wusste genau, wo sie hinfahren sollte, man hatte es ihr ausführlich erklärt. Kurz vor der abgemachten Zeit war sie beim Haus des ehemaligen Polizisten. Dieser stand schon an der Eingangstür und begrüßte sie barsch mit den Worten: „Da bist du ja endlich!“ Er ließ Julia durch die offene Tür gehen und machte diese hinter sich wieder zu. Das Mädchen wäre am liebsten gleich wieder umgekehrt, aber es war schon zu spät. Der Mann zeigte ihr den Weg ins Wohnzimmer. Sie hatte keine Möglichkeit davonzulaufen, denn er versperrte ihr den Rückweg. Im Wohnzimmer angekommen, reichte er ihr ein Glas mit grüner Limonade, die er schon auf dem Tisch stehen hatte. Er fragte: „Du hast sicher Durst?“ Julia nahm es dankend an und trank einen großen Schluck davon, stellte das Glas ab und nahm ihr Schifferklavier vom Rücken herunter. Als sie es aus der Hülle nehmen wollte, sagte der Mann: „Das hat noch Zeit.“ Er setzte sich in einen großen Sessel und wollte, dass sie sich auf seinen Schoß setzte. Er wolle mit ihr alles genau besprechen. Julia blieb jedoch stehen, wo sie war. Sie mochte sich auf keinen Fall auf seinen Schoß setzen. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, um den Mann zu fragen, wo denn seine Frau und seine Kinder seien. Der Mann antwortete, dass seine Frau schon vor zwei Jahren gestorben wäre und er keine Kinder hätte. Julia fühlte sich hier nicht wohl. Der Mann stand auf, kam auf Julia zu, nahm sie bei der Hand, führte sie mit Zwang zum Sessel, setzte sich wieder und zog sie zu sich auf den Schoß. Mit beiden Händen um ihren Bauch klammernd, saß er einige Zeit so da. Er sprach kein Wort. Als die Kleine aufstehen wollte, hielt er sie noch fester. Erst dann sagte er: „Du brauchst doch vor mir keine Angst haben. Jetzt lernen wir uns erst einmal ein bisschen kennen, dann zeige ich dir, wie du Noten lesen kannst.“ Mit den Worten: „Ich muss mal schauen, was du da unten hast“, versuchte er unter das Kleid des Mädchens zu fassen. Julia wehrte sich. Da wurde der Mann energischer. „Komm, stell dich nicht so an! Du bist doch schon ein so großes Mädchen“, sagte er. Julia hatte genug. Sie wartete auf einen Moment der Unachtsamkeit seinerseits, sprang auf, schnappte sich schnell ihr Akkordeon und sauste den Weg zurück, woher sie gekommen war. Der Mann war zu träge, um ihr schnell folgen zu können. Draußen vor der Tür schnallte sie sich das Musikgerät rasch wieder auf den Rücken, schnappte sich ihr Fahrrad, schwang sich darauf und trat in die Pedale, so fest sie nur konnte. Der Pensionär hatte nun ebenfalls schon die Tür erreicht, folgte dem Kind, doch er bekam es nicht mehr zu fassen. Der Mann blieb am Gartentor stehen und schrie dem Mädchen hinterher: „Bleib hier, du Rotzgöre!“, aber Julia tat ihm nicht den Gefallen. Als ob der Teufel hinter ihr her sei, so radelte und radelte sie. Der Ort, in dem sie gerade war, lag längst hinter ihr. Nun traute sich Julia vorsichtig umzuschauen. Erleichtert stellte sie fest, dass niemand hinter ihr war. Sie kannte diese Gegend genau. Da gab es Gräben, in die man von der Straße aus nicht einsehen konnte. Genau so einen suchte sich Julia. Sie schob ihr Rad in einen solchen Graben, nahm ihr Akkordeon und spielte. Sie verdrängte das Geschehene für eine Weile.
Von weitem hörte sie die Kirchenglocke aus ihrem Ort fünfmal schlagen. Es wurde Zeit nach Hause zu radeln. Der Gedanke an den nächsten Termin verursachte ihr Übelkeit. Julia traute sich nicht ihren Eltern von all dem etwas zu erzählen. Was würden sie sagen? Die Angst in ihr wurde immer stärker, um so mehr sie sich dem Zuhause näherte. Sie hatte heute nichts gelernt. Auch würde sie in Zukunft nichts lernen. Plötzlich machte sich in ihr ein Gedanke breit. Ich brauche keine Noten zum Spielen. Ich spiele einfach so wie bisher nach meinem Gehör. Durch diesen Gedanken beflügelt, kam sie gutgelaunt zuhause an. Julia war froh darüber, dass sie keiner so richtig lange aushorchte. An diesem Abend ging sie sogar freiwillig früher zu Bett als sonst. Dadurch wollte sie vermeiden, dass nicht doch noch jemand auf die Idee kam, sie über ihren ersten Musikunterricht auszufragen. Julia war froh darüber, dass sie Schulferien hatte. Da konnte sie spielen, so lange sie wollte. Manchmal ermahnte ihre Mutter sie, nicht immer Musik zu spielen. Die Mutter meinte, sie solle auch mal wieder etwas mit ihren Freundinnen zusammen machen. Später erfuhr Julia, dass sich schon die eine oder andere Freundin bei ihrer Mutter beschwerte, weil sie nur die Musik im Kopf hatte. Jedes Mal, wenn Julia einen Termin beim pensionierten Polizisten hatte, nahm sie ihr Akkordeon auf den Rücken und radelte los. Doch sie kam nie dort an. An ihrem Geheimplatz angekommen, übte sie so lange, bis es Zeit wurde, wieder nach Hause zu fahren. Wenn es nach ihr ginge, hätte sie dieses Versteckspiel noch lange ausgehalten, doch eines Tages sah ihr Vater den Pensionär, der sich beeilte, in einem großen Abstand zu ihrem Haus, mit seinem Fahrrad den Ort zu verlassen. Julia stand neben ihrem Vater. Sie hörte, wie er dem Mann zurief: „Wie macht sich meine Julia?“ Der Mann auf dem Rad drehte sich nicht einmal um. Er rief nur zurück: „Die Göre kommt ja nimmer!“ Da war es heraus. Vor diesem Moment hatte Julia Angst. Das Mädchen wollte sich gerade davonschleichen, da hielt sie der Vater fest. Ohne ein Wort zu sagen oder irgendetwas zu fragen, ging er mit Julia an der Hand in die Küche, denn dort stand das Akkordeon. Er nahm es und sagte nur: „Dann brauchst du es ja nicht mehr.“ Für Julia brach eine Welt zusammen, als sie sah, wie ihr Vater das Gerät auf den Schrank im elterlichen Schlafzimmer stellte. Als er zurückkam, meinte er nur noch: „Das Schifferklavier gehört ab jetzt deinem Bruder Josef.“ Dieser konnte auch darauf spielen. Von diesem Tag an hatte Julia aufgehört zu Spielen, und wenn irgendjemand in der Familie sie bat, sie solle doch etwas auf dem Akkordeon vorspielen, weigerte sie sich.
Sie spielte nie wieder irgendein Instrument.
Geisterstunde
Wir hatten wieder einmal Besuch von der Verwandtschaft. So blieb es nicht aus, dass wir Kinder Platz zum Schlafen machen mussten. Da mein großer Bruder ein Schreinergeselle war, konnte er für die Familie einen großen Esszimmertisch anfertigen. Genau dieser Tisch war immer eine Ausweichliegestätte für uns Kinder, wenn wir Besuch bekamen. Nein! Nicht auf dem Tisch, sondern im Tisch. Meine Eltern kippten einfach den Tisch um und legten ihn verkehrt herum hin. Eine von meiner Mutter extra dafür angefertigte Matratze wurde in den Tischrahmen gelegt. An Kissen und Decken mangelte es uns auch nicht. Fertig war ein großes Bett für zwei meiner kleineren Geschwister. Zusätzlich warf meine Mutter eine Decke über die hochstehenden Tischbeine und machte aus dem „Tischbett“ eine Art Zelt. In diesem Zelt wollte und durfte auch jeder einmal schlafen. Ich selber durfte diesmal im Bett meiner Eltern übernachten. Am Fußende des Bettes stand ein kleiner Diwan. Auf diesem schlief mein um ein Jahr älterer Bruder. Es war genau richtig für seine damalige Größe. Ich war sechs Jahre alt und freute mich immer, wenn ich mal wieder bei meinen Eltern schlafen durfte.
Mitten in der Nacht. Alle schliefen schon, als es plötzlich einen Knall gab. Es hörte sich an, als ob jemand eine Schublade mit Schwung zuknallen ließ oder eine entfernte Tür zuknallte. Wir vier, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich, saßen wie auf Kommando aufrecht im Bett. Vor Angst traute ich mich nicht zu atmen. Meine Eltern verließen das Bett, um nach der Ursache zu sehen. Ich klammerte mich ans Nachthemd meiner Mutter und ließ mich auch nicht davon abbringen mitzugehen. Ich wollte auf keinen Fall allein im Bett zurückbleiben. Mein Vater, mit einer Taschenlampe voran, wir hinterher. Nur ja nicht die Mädels im Tischzelt aufwecken, dachte ich, aber die schliefen wie die Murmeltiere. Sie hatten von all dem bis jetzt nichts mitbekommen, obwohl sie in dem Raum schliefen, von dem das Geräusch zu hören war. Mein Vater bemerkte als Erster, woher dieser Knall kam. Ohne ein Wort zu sagen, leuchtete er mit der Lampe auf unser Medizinschränkchen an der Wand, um meine Mutter darauf aufmerksam zu machen. Diese sah jedoch gerade nach den schlafenden Kindern. Ich hielt mich immer noch an ihrem Nachthemd fest und wich nicht von ihrer Seite. Meine Mutter näherte sich dann wieder meinem Vater. Ich immer hinterher. Der Störenfried wurde gefunden. Das Türchen vom Medizinschränkchen stand offen. Meine Mutter meinte später, sie dachte zuerst, dass die Kleinen sich einen Scherz erlaubt hätten, aber es stand kein Stuhl davor und ohne Kletterhilfe kamen diese nicht an das Schränkchen. Unvermittelt knallte das Türchen vom Medizinschränkchen auf einmal zu, um gleich darauf mit Schwung wieder aufzuspringen. Weil es so schön war, das Gleiche noch einmal.





























