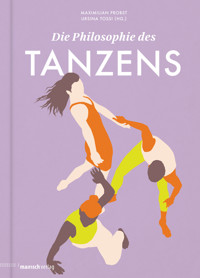12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie die Hoffnung bewahren, wenn die Welt vor die Hunde geht? Auf einer stillgelegten alten Saline lebt Zeno mit seiner Mutter Leda. Hier in den Salzmarschen gelten eigene Gesetze, ab und an steigt der Fluss ins Haus, die Vögel werden immer weniger. Als Leda dem Jungen nicht länger beim Verlieren seiner Welt zusehen kann, verschwindet sie. Doch Zeno hält sich noch an die kleinsten Wunder. Über die verschlungenen Wege einer App lernt er Katt kennen, die auf der Flucht vor dem Ende einer Liebe ist – und das Zusehen aushält. Und bald zieht es auch andere, dem Großstadtleben am Rande der Apokalypse müde Menschen in die karge, schöne Marschlandschaft. Ein schillernder Roman über die Sehnsucht nach Natur, lebensrettende Wahlverwandtschaften und die Hoffnung, die in den Gezeiten liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Leona Stahlmann
Diese ganzen belanglosen Wunder
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dies ist ein versehentlicher Hoffnungsroman.
Für Niklas, mein hoffnungsvolles Versehen
End of August. Heat like a tent over John’s garden. And some things have the nerve to be getting started, clusters of tomatoes, stands of late lilies
(…)
but why start anything so close to the end?
Louise Glück: Vespers (End of August)
Aber Kinder (…) kennen keine Unmöglichkeit.
Franz Kafka: Briefe an Milena
Teil ISalz und Satelliten
EpilogWer den Jupiter aufhängen will, braucht Zahnseide
Die Nacht in den Marschen gehört den Astronomen und den Neunaugen. Genau genommen gibt es unter den geteerten buckligen Dächern am Fluss nur einen einzigen Astronom. Noch weiß er nicht, dass er ein Astronom ist, nur das erklärt sein Versäumnis: Es ist nicht einmal Mitternacht, der Himmel ist klar. Der Astronom schläft. Er hat die Decke fest um sich gewickelt, er schläft mit dem Rücken zur Tür, Hals und Schultern liegen frei, nackt; er hat sie noch, diese eine pochende warme Kerbe unterhalb des Haaransatzes. Sein ganzer unentschiedener Fall läuft auf diese kleine Mulde zu, daumennagelgroß nur, noch ist es nicht vom Haar überwachsen: das ganze leicht vermeidbare Wunder, am Leben zu sein. Der Astronom schläft tief.
Alles, was fest war zwischen den Häusern am Fluss und dem Sund, an dessen Höhlung der Strom in das Meer auswäscht, ist mit der Luft verschmolzen; in dieser Stunde steigt der Fluss über seine Rinne ins Haus, alles beginnt zu wogen, zu fließen, die Luftblasen über dem Bett des Astronomen, die langen strähnigen Kopffedern der Seidenhühner im Salzlager, Ledas Kugelschreiber auf dem Papier, die Tinte aus dem Stift zieht mit blauen Fahnen durch die Küche wie Rauch. Vielleicht ist das der Grund, warum noch kein Wort auf dem Papier gelandet ist, das vor ihr liegt. Vor dem Haus liegt der Fluss, den sie Blanke Elle nennen, grün und glasig vor Kälte. Die Neunaugen schlafen. Am Flussboden knoten sie sich zu dunklen Nestern zusammen, die Schwanzflossen fächeln träge in der Strömung. Der Fluss hält still, bis die Neunaugen wach sind. Der Fluss hält still, bis der Astronom kommt. Noch schlafen sie alle.
Ein feiner, heller Plüsch wie Frost überzieht die schwarze Teerfarbe auf den Blechdächern der drei Gebäude, die sich an die Biegung des Flusses schmiegen. Es sind zwei niedrige, langgestreckte und ein größeres, darauf ein Turm aus buckeligem Feldstein gemauert, ein Windrad daran, grünspanig und verbogen, man muss es nicht hören, um zu wissen, dass es knarrt, man muss es nicht von Nahem sehen, um zu wissen, dass das, was es einmal in Bewegung gesetzt hat, schon lange stillsteht. Der helle Flor bedeckt auch die weißen Zelte am Flussufer. Die Zeltleinen sehen aus wie gefroren über Nacht und am Tag nicht aufgetaut. Sie schwingen starr im Wind. Auf den Leinen mag einmal Wäsche getrocknet, mögen Badesachen getropft haben, jetzt hängt da nichts, nicht einmal vergessene Klammern. Die Zelte stehen in einem Kreis, die Eingänge zeigen in die Kreismitte. In der Mitte ist nichts. Keine Feuerstelle, nichts, auf dem man sitzen könnte. Das Gras wächst dort hoch, schon lange hat niemand mehr dort gestanden. Auch die Zelteingänge sind eingewachsen im Gras, die Heringe und Bodenschnüre zwischen grünen Büschelinseln versunken. Bei genauem Hinsehen ist der weiße Überzug überall, die Zeltplanen sind gespickt damit, ein splittriger Pelz auf dem Stoff und im Gras, das um die Zelte herum sich wiegt, die Unterseiten der Gräser sind blind von diesem Weiß, das man mit einem feuchten Finger wegwischen kann, es brennt in feinen Schnitten an den Händen, in angekauten Nagelrändern: Salz.
Ein einzelner Trampelpfad führt vom Haupthaus durch die Marschen und zum Fluss. Kleine Füße haben ihn getreten, es scheinen zwei Paare zu sein, doch dem einen Paar fehlt etwas Entscheidendes. Gewicht. Die Füße drücken die Halme nur leicht ein, fast nicht sichtbar. Sie haben keine menschliche Form.
Die Wände des Hauses sind kalt, die Kälte zieht vom Fluss hoch und drückt sich durch die dünnen Teerpappen, Ledas Hände auf dem Papier sind kalt, wenn sie sie müde hebt und in ihren Nacken legt, drücken sie sich gegen den Hals mit der Kälte einer Schere, eines Messers. Nur der Körper des Astronomen ist warm. Sein Haar, lang und voller Knoten, fällt ihm bis zur aufgedeckten Brust. Die Strähnen sind von einem beschlagenen Rotbraun, ein Fuchs, der sich im Staub gewälzt hat. Ein schmutziges Aufglimmen, wie ein Grinsen mit einem Mund voll Karies.
Der Astronom kann Walnüsse pflücken und in Säcken auf dem Rücken zum Trockenboden tragen, er kann sie mit dem Messer knacken und mit warmen kräftigen Kinderfäusten aufdrücken, er kann ein krankes Seidenhuhn mit einem Besenstiel auf den Kopf schlagen, der leichte Schädel unter dem Gefieder ist klein und rund wie die Walnüsse, zerbrechlich wie chinesisches Teegeschirr, der Schädel knackt wie eine Walnussschale, das Blut läuft aus dem geraden Schlitz am Hühnerhals in den Eimer zwischen Zenos Knien, im Schuppen ist es dunkel, er muss nichts sehen, er spürt genau, wann das Herz des Huhns stillhält und wie es aussieht, wie ein großer schwarzglasierter Backenzahn mit einer Krone aus festem weißem Fett, er fühlt, wann, ein paar Minuten später, die elektrischen Ströme im Hirn des Huhns in den Eimer getropft sind, Zenos Hände sind gepunktet mit Hühnerblut wie flüssige Sommersprossen. Er kann Ledas alten Computer immer wieder zum Laufen bringen, der aus den Lüftungsschlitzen nach verkohltem Toast und Hundefell riecht. Er kann mit nassem Schwemmholz den Ofen anzünden, er kann dünnwandige Organe aus den Bäuchen der Bitterlinge schlitzen mit demselben Messer, mit dem er die Nüsse knackt, Herzen und Magenschläuche, zart und blasig. Er kann Fische ausnehmen, Anwendungen auf sein Gerät herunterladen, schwarzfahren. Er hat gelernt, die Därme der Flussmuscheln und Napfschnecken mit dem Mund auszusaugen und den graubraunen Inhalt in die Spüle zu spucken, Ledas Pornographieblocker zu umgehen, er muss bei beidem nicht mehr würgen, er weiß, dass er bei den Därmen nicht schlucken darf und nur durch die Nase atmen und dass in den verwackelten Filmchen aus der Amateur-Kategorie meistens Fernseher im Hintergrund laufen, bei den Quizshows rät er mit, Was kommt in der Marsatmosphäre gar nicht vor: Stickstoff Sauerstoff Schwefel. Wodurch unterscheidet sich das Hotel im Themenpark von Nagasaki von den meisten anderen: Alle Angestellten sind Katzen Alle Katzen sind Gäste Alle Katzen sind Roboter Auf dem Menü steht ausschließlich Katzenfleisch. Zeno kennt die Antwort (Katzenroboter), ein Versandhaus für Fußheizkissen hat neulich Werbeanzeigen geschaltet und einen Aufenthalt verlost bei allen Bestellungen über fünfzig Euro, Flüge inklusive und ein T-Shirt obendrauf: Ich habe in der Nähe einer bekannten historischen Kernwaffenabwurfstelle eine Roboterkatze gestreichelt und alles, was ich bekommen habe, ist dieses T-Shirt. In dem Filmchen war nicht viel zu sehen, nur ein Mann in rotweiß gestreiften Badeshorts, gestreift wie Zenos Zahnpasta, und ein blasser runder Hintern, der auf seinen Badeshorts vor dem Fernsehbildschirm auf- und abhüpft. Zeno hat das T-Shirt bestellt.
*
Leda dreht den Stift zwischen den Fingern. Ein Zauberspruch, denkt sie, eine Faustformel. Eine bruchsichere Kiste, in die alles hineinpasst, veränderlich und beständig, ein Oxymoron zum Mitnehmen an einer Taschenuhrkette. Das wäre ein Trost. Sie klemmt den Stift zwischen Daumen und Mittelfinger und setzt den Stift fest aufs Papier. Ordentlich gesetzte Punkte untereinander. Komm schon. Das ist einfach. Sie setzt fünf Punkte. Eine Liste. Dann beginnt sie zu schreiben. Es ist ganz einfach, Leda, es gibt eine Reihenfolge, an die man sich halten kann. Eine Reihenfolge ist ein Trost. Erstens, schreibt sie. Zweitens. Drittens. Viertens. Sie knackt mit den kalten Fingerknöcheln. Ihre Finger sind zu steif zum Schreiben. Sie braucht eine Pause. Sie hat sich eine Pause verdient.
*
Es hat ein Summen in der Luft gelegen an diesem Abend, wie wenn man ein Weinglas zum Singen bringt, dünn und dringlich. Die Seidenhühner hatten sich flach in sandige Mulden auf dem Boden um das Lager gedrückt. Leda wies Zeno an, sie einzusperren. Er scheuchte die Vögel vor sich her in den Schuppen, verriegelte das Gatter, löschte das Licht. Im Dunkeln wurden die Hühner ruhig. Vereinzeltes Scharren noch, dann Stille. Als hätte Zeno mit dem Licht auch den Ton ausgeknipst. Zeno drückte seine Hände von innen gegen die Fensterscheibe, Leda verdunkelte das Haus, sie warteten auf das Geräusch, das dem Summen folgen würde.
Wenig später schlug etwas von außen gegen das Glas. Einmal. Zweimal. Es trommelte, hart wie Fingerknöchel, Hagel, Kies.
Die schweren Köpfe der Pferdebremsen schlugen an die Fensterscheiben mit einem zischenden Geräusch, als würden ihre heißen, wütenden Körper das kühle Glas verdunsten lassen.
Leda öffnete das Fenster.
Unten am Fluss sahen sie die schlanken Stämme der Eschen am Ufer zimtrot aufleuchten. Die Pferdebremsen auf der Fensterbank lagen mit den Bäuchen nach oben. Ihre bohnengroßen Körper schwarz, sie rochen nach verbranntem Brot. Feuer. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein brennen sie hier und da außerhalb der Städte, entzünden sich an einem Funken der Oberleitungen, der vergessenen Glut eines Lagerfeuers, einer Brechung des Lichts durch einen Tropfen Wasser auf einem Blatt, es gibt eine Feuervorhersage am Morgen, wie es die Wettervorhersage in den Zwanziguhrnachrichten gibt, der Gong ist ein wenig tiefer, das Lächeln der Moderatorin ist freundlich, weiß und gerade, sie trägt die Vorhersage sorgfältig vor, in immer genau derselben Geschwindigkeit, Leda stellt sich vor, dass sie nicht schneller oder langsamer sprechen kann, niemals, auch wenn das Feuer des Tages in ihrem Studio lodert, an ihren Moderationskärtchen frisst. Der Gedanke hat etwas Beruhigendes.
Zeno sah ein letztes Mal nach den Hühnern. Sie saßen in ihren Kästen mit Sägespänen, gluckerten leise. Ein weich in der Dunkelheit aufplatzendes Blubbern, wie kochender Grießbrei, der Blasen warf. Bald darauf sagte er ihr Gute Nacht und ging schlafen.
Jetzt sitzt sie allein auf der Fensterbank. Der Geruch von stehendem Rauch zwischen den Ästen der Bäume, auf den Wiesen, um das Haus. Dazwischen spult sich vom Fluss, in Windrichtung der Stadt, etwas Süßes. Hefe. Rosinen. Zucker. In der Stadt an der Blanken Elle gibt es keine Läden mehr, in denen man etwas kaufen kann wie ein Hemd, einen Fahrradschlauch, ein Stück Seife. Aber es gibt Bäckereien, Dutzende. Jede Woche eröffnet irgendwo eine neue. Sie atmen Tag und Nacht den Geruch warmer Butter über das Land, die Luft ist schwer von Teig und Zucker, die Menschen öffnen ihre Fenster weit, Hefeknoten mit Kardamom, Hefezöpfe mit Apfel, Hefeschnecken mit Marzipan und Pistazie, Männer und Frauen mit weißen Leinenkitteln und mehligen roten glücklichen Gesichtern ziehen sie mit hölzernen Handwagen durch die Straßen, tragen den Geruch in braunen Packpapiertüten von Haus zu Haus, reichen die Tüten durch die Fenster in die Wohnungen, die Menschen schließen den Feuern die Fenster bei Nacht und öffnen der Hefe die Fenster am Morgen, der Boden der Papiertüten ist übersät mit diesen tröstlichen buttrigen Fettflecken, auf die sie alle so wild sind, das Gebäck wärmt ihnen die Hände. Das ist sie, denkt Leda und atmet tief ein, die Faustformel. Die Welt wird schlechter und das Gebäck wird besser.
*
Das Kind kann Fahrrad fahren, es kann zählen. Das Kind weiß, dass die Kindheit ein enges, schmales Gefäß ist, in das man von oben hineingestopft wird, es weiß, dass man das Gefäß nur verlassen kann, indem man es zerschlägt, und dass das, zerschlag mal etwas von innen, nicht so einfach ist. Er weiß, dass er ein Zylinder aus Wasser ist und dass das Wetter aus Wasser besteht, er weiß, dass das Wetter zwischen ihm und sich selbst keinen Unterschied macht, er weiß, dass uns allen das Wasser bis zum Hals steht und dass sein Haus, sein schartiges krummes Haus, genau an der Biegung eines großen Flusses steht, dessen Wetter die Strömung ist, ein wütender Wind, der innen weht, die Erlen am Ufer entwurzeln kann und das Haus mitnehmen, ein Haus hat nicht einmal Wurzeln, es steht nur herum wie ein großes, umständliches Möbel. Leda schlägt die ausgekühlten Hände aneinander, ein Geräusch so trocken wie Knochen, sie setzt sich an den Küchentisch und greift nach dem Kugelschreiber. Die Regeln sind uns ausgegangen, schreibt Leda, Den einen Zauberspruch gibt es nicht mehr. Das ist Dein Trost, Zeno: Wir können uns alles selbst ausdenken.
Zeno kann im Stehen pinkeln, ohne dass etwas danebengeht, Zeno gelingt der erste Pfannkuchen. Zeno kann ein fliehendes Seidenhuhn fangen, das ist ungefähr so, als würde man eine Wolke fangen, so schwer kann man es greifen, Zeno kann das in unter drei Minuten.
Zeno kann nicht schwimmen.
*
Die Hände des Astronomen flattern auf der Decke. Kleine weiße Segel, sie ragen aus dem Strom seines Schlafes, knattern im Sturm des Traums, blähen sich dann ein letztes Mal, drehen zum Ufer. Die Hände liegen ruhig. Zeno wacht auf, vor dem Fenster ein seltsam körniges Licht, wie aufgeschüttelter Staub, der sich wieder gesetzt hat, das Nachgefühl einer Störung. Am Fußende des Bettes liegt etwas. Er richtet sich auf, tastet danach. Ein Stück Papier und etwas Rundes. Auf dem Zettel Ledas flüchtige, verschmierte Kugelschreiberschrift.
Drei Beispiele.
Zum Beispiel.
Wenn du durcheinanderkommst
Erst passiert lange nichts. So lange, dass du das Ende beinahe vergessen hättest, du übersiehst es wie die dicken Winterspinnen über deinem Bett, die im März fast nichts mehr wiegen und um deretwegen du im Herbst noch in mein Bett gekrochen bist, wenn ein Ende lang genug dauert, einen Winter und länger, fängst du an, es zu übersehen. Und auch wenn es losgeht, kann es noch dauern. Das Ende löscht die Lichter nacheinander; hier eins, dort eins.
Aber es gibt immer eine Reihenfolge. Die Welt ist so voll von Reihenfolgen, dass die, die übrig bleiben, sich auf Buchstaben setzen und zu Gedichten werden. Früher oder später wirst du müde werden und durcheinanderkommen; ein Gedicht ist die einzige Reihenfolge, die zählt.
Zum Beispiel.
Wohin es geht
Nach oben. Es geht immer nach oben. Wenn du lang genug geradeaus läufst, landest du am Ausgangspunkt. Rechts und links sind das Geradeaus für Idioten, die noch an Charakter glauben. Nach unten ist es mühsam. Von unten kommt das Wasser. Und darum ist oben die Richtung, in die du gucken solltest.
Zum Beispiel.
Woran du dich festhältst
Die Schildlaus ist ein winziger talentloser Parasit. Sie hat weder Hände noch Gehirn. Auf dem Gipfel des Mount Everest gibt es nichts. Flechten, eine Handvoll Pilze. Und Schildläuse. Die Schildlaus kann nicht laufen. Aber sie kann sich festhalten. Auf unsichtbaren Fäden aus Sekretseide sitzt sie, dünner als Glasfaser. Sie hält sich fest und der Wind trägt die Fäden Hunderte Kilometer weit über das Land, sie hält sich fest und überquert die Alpen, landet auf einer vertrockneten Topfpflanze auf einer Fensterbank des Burj Khalifa, 900 Meter über den Straßen von Dubai. Du brauchst nicht viel, das meiste ist Zinnober. Aber wenn du nur einen Rat von dreien befolgst: Nimm Zahnseide mit.
Und wenn du vielleicht auf einen weiteren hören willst, da ist der Beweis: Guck nach oben. Jupiter, Uranus, Neptun und Saturn. Siehst du die weißen Ringe? Wer den Jupiter aufhängen will, braucht Zahnseide: 500 Meter, reißfest.
Zeno lässt den Brief sinken und inspiziert den runden Gegenstand auf der Bettdecke. Eine weiße Scheibe, ein handlicher Mond aus Plastik: eine Packung reißfeste Zahnseide, ungewachst.
P.S.: Finger weg von der gleitfähigen (mit Wachs). Du wirst noch verstehen, warum.
1Morgengötter
Es ist ein Tag ohne Sonne. Die Flussnebel lichten sich nicht. Sie simmern durch die Marschen, lagern sich um die Zeltbahnen, umwolken das Salz, das Flut und Wind in die Wiesen tragen und über die Zelte am Ufer ziehen, Salz und Wasser kriechen tief in jede Faser und machen das Leinen mürbe. Die Nebel wandern bis zur Klippe und zum Sund und knüllen sich über die Öffnung des Sunds hinaus aufs offene Meer wie Watte aus einer aufgerissenen Puppe. Die Nebel flechten sich um das ganze Land herum, das sie Öde Speiche nennen und das sich wie ein dürrer Armknochen an die Blanke Elle schmiegt, sie flechten sich durch die Föhren und Schwarzerlen und Walnussbaumzweige und windgetrockneten Faulfrüchte an den Maulbeerbäumen, sie füllen sich in die leeren Becken der Salzgärten, sie sammeln sich um die Saline, das Haupthaus, das Salzlager, in dem kein Salz mehr lagert, in dem jetzt die Seidenhühner die Köpfe unter die nachtklammen Federn stecken und in ihren Gehegen auf Zeno warten. Der letzte Bus fährt auf der Landstraße vorbei, Zeno weiß ohne hinzusehen, dass er leer ist, meistens hält der Busfahrer nicht einmal hier an, Zeno hört die Räder auf dem Kies am Parkplatz knirschen, wenden, dann fährt der Bus zurück in die Stadt. Die Scheiben im Passagierraum sind dunkel. Zeno stellt sich vor, dass sie die Nacht zwischen Stadt und Marschland auf sich abbilden wie die Mehrfachbelichtung auf einer der angelaufenen Fotografien, die Leda in weichen feuchten Stapeln auf Flohmärkten kauft und in Keksdosen sammelt, jeder Zentimeter Nacht zwischen hier und dem Buslager wird darin gespeichert, früh am Morgen nimmt das Putzpersonal die großen schwarzen belichteten Negative aus den Fenstern und ersetzt sie durch neue, danach kommen sie in ein Archiv mit busfenstergroßen Mappen in Aktenschränken, die jemand beschriftet, Zeno stellt sich vor, dass er das irgendwann sein könnte: der, der die Nächte in den Busfenstern archiviert, das wäre etwas für ihn, er hat eine schöne ordentliche Handschrift, ein bisschen fällt sie nach links, aber er bleibt immer auf der Heftlinie, er muss nur herausfinden, wo man sich bewirbt.
Es gibt eine Busstation für Ausflügler hier, die dreimal am Tag befahren wird, vielleicht nur, weil sie vergessen haben, dass es die Station gibt, und weil es nicht einmal lohnen würde, sie abzuschaffen. Manchmal sieht man einen Ort zum ersten Mal und weiß, dass man dort hingehört. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht irgendwann. Bei Leda muss alles sofort sein, sofort oder gar nicht. Sie hatte die Saline an der Bahnstrecke zum Sund entdeckt, Zeno ein Pantoffeltier unter ihrer Bauchdecke, bald eine wuselnde, nie schlafende Teilung von Zellen, dunkle Mauern, die sich durch die spätwinterlichen Zweige der Walnüsse, Erlen, Maulbeeren entlang der Gleise hindurchdrückten. Sie lief den Weg vom Sund zu Fuß zurück zu den Mauern, die sie hinter den Bäumen gesehen hatte, da standen drei Gebäude, zwei kleine und ein größeres, die Fenstergläser eingeschlagen, die Hölzer der Rahmen und Türen verzogen und morsch, die Blechdächer pockennarbig von Dellen und Beulen, aber Leda sah etwas anderes.
Jeder Quadratzentimeter Erde ist überzogen mit einer Flechte aus Erinnerung und Geschichten, sie bedeckt die Steine und die Menschen, und beide stehen immer dichter, mit jedem Jahr gibt es mehr Steine und mehr Menschen, rücken Steine und Menschen enger zusammen, um denen, die nachkommen, Platz zu machen, den wenigen Platz, wo vorher nichts gewesen ist: Nichts, das gab es einmal, das war der hauptsächliche Anteil an der Welt. Weil das Nichts ja nichts war und also nichts bedeutete, musste man sich um das Nichts nicht kümmern. Seine Existenz oder besser: Nichtexistenz war nicht wichtig. Das Nichts war nicht und musste also nicht erhalten werden. Um nichts musste man sich nicht kümmern. Das, was war und dazukam, war es, was Scherereien machte. Bis das Nichts fast ganz von den Böden verschwunden war, und mit dem Verschwinden der Lücken zwischen etwas, in denen das Nichts friedlich gesessen hatte, die Scherereien erst richtig zu wuchern begannen, schwarzes Unkraut, das sich von dem ernährte, was nun statt dem Nichts auf und in den Böden zu finden war: Enge und Abfall und Erinnerung.
Das Marschland, das Leda sah, hatte seine Erinnerung und seine Geschichten, ganz sicher, aber sie waren vergessen worden, überstrichen mit der schwarzen Teerfarbe, die sich von den Außenwänden der Häuser schälte wie verbrannte Haut und weiße empfindliche Stellen im Gemäuer zurückließ, in die das Salz und die Feuchtigkeit einzogen. Es gab keine Chronik der Marschen. Es war niemand geblieben, um sie zu bewahren. Was Leda sah, war ein unbesetztes Land, das man einnehmen konnte, und eine neue Chronik der Ereignisse, die sie erfinden würde, wie sie ihr passte. Was Leda sah, war nichts, und viel davon: so viel davon, dass man es mit beiden Händen greifen konnte. Nie hatte das Nichts mehr nach etwas ausgesehen. Es versprach Leda nicht weniger als: alles.
Als Leda im geländestaubigen Linienbus zurück in die Stadt saß, lag ihr ein Geruch in der Nase.
Er war wässrig und sauer, er hatte einen Stich von hartem Leder, das im Keller schimmelte, und er brannte kalt an ihrer Nasenscheidewand. Das feste Fleisch der noch grünen Maulbeeren. Die faltigen Schalen der alten Walnüsse, die sich unter den Bäumen zu Erde zersetzen. Der scharfe grüne Geruch der jungen Birken am Fluss. Die Salzschneide des Stroms, die sich in die Schleimhäute drückt wie in die Mauern.
*
Das Gerät in Ledas Jackentasche wurde von kleinen nervösen Stößen gerüttelt und leuchtete auf. Es hatte eine Nacht gegeben, sie saßen auf seinem Bett, hörten Riders on the Storm und kauten pfeffrige Rollen aus Betelblättern, darin ein Mehl aus grauem Kalk und eine Nuss, die roch wie Muskat und Leda sehr wach machte, sie kauten die Rollen, bis Leda sein und ihr waches Blut zusammen mit dem Grollen des Donners in Songsekunde Einundzwanzig auf der Aufnahme in ihren Haarspitzen zucken spürte, und danach hatte Leda nicht zurückgerufen, nicht nach dem zweiten Strich auf dem Teststäbchen, dann schon gar nicht. Leda sah den Mann vor sich, sein Gerät am Ohr in seiner Einraumwohnung in der Stadt, sein Körper zu massig für diese Wohnung, seine Unruhe zu groß, um zwischen Wände zu passen, Männer, dachte Leda, sie waren hilflos wie Könige, die Welt war in einem Ausweichmanöver um ihre Schwänze herum gebaut, aber sie konnten nicht allein sein, allein verhungerten sie, erfroren sie in ihren Betten, Leda stellte sich vor, wie er ihren Bauch mit dieser ratlosen Bewunderung von der Seite ansehen würde, sie erinnerte sich an das Gefühl, unter ihm zu sein, nicht ganz damit einverstanden zu sein, was gleich passierte, und dass sie sich gewünscht hatte, dabei aber doch wenigstens gut auszusehen, sie hätte leicht Nein sagen können, aber dazu war sie nicht überzeugt genug gewesen, es nicht zu wollen, sie griff in ihre Tasche und schaltete das Gerät aus.
*
Wie selten ist es die Erscheinung der Dinge und wie oft der Geruch, der entscheidet, wo wir uns zu Hause fühlen?
Während die Dunkelheit kam und der Linienbus durch die blassblauen Leuchtflure der Natriumdampflampen in den Industrieparks rollte, auf die Städte zu unter ihrer unruhigen Kuppel aus warmen und kalten Lichtern, schwamm etwas durch Ledas Arterien, mit lautlosen Schlägen einer unsichtbaren, wendigen Flosse. Das Salz des Flusslands zog ihre Arterien hoch wie ein Fisch in einem Strom. Es zog Richtung Herz.
*
Miete zahlen sie nicht, es hat sie noch nie jemand danach gefragt. Manchmal kommt Post vom Finanzamt und erinnert Leda an ihre Steuer. Leda antwortet jedes Mal mit dem gleichen Brief, Zeno unterschreibt für sie, er beherrscht ihre Unterschrift flüssiger als sie selbst, er wird jedes Jahr besser, Leda bemerkt das nicht ohne Stolz.
Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich mir der Königin ihr Kind.
Wenn sie gute Laune hat, malt sie sich die Lippen rot an und setzt einen Kussmund darunter.
*
Zeno führt samstags und sonntags, dann ist Hochbetrieb in der Saline, die Tagesgäste aus den Städten herum, zeigt ihnen den Ausstellungsraum, die gerahmten Schwarzweißfotografien an den Wänden, Arbeiter mit Kopftüchern und großen Rechen vor den Salinenbecken, eine eisweiße Kruste aus Salzblüten schwimmt darauf, Zeno weiß, dass das Salz nie wirklich weiß ist, wenn man es in der Hand hält, es ist immer dann am weißesten, wenn man es von weit weg sieht, zwischen den Fingern trübt es ein, bekommt die Farbe von gemahlener Eierschale, man kann dieses Weiß nicht berühren, man kriegt es nicht zu fassen, es ist immer da, wo man gerade nicht ist, Zeno hat oft versucht, seine eigenen Finger zu überholen, aber die Feuchtigkeit seiner Haut ist schneller, zieht in das Salz und macht es grau, sooft Zeno es versucht hat, manchmal versucht er es immer noch, das behält er für sich. Irgendwann kriegt er dieses Weiß. Irgendwann schleicht er sich an und hat es in der Hand. Zeno kann sich stundenlang, tagelang mit so etwas beschäftigen. Einem Körnchen Salz. Einer dieser Ideen, die Leda spinnert nennt. Zeno zuckt nur mit den Schultern. Als würde die Größe der Entdeckung das Wunder machen. Leda lacht laut über diesen Satz. Und da hab ich jahrelang versucht, mein Kind vor Küchenwandkalendern zu beschützen. Alles umsonst.
Zeno erklärt, wie der Fluss noch vor ein paar Jahrzehnten durch das Gewirr der Zuflussrinnen die Salinenbecken geflutet hat, die jetzt brach liegen, wie das Wasser an den warmen Tagen verdampfte und das Salz darin heranreifte und die Arbeiter die weißen Körner im Salzgarten mit Schaufeln an langen Holzstielen ernteten, wie sie jeden Tag die Salzblüte von den Becken schürften, die im Wasser an die Oberfläche stieg und darauf schwamm wie der Rahm auf der Milch. Er hat die Gäste vom Salz probieren lassen, das Leda und er im Internet bestellen und in alte Marmeladengläser füllen, sie bestellen es für wenig Geld bei einem Großhändler und verkaufen es den Gästen für das Zehnfache.
*
Der Nebel sickert in den Schippen zu den Hühnern und macht ihr Gefieder schwer, sie sitzen trübe auf den Stangen und regen sich nicht, bevor Zeno nicht den Türriegel aufschiebt, harte schwarze Augen und graue gebogene Schnäbel und glänzende Federn, eine einzelne Feder ist hart und robust, im Gefieder der Seidenhühner schmelzen sie zu wattigen warmen Haufen, perlgrau, rot, braun, silberweiß. Panzer aus Seide, fest um die Brustmuskeln gespannt. Einmal war ein Marder in den Schuppen gekommen, Zeno fand das Loch in der Teerpappe am nächsten Morgen, er hatte sich durchgefressen, durch dicke Placken Teerfarbe und Blech, Zähne und Hunger in der spitzen Schnauze. Die Hühner haben ihn totgepickt.
Heute sind es dreißig Tage, Zeno kann nicht schwimmen, aber er kann zählen. Dreißig Tage, seit Leda fort ist, dreimal fahren seine Augen die hochgestreckten Finger seiner Hände ab, von links nach rechts und wieder zurück, siebenundzwanzigachtundzwanzigneunund –
Schhhhhh!
Stint steht in den mit eingeschlagenen Treibhölzern umhegten Beeten vor dem Haupthaus und hackt. Zeno rennt auf das kleine Seidenhuhn zu, es ist dünn, eine Handvoll Huhn nur, seine Beine sind knotig und kahl, er wedelt mit den Händen, faucht wie eine nasse Katze, Schhhhhh! Scher dich weg, weg da!
Leda nennt die spärlich bewachsenen Beete ihren Gemüsegarten, aber eigentlich wächst dort kaum etwas, das man essen könnte; sie haben vieles versucht, sogar Blumen, es ist schwierig für die Pflanzen auf diesem Land: das nie aussetzende Schleifen des Windes vom Sund, die Hochwasser vom Fluss, die Sommerdürren, der harte salzige Boden. Nur scharfer Rettich gedeiht hier, und der Meerkohl schießt ins Kraut zu jeder Zeit des Jahres, schlägt die steifen blauen Borten seiner Blätter mit der Richtung der Stürme und nicht dagegen und saugt sich gierig mit brackigem Salzwasser voll, wenn die Flut über die Marschen hinausrollt und bis zum Haus steigt. Jetzt im Frühsommer reicht der Meerkohl Zeno bis zur Hüfte, niemand hat ihn geerntet. Ledas Gemüsegarten ist ein freies Geviert zwischen Salzlager und Haus, sie hat die Stelle mit kalkweißen Steinen begrenzt, wie sie der Fluss manchmal anschwemmt. Sehr selten haben die Steine ein Loch in der Mitte, durch das Zeno den Zeigefinger stecken kann. Hühnergötter, sagt Leda, bringen Glück, du hältst sie dir vor das Gesicht und guckst durch, und was du siehst, ist das Glück, sie fädelt sie zu Ketten auf, hängt sie sich um den Hals, bindet sie sich um die Fußknöchel. Zeno hält ihr einen Stein vor das linke Auge, Und was siehst du? Leda schiebt eine Hand vor das andere Auge, blinzelt.
Mich, ruft Zeno, du siehst mich!
Eigentlich, sagt Leda und tickt ihm mit dem Stein sanft an die Schläfe, sehe ich den Kühlschrank. Den Kühlschrank und einen Jungen mit zu langem rotem Haar, der mir ein großes kaltes Glas Weißwein bringt. Hier, guck du mal. Siehst du ihn auch?
Leda streicht ihm mit dem Zeigefinger den Scheitel entlang wie an einem Satz auf einer Buchseite, den man schon so oft gelesen hat, dass man die ersten Buchstaben sieht und den Satz im Kopf ergänzt, ein blinder Reiz ohne Hinsehen, ein selbstverständliches Wissen, das ungeduldig macht, Liebe, denkt Leda, besteht zu neunzig Prozent aus zärtlicher Vernachlässigung, heiligem Schludern. Alles andere überleben wir nicht.
*
Morgengötter nennt Zeno die Steine mit dem Loch in der Mitte, er findet sie am Morgen nach der Flut im Sand, wenn selbst die Austernfischer noch schlafen und das einzige Geräusch das Strömen von Wasser über Steine ist. Die Morgengötter beherrschen das Ufer mit einer stillen Autorität, die nicht zur Verhandlung steht, sie warten auf ihn mit beinahe vollkommen runden Öffnungen, nasse kleine Götter, deren Augen immer offen sind. Sie riechen entfernt nach Feuer und Regen, würzig und feucht. Der Morgen gehört allein den Steinen und dem Rauschen, es ist, als kämen die anderen erst hervor, wenn das Rauschen sich aus dem Morgen zurückzieht, als wäre vorher kein Platz für die Möwen und Austernfischer, die Rotschenkel und Graureiher, nicht einmal für das leise Ploppen der Fischmäuler, die erst am Abend mit der Stille in die Marschen kommen, als wüssten sie, dass man sie vorher nicht hören kann, nur die Steine bestehen neben dem großen Rauschen, Warum denn Götter?, will Leda wissen, Nur rumliegen macht einen noch lange nicht zum Gott, ich wüsste das, ich wäre einer.
Du isst zwischendurch ein Käsebrot, sagt Zeno, du trinkst ein Glas Milch, du musst aufs Klo, Steine schlafen immer oder nie, das ist ihr Geheimnis, nur Götter können das, das ist doch wohl klar.
Das Glück ist ein glitschiges Ding, das Leda immer wieder zwischen den Löchern der Morgengötter hindurchrutscht und verloren geht, anders kann Zeno es sich nicht erklären, die Schalen und Dosen und Schubladen im Haus sind voll, jeden Tag geht er den Fluss ab bis zum Toten Grund, das ist die Stelle mit den verdorrten Föhren, die das Salz und die Hitze der vergangenen Sommer Stück für Stück vergiftet hat, und auch in die entgegengesetzte Richtung, bis zur ersten Flussbiegung, hinter der man die Saline nicht mehr sehen kann. Leda fädelt die Steine auf Schnur, trägt sie um den Hals, die Arme und Beine, durch das Loch in der Mitte gesehen hat sie noch nie.
*
Zeno könnte die Wärmeverteilung von Ledas Körper aufzeichnen wie eine Topographie. Die gemäßigten Kältezonen der Ohrläppchen im Frühling auf der Wolldecke am Fluss bei Ebbe, ihr Atem sauer und weich an seiner Wange. Die Treibeisgrenze der Fingerknöchel beim Nüssesammeln im Herbst, die Finger bald so kalt, dass sie sich nicht mehr um die Früchte krümmen lassen, die Winter sind hier mild, sie werden immer wärmer mit jedem Jahr, aber sie sind klamm, die Winter lagern sich in den Knochen ein, jeden Winter ist das Krümmen der Finger schwerer für sie. Die eisige Fingerspitze, die ihm im schmalen Kinderbett auf die Stirn klopft, Schlaf jetzt, mein taubes Nüsschen, und dass du mir einen hübschen Traum übrig lässt. Die Polarkreise um ihren Mund, wenn sie aus dem Bett kommt nach Tagen, Wochen manchmal, sie steht in der Küchentür und starrt das Kind an wie fremd, als hätte sie das Kind nicht dort erwartet, wo sie es zurückgelassen hat, oder sich selbst nicht wieder auf der Türschwelle zur Küche, auf das Kind blickend. Aber auch: der Äquator um ihre Hüfte, auf der sie das Kind trägt, wenn sie dann durch die Tür hineingekommen ist, drängende Umarmungshitze, es verdampft darin das Befremden, die Stirn, das Kinn, die Wangen des Kindes bald stickig vor Küssen. Es friert in ihrem Frost, es wächst in ihrer Wärme, sie ist das eine oder das andere, sie ist nie gemäßigt, sie ist so absichtslos unerbittlich wie eine Hitzewelle, so gerecht oder ungerecht wie Regen. Auf Zenos Bettdecke wirft Leda das Mitgebrachte, wenn sie in der Stadt war, Plunder und Verlorenes, Ramsch, Rost und Kruste, in Pfützen aufgeweichte Einkaufslisten, abgerissene Perlmuttknöpfe, schrumpelige gelbe Äpfel, eine Kuhglocke ohne Klöppel, ein Namensschild mit Sicherheitsnadel, nur der Vorname mit rotem Filzstift: ANDRA. Streichholzhefte und Zuckertütchen aus Cafés und einmal fingerhutgroße Kristallgläser aus einer Bar und eine grüne Schraubflasche dazu, auf der sich wie ein Relief Berge um den Flaschenhals ziehen, ein goldener Kreis, der Mond vielleicht, hängt tief zwischen zwei goldenen Bergspitzen. An einem Tag lädt ein Schulfreund Zeno zu sich ein. Zeno bleibt in der Stadt, es wird spät, der letzte Bus zur Saline ist lang schon abgefahren. Der Vater des Freundes ruft bei Leda an, ob er über Nacht bleiben darf. Am Morgen schwänzt Zeno die Schule und fährt nach Hause, er hat ein schlechtes Gewissen. Leda liegt noch im Bett. Am Boden steht die Flasche mit dem goldenen Mond. Zeno hebt sie an: Sie ist leer. Leda bleibt den ganzen Tag im Dämmer des Zimmers und steht nicht auf, Zeno bringt Kaffee schwarz, Spiegeleier mit Ketchup, pflückt Fieberklee und stellt ihn in der leeren Flasche aufs Tablett, sie fegt alles herunter, die Flasche zerspringt. Der Junge bückt sich nach den Bergen, fegt den Mond zusammen. Zeno schneidet sich nicht mehr. Ich hab mich nicht geschnitten, er hebt seine zehn unverletzten Fingerspitzen vor ihrem Gesicht, Leda sieht ihn an ohne einen Ausdruck, inspiziert dann seine Füße, seine Knie, nicht seine Fingerspitzen. Schön, sagt sie. Das ist schön.
An den guten Tagen steht Leda frühmorgens auf und lässt alle Rollläden hochschnappen. Sie reißt die Fenster auf, sie kann von der Flussluft nicht genug bekommen, auch wenn sie selbst kaum je zum Ufer geht, zwischen Lager und Haupthaus und Garten fühlt sie sich wohl, hinter der Saline, wo die Maulbeeren und die Walnüsse stehen und der Oberleitung der Straßenbahn aus den Städten zweimal am Tag zarte leuchtende Äste wachsen, Leda lässt abends, wenn die Bahn ihre letzte Tour macht, die Beine vom Fensterbrett baumeln und sieht den Verästelungen der Blitze beim Wachsen zu, stell dir vor, sagt Leda, vielleicht hängen ja irgendwann Früchte dran, und sieht der Bahn hinterher, die bis zum Sund fährt ohne Halt, aus der Stadt zum Sund und zurück zweimal am Tag, so als gäbe es sie gar nicht, Zeno und Leda, die Saline. An den guten Tagen sagt sie das oft: Stell dir vor.
Die anderen Tage. Sie liegt in den leeren Salzgärten vor dem Haus, in einem der Becken zwischen altem Laub und den grauweißen Flatschen der Seidenhühner und verschrumpelten Maulbeerrosinen, sie rudert mit den Armen, als würde sie durch die Wolken schwimmen, die über dem Turm der Saline schnell hinwegziehen. Sie steht lange nicht auf. Als Zeno sie hochzieht, sind ihre Augen glasig. Die Wärmekarte des Kindes ist durcheinander. Ledas Hände laufen heiß, als fasse sie auf einen unsichtbaren Herd, ihr läuft der Schweiß die Schläfen und Achseln herunter, ihr Hemd ist durchgeweicht zwischen den Brüsten. Um ihre rudernden heißen Hände herum fährt der Herbstwind und weht die Blätter um ihren Körper zu wilden Strudeln auf, sie greift danach, lacht schwankend und heiser. Zeno bringt sie ins Bett. Sie schläft nicht und isst nicht. Liegt nur da. Manchmal dauert es nur Tage. Manchmal länger. Voraussagen kann man es nicht. Zeno fährt mit dem Bus in die Stadt und kauft ein. Als er zurückkommt, liegt sie noch immer dort im Bett, die Rollläden unten, die Fenster verriegelt. Nichts hat sich bewegt. Nur: Über ihr erkennt Zeno im Dunkeln ein weißes Quadrat. Er knipst das Licht an, Leda blinzelt. Ein Stück Papier hängt über ihrem Kopf an der Wand. Sie hat mit Kugelschreiber drei Worte daraufgeschrieben.
BlackberriesBlackberriesBlackberries
Was heißt das?, fragt er. Das Wort ist im Englischunterricht noch nicht vorgekommen.
Brombeeren, sagt sie. BrombeerenBrombeerenBrombeeren.
Aber was heißt das?
Das ist aus einem Gedicht.
Ein komisches Gedicht, sagt Zeno. Ohne Reim und nur mit einem Wort. Du magst doch gar keine Brombeeren.
Leda sinkt in die Kissen zurück, sie sieht aus, als hätte sie sich unendlich angestrengt. Ihre Handgelenke auf der Decke sehen nackter aus als sonst. Bitte, sagt sie, mach jetzt das Licht aus, bitte.
In den Marschen haben sie Milchkraut und Meerfenchel, Föhren und Eschen und Erlen, Eiben und Birken, sie haben Wasserpflanzen im Fluss, Nüsse im Herbst und Maulbeeren und manchmal auch Moltebeeren im Sommer, aus denen sie Gelee kochen, wilde Felsenbirnen, die die Wespen fressen, wenn Leda vergisst sie zu pflücken. Es wächst Strandmelde und Strandflieder und Salzaster und Hornklee. Brombeeren haben sie keine auf den salzigen Böden. Brombeeren wachsen hier nicht.
*
Aber das Beste an den guten Tagen sind die Einkaufszettel. Leda bringt sie dem Kind mit, wenn sie einen findet, sie sind ihm lieber als alles andere. Sie fallen den Leuten im Supermarkt aus der Tasche, sie vergessen den Dosenfisch und die Schlagsahne, die Zuckerwürfel und das Flaschenbier, die Blumenerde. Sie legen die Erde, das Bier, die Sahne auf ihren Zetteln ab und haben sie beim Schreiben schon vergessen, wie Leda Zeno vergisst, sobald sie ihn am Abend ins Bett gelegt hat. Sie vergisst Zeno oft. Das regelmäßige Vergessen des Kindes ist unvermeidbar. Das regelmäßige Vergessen des Kindes ist lebensnotwendig. Sie vergisst ihn wie einen Joghurt auf einer verlorenen Einkaufsliste, von einem Moment auf den anderen. Einmal ist sie eine Woche fort und hat Zeno kein Geld auf dem Tisch gelassen, die Küchenschränke sind leer, ein Stück Käse in einem feuchten Wachspapier im Eisschrank. Sie geht am Mittwoch, und am Freitag kaut Zeno gründlich die Rinde, der Speichel streckt die übrig gebliebenen Käsekrumen, sie scheinen mehr, fast machen sie satt.
Wenn sie länger fort ist, als der Kühlschrank reicht, durchkämmt er die Beete, grüne Fransen stehen hier und da in den Saatreihen, darunter Rettich, fleischig und im Saft, ein paar muffige Radieschen. Zeno isst den Rettich roh, schlägt die Zähne gierig in die dicken Rüben. Der Saft fliegt in schaumigen Placken auf Zenos Arm, in der Nacht spritzen die Krämpfe aus seinem Bauch durch die Eingeweide und aus ihm heraus, vorn und hinten, Zeno kotzt und scheißt den Rettich und die Radieschen aus. Er versucht sie nicht noch einmal. Ganz hinten in der Speisekammer steht eine Tüte Weißzucker im Staub. Zeno lässt Esslöffel voll Zucker in der Innentasche seiner Wange schmelzen, bis seine Zähne Gewitterblitze ins Zahnfleisch jagen. Er knüllt die leere Zuckerpackung zusammen und wirft sie auf den Boden. Er hebt das Papier wieder auf. Er streicht es glatt und schreibt in Großbuchstaben darauf: BROMBEERE. Er legt das Papier in den Kühlschrank wie ein verderbliches Lebensmittel. Als könnte man das Papier essen.
2Die flüssige Königin
Wenn es nicht wäre, wie es ist, hätte es zum Beispiel schön sein können. In dem Sommer, als Leda im neunten Monat schwanger war, titelten die Zeitungen zum ersten Mal das Überschreiten der Thermometeranzeige bei siebenundvierzig Grad. Sie dachte, es würde unmöglich sein, jetzt noch ein Kind großzuziehen. Dieses Kind großzuziehen. Dann kam das Kind.
Die Vogelknöchel des kleinen Schädels verformbar und durchlässig, mehr Membran als Knochen. Der Geruch des Kindes strömte daraus hervor. Sie erwartete, ohne genau zu verstehen, warum, etwas Pudriges. Etwas, das rosa und milchig war, süß und warm. Leda roch Tier. Ein Tier, das aus dem Nest gefallen war, das mit wundnassem Fell auf dem Boden lag, sie roch Schorf, eine Schärfe wie Ingwer und Bitterkeit, nicht wie ein Kraut, wie ein ungewaschener Körper, der lang gelegen hat. Roch so das Innere ihres Körpers?
Sie wickelte das zerdrückte, kleine, klebrige Tier in eine Decke und nahm es mit in das teerschwarze Haus am Fluss. In der Stadt roch der Fluss nach nichts. Wenn etwas oder jemand hineinfiel oder sprang, kräuselte sich für einen Moment die Oberfläche des Flusses, kaum merklich. Dann lag er wieder glatt und geruchlos da. In den Salzwiesen wurde derselbe Strom ein anderer. Er schlang sich durch das Land wie ein überlaufender Abfluss, grau, übelriechend und mit einem gemeinen Glanz. Leda mochte den Fluss nicht. Er war nicht schön. Er war nicht glasklar und still wie ein See. Er war nicht erhaben wie die Berge. Aber er war stark. Er sog einem an den Fußknöcheln wie ein Maul. Ein paarmal im Jahr pulsierte er wütend wie eine Ader auf einer Stirn und schwoll außerhalb der Stadt, wo er nicht befestigt war und keine Dämme ihn einhegten, über die weiße, gebrochene Erde der Marschen und riss die Autobahnen des Umlandes ab wie Schorf. Er war unberechenbar, wetterwendisch, ein Wechselbalg, mehlig und kreidebraun im Nebel, mal ätherblau und grundsichtig, ein brennendes Chartreusegrün bei Sturm, Blutschwarz in der Nacht; im Nebel blieb der Fluss ungenau und ließ sich auf nichts festlegen, die Strömungslinien entglitten dem Auge wie mit Fett bestrichen. Von der Quelle bis zur Mündung durchquerte er eine große und viele kleine Städte, Industriegebiete, Brachflächen, Salzland. Er kreuzte drei andere Flüsse, durchlief auf seiner Strecke mehrfach eine Umwandlung seines Geschlechts und seines Namens, wurde am Wehr des Kraftwerks im Gebirge abrupt aufgehalten und zusammengestaucht und vor der großen Stadt begradigt, als wäre er ein unerwünschter schiefer Zahn im Mund eines Kindes. Er teilte sich hinter der großen Stadt wie die Borsten eines Malerpinsels in Dutzende Stränge auf, wurde vom Fluss zum Delta, zerfaserte zu taudicken, rissdünnen, haarfeinen Rinnsalen und ging an der äußersten ausgefransten Spitze jedes dieser Rinnsale im Meer auf, die Kraft eines ganzen Stroms zerbröselt in einzelne schwächliche Tropfen, lautlos und unsichtbar geschluckt von der tauben, salzigen Schwere einer Wassermasse, die den Fluss in ihre Gleichmütigkeit einwalzte, gründlich, rhythmisch und restlos. Und das alles, ohne auch nur einmal gefragt zu werden. Sofern ein Fluss etwas fühlte, musste dieser hier, dachte Leda, nichts anderes empfinden als Wut. Einen brodelnden, unterdrückten Zorn. Dieser Fluss war gefährlich, womöglich boshaft. Dieser Fluss, beschloss Leda, war genau der große Bruder, den sie sich für das Kind gewünscht hatte.
*
Das Aufziehen des Kindes stellte sich als gar nicht unmöglich heraus. Es war nicht einmal besonders schwer. Die ersten Monate flossen dahin, die Blanke Elle vor dem Fenster ihres Schlafzimmers und ihr Wochenfluss ein ineinanderfließender Strom, gemächlich und nicht aufzuhalten, und sie ließ sich darin treiben mit dem Kind auf dem Arm, in ihre Brust schoss die Milch ein und lief im Schlaf in gelben dünnen Tropfen über ihren Bauch, in den Nächten schwitzte sie die Laken nass, den heißen Körper des Kindes dicht an sich gedrückt, zwischen ihren Beinen lief grindiges Blut. Sie regierte dieses Zwischenreich der sauren und süßen Nässe, der weichen Körper, der Eintönigkeit, sie war seine flüssige Königin.
*
Sie lernte das Kind zu streicheln. Es war nicht viel anders als bei einer Katze oder einem Hund. Sie kraulte es probeweise hinter den Ohren. Das Kind schloss die Augen und lächelte. Sie strich ihm über den gelben Milchschorf am Hinterkopf. Das Kind schloss die Augen und lächelte. Milch und Wärme, dachte Leda. Das hier ist einfach.
*
Die Nächte mit dem Kind zogen sich. Die Jahre seit dem Kind wurden mit jedem vergehenden kürzer. Es war anstrengend, aber sie musste sich nicht bemühen. Leda schwamm wie von allein in der Flucht dieser Jahre durch die Ewigkeit der Tage. Sie gewöhnte sich an den säuerlichen Geruch der Milch auf den Laken, in ihren Kleidern. Sie gewöhnte sich an die vollen Windeln, sie fing an, sie zu mögen, sie in den Händen zu wiegen, warm und schwer, hatte etwas Befriedigendes, als hätte sie damit etwas geleistet.
Der Kot des Kindes hatte die Farbe von Kurkuma und roch nach vergorenem Zucker.
Das Kind wuchs zu schnell und unerträglich langsam. Das Kind war klein wie kaum etwas, das man je in den Händen gehabt hatte, und das Größte, das einem je passiert war, und die Liebe war unendlich, unendlich war auch die Langeweile. Sie hatte es gewusst. Tag für Tag dieselben Handgriffe, das Wickeln und das Füttern, das Baden und das Trocknen der schorfigen Stellen hinter den Ohren, jeden Abend drehte sie das Kind in seinem Bettchen auf die Seite und legte zwei Finger in die nackte, rote, feuchte Mulde seines Nackens, die einzige Stelle an diesem Kind, die ihr je wirklich nackt vorgekommen war, auf eine ungehörig verletzliche Weise, nur mit ihren beiden Fingern auf dieser Stelle konnte das Kind einschlafen, das ging so zwei Stunden oder drei, und Leda hielt still und langweilte sich so leise und geduldig und liebevoll wie möglich, es kam doch jetzt ohnehin nicht mehr darauf an, mit seiner Zeit noch etwas Neues zu tun, etwas anderes anzufangen, jetzt nicht mehr. In Venedig wuchsen in den Blumenkästen der Balkone im ersten Stock Jakobsmuscheln statt Begonien und die sinkende Sonne über der Lagune ruhte sich jeden Abend in den Rillen der Gehäuse der Spitzkegelschnecken aus, die wie Zierknöpfe in den Gewandfalten der Heiligen auf der Marmorfassade der Kirche Santa Maria della Salute saßen. Im Pazifik sanken nördlich der Fidschis die ersten Inseln aus den Seiten der Atlanten und tauchten in den Geschichtsbüchern wieder auf. Alle Witze waren erzählt, man fing wieder mit dem Glauben an, und wem die Phantasie für Kaffeesatz und Gott nicht reichte, saß warm und müde mit Krawatte an Konferenztischen und schlang mit anderen Krawatten das nahende Ende vorerst zu einem locker gebundenen Windsorknoten und schob es sodann auf einen für ihn persönlich passenderen Termin.
Nein, was für Leda noch zu tun war, das Letzte, was sie angefangen hatte, war hier unter den Spitzen ihrer beiden Finger.
Irgendwann, wenn diese endlosen Nächte vorbei waren, würde das Kind gehen, ohne sich umzudrehen und ohne einen Dank, und das fand Leda richtig so. Das Kind schuldete einem nichts. Nicht sein Leben. Und schon gar nicht seine Liebe. Sie legten Leda im Krankenhaus das nasse, grauhäutige Bündel auf den Bauch, das nach ihr riechen sollte und nach Tier roch, und Leda hatte zwei Bedürfnisse: Sie musste sich dringend übergeben. Und sie wollte sich entschuldigen. Für beides hätte sie aber den Mund öffnen müssen, und so wischte sie nur dem Kind über das Gesicht, spitz und ohne Gewicht, schutzlos wie ein abgenagter Rattenschädel. An ihren Fingern blieb etwas hängen, eine dicke weiße Schmiere wie auf einer Rotebetesuppe, die drei Tage auf dem Herd gestanden hatte, und sie dachte, Jetzt bist du hier, mein Rattenkind, mein Federvieh, aus einem träumenden Nichts herausgefallen und in einer Zumutung gelandet, da musst du jetzt durch, und alt werden musst du auch, ein paar Jahre ohne Windeln und mit Zahnarztrechnung, das ist Erwachsensein, und dann alles zurück auf Anfang und du endest, wo du warst, bevor der Egoismus deiner Mutter dich hierher gezwungen hat, und all das, ohne dass dich einer auch nur gefragt hätte. Aber ich hab dir ein Nest gebaut, es ist schwarz und aus Teer und aus Salz, und du hast einen Bruder, vor dem sie alle Angst haben, und wenn er dich zwischen den Zehen leckt, kitzelt es und er macht dir Salzbeine, die sich abends im Bett trocken anfühlen und feucht, weich und auch rau und so, als wären deine Beine nicht ganz deine eigenen, deine Haut nicht ganz deine, und du wirst deine Beine aneinanderreiben, wenn ich dir die Bettdecke festgesteckt habe, und ich werde dir sagen, dass salzige Haut die Mücken vertreibt und die Gespenster, und das Nest wird für uns sein, was ein gutes Nest immer ist: ein Versteck und ein Geheimnis, und für ein paar Jahre wird das genug sein. Wird es reichen. Was meinst du. Kommst du mit?
*
Leda schien es seltsam, dem Kind einen Namen zu geben. Das Kind war ein Junge, aber mehr wusste Leda nicht über dieses Kind zu sagen, und auch, dass es ein Junge war, sagte doch im Grunde nichts. Das Kind war ein Fremder, der eben zufällig in ihrem Bauch gewachsen war und nicht in einem anderen. Wie sollte man einem Unbekannten einen Namen geben? Noch seltsamer, als dem Jungen einen Namen zu geben, fand es Leda, ihm keinen Namen zu geben. Sie nannte den Jungen Zeno. Sie schnupperte an dem feuchten, dunklen Wirbel auf Zenos Hinterkopf, bis sie anfing, den Geruch zu mögen: krustig und nach Eisen. Ein totes Reh nach einem Tag in der Sonne.
*
Mit jedem Kind beginnt die Welt von vorn, hatte man ihr damals gesagt, damals vor zwölf Jahren. Man hatte das freundlich gemeint. Eine Aufmunterung. An den Tagen, wenn das Salz in den Wiesen alles heller werden lässt, kann Leda sich darüber ausschütten vor Lachen. Dass die Welt statistisch jeden Tag achtzigtausendmal von vorn beginnt, alles auf Null, und es immer gleich läuft. Die Liebe, die nie endet, und die Arbeit, die erfüllt, und die Freiheit, alles zu tun und überall zu sein, und das Glück, das die Summe aus diesen dreien ergibt, wenn man nicht patzt, wenn man sie nur richtig zusammenrechnet, und all die anderen Versprechen, die den Menschen die Mäuler verkleben und Fäden zwischen ihren blendend weißen Zahnleisten ziehen wie fades Kaugummi. Es ist, als wären wir einfach so programmiert. Man kann da nichts machen. Schon gar nichts besser. Zweitausend Jahre Zeit, es zu kapieren, und der Lauf der Welt eiert trotzdem jedes Mal an denselben Stellen, Platte gesprungen, Seems like folks turn into things/that they’d never wa-a-a-a-a-a-n-n-n-n-t-t-t-t. Darüber kann Leda losprusten, sich auf dem Boden wälzen. Sich totlachen.
(Wie schön das wäre, denkt Leda. Aber dieses Ende war mit dem Kind endgültig vorbei.)
*
Leda fährt abends in die Stadt, es gibt Tage, da sie am nächsten Morgen zurückkommt, am Tag darauf, in einer Woche, es gibt Wochen, da sie gehen muss für eine Weile, damit die Dinge ganz bleiben, es ist ihr bewusst, dass sie für das Kind ein Kontinuum sein soll, ein beständiger Ort, an den es gehört, aber niemand, den sie kennt, ist je an diesem Ort gewesen, sie selbst ist es nicht gewesen, nie. Wenn sie zurückkommt, lehnt Leda in der Tür, es gibt ein Hier und ein Dort, ihre Seite, die auf der Schwelle in seine Seite kippt, auf der Schwelle kippt sie von Leda in Mama, Leda bleibt in der Tür stehen.
Leda steht lange so in der Tür. Später sucht sie mit ihrem kreisenden Zeigefinger eine Stelle an Zenos Hinterkopf. Da ist ein Gefühl, Leda kennt es gut, sie begegnet ihm oft, seit ein paar Jahren begegnet sie ihm fast jeden Tag zufällig, es kann ihr aus einem Schrank entgegenfallen, aus einer dunklen Ecke ganz plötzlich hervorspringen wie etwas, das an einer Sprungfeder befestigt ist: Nicht-mehr-Wiederfinden. Es ist eigentlich kein Gefühl, nichts, das so fließend wäre, es ist: eine steinerne, hart gefrorene Gewissheit, diese eine bestimmte Stelle nicht wiederfinden zu können. Diese Stelle verloren zu haben. Sich nicht einmal genau daran zu erinnern, was es gewesen ist: ein warmer Ort. Ein vertrauter Geruch. Sie weiß nur, dass sie sich darauf verlassen hat. Dass es Jahre gab, da es da war, ohne dass sie es suchen musste. Ein fester, warmer Punkt unter Ledas Zeigefinger. Sie hält den Finger in seiner kreisenden Bewegung auf Zenos Kopf an einer Stelle an, sie beugt sich vor, Zenos Haar an ihrer Nase, verklebt und weich wie Entendaunen. Mit den Jahren verliert sich der Geruch, die Stelle riecht nach nichts mehr, sie liegt unter Haar. Leda drückt den Finger in die Mulde, sie prüft, tastet, es fühlt sich ähnlich an, wenige Millimeter davor oder dahinter, beinahe richtig. Ledas Finger bleibt liegen. Leda ist sich nicht mehr sicher.
3Austernspucke
Die Liebe zu Leda kann Zeno genau lokalisieren. Sie hat keine Zeit und keine bestimmte Form, aber sie sitzt immer auf derselben Stelle. Zeno sieht Leda an, Ledas Mund, der Ledas schöne dunkle Rätselsätze sagt, über denen Ledas Halstücher aus dunkler Seide liegen, die Leda trägt, wenn sie abends in die Stadt fährt, Ich gehe, damit die Dinge ganz bleiben, die Tücher verhängen den Inhalt, aber sie folgen den Konturen der Wörter, sie sind wild geschwungen und nach oben gebogen, außerhalb von Zenos Reichweite, auch auf den Zehenspitzen. Ledas Hand auf Ledas Kunstbüchern, flämische Malerei des siebzehnten Jahrhunderts, Ledas Zeigefinger wischt über silberne Karaffen, Holz dunkel und glatt wie Honig, eine halbierte Artischocke, die dicke heugrüne Blätterschichten um ihr rosa Herz plustert, das jeden Moment anfangen kann zu pochen, so weich und fleischig sieht es aus, und dort im aufgeschlagenen Buch, wo eben noch Ledas Zeigefinger gelegen hat, ist die Stelle. Die Stelle pulsiert, das weiche Herz der Artischocke beginnt zu schlagen, es gibt einen Spalt, ein Stolpern im Vorangehen der Zeit, und die Stelle, an der Ledas Zeigefinger war, gibt es nicht mehr, es gibt sie nicht mehr, weil es sie nur mit Ledas Zeigefinger geben kann, und Zeno bewegt seine Augen von der Buchseite auf den Boden und hat vergessen, wo er ist, vor einer schwindelnden Sekunde doch noch im Herz der Artischocke, saftige atmende Wände, ein schwacher Geruch von Salzlake, er schließt die Augen und auf der äderigen leuchtenden Innenseite seines Lids ist die Stelle. Die Liebe zu Leda ist immer ein Nachbild. Sie hinkt Leda hinterher, ist nie flink genug, um Leda zu erreichen. Leda läuft schnell.
Zeno sitzt im Schneidersitz neben ihr auf dem Bett, am Nachmittag noch im Schlafanzug, sie löffeln kaltes Maulbeergelee mit Zimt aus dem Glas, es ist Sonntag, es ist eigentlich immer Sonntag, wenn Leda das beschließt, sie strecken sich gegenseitig die Zungen heraus, strecken sie lang, soweit es geht, ihre Zungen sind blau vom Maulbeergelee. Zeno zeigt auf die Artischocke, Sieht eklig aus, wie ein Gehirn. Ein Gehirn von einem Monster aus Salat. Dieser Salat, den du immer machst. Wie heißt der noch mal. Der eklige.
Endivie, sagt Leda, aber siehst du das Licht. Immer heißt es, die Liebe besiegt alles. Was für eine plumpe Erfindung. Sie kann so leicht widerlegt werden, dass Leute mit Verstand sich die Mühe gar nicht mehr machen. Das Licht besiegt alles, Zeno. Wie das Licht in einem Moment auf den einen gefallen ist, hart oder weich, hat schon oft über die ganzen erbärmlichen Zweifelsfälle entschieden, die sie Liebe nennen. Glaub mir, ich hab es selbst gesehen. Sie fährt die plüschigen Fransen des Artischockenherzens entlang, den silbernen haardünnen Lichtstreif auf der Schneide des Messers. Das Licht, sagt Leda, entscheidet. Das Licht entscheidet immer.
Der Satz ist mehr Geheimnis als Feststellung: So etwas sagt sie manchmal, mehr zu sich als in den Raum. Dass der Junge sie hört, ist eine akustische Begleiterscheinung. Zeno lauert diesen Sätzen von ihr auf, die er nicht versteht, er wartet darauf, dass sie für ihn abfallen am Ende des Gesprächs. Ich gehe, damit die Dinge ganz bleiben.