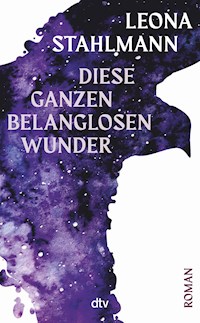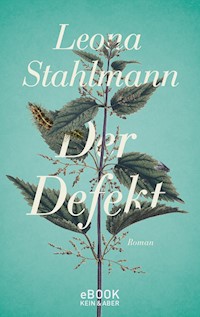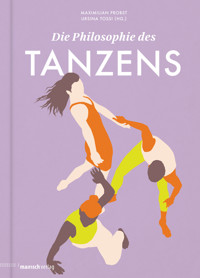
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir tanzen im Club, bei Hochzeiten, auf WG-Partys; gehen ins Ballett, in die Oper, zum Modernen Tanz. Tanzen in all seiner Vielfältigkeit ist immer verbunden mit Lebendigkeit, manchmal sogar mit Ekstase und dem Dionysischem. Die Herausgeber*innen Maximilian Probst und Ursina Tossi nähern sich zusammen mit den 14 Autor*innen einer Philosophie des Tanzens an. Sie erkunden das Politische des Tanzens auf der Straße, nehmen Friedrich Nietzsche mit in den Club oder laden Judith Butler auf Tanzperformances ein und fragen, was aus dem alten Anspruch des Tanzes, Avantgarde zu sein, heute geworden ist. In ihren Beiträgen ergründen sie, was das Tanzen schon von Kindesbeinen an so besonders macht, wie man als Tanzende Identitäten ausloten, ausprobieren und definieren kann. Sie erklären uns die Unterschiede zwischen Standardtänzen und dem Tanz in einer Performance. Und sie zeigen auf, warum Tanzen immer politisch ist und oft utopisches Potential birgt. Ein Buch für alle, die gerne selbst tanzen oder einfach in die Welt des Tanzens eintauchen wollen, um zu verstehen, was dessen Faszination ausmacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Die Philosophie des Tanzens
Herausgegeben von Maximilian Probst und Ursina Tossi
Vorwort - Von Maximilian Probst und Ursina Tossi
Über Tanz nachzudenken ist eine Herausforderung eigener Art. Auf den ersten Blick bilden Tanz und Philosophie ja so gar kein gutes Paar. Wenn Philosophie in Anlehnung an Hegel die Arbeit am Begriff ist, dann scheint der Tanz, als ein Spiel des Körpers betrachtet, davon in maximaler Entfernung. Wir könnten den Tanz sogar als eine Art Anti-Philosophie auffassen, als ein Phänomen, das sich wie kein zweites dem Zugriff der Begriffe entzieht und ihrem Geist entgegenwirkt. Tanz, könnten wir sagen, verbürgt, dass die Philosophie an eine Grenze stößt und über wesentliche Bereiche unserer Existenz keine relevanten Aussagen mehr machen kann. Der Tanz wäre damit ein allgemeines Prinzip, das für die Vielfalt von Lebensmöglichkeiten jenseits des Denkens einstünde.
In etwa so: Hier die einschnürenden, ordnenden Theorien und Lehrsätze – dort die Entfesselung der Bewegung, die über alles hinweghüpft. Hier der Versuch, Dauer zu schaffen, die Zeit anzuhalten, am liebsten ewige Wahrheiten zu verkünden (und sei es die Erkenntnis, dass nur der Wandel Bestand hat) – dort die Flüchtigkeit, die Laune des Augenblicks, die keine Spuren hinterlässt. Hier das große Ganze, Allgemeine, Universelle, das, was überall für alle gilt – dort ein unvorhersehbar Abweichendes, Singuläres und Nicht-Wiederholbares, aus dem sich der Zauber speist. Oder um es kurz zu machen: hier der Kopf – dort Füße, Beine, Arme.
Es ist im Übrigen diese Gegenüberstellung, von der sich die wenigen Philosophen, die über Tanz geschrieben haben, am meisten angezogen fühlten. Tanz als das andere der Philosophie, das aber in seiner Andersheit für die Philosophie fruchtbar gemacht werden soll. Dabei wird, folgenschwer, der Tanz zu einer Metapher, zu einem Muster, Paradigma oder Symbol. Den Anfang machte Nietzsche in diesem Spiel. Für ihn ist der Tanz ein Ideal, von dem er lernen will: »Tanzenkönnen mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten; habe ich noch zu sagen, dass man es auch mit der Feder können muss?«
Bezeichnenderweise braucht der Tanz als Metapher dann selbst nicht näher erläutert werden. Was mit Tanz gemeint ist, scheint sich von selbst zu verstehen, eine eigene tänzerische Erfahrung muss dafür auch nicht aufgerufen werden. Gemeint ist ganz einfach: Leichtigkeit, Beweglichkeit, Entgrenzung, Schwung, Sprunghaftigkeit, Lebensfreude, Sinnlichkeit, radikale Diesseitigkeit, Momenthaftigkeit und dergleichen mehr. Denkt man an Nietzsches philosophisches Programm – Kritik an aller Metaphysik von Platon angefangen, Kritik allem Moralismus, dem christlichen im Besonderen, Kritik an der Vernunft und Wissenschaftsgläubigkeit –, wird sofort ersichtlich, warum ihm der Tanz als perfekte Metapher erscheinen musste: Er beinhaltet mit seiner Leiblichkeit das Ausgeschlossene, Verdrängte der westlichen Kulturgeschichte. Nicht zufällig hat etwa die Kirche alle Künste miteingeschlossen, Dichtung, Musik, Architektur, Malerei, Theater. Alle, nur den Tanz nicht. Konsequent hebt Nietzsches Zarathustra als Gegenfigur deshalb den Tanz in den Himmel, wenn er bekennt: »Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde.«
Tanz als Metapher des Denkens und Schreibens und sogar eines möglichen oder unmöglichen Glaubens: Das ist die Linie, auf der sich die Philosophen bewegen, wenn sie vom Tanz reden. Beim französischen Dichter und Denker Paul Valéry wird auf diesem Weg der Tanz sogar zu einer absoluten und in diesem Sinne völlig entleerten Metapher. Weil Tanz reine Bewegungsenergie sei, verweise sie als Metapher auf ihre eigene Metaphernhaftigkeit. Damit macht Valéry den Tanz zum Prototyp aller Künste, die in ihrem ästhetischen Kern nicht ziel- und zweckgerichtet seien, sondern Spiel und Verausgabung.
Fortsetzen lässt sich diese französische Linie der Metaphorisierung des Tanzes bis hin zu heutigen Positionen wie denen von Alain Badiou und Jean-Luc Nancy, zwei Philosophen, die beide Variationen von Valérys Gedanken zum Tanz entwickeln. Bei Badiou heißt es, dass der Tanz »als Zeichen für die Möglichkeit der Kunst steht, wie sie in den Körper eingeschrieben ist«. Und bei Nancy gipfeln seine Überlegungen zum Tanz darin, dass er ihm den Sinn zuschreibt »hier und jetzt zum Tanz einzuladen«. Der Tanz dreht sich gewissermaßen einmal um die eigene Achse, ist sich selbst genug und kann nur als Metapher – beziehungsweise Metapher der Metapher – noch über sich hinausweisen.
Solche artistischen Denkbewegungen sind ganz gewiss zu bewundern. Es kann sich aber auch der Verdacht in die Bewunderung schleichen, dass diese Denker am Ende doch mehr vom Denken als vom Tanzen verstanden haben. Von Nietzsche ist tatsächlich überliefert, dass er den Tanzunterricht an der Landesschule Pforta nur mit mittelmäßigem Erfolg absolviert hat. Wirklich tanzen gesehen hat ihn angeblich nur seine Wirtin in Turin: durchs Schlüsselloch, kurz vor seinem psychischen Zusammenbruch sei er nackt durchs Zimmer gehopst. Auch diese extreme Szene, der nackte Nietzsche an der Grenze des Wahnsinns, ließe sich natürlich als Metapher in Dienst nehmen: dafür, dass für die Philosophen der Tanz etwas ganz Besonderes ist, etwas Fremdes, ein Terrain, auf dem man nicht zu Hause ist. Womit wir wieder bei der Ausgangslage angelangt sind, der Gegenüberstellung von Tanz und Philosophie, die immer dazu führt, dass die Philosophen den Tanz zur Metapher machen, denn wenn man den Tanz aus der Ferne betrachtend nicht versteht, dann lässt man ihn für sich selbst oder für etwas anderes stehen. Wie wäre es – das mal als Frage – wenn Tänzer:innen sich der Philosophie annehmen würden und zu Sätzen gelangten, im Denken gehe es um weiter nichts als das Denken, die Philosophie sei nicht eine Suche nach der Wahrheit, sondern eine Metapher für irgendwie alles und nichts zugleich.
Unser Buch ist aus dem Misstrauen gegen solche Metaphorisierung entstanden. Es sucht das Verhältnis zwischen Tanz und Philosophie dort auf, wo es konkret wird: an den verschiedenen Orten des Tanzes, und in den verschiedenen Stilen und Kulturen des Tanzes und ganz generell: an Erfahrungen, die Hand und Fuß haben. Auch deshalb haben wir zu gleichen Teilen sowohl Beiträge von professionell Schreibenden wie professionell Tanzenden erbeten. Eine (im Sinne von eine einheitliche) oder gar die »Philosophie des Tanzens« ist dabei sicher nicht entstanden und sollte auch nicht entstehen. Wie auch, wo ja der Tanz selbst radikal vielgestaltig ist. Das muss eigens betont werden, weil der Tanz gelegentlich, wie die Musik, als universale Sprache gehandelt wird, die vermeintlich alle sogleich verstehen. Doch diesen einen Tanz gibt es nicht. Tanz ist immer lokal, an spezifische Kontexte und Körper angepasst. Er sperrt sich gegen naive Aneignungen und Übersetzungen und erlaubt stattdessen dialogische Teilhabe und ein Erleben von Differenz. Das gilt auch für die Philosophie. Sie kann sich den Tanz nicht metaphorisch aneignen, ihn nicht interpretieren, sondern nur in einen Dialog mit ihm treten. Andersherum verhält es sich genauso. Der Tanz kann nicht der Leitstern der Philosophie sein. Wir können aber stattdessen schauen, wie sich ausgehend von konkreten Erfahrungen die Frage nach der Philosophie und nach dem Tanz zu Figuren fügt, die Relevanz fürs Denken wie fürs Tanzen haben. Diesem Ansatz sind wir im Buch gefolgt. Entstanden ist dabei ein immer neu ansetzendes Pas de deux von Philosophie und Tanz, das hoffentlich die vielfachen Verbindungen der beiden Phänomene, die nicht auf einen Begriff zu bringen sind, anschaulich werden lässt.
Um abschließend dennoch eine Synthese zu wagen: Tanz ist Wissen in Bewegung. Philosophie ist es auch. Und die Essays dieses Buches sind ein Versuch, zu beidem einzuladen.
Kurzbiografie: Maximilian Probst
Maximilian Probst arbeitet als Journalist für die ZEIT. Zuvor übersetzte er Texte von Paul Virilio, Alain Badiou und Slavoj Žižek. 2014 erhielt er für seinen Beitrag in Die Philosophie des Radfahrens den Clemens-Brentano-Preis, 2018 den Ernst-Bloch-Förderpreis. 2016 erschien sein Buch Verbindlichkeit im Rowohlt Verlag. Bisher waren Beiträge von ihm in allen Philosophie-Bänden des mairisch Verlags. Nun ist er erstmals als Herausgeber dabei.
Kurzbiografie: URSina Tossi
URSina Tossi ist freischaffende Künstler*in, Choreograf*in, Regisseur*in, Tänzer*in, Autor*in und Dozent*in. URSinas Projekte verbinden politische, queerfeministische Diskurse mit intensiver Körperlichkeit und Aesthetics of Access. In Koproduktion mit dem internationalen Produktionshaus Kampnagel Hamburg, der TanzFaktur Köln und Stadt- u. Staatstheatern entstanden unter anderem BARE BODIES, BLUE MOON, REVENANTS, SWAN FATE und GHOSTS. COSMICBODIES wurde nominiert, HELL gewann den Tanztheaterpreis Köln 2024 und FUX erhielt den Kindertheaterpreis Hamburg,
01 - Der Ballsaal - Tanz als körperliches Denken - Von Oliver Marchart
»Je danse donc je suis«Brigitte Bardot
Wir alle tanzen. Und tanzen wir, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr, so haben wir doch früher getanzt – und sei es nur in unserer Kindheit. Auch erscheint Tanzen über alle Kulturen hinweg als menschheitliche Universalie. Eine Kultur, in der nicht getanzt würde, ist schwer vorstellbar. Menschen tanzen, und sie tanzen überall. Dennoch rangiert der Tanz am unteren Ende jener imaginären Hierarchie von Kunstsparten, wie sie in westlichen Gesellschaften nach wie vor Geltung besitzt. Ein guter Maßstab für das Gewicht, das einer bestimmten Kunstpraxis zugestanden wird, ist deren akademische Erforschungswürdigkeit. Die meisten Volluniversitäten besitzen Institute für Kunstgeschichte, aber nicht für Tanzgeschichte, für Musikwissenschaft, aber nicht für Tanzwissenschaft. Selbst innerhalb der Theaterwissenschaft, der man Tanz vielleicht zuordnen möchte, fristet er ein Schattendasein. Und auch die Ästhetik, als zuständige Teildisziplin der Philosophie, ist nicht für ihr übergroßes Interesse an Tanz bekannt. Nicht dass der Tanz völlig ignoriert würde, aber er befindet sich am Rand wissenschaftlicher Aufmerksamkeitsverwaltung.
Nicht anders in der Praxis. Zwar kann Tanz in den letzten Jahren einen enormen Popularitätsschub verzeichnen; und hie und da wurde er sogar zum Standortfaktor. Wer an Wuppertal denkt, denkt an Pina Bausch. Wer an die Hamburger Staatsoper denkt, denkt an John Neumeier, der dort mehr als fünf Jahrzehnte lang das Zepter schwang. Und doch steht am Theater das Ballett, wo man sich überhaupt ein solches leistet, nur selten im Mittelpunkt. Es herrscht eine unausgesprochene Hackordnung. Die Mitglieder des Corps de Ballet sind gleichsam die Proletarier der darstellenden Künste.
Woher rührt diese Randständigkeit des Tanzes im Reigen der Künste? Es ließen sich viele Gründe anführen. Die tiefere Ursache aber liegt wohl in der – immer schon verdächtigen – Verbindung aus Bewegung und Körperlichkeit, die den Tanz auszeichnet. Wie die wirklichen Proletarier arbeiten Tänzer und Tänzerinnen mit ihren Körpern. Und dem Körper begegnet man im Westen seit Platon und Augustinus mit größtem Misstrauen. Freilich, man wird sagen, dass es sich hierbei um kein Alleinstellungsmerkmal handelt – auch Violinisten oder Opernsängerinnen arbeiten mit ihren Körpern. Deren Körper bedient ein Instrument oder ist selbst das Instrument. Aber er steht nicht im Mittelpunkt. Deshalb beschreibt der Begriff »Instrument« den tanzenden Körper nur unzulänglich. Denn wozu sollte dieses Instrument denn dienen, was sollte es hervorbringen? Der tanzende Körper hat nicht den Zweck, etwas abseits seiner selbst zu erschaffen, zum Beispiel eine Skulptur, ein Gebäude, eine bemalte Leinwand oder auch nur einen Ton. Was er, so scheint es auf den ersten Blick, hervorbringt, ist Bewegung.
Aber erzeugt der Körper Bewegung? Bejahen wir die Frage, dann behandeln wir Bewegung wie einen vom Körper abgetrennten Gegenstand, wie ein eigenständiges Erzeugnis des Körpers. Damit würden wir übersehen, dass Bewegung nichts anderes ist als der Körper selbst in Bewegung. Bewegung als solche, also abseits eines bewegten Körpers, existiert nicht. Natürlich lassen sich Bewegungen von den Körpern, die sie ausführen, abstrahieren. Sie lassen sich beschreiben und formal notieren. Aber die in der Geschichte des Tanzes mühsam entwickelten Bewegungsnotationen sind nur choreografische Hilfsmittel, sie sind nicht der Tanz selbst – so wie sie nicht selbst Bewegung sind, sondern eben nur Notation von körperlichen Bewegungen.
Vielleicht verhält es sich also umgekehrt, und wir müssen unsere Vorstellung von Tanz revidieren: Nicht der Körper produziert Bewegung, sondern die Bewegung produziert den Körper. Zumindest in dem Sinne, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenkt. Sehen wir einen Körper in merkwürdigen, von unseren alltäglichen Bewegungsroutinen abweichenden Verrenkungen, werden wir seiner Körperlichkeit gewahr. Umgekehrt ignorieren wir dessen Körperlichkeit, wo er uns unbewegt erscheint oder in unhinterfragte Bewegungsroutinen eingebettet bleibt. Damit verweist der Tanzende, allein indem er tanzt, auf sich selbst als Körper. Tanz ist Reflexion des Körpers auf sich selbst. Jede seiner Bewegungen biegt diesen zurück auf ihn selbst und damit auf die Körperlichkeit des Bewegten.
Tanz ist also körperliche Selbstreflexion. Die akademische Philosophie besitzt kein Sensorium, um eine nicht-mentale Form der Reflexion registrieren zu können. Sie setzt Reflexion mit Kognition gleich und verankert diese im Inneren des einzelnen Subjekts: Denken als innerliche Kontemplation statt äußerlicher Exaltation. Das ist für die meisten Common Sense. Wie bei Rodin stellt man sich Denken als etwas Statisches vor. Dabei lässt sich doch am besten im Gehen denken, wie schon Aristoteles wusste, der seine Schule im Peripatos gründete, einer Wandelhalle Athens. Wir müssen uns Aristoteles als einen gehenden Philosophen vorstellen. So wie wir uns Nietzsche, dem jeder Tag ohne Tanz verloren schien, als einen tanzenden Philosophen vorstellen müssen. Denken entfaltet sich also in und durch Bewegung. Und doch hat sich das Klischee vom Philosophen als einem Sitzenden eingeschlichen, das Kinn auf die Faust gestützt, erstarrt und versunken ins Innere seiner selbst.
Überlassen wir das Innere unserer selbst der analytischen Scholastik, die heute die meisten Philosophieinstitute dominiert und sich immer mehr zu einem Zweig der Kognitionswissenschaft entwickelt. Zunehmend versteht sich Fachphilosophie entweder als ein sprachanalytischer Denksport, der Klarheit in unsere angeblich verwirrten Gedanken bringen soll, oder als Hilfswissenschaft der Life Sciences. Aber wen interessiert schon unser Inneres, wenn es auf biochemische Prozesse zurückgeführt oder in philosophische Kreuzworträtsel übertragen wird. Nichts davon hat mit Denken zu tun. Denken ist aus der kognitivistischen Schulphilosophie emigriert. Das muss ihm nicht zum Nachteil gereichen. Das Denken, das sich außerhalb institutioneller Mauern entfaltet, ist im Regelfall spannender als die in den Routinen des Wissenschaftsbetriebs erstarrten fachphilosophischen Debatten. Es ist auch erklärungswürdiger. Ohnehin ist ein Denken erklärungswürdig, das außerhalb des kognitiven Innenraums des Subjekts entsteht. Ein Denken in Bewegung, ja als Bewegung.
Einen wichtigen Schritt hin zum Verständnis von Denken als einer Form von Bewegung hat vor mehr als hundert Jahren Henri Bergson getan. In einem Artikel, der 1903 als Einführung in die Metaphysik veröffentlicht wurde, schlägt Bergson vor, uns in ein bewegtes Objekt zu versetzen, also die Position des Bewegten selbst einzunehmen, nicht die des Beobachters von Bewegung. Eines seiner Beispiele: Wir können noch so viele Fotografien einer Stadt nebeneinanderlegen, sie werden doch nie den »plastischen Eindruck« vermitteln können, den ein Spaziergänger von dieser Stadt gewinnt.1 Der Spaziergänger versetzt sich in den Gegenstand, er wird Teil der Bewegung, indem er sich selbst zu bewegen beginnt. Bergsons Spaziergänger, so könnte man sagen, wird zu einem neuen Diogenes. Der hatte den Sophisten Zenon, welcher bestritt, dass so etwas wie Bewegung überhaupt existiert, mit einer einfachen Demonstration widerlegt: Diogenes stand schweigend auf und begann zu gehen. Die praktische Widerlegung ist schlagender, als jede theoretische sein könnte. Die Bewegung selbst widerlegt die Sophisterei.
Kein Wunder, dass sich durch die Philosophiegeschichte eine Abneigung gegenüber allem Bewegten zieht. Das hat, Bergson zufolge, wohl nicht zuletzt damit zu tun, dass unser Geist nach festen Haltepunkten sucht. Unserem Geist »erscheint die Unbeweglichkeit klarer als die Beweglichkeit, der Ruhepunkt als primär gegenüber der Bewegung«, während doch in der Wirklichkeit die Bewegung der Unbeweglichkeit vorausgehe.2 Um einen Gegenstand denken zu können, meinen wir ihn festnieten zu müssen: »im gewöhnlichen Sinn des Wortes bedeutet ›Denken‹ über ein Objekt nichts weiter als von seiner inneren Beweglichkeit« abzusehen. Etwas denken heißt eine Reihe Standfotografien davon aufnehmen. Wohldefinierte philosophische Begriffe sind nichts anderes als Standfotografien. Sie dienen dem Zweck, »die Bahn des Werdens« abzustecken. Aber zum »Wesen der Dinge«, nämlich zur »innere[n] Beweglichkeit des Wirklichen« lässt sich auf diese Weise nicht vordringen: »Es ist erstaunlich, daß die Philosophen so oft das Objekt, das sie zu umfassen streben, entgleiten sehen wie Kinder, die mit der Hand Rauch festhalten möchten.«3
Begriffsarbeit alleine wird uns also nicht auf die Spur bewegter Körper bringen. Akademische Anstrengungen reichen nicht aus, um die Natur von Bewegung zu verstehen. Es gibt kein Mittel, so Bergson, »um mit der Festigkeit der Begriffe die Beweglichkeit des Beweglichen wiederzugewinnen«4. Philosophie stößt folglich an ihre Grenzen und übergibt an etwas, das Bergson als Intuition bezeichnet: an das intuitive Hineinversetzen in das Bewegte selbst. Allerdings bleibt Bergsons Begriff der Intuition, so wenig er ihn als »fest« verstanden wissen will, nach wie vor dem philosophischen Paradigma innerer Wahrnehmung verpflichtet. Intuition ist letztlich auch ein kognitiver Akt. Aber kann man sich kognitiv überhaupt in Bewegung hineinversetzen? Muss man sich nicht, will man sich in Bewegung hineinversetzen, in Bewegung setzen? Indem man, wie Diogenes, zu gehen oder, wie Nietzsche, zu tanzen beginnt?
In der zeitgenössischen Choreografie war in den letzten Jahren der Versuch zu beobachten, dem Wesen von Bewegung mit choreografischen Mitteln auf die Spur zu kommen, Tanz gleichsam auf sich selbst zurückzubiegen. Auf der Suche nach dem Wesen von Bewegung erhoffte man Antworten nicht von der Philosophie, sondern von der Choreografie. Paradoxerweise bedeutete das in manchen Fällen gerade den Ausstieg aus Tanz im herkömmlichen Sinn. Als »konzeptueller Tanz« oder »konzeptuelle Choreografie« wurde ein Trend bezeichnet, der seinen Höhepunkt in den 1990er- und 2000er-Jahren hatte und mit den Arbeiten von Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Eszter Salamon oder Boris Charmatz assoziiert wird.5 Deren Arbeiten sind charakterisiert durch hohe Selbstreflexivität, die Berücksichtigung der sozialen und politischen Kontexte, die Befragung des Dispositivs von Tanz (wie etwa des athletischen Körperideals) bis hin zur Abkehr vom menschlichen Körper als Medium des Tanzes.
Exemplarisch sei auf die radikale Arbeit Product of Circumstances von Xavier Le Roy verwiesen. Eingeladen zu einem theory event der Wiener Festwochen, beschloss Le Roy, weder Theorie noch im engeren Sinne Tanz zu präsentieren, sondern im Rahmen einer durchinszenierten lecture von seiner Ausbildung zum Molekularbiologen und – zeitgleich – zum Tänzer zu berichten. Dieser Bericht, durch den wir vor allem Informationen zu Le Roys Arbeit an seinem biologischen Dissertationsprojekt erlangen, wird immer wieder durch die Demonstration von Tanzübungen, die er parallel zum Biologiestudium absolvierte, unterbrochen. Dabei wird nicht nur der Werdegang eines atypischen Tänzers sichtbar gemacht, auch die Entstehungsgeschichte von Product of Circumstances selbst wird im Vortrag thematisiert. Wir erfahren also, wie es überhaupt zu dieser Arbeit, deren Aufführung wir beiwohnen, gekommen ist und was sich der Künstler dabei gedacht hat.
Einen ganz anderen Weg »konzeptueller Choreografie« beschreitet der vielleicht bedeutendste zeitgenössische Choreograf, William Forsythe. Forsythes Arbeiten verschreiben sich der Erforschung von Bewegung als solcher. Dient in Le Roys Product of Circumstance Tanz nur noch zu Demonstrationszwecken im Rahmen einer lecture performance, bleibt aber nach wie vor präsent, so entkoppelt Forsythe Choreografie immer wieder von Tanz und delegiert sie an sogenannte »choreografische Objekte«. In manchen Experimenten – wie etwa in White Bouncy Castle, wo eine Hüpfburg zum eigentlichen Choreografen der Bewegung wird – geht es noch darum, den Rahmen menschlicher Bewegungen durch Objekte modifizieren und Choreografieren zu lassen. Andere Arbeiten delegieren die Bewegung gleich an die Objekte selbst, wie in Black Flags: Zwei große Roboterarme wurden darauf programmiert, schwarze Fahnen raumgreifend zu schwenken. Das Ziel dieses Spiels mit choreografischen Objekten besteht darin, einen Erkenntniseffekt bei jenen zu bewirken, die sich auf dieses Spiel einlassen. Ziel ist es, wie Forsythe sagt, »eine akute Selbstbewusstwerdung innerhalb spezifischer Aktionsschemata anzustoßen«6.
Forsythes Anordnungen sind Bewegungsstudien. Zumeist besitzen sie eine praktische Komponente, denn sie müssen, sofern das choreografische Objekt sich nicht selbst bewegt, durch das Publikum aktiviert werden. Publikum und Objekt werden zu Ko-Choreografen. Manchmal überlässt Forsythe die Bewegung den Objekten, wie etwa in einem charmanten Videoloop mit dem Titel Analogon von 2024: Wir sehen sieben Erdbeeren, die in einer Schüssel von einem Wasserstrahl umhergewirbelt werden. Hatte ich eingangs Tanz definiert als Reflexion des Körpers auf sich selbst, so ließe sich mit Forsythe Choreografie verstehen als die Rückbiegung von Bewegung auf diese selbst. Die konkrete Bewegung – sei es die Eigenbewegung von Objekten, sei es unsere Bewegung mit Objekten – verweist zurück auf die Bewegtheit von Menschen und Dingen, so wie Tanz zurückverweist auf Körperlichkeit.
Ich vermute, dass Forsythe hier nur etwas explizit werden lässt, was Choreografie, wie auch Tanz, ja vielleicht jede künstlerische Praxis, wenn nicht ohnehin jede menschliche Praxis auszeichnet: nämlich den immer – zumeist stillschweigend – mitlaufenden Rekurs auf sich selbst. In einer bestimmten Handlung, gleich welcher, geht es nicht allein um deren konkrete Zwecksetzung, es geht immer zugleich um die Handlung als solche: Es wird immer auch der Handlungstypus – wie zum Beispiel Tanzen – und die Natur einer solchen Handlung mit-verhandelt. Im Fall des Tanzens würde die Frage also nicht nur lauten: Was tanzen wir? So zum Beispiel einen Tempeltanz, Schwanensee oder Cha-Cha-Cha. Die immer schon mit-verhandelte Frage lautet: Was tun wir, wenn wir tanzen? Unser Tanzen ist dann die praktische Antwort nicht nur auf die erste, sondern auch auf die zweite Frage. Anders gesagt: Jede Handlung ist immer zugleich ein impliziter Kommentar zu ihr selbst, ja eine diese Handlung – und sei es nur minimal – transformierende praktische Selbstinterpretation. Wann immer wir tanzen, beantworten wir tanzend die Frage, was Tanz überhaupt sei.
Auf dieser zweiten Ebene ist das Denken verortet. Denken, wie gesagt, nicht im kognitivistischen Sinn eines inneren Bewusstseinsvorgangs, sondern im Sinne des mit Praxis einhergehenden Selbstbezugs. Denken hieße dann Zurückbiegen einer Handlung auf sie selbst. Denken wäre ein Aspekt von Praxis, nicht von Kontemplation. Dazu müssen wir uns freilich von allem, was landläufig unter Denken verstanden wird, verabschieden. Wir denken nicht, oder jedenfalls nicht nur, mit unserem sogenannten Geist. Descartes hat bekanntlich in der Tatsache, dass »ich denke« (und damit auch zweifle) den Existenzbeweis dieses »ich« sehen wollen: Je pense, donc je suis. Brigitte Bardot war da schon weiter, als sie sang: Ich tanze, also bin ich. Je danse donc je suis. Der Existenzbeweis liegt im Tanzen. Aber Tanzen ersetzt nicht das Denken. Wir müssen Descartes mit Bardot lesen: Tanzen ist Denken. Denn Denken vollzieht sich keineswegs immer als ein mentaler Vorgang. Denken kann sich eben auch praktisch, in Gestalt auf sich selbst zurückverweisender körperlicher oder choreografischer Bewegung entfalten.
Das mag sehr abstrakt klingen. Um es nachzuvollziehen, benötigen wir, um mit Bergson zu sprechen, Intuition. Vielleicht müssen wir selbst zu tanzen beginnen. Aber unser Abstecher zur konzeptuellen Choreografie sollte zumindest illustrieren, dass Tanz und Bewegung auf sich selbst zurückverweisen. Die konzeptuelle Choreografie macht diesen Selbstbezug explizit. Aber letztlich benötigen wir dazu keine intellektuellen Experimente. Der bedeutende US-amerikanische Choreograf Jerome Robbins war alles andere als ein Verfechter konzeptueller Choreografie; er wird dem vergleichsweise traditionalistischen neo-klassischen Ballett zugerechnet. In seinem epochalen Ballett Dances at a Gathering, das er 1969 für das New York City Ballet Choreografierte, lässt Robbins einen Ballsaal des 19. Jahrhunderts wiederauferstehen: Nicht durch das Bühnenbild, die Bühne ist leer, sondern allein durch die Klaviermusik Chopins, zu der zehn Tänzer und Tänzerinnen alle zwischenmenschlichen Konstellationen ausloten, die sich auf einem Ball ergeben können. Nach der gefeierten Premiere begaben sich Publikum wie Kritik, die von Robbins Handlungsballette gewohnt waren, auf die Suche nach einem Narrativ. Was sollte hier erzählt werden? Robbins war schließlich so entnervt von dieser Suche nach einer Handlung, dass er die Zeitschrift Ballet Review bat, folgendes Statement abzudrucken: »THERE ARE NO STORIES TO ANY OF THE DANCES IN DANCES AT A GATHERING. THERE ARE NO PLOTS AND NO ROLES. THE DANCERS ARE THEMSELVES DANCING WITH EACH OTHER TO THAT MUSIC IN THAT PLACE.«7
In Dances at a Gathering geht es um nichts anderes als um dances at a gathering. Aber nicht in einem imaginären Ballsaal des 19. Jahrhundert, wie in einem Handlungsballett, sondern, so müssen wir Robbins interpretieren, auf dieser Bühne, zu dieser Zeit, von diesen Tänzern. Das »Gathering«, das Zusammenkommen, ist genau das der Tänzer und Tänzerinnen, wie es vor den Augen des Publikums stattfindet. Im strengen Sinn spielen diese auch keine Rollen – sie sind ohnehin nur durch den Farbcode ihrer Trikots etwa als »Brown Boy« oder »Apricot Girl« identifiziert. Sie tanzen, so Robbins, als sie selbst. Ganz so wie Xavier Le Roy auftritt als er selbst, um uns etwas von seinem Leben zu erzählen, tanzt Edward Villella – der »Brown Boy« in der ursprünglichen Besetzung – sich selbst, oder genauer: Er tanzt. Punkt. Es gibt keine Rolle, nicht einmal die des Edward Villella. Der Tanz verweist auf den Tanzenden, die Bewegungen auf dessen Bewegungen.
Doch ist damit nicht alles gesagt. Selbstverständlich tanzt Villella nicht alleine. Wenn es in Dances at a Gathering um etwas geht, dann um das Tanzen als versammlungsstiftende Praxis genau dieser gerade tanzenden Menschen. Es geht um deren Zusammenkommen im Hier und Heute der jeweiligen Aufführung.8
Das führt uns zurück zu unserer allerersten Beobachtung: Wir alle tanzen. Der Tanzende, das sind wir alle. Damit ist auch gesagt, dass wir niemals alleine tanzen. Das scheinbar solipsistische Tanzen mit sich selbst ist nur ein Grenzfall. Das Subjekt des Tanzens – der Tänzer im strengen Sinn – ist nicht das Individuum, sondern die Gesamtheit der zusammenkommenden Tanzenden. So sehr manche Tanzenden auch in sich versunken sein mögen, sie sind doch nie nur auf sich selbst und ihren eigenen Körper verwiesen. Sie sind immer auch auf andere Körper – auf ein tanzendes Wir – verwiesen. Der Tanz verweist auf den Körper, aber nie nur auf den eigenen. Er verweist auf einen zwischen den Tanzenden geteilten Körper. Tanzen ist eine kollektive Unternehmung, so wie Denken, streng genommen, eine kollektive Praxis ist.9 Brigitte Bardot vergriff sich mit dem Titel ihres Chansons. Korrekt hätte die Formel lauten müssen: Nous dansons, donc nous sommes. Wir tanzen, also sind wir. Und damit auch: Wir denken gemeinsam, also sind wir. Nur entkettet vom Innenraum des individuellen cogito – des »ich denke« – beginnen wir überhaupt zu existieren. Nur durch Bewegung können wir uns entketten und unserer individuellen Nichtexistenz entfliehen. Und zwar hin zur Mit-Existenz. Wir sind, sofern wir zusammenkommen. Nicht zuletzt tanzend.
Die letzte Szene von Dances at a Gathering liefert uns das utopische Bild eines zivilen Zusammenkommens. Eine Stunde lang wurden die Körper der Tänzer zu Walzern und Mazurken herumgewirbelt wie die Erdbeeren in Forsythes Schüssel. Nun kommt die Bewegung zum Stillstand. Nacheinander betreten die Tänzer und Tänzerinnen die Bühne und wenden sich dem Publikum zu. »Brown Boy« fasst mit einer Hand auf den Boden, so als wolle er sich versichern, dass die Bühne sich nicht länger dreht – auch wenn sich doch nur die Tänzer gedreht hatten. Deren Blick beginnt nach langen Sekunden des Stillstands langsam einem imaginären Objekt zu folgen, das sich am Horizont von der einen auf die andere Seite der Bühne zu bewegen scheint. Dann treten alle zurück und verneigen sich kollektiv voreinander, so wie sich Wohlerzogene nach einem Tanz beim Partner oder der Partnerin bedanken. Spielen sie dabei Rollen? Befinden sie sich in einem Ballsaal des 19. Jahrhunderts? Oder bedanken sich die tatsächlich Tanzenden bei ihren Kollegen und Freunden für eine Stunde gemeinsamer harter Arbeit?
Bevor sie paarweise abgehen, bilden die Tänzer und Tänzerinnen schließlich einen Kreis und bedanken sich ein weiteres Mal. Und wieder wird klar, dass es um das Tanzen und die Tanzenden selbst geht. Für diesen Moment spielt ein Publikum, dessen Applaus erheischt wird, keine Rolle. Die einzig relevante Bezugsgröße sind die Performer selbst, die zusammengekommen waren, tanzten, und sich nur voreinander zu verneigen haben – nicht vor irgendeinem Publikum. Und noch etwas anderes wird deutlich: Wir befinden uns in einem Raum der Utopie. Ein Ballsaal, jedenfalls idealtypischerweise, ist so ein utopischer Raum – auf sich selbst bezogen und isoliert von den Konflikten und Turbulenzen da draußen. Die einzigen Turbulenzen, die der Ballsaal kennt, sind die wirbelnder Körper.
Ob es so einen isolierten Raum überhaupt geben kann, ist fraglich. Aber dessen Bild kann es geben. Robbins zeichnet uns ein Bild der Welt als Ballsaal. Er, der als Choreograf allen Zeugnissen zufolge ein Tyrann gewesen sein muss, entwirft ein Bild des perfekten demokratischen Zusammenkommens.10 Aber auch hier wieder handelt es sich um mehr als nur ein Bild. Die Hierarchien zwischen den Tanzenden sind de facto aufgehoben. Dances at a Gathering ist ein Ballett ohne Solisten. Oder anders gesagt: ein Ballett, in dem das ganze Ensemble aus Solisten besteht und doch niemand Solist ist. Vielleicht liegt darin die größte Utopie, die Utopie einer Welt, in der sich das Selbst-Sein nicht im Mit-Sein auflöst. In der Körper, die zusammenkommen, nicht zu einem Kollektivkörper verschmelzen. In der wir alle gemeinsam Solisten sein dürfen und doch niemand Solist ist. Ein bisschen so wie in einem Ballsaal.
Kurzbiografie: Oliver Marchart
Oliver Marchart ist Professor für Politische Theorie an der Universität Wien. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen u. a. Demokratietheorie und politische Ästhetik, so etwa mit seinem Buch Conflictual Aesthetics. Artistic Activism and the Public Sphere (Sternberg 2019). Aktuell erscheinen: Post-foundational Theories of Democracy. Reclaiming Freedom, Equality, Solidarity (Edinburgh University Press 2025) und Der demokratische Horizont. Politik und Ethik radikaler Demokratie (Suhrkamp 2026).
02 - ZUHAUSE TANZEN - Über private und öffentliche Orte, Feminismus und Tanzen - Von Orly Almi.
Was bedeutet »Zuhause«? Eine Vorbemerkung
Für mich, als jüdisch-israelische Künstlerin, ist es seit dem 7. Oktober 2023 zu einem schwierigen Unterfangen geworden, über Tanzaufführungen, die in den Wohnungen von Privatleuten stattfinden, zu schreiben. Sowohl das Haus im Sinne von Gebäude als auch das, was wir unter Zuhause verstehen, haben ihre Bedeutung in einer Weise verändert, deren Ausmaße noch nicht absehbar sind. Einige meiner Freund*innen wurden in ihrem Zuhause angegriffen und haben ihre Wohnungen verloren. Sie und weitere hunderttausend Menschen in Israel ziehen seit einem Jahr von einem Ort zum anderen, weit entfernt von ihrem ursprünglichen Wohnort. Und im Gazastreifen mussten nahezu alle Menschen ihre Wohnungen verlassen, die meisten dieser Wohnungen sind inzwischen zerstört. Selbst die Notunterkünfte sind teilweise Zerstörungen zum Opfer gefallen. Inzwischen wurden auch Menschen im Libanon vertrieben und sind infolge dessen wohnungslos: Die gesamte Region ist für ihre Bewohner*innen nicht mehr sicher.
Auch mein Zuhause in Tel Aviv ist nicht mehr sicher. Es gibt hier keinen sicheren Bunker, in den ich flüchten könnte. In den ersten Monaten des Krieges wurden tagtäglich unzählige Raketen in die Richtung meiner Wohnung abgefeuert, und auch heute (September 2024) gibt es hin und wieder Abschüsse. Wenn ich Sirenen höre, suche ich Deckung im Badezimmer, lege mich schützend über meine Hunde, senke den Kopf, hoffe, dass es noch einmal gut gehen wird. Manchmal breite ich meinen Bademantel über mich aus, um einen möglichen Einschlag abzumildern. Danach setze ich mich wieder an mein Notebook im Wohnzimmer, in der Küche oder im Bett, wenn es nachts geschieht. Beim Schreiben dieses Textes wurde ich mehrmals auf diese Weise unterbrochen.
Ich habe vor Kurzem online einen Gaga-Tanzkurs11 absolviert, der Lehrer gab den Kurs von zu Hause aus und tanzte auf diese Weise in vielen verschiedenen Wohnungen weltweit, auch in meiner. In Gaga-Tanzkursen kommt das eigene Tanzen ganz am Schluss der Stunde, alle Teilnehmer*innen richten dann die Kamera auf sich selbst, damit der Lehrer konkrete Anweisungen geben kann – dabei werden auch die eigenen Wohnräume, in denen die Möbel so umgestellt wurden, dass man Platz zum Tanzen hat, für alle sichtbar.
Die Corona-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir über private und öffentliche Räume denken, und auch wie wir Kunst rezipieren und erlernen, verändert. Die Fragen, die ich hier eruieren möchte, beziehen sich aber nicht nur darauf, wie Technologie und Politik die Art und Weise beeinflussen, wie Kunst sich im Verhältnis zum Raum verhält. Ich möchte Fragen stellen, die vor der Pandemie relevant waren und es auch heute noch sind. Auf die Frage »Was bedeutet es, zu Hause Kunst aufzuführen?«, gibt es mehrere Antworten. Aber bevor ich auf einige der verschiedenen Aspekte (politische, geschlechterspezifische, persönliche und performative) vor dem Hintergrund meiner eigenen Aufführungserfahrung und meiner Masterarbeit12, die ich vor etwa zehn Jahren verfasst habe, zu sprechen komme, muss grundlegend konstatiert werden, dass die Annahme, dass Zuhause ein sicherer Ort ist, bezweifelt werden.
Der Angriff auf so viele Wohnungen am 7. Oktober hat das, was wir als Zuhause, auch im metaphorischen Sinne, begreifen, stark verändert. Für mich als Künstlerin, als jemand, der mit seiner Kreativität und seinem Körper arbeitet, als Tänzerin, als Frau, als jüdische Israelin, ist es geradezu meine Pflicht, daran zu erinnern und sich auch immer wieder selbst bewusst zu machen, dass es möglich ist, durch und mit unseren Körpern zu handeln, mit all ihren Verletzlichkeiten, dass wir darauf bestehen, dass Zuhause ein sicherer Ort – überall und immer – sein muss, in dem wir leben und tanzen können
Manchmal rolle ich nach den Raketenangriffen die Yogamatte aus, schüttle, stretche und bewege mich. Was wäre, wenn wir uns alle schüttelten? Welch tektonische Bewegung könnte entstehen, wenn Millionen von Israelis und Palästinensern ihre Körper erheben würden, nachdem die Erde von Raketen erschüttert wurde? Könnte das Tanzen auf dem Schutt unserer zerstörten Häuser eine Gegenbewegung erzeugen?
Zuhause – was wir darunter verstehen
Schließen Sie Ihre Augen für einen Augenblick, und konzentrieren Sie sich auf das Wort Zuhause. Was sehen Sie? Was riechen Sie? Was fühlen Sie? Was sind das für Stimmen, die Sie hören? Welche Gefühle rücken in Ihren Fokus, an was denken Sie? Wer ist da mit Ihnen?13
Selbstverständlich werden die Antworten stark von Ihrer sozioökonomischen Situation abhängen und von Ihren frühkindlichen Erfahrungen. Wie auch immer, wahrscheinlich kann man aber davon ausgehen, dass für die meisten Leser*innen zumindest einige der Gefühle und Bilder in irgendeiner Form mit Familie, sehr engen Freund*innen, mit Vertrauen und Sicherheit assoziiert werden. Zuhause ist in unserer Vorstellung ein sicherer Ort. Ein Ort, an dem wir Gefühle offenlegen können, an dem wir nicht mehr funktionieren müssen, wo wir verletzlich sein dürfen, uns ausruhen können, wo wir Hilfe erfahren, mal ein Risiko eingehen, unsere Masken und Rüstungen ablegen, ein Ort, an dem wir wir selbst sein können, mit all unseren Fehlern. Zu Hause zu tanzen bedeutet, mit all diesen Gefühlen und Eindrücken zu tanzen. Es bedeutet, dass man einer gewissen Verletzlichkeit Raum gibt, zwischen Tänzer*- und Zuschauer*innen, eine gewisse Intimität zulässt, die manchmal gezwungenermaßen zwischen Tänzer*innen und den Gastgeber*innen und ihren privaten Räumen entsteht; ebenso eine bestimmte Nähe durch Körper, Schweiß, Muskeln und Narben, deutlich sichtbar für alle Anwesenden.
Das Zuhause vieler Menschen, in vielen Teilen der Welt, ist ständig bedroht. In seinem Buch Homo sacer14 spricht Giorgio Agamben vom nackten Leben15. Wenn wir vom nackten Leben