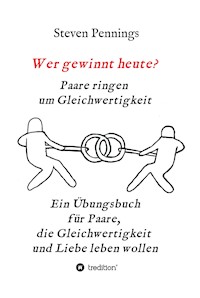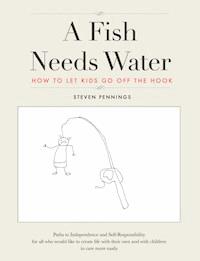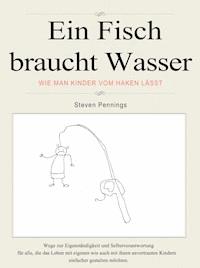2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meine Freunde bekommen und bekamen von mir, wenn die Gelegenheit reif dafür war, immer wieder einen Schwank aus meinem Leben zu hören. Oft bekam ich außer fasziniertem Zuhören das Feedback: „Wann und wie hast du das alles gemacht, wieviel Leben hast du?“ Gute Frage! Geschichten, die kurzzeitig hintereinander erzählt werden, bieten keine gefühlsmäßige zeitliche Orientierung – zwanzig Jahre verfliegen in einer halben Stunde. Buchstaben und Wörter in Sätzen schaffen dies eher! Deswegen dieses Buch in der Hoffnung, dass sogar Menschen von meiner Geschichte fasziniert sein werden, die ich gar nicht kenne. Sie mich dann schon, wenigstens ein bisschen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Steven Pennings
Dieses eine Leben hätte es auch getan
120 Jahre, gerade so!
© 2020 Steven Pennings
Autor: Steven Pennings
www.praxispennings.de
Umschlaggestaltung, Illustration: Steven Pennings
Lektorat, Korrektorat: Gudrun Müller-Reiners
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
Paperback:
978-3-347-19870-8
Hardcover:
978-3-347-19871-5
E-Book:
978-3-347-19872-2
Des Datenschutzes wegen nenne ich nur die Menschen, die nicht mehr unter uns sind, beim Namen.
Alle Aussagen und Bewertungen Personen betreffend, die in diesem Buch vorkommen, sind meiner persönlichen Wahrnehmung entsprungen und nicht bezogen auf objektive Fakten.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d- nb.de abrufbar.
Danksagung
Besänftigung der Protagonisten
Ich danke all den Menschen, mit denen ich positive und negative Erfahrungen machte. Sie haben gewollt und ungewollt zu meinem Wachstum beigetragen. Darüber hinaus bin ich dankbar dafür, mit meinen früheren Frauen verheiratet gewesen zu sein, bei denen ich viel über Paarbeziehungen lernen konnte. Genauso danke ich meinen tollen Kindern dafür, wie sie mit mir als Vater zurechtkommen: „Typisch Papa!“ Nicht zuletzt danke ich meiner jetzigen und letzten Frau dafür, dass sie mich liebt, ich sie lieben kann und vor allem mich geliebt fühle sowie dafür, dass ich bei ihr schon fünfundzwanzig Jahre lang meistens so sein kann, wie ich in gerade dem Moment gerade bin!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kinderheimkind
Krankenhauskind
Seefahrerkind
Arbeiterkind
Sozialarbeiter
Nach Deutschland
Wer sucht wird finden
Finale
Nachwort
Vorwort
Ein anderer Blickwinkel
Wenn Sie eine etwas mehr als zur Hälfte gefüllte Sprudelwasserflasche in die Mitte ihres Wohnzimmers stellen und drei Menschen im Abstand von ca. zwei Metern – einer stehend, einer sitzend und einer liegend – diese Flasche betrachten lassen, werden diese Menschen im Nachhinein (Vergangenheit) diese Flasche unterschiedlich beschreiben: mehr oder weniger Wasser gesehen; mehr oder weniger auf dem Etikett gelesen haben; unterschiedliche Farbwahrnehmung des Etiketts usw. Die Flasche selber hat sich jedoch nicht verändert! Unterschiedliche Perspektiven kreieren unterschiedliche Wahrheiten bzw. Wahrnehmungen. Im Alltag kommen noch erschwerend unterschiedliche Befindlichkeiten, Absichten und Personen hinzu.
Theoretisch kann Vergangenheit nicht geändert werden! Praktisch tun alle Menschen kulturübergreifend aber genau dieses immer wieder.
Auch ich gehöre dieser Gruppe an.
Personen, die in diesem Buch vorkommen, werden höchstwahrscheinlich mit mir zusammen je nach Perspektive eine andere Vergangenheit erlebt haben als ich und vielleicht mit der meinigen nicht einverstanden sein. Und auch Sie, der Leser, werden sich Ihr eigenes Bild machen! Trotzdem hoffe ich, dass Sie mitgehen auf diese Reise über so viele Lebensjahre und dann vielleicht den Steven der Gegenwart erkennen können!
Kinderheimkind
Gottes Wege sind nicht meine Wege
Der Samstag meiner Geburt war wettertechnisch besonders schön, klarer Himmel, 22,2 °C. Genau fünf Minuten nach neun Uhr - ungewollt und mehrere Wochen zu früh - startete ich am 23. August 1952 meinen Aufenthalt in diesem Leben. Zu früh irgendwo zu erscheinen habe ich bis jetzt hartnäckig beibehalten. Meine Mutter dagegen war und ist bis jetzt nicht davon begeistert! Sie musste sogar meinetwegen meinen Vater heiraten. Dies hat wiederum meine Mutter hartnäckig beibehalten, meinetwegen etwas tun zu müssen! Die erste Woche hatte ich wenig mit ihr am Hut. Schließlich lag ich in einem Brutkasten und bekam von ihr nur die abgepumpte Milch ins Gesicht geführt. Außer dass mein Bruder ein Jahr und drei Monate minus 3 Tage später gewollt geboren wurde, habe ich aus dieser Zeit keine Erinnerungen. Sie kann jedoch nicht sehr gut gewesen sein, da meine Eltern sich scheiden ließen; und meinetwegen – ich war nicht zu ertragen – kamen wir, mein Bruder etwas später als ich, obwohl wir jüdisch waren in ein christliches Kinderheim.
Ohne Erklärung von Seiten meiner Mutter wurde wir ins Heim “Sei ein Segen“ - was ich laut meiner Mutter ganz und gar nicht war - gebracht. Groß stand dieser Name an der Fassade des Hauses. Das war ja auch, wie sich später herausstellte, wirklich nur eine Fassade dieser Einrichtung. Erst drei Jahre alt war ich, als ich dieses Haus ganz unbefangen, da ich noch nicht lesen konnte, betrat. Wie sollte ich auch wissen, dass dieses Haus ein Kinderheim war und sich obendrein noch christlich nannte.
Schnell und schmerzlich genug fand ich heraus, was das hieß, christlich: Es hieß leiden und „jeder trage sein eigenes Kreuz“.
Wir Kinder standen am Tisch entlang und beidseitig am Kopf des Tisches saßen die Erzieher. So wie es sich gehörte beteten wir: “Gott segne diese Speisen.“ Im Allgemeinen bestanden diese aus warmer Milch mit altem Brot. Eine dicke, satt machende Suppe, für die mir sogar das Wort “scheußlich“ nicht passend erscheint. Sie war einfach zum Kotzen, was ich auch oft tat.
Vorstellen müssen Sie sich einen Tisch für erwachsene Leute, an dem Kinder zwischen zwei und sechs Jahren alt aufgereiht stehen. Ich konnte gerade mit meinem Kopf über den Tisch schauen. Das Erbrechen passierte, logischerweise, unter dem Tisch. Auch wenn die Erzieher es nicht merkten, Gott und die anderen Kinder sahen alles. „Igitt, der hat unter den Tisch gekotzt“, und bevor ich mich wehren konnte, saß ich im Brikettschrank unter der Treppe. Schwarz, dunkel und dreckig war es dort. Vor allem hatte ich Angst, obwohl Gott laut den Schwestern bei mir war. Oder vielleicht gerade deswegen. Vor lauter Angst pinkelte ich in die Hose. Er, Gott, sah es und sagte: „Du Schmutzfink“. Ich spürte schon seine Schläge und bekam sie später von den Schwestern. Zur Strafe musste ich dann oft noch eine Stunde länger im Schrank bleiben.
Ich sollte unbedingt doch zu dem lieben Gott auf meinen nackten Knien beten, dass er einen artigen Jungen aus mir macht. Jeden Tag, bevor ich ins Bett ging, tat ich dies. Es hat mir nichts gebracht, Gott sei Dank.
Die Kirche des Heimes, wo wir natürlich jeden Sonntag verweilten, war ein Teil eines Klosters, das schräg gegenüber dem Wohnhaus stand. Schräg im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Weg dorthin war für uns ein Bußeweg. Wir kleinen Sünder mussten ihn, der für uns unendlich lang erschien, in Stille gehen.
Mit gesenktem Haupt Demut zeigen und uns während dieses Ganges offen machen für die Liebe Jesu.
Manchmal klappte das nicht so. Vor allem, wenn wir Lachkrämpfe bekamen und daraufhin ziemlich “tatkräftig“ die Liebe Jesu spürten. So wurde der Gott, den ich kennenlernte, ein böser, rächender und nur selten auch liebender Gott. Liebend wurde er an dem Tag, als meine Mutter uns - meinen Bruder und mich - aus diesem Kinderheim holte und nach ein paar Monaten Zwischenstopp zu Hause “meinetwegen“ zu einem anderen Kinderheim brachte. “Sei ein Segen“ wurde kaum ein Jahr später aufgrund von Missständen geschlossen. Es wurde ein Heim für alte Menschen und vielleicht sogar ein Segen. Heute befindet sich an dieser Stelle eine Autobahn. Ich hätte mir gewünscht, dass man früher auf die Idee gekommen wäre, das Ding platt zu fahren.
Das zweite Heim war eine jüdische Einrichtung, wurde aber nicht wegen unserer jüdischen Wurzeln gewählt, sondern vielmehr, weil es das beste Kinderheim weit und breit war. Es lag ca. 3o Kilometer von Amsterdam entfernt, unmittelbar an einem Friedhof. Heute steht die “Bergstiftung“, wie es sich nennt, in Amsterdam.
An einem Montag, ich war gerade sechs Jahre alt, wurden wir zu diesem Heim gebracht. Unsere gottlose Zeit - die Zeit, in der Gott uns nicht aufgezwungen wurde - dauerte genau bis zum Abendessen dieses Tages.
Als der Tisch gedeckt wurde und ich, wie es sich so gehörte, mithalf, machte ich den unverzeihlichen Fehler, Frühstücksteller (Milchservice) anstatt großer Teller (Fleischservice) auf den Tisch zu stellen.
Es wurde mir erklärt, warum dies falsch war: Alle Services und alles Weitere, was damit zusammenhängt, sogar Tischdecke, Spültücher und Spüle, dürfen nur für entweder Fleisch- oder Milchmahlzeiten benutzt werden. Bei Verwechslung werden sie unrein und dürfen gar nicht mehr gebraucht werden.
Verstanden habe ich das damals nicht, nur “Ja“ gemurmelt. Schließlich war ich schon heilfroh, keine gelangt zu bekommen. Als Strafe musste ich die Teller im Mülleimer kaputtschmeißen. Das war mal eine “Strafe“! Ich habe mich noch des Öfteren vertan, bis der Gegenwert letztendlich vom Taschengeld abgehalten wurde.
Vor und nach jedem Essen wurde gebetet. Am Anfang fand ich das noch schlimmer als bei den Christen. Später, als ich mehr vom Hebräischen und den Hintergründen verstand, konnte ich etwas besser damit umgehen. Der Alltag, vom Beten beim Essen abgesehen, war in diesem Heim kaum durch Gott bzw. alles, was mit der Religion zusammenhängt, beeinflusst.
Bei der ersten Dämmerung am Freitag kam Gott hereinspaziert, vertreten durch seinen Rabbi (Rabbiner). Meine Unbekümmertheit war wie weggeblasen. Er kam wie der Wind und säte Sturm in mir: Erinnerungen an Schwestern gleich Gott, Recht und Ordnung waren, weil sie immer mit Strafe verbunden gewesen waren, noch sehr spürbar. Ich fürchtete mich! Er sagte aber: „Ich heiße Jichal, wie heißt du?“
Wahrscheinlich merkte er, dass ich Angst hatte, und sagte: „Nun ja, wenn du willst, kannst du es mir später erzählen“, machte die Kerzen an und brach das Brot, das schon fertig auf dem Tisch stand, sprach ein Gebet in Hebräisch und gab jedem ein Stück davon.
Dann nahm er das Salz, sprach noch ein Gebet, streute etwas davon auf sein Stück Brot und gab es weiter.
Als letztes nahm er den Wein, sprach wiederum ein Gebet, trank mehrere Züge davon und sagte mich anschauend, der sei besser als letzte Woche und reichte mir den Becher. „Komm, lass es dir schmecken, und wenn du fertig bist, reiche ihn weiter.“ Obwohl meine Angst noch nicht ganz verschwunden war, fühlte ich mich erheblich wohler als vorher. Vielleicht kam das durch seine Anwesenheit, vielleicht aber auch durch den Wein. Ansatzweise konnte ich, zum ersten Mal in meinem Leben, Gott mit einem Gefühl von Wohlbefinden verbinden. Abends wurden Geschichten aus der Thora — ähnlich wie das Alte Testament — erzählt, die ich zwar nicht verstand, die aber sehr spannend waren. Es wurde freitags abends für unsere Verhältnisse ziemlich spät. Toll war, dass wir vor dem Schlafengehen nicht zu beten brauchten, das scheint wohl nur zum Christentum zu gehören.
Samstags morgens trafen alle aus dem Heim sich in der Sjul — „Schule“ oder für Sie, die dies lesen, auch wenn das nicht ganz genau stimmt „Synagoge“. Die Sjul war und ist tatsächlich eine Schule, weil dort nicht nur Gottesdienst gefeiert, sondern auch Unterricht gegeben wird. Übrigens stammt das deutsche Wort Schule vom hebräischen Sjul ab. Wenn Herr Hitler das gewusst hätte…? Ich weiß, Klugscheißer!
Komisch sah es dort schon aus, die Männer und Jungen auf der einen und die Frauen und Mädchen auf der anderen Seite der Sjul.