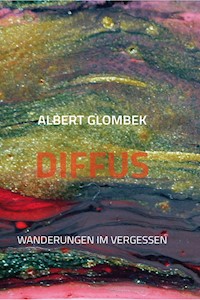
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem alternden Protagonisten ist "Vergessen" im doppelten Wortsinn vertraut. Er ist vergesslich. Und er erfährt, dass er immer weniger die Dinge des Lebens ergreifen ("to get") und festhalten kann. Sein Innenleben ist unstet, gleichsam verflüssigt, es verfließt in Augenblickswahrnehmungen und wird zugleich davon bereichert. Seine Gedanken "diffundieren". Sein Erleben driftet aus dem Normalen, es ist ruhelos und faszinierend wie seine Wanderlust. Seine Beobachtungen, Erinnerungen und zeitkritischen Statements folgen keinem Handlungsfaden und keiner thematischen Anordnung - eher evozieren die andauernden Übergänge und Wiederaufnahmen verschiedenster Motive und Tonlagen etwas wie einen musikalischen Eindruck: von Auflösung und doch auch Lebensintensität .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diffus
Titel SeiteTitel Seite
Albert Glombek Diffus - Wanderungen im Vergessen
Impressum
Texte: © 2021 Copyright by Albert Glombek
Umschlag: © 2021 Copyright by Stefan Pangritz
Pouring-Art-Vorlage: Lucia Glombek
Verantwortlich für den Inhalt: Albert Glombek, Brühl
Druck: epubli / Neopubli GmbH, Berlin
In Erinnerung meiner Mutter
„vergessen“
Dieses komplexe Verb (mhd. vergezzen, ahd. firgezzan) besteht aus der Vorsilbe ver– (bzw. deren Vorläufern), die die Bedeutung des darauf folgenden Wortes ins Gegenteil verkehrt, und einem einfachen Verb, dessen Ursprung in idg.*ghed– „fassen, ergreifen“ liegt und das heute noch in engl. to get „bekommen“ fortbesteht, demzufolge ist von einer Grundbedeutung wie etwa „aus dem (geistigen) Besitz verlieren“ auszugehen.
(www.wissen.de/wortherkunft/vergessen)
Meine Gedanken diffundieren, dachte er.
Ihm war oft zumute wie beim Wandern. F. ging gerne. Wenn möglich, wenn er Lust hatte, machte er auch Alltagswege zu Fuß – dem Stillstand ausweichen. Immer wieder Versuche, der Bewegungsbeschränkung nicht vollends nachzugeben, dem Älterwerden, dem späten Erwachsenenzustand, in dem man Seins gefunden hat oder auch nicht. Aber es schwant einem, dass so viele neue Seiten nicht mehr aufgeschlagen werden. Nur lauter fragmentarische Ideen und Impulse, wie Blitze eines unaufhörlichen, fernen Gewitters, die zu nichts führen. Damit brachte F. nichts zustande. Erstaunlich schmerzlos hat das Innere Eigenschaften abgeschlagenen Holzes angenommen, eines starken Astes am Boden, noch eine Zeit lang kleine Knospen austreibend … das, was nach seiner Erinnerung doch grün wuchs und jedenfalls ins Kraut schoss; wie man sagt. Das Innere, das Äußere?
Vielleicht dachte er so.
Die Selbstverständlichkeit einer Zukunft verblasste. Natürlich hatte F. Quasi-Ziele, bei Besorgungen außer Haus, auch bei seinen Wandertouren. Er ging recht zügig – also ging er irgendwo hin, irgendwo lang. Er machte kaum Pausen. Was geschah, wenn er so ging? Was ging in ihm vor? Seine Aufmerksamkeit dockte an, wohin gerade sein Blick fiel, manchmal kaum einen Atemzug lang, manchmal länger. So blickte er umher. Ohne Absicht, ohne Kontrolle beschäftigte ihn, was er sah – zumindest manches.
Auch in einem dementen Menschen ist unablässig irgendetwas tätig, sagte ihm ein Vorgefühl. Die Gedanken kommen nicht zur Ruhe, trotz Fehlschaltungen im Gehirn und abnehmender Energie des Organismus. Wie getrieben verfallen sie dauernd auf etwas Weiteres. Kein vernünftiges Nachdenken, nur ein Herumdenken.
So wie F. herumwanderte: meist keine Wandertouren mit geplantem Verlauf, bekannten Sehenswürdigkeiten rechts und links. Die Art der Bewegung selbst war das Ausschlaggebende, nicht irgendetwas, das man „davon hatte“, etwa eine Leistung, ein lohnendes Ziel, ein Zuwachs an Erfahrung, Selbstertüchtigung. Das bloße Weitergehen war ein Selbstzweck, ein Selbstläufer – einschließlich der ihn unwillkürlich einnehmenden Wahrnehmungen, einschließlich eines intensiven, benommen machenden Strömens der Umgebung. Draußen zu gehen hatte für F. wenig mit einem Sinn darüber hinaus zu tun, es war fruchtlos; und dennoch nicht vollends totes Holz. Er erwartete keine Highlights, es ging nicht um einen Trainingsgewinn. Nichts motivierte ihn, seine Erlebnisse in eine Bewertungsskala einzutragen oder ihnen irgendwelche Kriterien zuzuordnen. Nach einer gewissen Zeit unterwegs, zwei oder drei Tagen, gelangte er in eine mentale Verfassung, die gänzlich außerhalb von Plus und Minus lag. Vielmehr erwies sie sich als offen für alle möglichen Qualitäten des Erlebten, die er nicht recht bezeichnen konnte. Doch dabei fühlte er sich wohl: zu gewärtigen, dass es jeweils wieder ganz anders wurde – oder nur ein wenig anders. Mit dem Vorbeistreichen der Tage, Stunden und Augenblicke bot er ohne Widerstand dem Wechsel in seinem Bewusstsein Raum. Bewegung war sein Ort, ähnlich den allerkleinsten Elementarteilchen, die eigentlich gar keine richtigen Teilchen mehr waren. Er nahm das „Zwischen“ als etwas Positives, als das Gegebene an – das ihm zufließende wie entgleitende Schöne und das, was ihn weniger angenehm berührte.
Diffundieren – das hieß für ihn auch: nicht verbleiben, nicht festhalten am Bisherigen, nicht bestehen auf Gewesenem. Nicht einmal: ein Lebensziel setzen und darauf zu halten, sich auf eine bestimmte Zukunft ausrichten, eine Entwicklung unterstellen, sich selbst und die Welt im Hinblick auf etwas räumlich, zeitlich, geistig Folgendes verstehen wollen. Derartige Impulse zerflossen für F. mehr und mehr, flossen auseinander, versiegten, verloren sich und mischten sich, füllten sich anders an im und aus dem Jetzt – „jetzt“ nicht als besonderer Punkt auf einer Linie, sondern als „bloß dasein“: als gerade eben leben und nichts sonst. Bei Kindern, im Spiel, beim Wandern, im selbstverlorenen Betrachten, darin erkannte F. sein Altersbefinden wieder, seine Löslichkeit, sein nomadenhaftes Bewusstsein: nicht zu siedeln, nicht seine Umgebung nach eigener Fasson einzurichten, sondern sich im Augenblicklichen, im Vorübergehen, im Fließen zurechtzufinden; Bewegung, Auftauchen und Verschwinden als recht zu empfinden, als das Seine und doch weder besitzbar noch beraubbar. Sich aufzumachen oder eher: längst unterwegs zu sein, immer Neuem zugewandt zu sein; nicht die unzähligen feinen Spinnfäden zu zerstören und von sich zu wischen, wohl aber die Taue zum Vergangenen zu kappen – das hatte er als beatmend zu empfinden gelernt, wenn ihn auch jeweils ein gerade ansetzender Schnitt schmerzte.
F. mochte dieser Vorstellung Platz geben: Nomaden warfen dem Gestrigen nichts vor, wenn sie weiterzogen. Und sie überhöhten das Kommende nicht, weder als Befreiung noch als Beeinträchtigung. Der vergangene Tag und auch der nächste Monat löste nichts ein. Das Vergangene war nicht schuldig und schuldete dem Weiterziehenden nichts, wie dieser auch dem Zurückgelassenen nichts schuldete. Sesshaft sein dagegen hieß sich eingraben, sich in die Scholle graben, Besitz ergreifen, ihn festhalten, sichern, beherrschen, erweitern, Macht ausüben, überlegen sein. F. meinte diesen Typus bereits an der „Handhabung“, am Anfassen einer Sache zu spüren. Packte man Dinge als etwas Schweres, Klotziges an, dem man mit harter Hand beikommen musste, einem steinernen Brocken, einem Gerät, der Hand eines anderen; oder suchten die Hände nach Lebendigem, Blutvollem, Fließendem, das sie zulassen, aber dann wieder loslassen und es gelassen sein lassen konnten?
„Lassen“ – F. hing dem Klang nach; wie dem alten Lied der wandernden Handwerksburschen, die immer wieder Abschied nehmen mussten, von der Werkstatt ihres Meisters, von dem geliebten Mädchen. Waren sie dabei gelassen? Fühlten sie sich verlassen? Waren sie unzuverlässig?
Manchmal, wenn F. keinen Halt fand, spürte er Worten nach, um sich einem trudelnden Absturz entgegenzustellen. Wollte, konnte denn der Wanderer eingebunden sein in eine vorgefundene Wirklichkeit? Oder war er allein, „der Welt abhanden“? Fühlte er Leid oder Freud, da er weiterzog? Verlor er allen wirklichen Bezug zu anderen? Entzog sich ihm die Realität oder war es umgekehrt? F. konnte dieser Unsicherheit wenig entgegensetzen. Vielleicht, so versuchte er sich zu fassen, glich das Nomadendasein Ausschläge des Lebensgefühls aus, nach oben ebenso wie nach unten. Wanderer fanden irgendwann ihren Schritt und damit einen gewissen Gleichmut und guten Mut. Auch wenn ihnen etwas weh tat, sie konnten sich nicht vom Weitergehen dispensieren. Es gab nichts, auf das sie sich sonst verlegen konnten. Immerhin waren sie sich selbst nahe, indem sie ihrer seelischen und körperlichen Belastbarkeit und Aufnahmefähigkeit gewahr wurden. Sie waren sich des Trostes sicher, abends irgendwo ruhen und morgens wieder losziehen zu können. Und sie waren freundlich und kamen einander entgegen, waren offen, hilfsbereit. Es freute sie, ihre Erfahrung oder sonst Brauchbares weiterzugeben. Sie saßen nicht auf dem Ihren. Was hatten sie schon? Was sollte man ihnen nehmen wollen? So mochte es auch zur Jahrtausende alten Gastfreundschaft ungesicherter Menschen gehört haben: Solidarität, gegenseitige Hilfe, Freundlichkeit, Interesse füreinander, Wertschätzung, Sympathie, ohne zu kalkulieren, ohne Pflöcke in den Boden rammen zu wollen. Was hätten sie auch von festen Zäunen?
F. nahm seine Labilität hin und zog jedenfalls nicht das gerahmte Denken und die kanalisierte Lebensform vor, die er bei so vielen zu erkennen meinte. In seiner Welt gab es Bedeutung ohne Herleitung, Klarheit ohne Übereinstimmung mit irgendetwas: die Farben eines Kiesels, das Licht an einem verhangenen Vormittag, die kaum wahrnehmbaren Fältchen um den Mund einer jungen Frau. Das sich ihm gerade Eröffnende hatte den stillen und doch erregenden, manchmal fast rauschhaften Reiz eines jetzigen, eines erstmaligen Erlebens, selbst bei desillusionierender, niederdrückender, wunder Tönung. Es waren Augenblicke einer neuen Öffnung von Welt und Selbst aufeinander zu, ein kurzes Ineinanderwachsen.
Das Alte, Zurückgelassene erklärte ja nichts wirklich. Aber es verlor auch nicht das Gewicht und den Glanz des ehemals Gelebten. Was F. mit den verschiedensten Menschen, Orten, Situationen zusammengebracht hatte, war seiner Verfügung, meist auch seiner detaillierten Erinnerung entglitten, und dennoch war es nicht einfach weg und wertlos, entkerntes Geschehen, hingeworfenes Kostümteil einer abgesetzten Theatervorstellung. Wenn alte Menschen die Vergangenheit vergolden, wenn sie Kindheitserlebnisse in wundervollem Licht sehen, meinen sie ja auch nicht, es handle sich dabei um haltbar in Stanniol eingepackte Inhalte, die man in alter Form wieder vor sich ausbreiten könnte. Sondern sie spüren das Schwebend-Unverwüstliche, das zu ihnen Lebenden gehört. Man wird seines Lebens gewahr: der Tatsache, zu leben. Töne seiner Lebensmelodie stellen sich ein, Helligkeiten, undeutlich und doch schimmernd.
Wenn F. durch Wald und Felder lief, startete er naturgemäß auf einem vorhandenen Weg in eine bestimmte Richtung. Bei einer Gabelung entschied er sich, diesen oder jenen Abzweig zu nehmen. Aber immer wieder und oft zum Verdruss eines Mitwanderers trieb es ihn an irgendeiner Kreuzung, nicht den einen oder den anderen Weg zu gehen, sondern querfeldein ein Durchkommen zu finden: sei es, dass der eine wie der andere Weg ihm nicht gefiel, sei es, dass er sich eine Abkürzung versprach. Vielleicht trieb ihn ein Widerwille gegen vorgegebene Routen, vielleicht lockte ihn „die Wildnis“.
Jedenfalls handelte es sich bereits um eine familiäre Prägung. Seine Geschwister und er waren von Kindheit an gewohnt, mit ihren Eltern „ins Grüne“ zu fahren und einige Stunden zu wandern. F. erinnerte sich daran, dass sie und am meisten seine kleine Schwester alle Ermüdung vergaßen, wenn sie vom vorgegebenen Weg abgingen. Dann erlebten sie Abenteuer: ein kleiner Bach mit Krebsen oder zum Stauen, eine Stelle mit massenhaft reifen Blaubeeren, ein Reh oder Wildschwein unweit im Gebüsch verschwindend, ein herausfordernder felsiger Abstieg, ein Ochse, der ihnen auf der Weide, in die sie eingedrungen waren, langsam mit gesenktem Kopf entgegenkam. Manchmal erst nach längerem Suchen fanden sie wieder einen sicheren Weg, abgekämpft, durstig, mit Schrammen an den Beinen und mit blauen Mündern.
F. ging nicht gern auf breiten geraden Wegen und fand auch die Wahlmöglichkeiten bei Weggabelungen viel unbefriedigender als verschlungene, kaum erkennbare Pfade und ungespurtes Gelände. Er mochte nicht Spur halten.
„Diffundieren“ kann bedeuten: auseinanderfließen. F.s Gedanken blieben nicht zusammen.
Er wanderte offenen Sinnes, wahrnehmungsdurstig, aber unausgerichtet, zerstreut. Er sah das Eine oder das Andere, das Unzählbare und Unerzählbare, was weit und nah und ganz nah zu sehen war: die Bodenbeschaffenheit und die Form eines Steins, die Ferne und den Himmel, Pflanzen und Getier, Abfall und sonst Menschengemachtes rechts und links. Es drängte ihn nicht, Zusammenhänge zwischen all dem zu bilden oder Bedeutungen zu suchen. Er nahm es bloß auf, auch wenn er auf einsamen Wegen Menschen begegnete.
Auf einem schweißtreibenden Pfad im Apennin traf F. ein älteres Ehepaar. Sie trug den leichten Rucksack und ging voraus. Man grüßte, fragte sich gegenseitig nach dem Weg. Dann kam ihr Mann dazu, grauhaarig, blass, seine Schritte wirkten fast greisenhaft unsicher, er trug eine knielange Hose, Kniestrümpfe und Bergschuhe. Sie hatten ein Gutteil des anstrengenden Aufstiegs hinter sich. Er sprach kurzatmig und nuschelnd mit trockenen Lippen. F. schätzte, dass sie noch mindestens hundert Höhenmeter vor sich hatten. „Wenn das noch länger so weiter geht… das habe ich dir eben gesagt… da kriegst du mich nicht rauf“, grummelte der Alte. Natürlich gab es keine Alternative. Mit einem kaum hörbaren „Na ja!“ hatte sich seine Frau schon wieder auf den Weg gemacht, merklich rücksichtsvoll gemessenen Schrittes. Der Alte setzte hinterdrein wieder zu seinen Trippelschritten an. Dabei grinste er fast jungenhaft hinter seinem langen schütteren Bart, als er an F. vorbeiging.
Einmal verfolgte F. in einer bergigen Wald- und Weidelandschaft nach Gefühl ohne festen Weg eine ungefähre Richtung. Fast hatte er zwei kleine Seen erreicht, die kaum jemand an diesem spätsommerlichen Vormittag aufsuchte, da traf er auf einen etwa gleichaltrigen Mann. Der saß nahe bei einem leeren Parkplatz auf einem Mäuerchen und schaute in die Gegend. Sie grüßten sich und kamen ins Gespräch. Dieser Mann wusste alles über die nähere und weitere Umgebung. Er war Rentner und fuhr mehrmals die Woche hinaus in diese Bergwelt, einfach, um dazusitzen, sich daran zu erfreuen, um dort die Zeit verstreichen zu lassen; oder er wanderte umher. Weit und breit schien er jeden Pfad gegangen zu sein. Es stellte sich heraus, dass er in seinem weiter abgestellten Wagen eine Unzahl ungeordneter Informationsblätter und kopierter Kartenausschnitte hatte, die er gerne weitergab. Nebenbei und sozusagen pflichtgemäß empfahl er F., der nur einen Zwischenstopp auf der Durchreise eingelegt hatte, einige beliebte Touristenattraktionen und schöne Stellen in der Gegend aufzusuchen. Eigentlich pries er aber nur, in dieser grünen, gestaltenreichen Berglandschaft die wunderbare Luft zu atmen und auf seiner Haut zu spüren.
An einem anderen Tag ging F. einen langen Weg in schwüler Hitze durch weit sich hinziehende Gärten und Felder: gefällig, unspektakulär, auf Dauer ein wenig benebelnd. Er freute sich auf einen Brunnen am Straßenrand, dessen frisches Wasser man trinken konnte, wie er auf dem Hinweg gesehen hatte. Näher herangekommen ging er langsamer, denn da standen schon zwei Wanderer, die sich erfrischten, ihre Trinkflaschen auffüllten, Gesicht und Arme unter das Wasser hielten. Ein junges Paar. Beide hatten ihre Rucksäcke nicht abgelegt, vielleicht um – ausgedürstet – keine Sekunde zu verlieren, ihren Durst zu löschen. Er, auf Anhieb sympathisch, wohl Mitte zwanzig, hatte ihr den Vortritt gelassen. Auf F.s Gruß in Landessprache reagierte er undeutlich, zurückhaltend, der Sprache nicht mächtig. Die junge Frau, die ihren Kopf ganz unter den Wasserauslauf gehalten hatte, richtete sich auf und half mit einer passenden Antwort aus: das Bild einer elektrisierend schönen, freundlichen, schlanken, südländischen jungen Frau. Während sie sprach, sammelte sie ihre klatschnassen schwarzen Haare und versuchte sie unter ihrer Kappe zu bändigen. Über ihren Rucksack hing ein Tuch, wohl um es in der Sonne zu trocknen. Schnell stellte sich heraus, dass man nicht in der Landessprache radebrechen musste, sie war eine Deutsche. Sie wanderten schon tagelang, teilweise mit alpinen Strecken- abschnitten, jeden Abend zu einer neuen Unterkunft. Unter dem als Sonnenschutz übergehängten Tuch machte sich ein Baby bemerkbar. Es war vier Monate alt und wurde noch ganz gestillt. Die beiden wollten nun weitergehen, damit ihr Kind nicht wegen der unterbrochenen Gehbewegung der Mutter unruhig wurde. Der Vater, Argentinier, hatte nicht viel gesagt. Er trug den riesigen Rucksack.
Weil es hier unsicher war, einfach eine Richtung zu wählen, die ihn aus unklaren Motiven anzog – oft endeten auch aus-gezeichnete Wanderwege im Gestrüpp oder vor einem eingezäunten Privatgrundstück –, wanderte F. Teilstrecken des Franziskus-Weges. Auch dessen Markierungen waren zuweilen enigmatisch. Es gab aber auch nicht zu verfehlende breite Karrenwege. Auf einem abgelegenen Bergrücken hatte einmal ein Eremit gelebt, so hieß es. Jetzt gab es da eine leere Kapelle und ein leeres Steinhaus auf einer recht gepflegten Wiese, wohl als Schutzhütte für Wanderer bei schlechtem Wetter oder als Wallfahrtsziel errichtet. Kein Mensch war da. F. aß und trank etwas, legte sich auf eine Holzbank, schloss die Augen und hörte nur den schwachen Wind. Irgendwann näherten sich von fern Motorengeräusche, wurden schnell laut und aggressiv. Drei Motorradfahrer auf schweren Maschinen in ihrem martialischen Lederzeug fuhren auf der Wiese kaum zwei Meter an F. vorbei, hielten einen Steinwurf entfernt abrupt nebeneinander an, standen da vielleicht eine Minute, ließen die Motoren aufheulen und verschwanden in einen Waldweg.
Vor einer Fährüberfahrt standen Fahrzeuge in langer Schlange, Personenwagen, aber hauptsächlich Lastwagen und Busse mit internationalen Kennzeichen. Sich an ihnen vorbeischlängelnd fuhr an der Kontrollschranke eine Radfahrerin in studentischem Alter vor: Profirad, auf dem Rücken ein kleiner Rucksack, leichte Kleidung. Die zurückliegende Anstrengung war ihr anzusehen. Sie lachte, vielleicht verstand sie die Erklärungen des Beamten an der Schranke nicht, vielleicht merkte sie, wie sonderbar in der dichten Reihe der großen Trucks eine abgekämpfte, aber unerschrockene amazonenhafte junge Frau wirkte, die in kurzem Sportdress dastand und ihr Rad hielt. Die Vierundzwanzigjährige hatte ihre Arbeit bei einer Entwicklungshilfeorganisation in Brüssel aufgegeben und fuhr nun ihre Mutter in Sizilien besuchen. Dazu hatte sie für die letzten siebenhundert Kilometer auf dem Landweg als Herausforderung an sich selbst das Rad gewählt. Sie war oft stark befahrene Landstraßen gefahren. Nur wenige als fahrradgeeignet ausgewiesene Teilstrecken hatten sich angeboten, die aber manchmal kaum für einen Jeep passierbar gewesen wären. Jeden Tag machte sie um die hundert Kilometer, großenteils durch bergige oder hügelige Landschaft, immer wieder bei Regen. Ja, manchmal sei sie an ihre Grenzen gestoßen, mit dem Rad gestürzt, das ganze Bein aufgeschürft, völlig durchnässt, habe dagehockt und geweint, vor Hunger habe sie sich auf Obst aus den Gärten am Wegrand gestürzt, salutiert vom fröhlichen Hupen und Johlen junger Männer in vorbeifahrenden Autos. Sie wolle jetzt ein paar Wochen bei ihrer Mutter verbringen. Danach am liebsten eine Tätigkeit in einer Selbsthilfeorganisation in Afrika.
In einem Dorf am Hang des Ätna kam F. ins Gespräch mit einem Zimmerwirt. Inbrünstig bestand dieser darauf, der Vulkan sei keine Naturgefahr, sondern eine Respekt fordernde Persönlichkeit. Schon immer dagewesen, von niemandem abhängig, gewähre er den Bewohnern großzügig Gastrecht, fruchtbares Land, unvergleichliche Schönheit. Er lasse unaufhörlich die maßlose Kraft seines Eigenlebens spüren, aber er habe noch nie und zu keiner Zeit das Leben eines Menschen angetastet. Wer hier lebe, liebe ihn und sei ihm dankbar. Ihm wegen seiner häufigen Eruptionen gram zu sein, sei so absurd wie einem Rettungsschwimmer vorzuwerfen, den Geretteten nicht trocken an Land gebracht zu haben.
Wenn ihm solche Begegnungen in Erinnerung kamen, fühlte F. seine Stimmung derjenigen von alten Männern verwandt, wie man sie vor einem griechischen Kafenion oder in einer tunesischen Teestube sah. Sie saßen ohne weitere Ansprüche auf kleinen Holzstühlen, manchmal allein oder in einer Reihe mit ihresgleichen, und schauten ohne sichtbare Reaktion zu, was sich vor ihnen abspielte: Straßenverkehr, Passanten, die wenigen Männer, die ein und aus gingen. Vielleicht erhob sich einer einmal, besorgte irgendetwas innerhalb oder außerhalb des Lokals, kam schlurfenden Schrittes zurück und setzte sich wieder. Einige waren mit gesunkenem Kopf eingenickt und dösten vor sich hin. Sie wirkten weder angespannt noch gelangweilt oder in irgendeiner Weise darbend, auch wenn in ihre Körperhaltung und in ihre Bewegungen ihr vorgerücktes Alter deutlich eingeschrieben war. Sie guckten und schliefen und verbrachten den Tag.
F. hielt beim Wachwerden manchmal seine Augen geschlossen. Dann konnte es sich anfühlen, als ob auf den Lidern ein leichter, behütender Druck läge. Fast, empfand er, waren seine Augen wie zugeklebt und er würde seine Lider nur gegen einen leichten Widerstand anheben können. Er blieb auf dem Rücken liegen und vernahm das Innere seines Körpers, seines Unterbauchs, seines Brustkorbs, aber auch das Blut in seinen Adern und die Regungen der Haut und Muskulatur. Zunehmend spürte er all das wie ein ruhiges, warmes Wogen in tiefen Tiefen des Meeres. Er wollte lieber da hineinsinken, in eine unergründliche Leiblichkeit und Lebendigkeit, und nicht die Außenwelt – die Realität – wie eine kantige und flächige Last auf Brustkorb und Stirn fühlen. Von Grundströmungen bewegt fluteten ihn in solchen Minuten überreichliche Erscheinungen an, von denen er keine wirklich fassen und in irgendetwas einordnen konnte. Aber es waren keine schimärenhafte Traumbezirke, es handelte sich um sein Leben.
Und dann überwand er jenen sachten Widerstand, konnte es jetzt richtig finden, den Augen das Ihre zu geben, nämlich zu sehen, sich mit Einverständnis einzureihen in all das, was da war, und darin – kaum bewusst – eine Art von Heimeligkeit zu erleben. Er atmete unwillkürlich langsam, in kleinen Zügen, mit Abständen. Er hielt die Luft an, gab dann dem zarten Impuls nach, die eingehaltene Luft auszuatmen, fühlte den Moment der angenehmen Leere in seinem Leib und darin seinen Pulsschlag. Dann folgte er seinem Einatmen – selbsttätig einströmend, als wenn ein kleines Gefäß in einen See getaucht wurde, ohne es ganz volllaufen zu lassen.





























