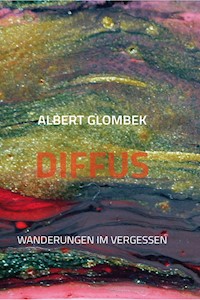Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch ist mit der Frage nach der Vergänglichkeit oder „Ewigkeit“ seines Lebens konfrontiert. Erreicht die „Linie“ der persönlichen Lebenszeit im Tod eine Art „Endstation“, von der aus es dann auf einer Schiene mit anderer Spurweite weitergeht, als „Leben nach dem Tod“ oder „ewige Seligkeit“? Oder verschwinden wir einfach aus der Welt in ein Nirwana? Unsere Antworten hängen oft von den aktuellen Lebensumständen ab: Konfrontiert mit dem Tod im persönlichen Umfeld, versuchen wir uns gerne zu trösten mit mehr oder weniger religiös ausgeprägten Vorstellungen eines verwandelten Weiterlebens „im Himmel“. Ohne unmittelbaren Bezug zu einem Sterbeereignis kappen wir in der Regel diese Perspektive und halten uns an die „entmythologisierte“ Lebensrealität. Albert Glombek zeigt in seinem Buch einen Weg aus diesem Dilemma auf, indem er einen Ewigkeitswert unseres konkreten, endlichen Lebens in den Blick nimmt, den es wahr-, an- und entschieden ernst zu nehmen gilt. Zur Entzifferung dieser „geheimnisvollen“, zeitüberhobenen Dimensionen des tatsächlichen Lebens lässt sich Glombek leiten und inspirieren von literarischen und philosophischen Texten, z.B. eines Thomas Mann, Max Frisch oder Samuel Beckett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albert Glombek
›ewig‹ lesen
Eine philosophisch-literarische Spurensuche nach Ewigkeit
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar
© Parodos Verlag, Berlin 2018
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: iStockphoto
ISBN der Printausgabe: 978-3-938880-91-3
ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-96024-044-4
https://parodos.de
Mont-kaws Ölbäumchen
Ich glaube fest daran, dass sie an einem anderen Orte weiterlebt, wo es ihr besser geht, schrieb mir eine Freundin zum Tod ihrer alt und gebrechlich gewordenen Mutter. Meine eigene erste Tochter ist vor vielen Jahren als eben erst Geborene gestorben. Auch mir, ähnlich wie der zitierten Freundin, ist die Vorstellung nicht möglich, es sei mit meinem Kind „nichts“, nichts als die Zeit der Schwangerschaft und seine vier Lebenstage auf der Intensivstation: passé, ein Leben eingesaugt ins gänzlich Indifferente, ein Rückfall ins Nicht-Sein.
Nur gelingt mir ebenso wenig die Vorstellung eines anderen Ortes und eines zeitlichen Weiter. – Wo? Als was? – Etwa so, wie die verstorbene Mutter in ihrem letzten Lebensaugenblick war? So, wie sie zu einem früheren Zeitpunkt einmal war? So, wie sie alles in allem war? Wie sie seelisch war? – Was stelle ich mir da eigentlich vor von ihr, von ihrem „Weiterleben“? Ihr Aussehen? Ihren Charakter? Ihre Ausstrahlung? – Nichts davon ist doch etwas Festes, das man als lebendiges „Sie-selbst“ im Blick haben könnte. Und was mein verlorenes Kind angeht: Bis in tiefe Tiefen spürbar ist mein Bezug, mein inneres Hinziehen zu ihm und mein Gezogenwerden von ihm (und zwar keineswegs ungeachtet des beträchtlichen Einwands, es handle sich dabei um bloße Projektionen meines Schmerzes und meiner Sehnsucht).
Das aber sollte etwas mit einem Ort zu tun haben, wie immer andersartig er auch sein mag? Das sollte ein „Weiter“, ein höheres Neben-her, gleichsam parallel zu meinem Noch-Leben, beinhalten? Und was, wenn ich und die anderen Angehörigen und Freunde schon längst nicht mehr leben? Was tut die tote Mutter, wenn sie nicht mehr – erlöst und liebend, wie meine Freundin sich das wohl dachte, – auf uns herabgucken kann? Worin bestünde das Weiterleben eines früh verstorbenen Säuglings, seine nie entwickelte und nie erkannte persönliche „Physiognomie“? – Es sollte ja ein tiefer wurzelndes, wahres Leben sein: – „ewig“.
Nach eingewöhnten Vorstellungen hat diese Ewigkeit einen Start, nämlich den natürlichen Tod. Und „nach hinten hin“ scheint sie eher unbestimmt zu verlaufen. Lässt sich so eine Ewigkeit wertschätzen? Lässt sich denken, dass ein ewiges Leben einen Anfang hat (selbst wenn man gar keine weitere Segmentierung in Betracht zieht – etwa im Sinne eines individuellen „himmlischen“ Lebens, einer fegefeurigen Läuterungszeit und einer Ewigkeit nach dem Ende der Welt)?
So drängend die Idee einer Fortexistenz der Verstorbenen, die Vorstellung, mit dem Tod nicht einfach am Ende und verschwunden zu sein, die Menschen aller Epochen, Kulturen und Intelligenzgrade zu ihren jeweiligen Ausgestaltungen bestimmt hat, so fraglich kann einem doch die Annahme eines anderen Lebensortes und eines fortgesetzten Lebens nach dem Tod erscheinen. Der bequeme Weg liegt nahe, die Raum-Zeitkategorien für das „ewige Leben“ der „Seele“ nicht ganz so eng anzulegen. Dadurch rückt es in eine nebulöse Quasi-Zeit – irgendwann startend, eventuell mit einer gewissen Interpunktion, jedenfalls immer weiter in einem Irgendwie. So kann es uns aber kaum faszinieren. Dies empfindet sogar ein junger evangelischer Pfarrer in einem Roman von Dieter Wellershoff, der sich an einen Besuch in der Pathologie erinnert und seine eigene Position reflektiert. Er war Angestellter einer der größten menschlichen Phantasieleistungen: der Vorstellung einer Auferstehung von den Toten. Obwohl er selbst nicht mehr daran glaubte, wie er sich allmählich eingestanden hatte, war es ihm gelungen, den Trost dieser Phantasie nicht infrage zu stellen und zu ihrem Schutz jeden Versuch einer wörtlichen Zitierung zu umgehen. Viele Menschen verhielten sich vermutlich ebenso, ohne dass ihnen das bewusst wurde. Es war ein Glaube im Ungefähren und für alle Fälle. (Wellershoff 2009, 80)
Aber selbst wenn man eigentlich gerne an einem „Klein-Mädchen“-Glauben festhalten will, etwa dass man als seliger Geist dort oben in Ewigkeit Rosenduft atmen werde, stellt sich doch leicht der Verdacht ein, man werde sich dann sehr bald bis zu dem Grade an ihn gewöhnt haben, dass man ihn überhaupt nicht mehr spüren werde, und das könne man, wenn man spotten wolle, von der ganzen Seligkeit sagen – heißt es in Thomas Manns ›Die Betrogene‹. (Mann 1975 (1), Bd.2, 679)
Viele Texte dieses Autors kann man als Auseinandersetzung mit möglichen Lesarten des Transzendenten auffassen. Mann hat sich lebenslang mit dem Verhältnis Geist-Leben oder Seele-Leiblichkeit auseinandergesetzt und in diesem Zusammenhang einen Ironiebegriff geprägt, der auf die wechselseitige Freisetzung von Sinnlichem und Geistigem hinausläuft. So liegt es nahe, Manns Erzählwerk zu befragen nach Vorstellungshilfen zu dem Eigentümlichen des Menschenlebens und im Hinblick auf einen Begriff des „Ewigen“ jenseits eines Kleine-Mädchen-Glaubens, aber auch simpler Negation.
In Manns Roman ›Joseph und seine Brüder‹ steht der altägyptische Jenseits-Kult für einen hohlen, nachgerade lachhaften Begriff fortdauernder Existenz. Der Leichnam eines Reichen wird vor seiner prunkvollen Bestattung gesalzen und asphaltiert, dauerhaft gemacht für die Ewigkeit mit Wacholderholz, Terpentin, Zedernharz, Styrax und Mastix und gewickelt mit vierhundert Ellen Leinwandbinden. (Mann 1966, 1362) Auch wenn es nicht um die physische Konservierung eines Verstorbenen geht, sondern – im Bilde der Sphinx – um das rätselhafte Abstraktum der Zukunft, der andauernden Zeit, hat die ägyptische Sichtweise für einen Erben der abrahamitischen Verheißung nichts Belebendes. Das steingewordene Rätsel dauerte trunken hinaus in die Zukunft, doch diese Zukunft war wild und tot, denn eben nur Dauer war sie und falsche Ewigkeit, bar der Gewärtigung. (ebd.,745)
Offensichtlich verknüpft der Erzähler eine lebendige, nicht falsche „Ewigkeit“ mit der Gegenwart, das Zeitüberhobene mit der konkreten Lebenszeit, in der dieses gewärtigt wird. Die Form der Zeitlosigkeit ist das Jetzt und Hier. (ebd., 31) Mann versucht diese „geheimnis“volle Koinzidenz bildhaft geometrisch zu erläutern. Die Natur dieses Geheimnisses beruht nämlich auf der Tatsache, dass ihr Wesen nicht das der Strecke, sondern das Wesen der Sphäre ist. Die Strecke hat kein Geheimnis. Das Geheimnis ist in der Sphäre. Diese aber besteht in Ergänzung und Entsprechung, sie ist ein doppelt Halbes, das sich zu Einem schließt. (ebd., 189f.) Dies passt kaum zu der Vorstellung einer nachgeschalteten Lebenszeit als unendlicher Fortdauer. Beide „Zeiten“ – die hiesige und die nachfolgende – liefen dabei ja auf das hinaus, was das Wesen der Zeit ist: einfach nur zu „verstreichen“. Joseph, der Romanheld, ist demgegenüber zutiefst davon überzeugt, dass ein Leben und Geschehen ohne den Echtheitsausweis höherer Wirklichkeit, (...) (das) sich in nichts Himmlischem zu spiegeln und sich darin wiederzuerkennen vermag, überhaupt kein Leben und Geschehen ist. Manns Roman kann man in diesem Sinne als Versuch lesen, die Einheit des Doppelten, die Gegenwart dessen, was mitschwingt (ebd., 581), erzählerisch zu erweisen.
Er thematisiert diese Struktur immer wieder ausdrücklich. Die Zeit ist das Element der Erzählung, wie sie das Element des Lebens ist, heißt es in ›Der Zauberberg‹. (Mann (1)1974, 654) In diesem Roman wird eine sonderbar vom „normalen“ Leben losgelöste Atmosphäre in einem alpinen Lungensanatorium dargestellt. Viele Patienten verbleiben dort kürzer oder länger wie narkotisiert, bis sie sterben. Die Zeit vergeht überhaupt nicht für sie, es ist gar keine Zeit, und es ist auch kein Leben, äußert ein Insasse (ebd., 16), und – angesichts der vielen Todesfälle – ist es noch viel weniger eine Ewigkeit. – Wieder poetologisch gewendet, strebt dieser Roman nämlich selbst durch seine künstlerischen Mittel die Aufhebung der Zeit an durch den Versuch, der musikalisch-ideellen Gesamtwelt, die es umfasst, in jedem Augenblick volle Präsenz zu verleihen und ein magisches ,nunc stans‘ herzustellen. (ebd., XIV)
„Echtheitsausweis höherer Wirklichkeit“, „Gegenwart dessen, was mitschwingt“, „volle Präsenz“ und „magisches ,nunc stans‘“ – lägen darin (im rechten Zusammenhang verstanden) Hilfen zur Vorstellung eines unverwüstlichen Lebens, zur Vorstellung einer „Ewigkeit“, die nicht „blind fortdauert“? – Denn die Dauer ist tot und nur Totes dauert. (Mann 1966, 1130).
Die hier eingeschlagene Denkrichtung beansprucht nicht, das Verborgene eines geistig-seelischen Lebens über den Tod hinaus in ein klares Licht der Erkenntnis zu heben. Sie erhellt viele zentrale Fragen nicht – z.B. die schon angesprochene: Ein wie geartetes Subjekt erfährt ein „Darüber-hinaus“? Oder – wofern man das „jenseitige“ Leben als etwas Gutes erwartet – : Warum gebricht es dann dem „irdischen“ Leben an so Vielem, für viele Menschen auf schrecklichste Weise? Allerdings beantwortet z.B. eine traditionell christlich geprägte Annahme eines Weiterlebens im Jenseits diese Frage ebenso wenig: Was von mir und an mir soll „Gott von Angesicht zu Angesicht schauen? (Wobei zu fragen wäre, inwieweit dieses innige Bild erfüllter menschlicherBegegnung und Nähe je konkret „wörtlich“ verstanden werden darf in Bezug auf Gott; oder ob das antike Bewusstsein, dass man einem Gott nicht ins Angesicht blicken dürfe, doch einige Weisheit für sich hat.) Und gesetzt selbst, ein Leben nach dem Tod kompensiere erlittenes Leid und Unrecht: Warum wurde es zuvor so Vielen aufgebürdet? Soll man Gott als Zyniker sehen, der erst einmal indifferent bleibt gegen Teufelei, Unrecht, Krankheit, Leiden, Not? – Läge versuchsweise eine Alternative in einer Perspektive, aus der ausgeübte Unmenschlichkeit wie Menschlichkeit immer in „voller Präsenz“ das ist, was sie ist und wie sie ist, wie sie sich auch als solche in aller Schärfe „richtet“ (und also in einem entscheidenden Kern nicht mit irgendwelchen „äußeren“ Faktoren verrechnet werden kann)? In Bezug auf Verbrecherisches, in mythischer Ausdrucksweise, als Gottes Spruch: Wer (...) beschmiert ist mit eines Menschen Blut, dessen Herz soll an kaltem Entsetzen kranken, und ich will ihn jagen, dass er vor sich selber davonläuft bis ans Ende der Welt. (Mann 1975 (2), 654)Ein Gesichtspunkt aber zugleich, aus dem auch Mangel, Krankhaftes und Verstümmeltes nicht weniger unverwüstliche Seinskraft hat als bestausgerichtete Spalierpflanzen. Gängigen Normbegriffen entzieht sich nämlich ein Gott wie der, dem Abraham gehuldigt hatte: Er war nicht das Gute, sondern das Ganze. Und er war heilig! Heilig nicht vor Güte, sondern vor Lebendigkeit und Überlebendigkeit. (Mann 1966, 430)
Manns Erzählungen könnten Vorstellungshilfen dazu beisteuern, dass das lineare „Durchmessen“ einer Lebenszeit nicht das Einzige dieses Lebens ist, dass aber ein Darüber-Hinaus nicht am überzeugendsten als Fortsetzung des bisherigen Lebens mit anderen Vorzeichen gedacht werden muss – gleichsam auf einem endlosen Zeitstrahl als wolkenhaftes Schweben in höheren Regionen. Sondern dass das konkrete „irdische“ Leben des Menschen sein eines, einziges Leben ist, in allen Fasern erfüllt; dass es in einer weiteren, höheren Dimension steht; dass es – als zeitlich begrenztes – den „Echtheitsausweis höherer Wirklichkeit“ hat. Eine plane, endlose Ewigkeit verdient diesen nicht. Wo nicht Vergänglichkeit ist, nicht Anfang und Ende, Geburt und Tod, da ist keine Zeit, – und Zeitlosigkeit ist das stehende Nichts, so gut und so schlecht wie dieses, das absolut Uninteressante. (Mann 1953, 24) Gerade die Endlichkeit setzt ein „Ewiges“ frei. Das So-war-es, die „Geschichte“ des Lebens, Verhaltens, Erlebens, erweist sich als sein Sinn, sein „Echtes“. Damit tröstet Joseph seinen sterbenden Freund Mont-kaw, der sich sorgt, ob er seine früh verstorbene junge Frau wiederhaben werde, sein „Ölbäumchen“, dessen er sich zärtlich erinnert: Alles ist, wie es ist, sagt Joseph, und verhält sich aufs allernatürlichste, richtigste, beste, in glücklichster Übereinstimmung mit sich selbst und mit dir. (...) Was ist, das ist, und was war, das wird sein. (Mann 1966, 1002)
Was „ewig“ ist, zu „lesen“ bedeutet aus dieser Denkrichtung: die geheimnisvolle Dimension des tatsächlichen Lebens zu realisieren und dieses an-, wahr- und als entscheidend ernst zu nehmen. Ich werde nie jemand anders sein als derjenige, der dieses Leben so gelebt hat, nichts davon ist nichtig. Ein religiöser Glaube könnte diese Intuition betten in die Abgründigkeit eines unfassbar lebendigen, Sein und Leben gebenden Gottes. Dann wären auch die Verstorbenen, mit denen wir in Trauer und Liebe verbunden sind, womöglich nicht in ein wolkiges Jenseits verschoben, sondern, vermöge der Geheimnisnatur der Sphäre, genau als diejenigen, als die sie gelebt haben, eingetaucht in eine nicht minderbare Lebendigkeit und Überlebendigkeit. Ihr Leben wäre – in einer Raum und Zeit umschließenden und unfassbar übersteigenden Dimension – erlebbar und lebend als erweckte Fülle. Dass es die Vergänglichkeit sei, die allem Dasein Wert, Würde und Liebenswürdigkeit verleihe, dass nur das Episodische (...) beseelt (...) sei von Vergänglichkeit (Mann 1974(2), 279), erhebt ja gerade das sterbliche Leben zum Grund und zur Wirkkraft des „Seelischen“ (mit dem man gemeinhin am ehesten „Unsterblichkeit“ konnotiert). Das Ereignis des Sterbens aber könnte man damit umschreiben, dass der Nebel sich legt, in dem das Zeitliche defizient erscheint, dass ein Schleier des Ungelebten fällt, dass das, was gelebt ward, freigelassen wird in all das, „was ist“.
Dies Alles, so die Halluzination des lebensmüden Thomas Buddenbrook in Manns frühem Roman, gab seinen Geist frei und hinderte ihn nicht mehr, die stete Ewigkeit zu begreifen. Nichts begann und nichts hörte auf. Es gab nur eine unendliche Gegenwart. (Mann 1989, 656) Aber in ›Buddenbrooks‹ wird diese Schopenhauerische Ewigkeit unpersönlich gedacht: Dies ist es, dass ich leben werde! Es wird leben...und dass dieses Es nicht ich bin, das ist nur eine Täuschung, das war ein Irrtum, den der Tod berichtigen wird. (...) Individualität! (...) Ach, was man ist, kann und hat, scheint arm, grau, unzulänglich und langweilig (ebd.). In Manns späterem Werk dagegen nimmt Joseph dem Mont-kaw die Todesfurcht vor seiner Auflösung: Zweifeltest du in der Schwere, ob du dein Ölbäumchen finden würdest in drüberen Gefilden? Du wirst lachen über dein Zagen, denn siehe, sie ist bei dir, – und wie sollte sie nicht, da sie dein ist? (Mann 1966, 1002)
Nachgestelltes Vorwort
Ausgangspunkt und Zielrichtung der folgenden Kapitel sind damit skizziert: Dass nach dem individuellen Tod oder einem kosmischen Desaster („Ende der Welt“) die „Zeit“ abbricht und etwas ganz Anderem Platz macht, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen – weder dass damit alles in ein schwarzes Loch der Wesenlosigkeit aufgesogen wäre, also alle erfahrbare Wirklichkeit „nichts“ wäre; noch dass die „Linie“ der persönlichen Lebenszeit oder der weltgeschichtlichen Zeit an eine Endstation käme, von der aus es auf einer Schiene mit anderer Spurweite weiterginge, dann ohne Uhr und ohne Endstation („Leben nach dem Tod“, „ewige Seligkeit“).
Exspecto (…) vitam venturi saeculi – eine Formulierung aus dem christlichen Glaubensbekenntnis – eröffnet sich mir nicht als sinnvoll, sofern sie naiv „wörtlich“ verstanden werden sollte: Ich erwarte (…) das Leben der kommenden Welt, oder kürzer: Ich glaube an das ewige Leben. Was soll „Leben“ bedeuten ohne das, was es in Bezug auf „biologische Lebewesen“ (also auch lebende Menschen) bedeutet? Was ist das, was ich glauben soll? Was soll das für ein kommendes saeculum sein, wenn es eben gar kein saeculum, keine Zeitspanne ist? Wenn das die „Ewigkeit“ sein soll, wie kann eine Ewigkeit erst noch kommen? – eine Ewigkeit, die noch nicht einmal angefangen hat. Was soll das für eine „Auferstehung der Toten“ sein, die zu dem künftigen „Leben“ führt? In welchem Zustand sollen Tote sein, nachdem sie auferstanden sind? – Andererseits glaube ich aber, dass sowohl die Welt als auch Menschen „mehr“ sind als ein „Dreck“, ein bedeutungsloses Konglomerat von irgendetwas – gleich ob dieses „Irgendetwas“ als Materie im Sinne des 18. und 19. Jahrhunderts, als Oszillieren zwischen Kleinstteilchen und Wellen, als Energie oder – aktueller – als „Information“ gesehen wird. Dass ein einzelnes Atom ebenso wie alle kosmischen Abgründe bloße Blähungen des ,Wüsten und Leeren‘ seien, derlei lässt sich überhaupt nicht denken. Wir können in unserem Denken nicht aus dem Vorstellbaren, Nachvollziehbaren, wie immer „Sinnvoll“-Zusammenhängenden heraus. Dass es aber die Intuition jenes „Mehr“ nicht anders als gebunden an neuronale Vorgänge, also an „Materielles“, geben kann, diskreditiert ihren Inhalt nicht – so wenig wie der Wert eines Musikerlebnisses dadurch gemindert wird, dass es nur durch Instrumente zustande kommen kann.
Die Erwartung eines vita venturi saeculi müsste sich daher eher auf „hinzukommendes Leben“ beziehen; „hinzukommen“ nicht im Sinne von später kommen, sondern von „zusätzlich eröffnet sein“ – „zusätzlich“ aus dem Gesichtswinkel dessen, der die Lebensereignisse nur als absolut „platten“ Zeitablauf sehen kann oder sehen möchte. Sie müsste sich gleichsam auf eine tiefere, zeitüberhobene Dimension dieses konkreten, in vielerlei Hinsicht begrenzten Lebens beziehen, gegen dessen ephemere Nichtigkeit sie sich damit stellt.
Wer sich in die skizzierten kontradiktorischen Denkrichtungen (dogmatisch religiös vs. antimetaphysisch) hinsichtlich dessen, was es mit unserer (Un-)Endlichkeit auf sich hat, nicht hineinfinden kann, muss nach anderen Redeweisen suchen. Die vorliegenden Kapitel bieten – eher kreisend und umkreisend – entsprechende Vorstellungen aus meist literarischen Texten an, die mir in diesem Zusammenhang aufgefallen sind und auf die ich mir paraphrasierend einen Reim zu machen suche – keine distinkt begrifflichen Erklärungen, keine professionelle Studie, keine geradlinig schlagende Argumentation. – Zwar diskutiert auch die christliche Theologie Konzepte z.B. „präsentischer“ (statt futurischer) Eschatologie, auch im Gespräch mit anderen Religionen. Was aber soll das für ein ewigkeitswertiges tatsächliches, jetziges Leben sein, wenn es zugleich mit ungeschmälerter Gesundheit, Wohlstand, Gerechtigkeit, Friede, Glück, Vollendung assoziiert wird? Vermutlich wird man doch mit etwa nur philosphisch-ethischen Überlegungen „dem Leiden der Menschen nicht wirklich gerecht.“ (Drewermann 2013, 715) Im christlichen Umfeld scheinen eher (nicht nur rückständige) Frömmigkeits- und Lehrtraditionen einer „Ewigkeit“ als einem vom jetzigen (Er-)Leben „erlösten“ Danach vorherrschend zu sein.
Man kann nur lesend probieren, was diese Textangebote einem bedeuten. So ist der Titel gemeint: Was das (für uns heute) bedeuten mag, wofür es das Wort „ewig“ gibt (hier immer nur auf den Menschen bezogen), kann man – vielleicht überhaupt nur – zu „lesen“ versuchen. Eine solche Lektüre möchte ich eher mit einem nachdenklichen Ausprobieren und Nachspüren vergleichen als mit dem Studium einer Sachdarstellung. In dieser existenziellen Frage geht es wohl eher um Selbsterfahrung, lebendige Bedeutung „für mich“, nicht um zwingende Logik bzw. abschließende objektive Erkenntnisse. Denn diese würden einen Standort voraussetzen, der dem Bannkreis (unseres) Daseins, wäre es auch nur um ein Winziges, entrückt ist, während doch jede mögliche Erkenntnis (…) selber auch mit der gleichen Entstelltheit und Bedürftigkeit geschlagen ist, der zu entrinnen sie vorhat. (Adorno 1975, 334)
Ich sehe im Interesse eines eher betrachtenden Zugangs ab von der Einordnung der vorgestellten Zitate in das Gesamtwerk der Autoren, in biographische, historische, geistesgeschichtliche Kontexte etc. Die Orthographie ist öfters behutsam aktualisiert. Zitate sind kursiv gesetzt. – Meinen Geschwistern und meinen Münchener Freunden danke ich herzlich für Zuspruch, Denkanstöße und Korrektur, ebenso meinem Lektor und Verleger für seine kundige und freundliche Betreuung.
Der Streifzug durch die zwischen ewigem und hinfälligem Leben oszillierende Gedankenlandschaft setzt bei einem unauflöslichen Minimum an. Keine noch so rigorose, lebensverzweifelnde, lebensverachtende, lebensbewusste, lebenshungrige Kritik des eigenen Daseins kann Erfolg haben mit einem Feldzug gegen die Erfahrung und Erkenntnis, dass man offenkundig ist, dass das Innere pulst, dass der Körper atmet. Man kann sich selbst nicht weg„kriegen“. Menschen können einen irreduziblen „Glutpunkt“ ihres Lebens weder handelnd noch fühlend noch denkend auslöschen. Dass sie sich aber ggf. aus der Lebensbequemlichkeit herausgerissen und mit diesem eigenen Glutpunkt konfrontiert sehen können, lässt ihnen – zu allen lebensfeindlichen Umständen – möglicherweise das Instabile, Miserable ihrer Existenz deutlich werden. Ein als sehr begrenzt und leidvoll empfundenes „irdisches“ Leben eben deshalb als uneigentlich zu betrachten und daraus wiederum ein Wiedergutmachungsversprechen eines „ewigen“ Lebens abzuleiten, scheint mir nicht sehr geradlinig gedacht. Eine starre Fokussierung auf das Jämmerliche des Diesseits kann u.U. ähnlich lächerlich wirken wie die Erwartung eines gloriosen Upgrades in einer anderen Welt. Eine zustimmungsfähige „Mitte“ liegt wohl in der Einsicht, dass etwas nur lebt und existiert, indem es Grenzen hat, und dass also prinzipieller Protest gegen Bedingtheit nicht heilsam ist („Schwaches, Schwankendes – Eine Rehabilitation“). Andererseits kommt man nicht darum herum, sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen – bewusst oder unbewusst – über ihr unmittelbares Dasein und Sosein hinausgehen. Was bedeutet das? Ich schlage mehrere gedankliche Seitenwege vor, um analogisierend Vorstellungshilfen zu gewinnen. Wenn man z.B. träumt – sind das substanzlose Gespinste? Oder lebt der so Denkende, der Träumende erst wirklich sich selbst? Versuche scheinen lohnenswert, Wachwelt und Traumwelt zusammenzudenken, wodurch das Enge, Bedingte das Ausschließliche verliert und sich eine weitere Dimension eröffnet („Nur Nacht? – Nur Tag?“). Theorien des Traumes können ebenso wenig wie die Logik der modernen Physik inhaltliche Beiträge liefern zur Entscheidung darüber, ob und in welchem Sinne der Mensch Ewigkeitsqualitäten hat. Aber das Nachdenken darüber kann von diesen Seiten „Lockerung“ erfahren aus begrifflichen Zwängen, ohne sich dem Vorwurf des Gedankenkitschs auszusetzen („Komplementäres“). Inwieweit die dann folgenden Kapitel, hauptsächlich literarisch inspirierte „Lese-Versuche“, diesem Verdikt verfallen oder ob etwa künstlerischer Ausdruck eine lebenserfüllte Seinsqualität berührt, für welche die Religionen auch das Wort „ewig“ benutzen, wird der Leser beurteilen.
Die oft artifizielle Sprache, sei es der dichterischen Texte selbst, sei es in enger Korrespondenz dazu, mag ihn befremden – immerhin versucht sie, allzu erwartbaren, aber vielleicht doch verfälschenden Formeln zu entgehen. (Genauso gut aber mag er dem Großen des Lebens in sich auf andere, ganz „einfache“ Weise nachspüren, z.B. in seinem Atem. Den hat ihm – der biblischen Erzählung zufolge – der Schöpfer als seine besondere Lebensqualität eingehaucht.)
Ein wesentliches Recht von Leseerfahrungen scheint mir jedenfalls, dass sie nicht allgemeinverbindlich gemacht werden können. Wenn man sich auf unsicherem Boden bewegt, muss man sich u.U. geeignete betretbare Stellen, Planken, Steine zusammensuchen und vor sich legen, um ein Stück weiter zu kommen – gleich, wieso sie da liegen, wozu sie vielleicht gedient haben. So verstehe ich diese Überlegungen. Niemals vorm Einsinken im Unergründlichen sicher zu sein – wenn dies nicht bloß ein romantischer Kick ist –, kann die Wege- und Gehanstrengung womöglich entkrampfen und beflügeln.
Man kann sich selbst nicht weg„kriegen“
In Becketts ›Endspiel‹ erzählt Nagg den Witz von einem Schneider, der auch nach langem Warten und mehrmaliger Beschwerde des Kunden eine in Auftrag gegebene Hose nicht zufriedenstellend angefertigt hat. Bei der letzten Nachfrage sitzt der Hosenschlitz immer noch nicht richtig: