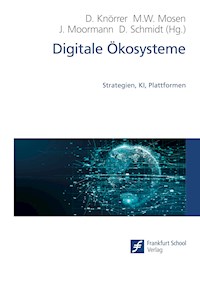D. Knörrer M.W. Mosen J. Moormann D. Schmidt (Hg.)
Digitale Ökosysteme
Strategien, KI, Plattformen
1. Auflage 2021
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.frankfurt-school-verlag.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung in ePub: mediaTEXT Jena GmbH
ISBN 978-3-95647-192-6 (Print)
ISBN 978-3-95647-194-0 (PDF)
ISBN 978-3-95647-193-3 (ePub)
ISBN 978-3-95647-195-7 (Mobi)
1. Auflage 2021 © Frankfurt School Verlag / efiport GmbH, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am Main
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
Herausgeber
Autorenverzeichnis
Strategien und Geschäftsmodelle
Mehr als Digitalisierung – Wie digitale Ökosysteme Wert für Firmen generieren
Dieter Knörrer/Lisa Knörrer
Rollenfindung in einer Welt digitaler Ökosysteme – Positionierung von Versicherern und Maklern
Gerrit Böhm
Ökosysteme als Next Normal – Erfolgsstrategien für Makler
Jörg Mußhoff/Georg Henig
Entwicklung von Finanzprodukten für digitale Ökosysteme
Michael Mohr/Markus Wernicke
Verschmelzung von Industrie 4.0 und Finanzbranche
Fabian Dingel/Guido Emmelius
Ökosysteme als Quelle für neue Ertragspotenziale für regionale Banken
Argjent Demiri/Ludwig Hierl
Einfluss von digitalen Ökosystemen und Plattformen auf die Zukunft der Versicherungsbranche
Wolfgang Hanssmann/Stefan Zurth
Vorgehensweise zur Teilnahme an digitalen Ökosystemen
Martin Nokaj
Künstliche Intelligenz und Daten
Smartes Datenmanagement im Kontext digitaler Ökosysteme
Dietmar Schmidt/Catharina Münch
Betriebliche Vorsorge als Ökosystem – Herausforderungen und mögliche Einsatzfelder von KI
Hans Eder
Algorithmic Economy – Treiber der digitalen Transformation im Forderungsmanagement
Sebastian Ludwig/Sarah Lehmann
Analytics-Plattformen als Wegbereiter der Cloud-Transformation
Martina Neumayr/Martin Baumann/Christophe Krech
Verwendung personenbezogener Daten in digitalen Ökosystemen
Wolfgang Epting
Plattformen und Technologien
Handelsplatz für IT-Ressourcen als digitales Ökosystem
Johannes R. Watzl
Das Innovationswunder von Berlin – das Berliner Software-Innovationsökosystem
Heinrich M. Arnold
Aufbau digitaler Banking-Plattformen in der Finanzbranche
Frank Kebsch/Marius Diedrich
Digitale Ökosysteme und die Relevanz der User Experience – Erfahrungen auf dem Weg von einer Neobank zur Fintech-Plattform
Jan Boehm
Dynamik und Perspektiven im Digital Payment Ecosystem
Marcus W. Mosen
Plattformentwicklungen im Versicherungsmarkt – Von Open Banking zu Open Finance
Sascha Kwasniok/Julius Kretz/Frank Kettnaker
Geschäftsmodelle auf dezentralen Plattformen
Guido Perscheid/Jürgen Moormann
Geleitwort
Derzeit erfährt die Digitalisierung einen bislang nicht gekannten Aufschwung. Leider bedurfte es erst einer Pandemie, damit realisiert wurde, welche besonderen Möglichkeiten in der Digitalisierung liegen. Wir sehen gerade, dass die Bereiche, die bereits weiter in der Digitalisierung vorangeschritten sind, besser durch die Krise kommen. Wenn wir zukünftig unsere wirtschaftliche Stellung in der Welt halten und weiter wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir den Weg der Digitalisierung mit mehr Entschiedenheit verfolgen und uns endlich an die Umsetzung der vielen guten Ideen in unserem Land machen.
Man könnte sich nun mit einer „einfachen“ Digitalisierung der analogen Welt zufriedengeben. Doch damit würde man sicher nicht die Potenziale nutzen, die in der Anwendung neuer Technologien liegen. Es muss daher um mehr gehen, als nur die Bereitstellung einer technischen Infrastruktur und die Unterstützung althergebrachter Abläufe. Dazu müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die die neuen Technologien, wie z.B. Künstliche Intelligenz und Big Data, bereithalten. Es muss zu einer echten digitalen Transformation kommen. Dann ergeben es sich ganz neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten.
Neben einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur spielen Daten eine immer größere Rolle. Laut dem BDI beträgt das Wertschöpfungspotenzial der Datenökonomie bis 2025 alleine für Deutschland bis zu 425 Mrd. EUR. Betrachtet man ganz Europa wird dieses Wertschöpfungspotenzial für die nächsten zehn Jahre auf bis zu 1,25 Bio. EUR geschätzt. Die Schwierigkeit ist aber, den Umgang mit den Daten zu organisieren. Wissenschaftler und Unternehmen gehen davon aus, dass wir über 90% unserer vorhandenen Daten gar nicht nutzen.
Die intelligente Nutzung von Daten – auch in digitalen Ökosystemen – spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir als Bundesregierung haben die Bedeutung von Daten und deren Wichtigkeit für die Zukunft erkannt. Deshalb haben wir eine Datenstrategie erarbeitet, die die verstärkte, innovative Datennutzung zum Ziel hat. Hierfür sollen die Dateninfrastrukturen leistungsfähig und nachhaltig ausgestaltet werden. Die Bereitstellung der Daten soll verbessert werden und es damit leichter machen, Daten über gemeinsame Infrastrukturen zu teilen. Die Datenkompetenz der Bürgerinnen und Bürger soll erhöht und eine Datenkultur etabliert werden. Mit diesen Maßnahmen möchten wir den Staat zum Vorreiter machen. Dies geschieht in der Hoffnung, dass sich entsprechende Aktivitäten dann auch im nichtstaatlichen Bereich entfalten.
Berlin, im Juni 2021 Dorothee Bär Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung
Vorwort
Die Digitalisierung ist inzwischen in nahezu alle unserer Lebensbereiche vorgedrungen. Diese Entwicklung ist keineswegs neu. Auffallend ist allenfalls die Geschwindigkeit und Heftigkeit, mit der sich die Digitalisierung nun Bahn bricht. Dazu tragen neue Technologien bei, aber auch neue Arbeitsweisen, Organisationsstrukturen (z.B. Innovation Labs) und – noch wichtiger – eine offenere Denkweise auf allen Seiten (Kunden, Gründer, Investoren, Management, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörden, politische Entscheidungsträger, Gesetzgeber usw.).
Ein wesentlicher Treiber der Veränderung ist die Entstehung von digitalen Ökosystemen. Diese basieren auf bekannten sowie neuen und innovativen Technologien. Entscheidend für den aktuellen Umbruch ist jedoch ein verändertes Verständnis bzw. Neudenken von Geschäftsmodellen. Während Unternehmen traditionell den Fokus auf die eigenen Kundinnen und Kunden legen und verhindern, dass Wettbewerber in die eigene Wertschöpfungskette eindringen, hat sich nunmehr eine differenziertere Auffassung entwickelt.
Inzwischen gibt es Rollenmodelle, in denen sich ein Unternehmen auf eine oder mehrere Rollen in einem Wertschöpfungsnetzwerk beschränkt, mit anderen Unternehmen kooperiert und sich bewusst in dieses Ökosystem integriert. Alternativ baut ein Unternehmen selbst ein solches System auf, führt es und integriert andere (komplementäre und nicht-komplementäre) Unternehmen. Dabei soll der Nutzen für alle Beteiligte jedenfalls (deutlich) größer sein, als wenn jedes Unternehmen einzeln tätig ist. Damit steigt natürlich auch die Komplexität hinsichtlich Strategie, Governance, Kommunikation, Logistik usw. in diesen Ökosystemen an. Die Realisierung derartiger Systeme ist ohne Digitalisierungstechnologien nicht möglich. Wir sprechen daher von digitalen Ökosystemen.
Die Thematik der digitalen Ökosysteme ist vielschichtig. Diese Systeme können aus mehr oder weniger gleichberechtigten Partnern auf lokaler Ebene bestehen, aber auch von übermächtig erscheinenden, weltweit tätigen Unternehmen dominiert werden. Beispiele sind die Ökosysteme, die von Amazon, Alibaba, Apple, Baidu, Facebook, Google, Tencent etc. betrieben werden. Diese Unternehmen verfügen über eine Marktmacht, die ganze Branchen bedroht oder gar vernichten kann.
Ein anderer Fokus entsteht, wenn sich funktionale digitale Ökosysteme entwickeln. Beispiele finden sich im Gesundheitsbereich (bestehend aus u.a. Kunden, Apotheken, Kliniken, Lieferdiensten, Pharmaunternehmen, Zulieferern in vielen Ländern) und im Zahlungsverkehr (bestehend aus u.a. Kunden, Händlern, Payment-Service-Providern, Netzbetreibern, Kartenorganisationen, Banken). Andere Ökosysteme wiederum bestehen – fast wie bei einer biologischen Symbiose – aus etablierten Unternehmen (Incumbents) und Neo-Unternehmen (Fintechs, Insurtechs etc.).
Die zunehmende Vernetzung in Form von digitalen Ökosystemen führt zum Verschwimmen traditioneller Unternehmens- und Branchengrenzen und ist damit hochrelevant für die Entwicklung von Unternehmensstrategien sowie die Ausgestaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen. Aus dieser Sicht ist es essenziell, dass sich Unternehmen möglichst vorteilhaft im eigenen Ökosystem bzw. in anderen Ökosystemen positionieren. Damit ändern sich zwangsläufig die Geschäftsmodelle der Unternehmen. Auch ist zu berücksichtigen, dass bei digitalen Ökosystemen regionale oder nationale Grenzen immer weniger eine Rolle spielen.
Darüber hinaus haben Daten in digitalen Ökosystemen eine zentrale Bedeutung. Die Nutzung von Daten bringt viele Chancen, aber auch große Herausforderungen mit sich. Daten sind nicht gleich Daten. Sie müssen normiert und zur Nutzung weiterentwickelt werden. Sie müssen ausgetauscht und gespeichert werden. Und v.a. müssen sie geschützt und gesichert werden. Eine effiziente und zielgerichtete Nutzung von Daten über Kunden, Kooperationspartner, Wettbewerber etc. ist daher wesentlich. Daten werden in Clouds gespeichert und Unternehmen sowie Kunden sind durch das Internet of Things (IoT) stärker denn je miteinander vernetzt.
Eine große Rolle spielt dabei die Verwendung von Data Analytics, die es erlaubt, große Mengen von Daten auszuwerten und Daten auf diese Weise beispielsweise für Vorhersagen nutzbar zu machen. Zudem wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl zur Erhebung als auch zur Auswertung von Daten selbstverständlich werden. Der korrekte Umgang mit Daten ist einer der wichtigsten Eckpfeiler digitaler Ökosysteme.
Eine weitere wesentliche Komponente von digitalen Ökosystemen besteht in der Konzeption und Implementierung von Plattformen und der Nutzung der dafür notwendigen Technologien. Das beginnt mit den grundlegenden Software-Bausteinen für Plattformen und reicht bis zum Einsatz von Cloud-Diensten, modernen IT-Schnittstellen, hochperformanter Hardware etc. Gemeinsam mit Daten bilden Plattformen die technologische Basis für digitale Ökosysteme. Nur wenn der Zugang zu Plattformen und angeschlossenen Systemen technisch einfach möglich ist, können Ökosysteme ihr volles Potenzial entfalten.
Digitale Ökosysteme, der Umgang mit Daten und die nötigen Plattformen sind die zentralen Themen dieses Buches. Dazu haben wir das Werk in drei Blöcke gegliedert. Diese Gliederung erscheint uns sinnvoll, um der Vielschichtigkeit des Themas gerecht zu werden. Zu Beginn eines jeden Teils findet sich eine kurze Einführung.
Die Struktur des Buches sieht folgendermaßen aus:
Der Teil „Strategien und Geschäftsmodelle“ behandelt die Themenfelder Business Cases, Kundenerlebnis, Netzwerkeffekte, Partner, Zahlungsdienste und Start-ups.
Der Teil „Künstliche Intelligenz und Daten“ beschreibt die für Ökosysteme zentralen Aspekte Data Analytics, Big Data, Datenschutz und -sicherheit, Algorithmen und Machine Learning.
Der Teil „Plattformen und Technologien“ erläutert die Arten von digitalen Plattformen, Schnittstellen, Cloud Computing und Blockchain.
Mit diesem Buch möchten wir Sie auf eine Reise durch die Welt der digitalen Ökosysteme mitnehmen. Zu diesem Zweck haben wir eine Reihe von Experten eingeladen, ihre Gedanken, Lösungsansätze und Einschätzungen in Beiträge zu fassen und zu teilen. Der Expertenkreis setzt sich aus Vertretern von etablierten, großen Unternehmen und jungen, aufstrebenden Unternehmen sowie aus auf Digitalisierungsthemen spezialisierten Beratern und Wissenschaftlern zusammen.
Wir bedanken uns bei allen Autoren ganz herzlich für die Bereitstellung ihrer Erfahrungen und ihr großes Engagement, durch das sie zum Gelingen dieses Buchs beigetragen haben. Auch möchten wir Frau Dorothee Bär, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte für Digitalisierung, herzlich für ihr freundliches Geleitwort zu diesem Buch danken. Darüber hinaus geht unser Dank an Frau Catharina Münch, die hingebungsvoll über Monate mit den Autoren kommuniziert, Texte redigiert und für die Termineinhaltung gesorgt hat. Vielen Dank auch an das Team dahinter mit Lisa Knörrer, Florian Schneider, Dr. Stefan Röder, Jan Pilgram, Lena Feulner und weiteren. Herrn Dr. Thomas Lorenz danken wir für die wiederum konstruktive Begleitung des Buchprojekts von Seiten des Frankfurt School Verlags.
Wir hoffen, dass dieses Sammelwerk zu einem guten Verständnis der aktuellen Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit digitalen Ökosystemen beiträgt. Wir würden uns freuen, wenn die Beiträge Handlungsimpulse geben und weitere Denkanstöße liefern. In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern eine anregende Lektüre, interessante Erkenntnisse und viel Erfolg bei der praktischen Umsetzung.
Bayreuth, Köln, Frankfurt a.M., Bad Homburg v.d.H., Dieter Knörrerim Juni 2021Marcus W. MosenJürgen MoormannDietmar Schmidt
[1]
Fußnoten:
[1]
Anm. der Hg.: Begriffe wie Mitarbeiter, Kunde, Autor usw. werden in diesem Buch im Maskulinum verwendet. Diese Nutzung dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. Eventuelle weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
Herausgeber
Dieter Knörrer
Dieter Knörrer ist Geschäftsführer der DWK Holding GmbH & Co. KG, ein Family Office, das alleiniger Gesellschafter der bbg Betriebsberatungs GmbH in Bayreuth ist. Er etablierte die bbg zum führenden Informations- und Kommunikationsdienstleister in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. In 2018 gründete er gemeinsam mit Dietmar Schmidt die VeDaTa VertriebsDatenServices GmbH in Bayreuth als gemeinsamer Gesellschafter.
Marcus W. Mosen
Marcus W. Mosen ist Senior Advisor, Beirat und Investor in verschiedenen Payment-, Tech- und Fintech-Unternehmen (www.mwmosen.com). Er war über 20 Jahre in Geschäftsführungsverantwortung bei führenden Zahlungsverkehrsanbietern, wie z.B. First Data, Easycash, Ogone, Ingenico und Concardis. Er hat maßgeblich Entwicklungen im Zahlungsverkehrsmarkt in Deutschland und Europa initiiert und mitgestaltet.
Prof. Dr. Jürgen Moormann
Prof. Dr. Jürgen Moormann ist Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance & Management. Seine Forschungsfelder sind Strategieentwicklung, Business Engineering und Prozessmanagement. Er ist Gründer und Co-Head des ProcessLab, ein auf das Prozessmanagement in der Finanzbranche ausgerichtetes Forschungscenter der Frankfurt School (www.processlab.info). Er ist Autor bzw. Herausgeber von zehn Büchern und hat Artikel in einer Vielzahl wissenschaftlicher Fachzeitschriften, national und international, veröffentlicht.
Dietmar Schmidt
Dietmar Schmidt ist geschäftsführender Gesellschafter der mexxon Gruppe (www.mexxon.com) mit branchenübergreifendem Schwerpunkt in Künstlicher Intelligenz, Smart Data und digitalen Ökosystemen. Seine Expertise liegt darin, eine erfolgreiche Datenstrategie in Unternehmen zu etablieren und Datenplattformen mit hoher Datenqualität zu entwickeln. In 2018 gründete er gemeinsam mit Dieter Knörrer die VeDaTa VertriebsDatenServices GmbH in Bayreuth als gemeinsamer Gesellschafter.
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. Heinrich M. Arnold
Honorarprofessor für Digitale Transformation, Technische Universität Berlin, Berlin
Martin Baumann
Director Analytics, informa Solutions GmbH an Experian company, Baden-Baden
Dr. Jan Boehm
Director Corporate Development and Public Affairs, N26 Group, Berlin
Dr. Gerrit Böhm
Mitglied der Vorstände, Volkswohl Bund Versicherungen, Dortmund
Prof. Dr. Argjent Demiri
Studiengangsleiter, Professor für Dienstleistungsmanagement, Consulting & Sales, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn
Marius Diedrich
Business Development Manager, finleap connect GmbH, Hamburg
Fabian Dingel
Innovationsmanager, Mittelstand.ai GmbH & Co. KG, Gießen; Innovationsmanager Finanzinnovationen und Data Science, Volksbank Mittelhessen, Gießen
Hans Eder
Principal, Horváth Management Consultants, Stuttgart
Guido Emmelius
Geschäftsführer, Mittelstand.ai GmbH & Co. KG, Gießen; Bereichsleiter Finanzinnovationen und Data Science, Volksbank Mittelhessen, Gießen
Wolfgang Epting
Solution Advisor Chief Expert, SAP Deutschland SE & Co. KG, Walldorf
Wolfgang Hanssmann
Vorstandsvorsitzender, HDI Vertriebs AG, Köln
Georg Henig
Partner, McKinsey & Company, München
Prof. Dr. Ludwig Hierl
Professor für Accounting, Controlling und Finance, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn
Frank Kebsch
CEO, finleap connect GmbH, Hamburg
Frank Kettnaker
Mitglied der Vorstände, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G, Hallesche Krankenversicherung a.G, Alte Leipziger Holding AG, Oberursel
Dieter Knörrer
Geschäftsführender Gesellschafter, bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth
Lisa Knörrer
Global Process Engineer, Kuehne + Nagel, Contern, Luxemburg; Doktorandin, WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar
Christophe Krech
Data Scientist, informa Solutions GmbH an Experian company, Baden-Baden
Julius Kretz
Bereichsleiter Marketing – Systeme & Plattformen, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Oberursel
Prof. Dr. Sascha Kwasniok
Professor für BWL, Fachrichtung Versicherung, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
Sarah Lehmann
Head of Marketing & Public Relations, coeo Inkasso GmbH, Dormagen
Sebastian Ludwig
CEO & Managing Director, coeo Group GmbH, Dormagen
Michael Mohr
Sprecher der Geschäftsführung, abcfinance GmbH, Köln
Prof. Dr. Jürgen Moormann
Professor für Bank- und Prozessmanagement, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt a.M.
Marcus W. Mosen
Berater, Non-Executive Director, Investor, Inhaber m.w. mosen GmbH, Köln
Catharina Münch
Head of Marketing & Communication, mexxon consulting GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.H.; Doktorandin, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg
Jörg Mußhoff
Senior Partner, Leiter Financial Institutions Group, McKinsey & Company, Düsseldorf
Martina Neumayr
Senior Vice President Credit Risk & Fraud Services, informa Solutions GmbH an Experian company, Baden-Baden
Martin Nokaj
Geschäftsführer, BFS health finance GmbH, Dortmund
Guido Perscheid
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt a.M.; Doktorand Wirtschaftsinformatik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg
Dietmar Schmidt
Geschäftsführender Gesellschafter, mexxon consulting GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.H.
Dr. Johannes R. Watzl
CTO, CCEX Cloud Commodities Exchange GmbH, Frankfurt a.M.
Markus Wernicke
Geschäftsführer, abcfinlab GmbH, Köln
Stefan Zurth
Innovationsmanager Marketing und Vertrieb, HDI Vertriebs AG, Hannover
Strategien und Geschäftsmodelle
Einführung
Der erste Teil dieses Buches befasst sich mit der Vielzahl von Strategien und Geschäftsmodellen im Bereich der digitalen Ökosysteme. Die voranschreitende Digitalisierung und die daraus resultierenden Veränderungen zwingen Unternehmen in praktisch allen Branchen dazu, ihre Geschäftsmodelle an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Doch neben den großen Herausforderungen bringt diese Entwicklung auch neue Chancen mit sich und ermöglicht enorme Effizienzsteigerungen.
Diese Herausforderungen und Chancen analysieren Dieter Knörrer und Lisa Knörrer im ersten Beitrag dieses Teils. Die Einführung eines digitalen Ökosystems bedeutet Veränderung von der Integration neuer Partner über die Neuordnung der eigenen Daten bis hin zu einem neuen Kundenfokus. Gleichzeitig kann auf viele Arten Wert für Unternehmen generiert werden. So können durch Prozessverbesserungen und Automatisierung die Kosten signifikant gesenkt werden. Außerdem können durch Ausweitung des Partnernetzwerks und durch Integration einer Vielzahl von Daten neue Umsatzströme generiert werden.
Im Beitrag von Gerrit Böhm wird speziell für Versicherer und Makler diskutiert, wie sich diese Unternehmen in einer digitalisierten und zunehmend durch Plattformen und Ökosysteme geprägten Welt behaupten können. Die Herausforderungen und Risiken werden zunächst vor dem Hintergrund der aktuellen technologischen Trends analysiert, bevor anschließend Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Ergänzend dazu zeigen Jörg Mußhoff und Georg Henig in ihrem Beitrag, wie man sich in der Versicherungsbranche am besten in der neuen Ökosystem-Welt positioniert und welche Erfolgsstrategien dabei zielführend sind. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Digitalisierung gelegt, die sowohl für Einzel- und Kleinmakler als auch für Finanzvertriebe dazu dient, Produkte und Leistungen besser miteinander zu verbinden.
Ebenfalls einen starken Fokus auf die Digitalisierung legen Michael Mohr und Markus Wernicke und zeigen in einem Werkstattbericht, wie ein digitales Finanzprodukt für ein Ökosystem entsteht. Wer Teil eines Ökosystems werden oder ein eigenes aufbauen möchte, muss zunächst sein Geschäftsmodell hinterfragen. Die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und die gezielte Einbindung in Ökosysteme hat organisatorische, personelle und technologische Konsequenzen, die in diesem Beitrag näher beleuchtet werden.
Passend dazu erfolgt im Beitrag von Fabian Dingel und Guido Emmelius eine Analyse der Herausforderungen und Chancen von Banken im Bereich der sich rasant wandelnden industriellen Produktion und die Verschmelzung von Industrie und Finanzdienstleistern. Dazu werden ausgewählte Bankfunktionen betrachtet und ein Blick auf die Seite der Firmenkunden, insbesondere der verarbeitenden Industrie, geworfen und aufgezeigt, wie die aus der Digitalisierung resultierende Konnektivität der Industrie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für Banken ermöglicht.
Der Auf- und Ausbau eines digitalen Ökosystems eröffnet auch regionalen Banken neue Ertrags- und Wachstumsperspektiven. Argjent Demiri und Ludwig Hierl empfehlen hierfür zunächst die Durchführung einer Machbarkeitsstudie, die alle Aspekte der Organisation berücksichtigt. Potenzielle Akteure und Kooperationspartner sollen in die Analyse ebenso einbezogen werden wie kritische Erfolgsfaktoren. Für die Entwicklung eines digitalen Ökosystems wird außerdem eine sukzessive Erweiterung mit neuen Themenfeldern empfohlen, die den Menschen und Unternehmen der jeweiligen Region wichtig sind.
Die Digitalisierung und Vernetzung macht auch vor der Versicherungsbranche nicht halt. Welche Rollen man als Versicherer auf diesem Markt einnehmen kann und was die nötigen Voraussetzungen und möglichen Strategien sind, erläutern Wolfgang Hanssmann und Stefan Zurth in ihrem Beitrag. Anhand von konkreten Beispielen wird dabei nicht nur die Relevanz, sondern auch der mögliche Umgang mit digitalen Ökosystemen aufgezeigt.
Schließlich wird von Martin Nokaj der Einfluss von digitalen Ökosystemen für den Gesundheitsmarkt untersucht. Es wird beschrieben, wie Krankenkassen, Arztpraxen und Patienten selbst Teil eines Ökosystems werden und so nutzerzentrierte Lösungen entstehen können. Als wichtige Faktoren identifiziert er sowohl die Findung der eigenen Rolle im Ökosystem, bei der je nach gegebenen Voraussetzungen zwischen Initiatoren und Teilnehmern unterschieden wird, als auch die Entwicklung von Strategien, um frühzeitig an der Entwicklung eines solchen Ökosystems teilnehmen zu können.
Dieser Teil des Buches zeigt, dass digitale Ökosysteme in einer Vielzahl von Branchen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unabhängig von der Branche gibt es jedoch eine Gemeinsamkeit: die Digitalisierung erfordert von allen Akteuren den Umgang mit enormen Datenmengen, womit sich der zweite Teil des Buches beschäftigt.
Mehr als Digitalisierung – Wie digitale Ökosysteme Wert für Firmen generieren
Dieter Knörrer/Lisa Knörrer
1
Einleitung
2
Strategien für eine neue Zeit
2.1
Strategische Neuausrichtung
2.2
Wichtigkeit einer effizienten Umsetzung
2.3
Balanceakt zwischen Standards und Flexibilität
2.4
Kundenbeziehung als neue Währung
3
Neue Architektur von Systemen
3.1
Modulare und flexible Architektur
3.2
Schnelle und reibungslose Integration
3.3
Cloud als Standard
3.4
Vorsicht vor dem Datensumpf
3.5
Governance und Sicherheit
4
Neue Organisation
4.1
Neues Management
4.2
Funktionsübergreifendes Arbeiten
4.3
Digitale Kultur, Vertrauen und Fehler
5
Fazit
Literatur
1
Einleitung
Digitale Geschäftsfelder wachsen mit einer immensen Geschwindigkeit und eröffnen neue Möglichkeiten für Kunden und Firmen. Neue digitale Unternehmen drängen auf den Markt und verändern ganze Branchen durch schnellere und bequemere Kundenerfahrung (Abbildung 1). Während Airbnb die Unterbringung für Reisende günstiger und individueller gestaltet und die Begegnung von Menschen vom Buchungsprozess bis hin zum Aufenthalt in den Mittelpunkt stellt, verändert Amazon unser Verständnis von Branchengrenzen. Haben sich Firmen traditionell einer Branche zugeordnet, zeigt Amazon, dass es nicht nur eine E-Commerce-Plattform ist, sondern auch Video-, Musik- und Bezahldienstleister sowie Cloud-Computing-Anbieter.
Abbildung 1: Unwucht der Plattformökonomie – die 60 wertvollsten Plattformen der Welt (Angaben in Mrd. USD (Börsenwert/jüngste Finanzierung; Juni 2018))
Quelle: Netzoekonom.de (2018)
Die Arbeit mit neuen technologischen Entwicklungen wie Cloud-Diensten, Internet of Things oder Big Data sind oft Neuland für Traditionsunternehmen. Sie verändern das Marktumfeld und bringen eine neue Geschwindigkeit und Agilität in den Markt sowie neue Produkt- und Serviceentwicklungen. Um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, reichen bekannte und erprobte Strategien nicht mehr aus.
Digitale Ökosysteme sind soziotechnische Systeme, die aus einer Vielzahl von Teilnehmern und technischen Systemen zusammengesetzt sind. Dabei agieren alle Teilnehmer unabhängig voneinander und alle Serviceleistungen werden digital erbracht.[1] Digitale Plattformen zu entwickeln ist ein komplexes Unterfangen, da viele Einzelkomponenten den Erfolg der Plattform beeinflussen. Auch wenn es einige erfolgreiche Beispiele gibt, deren Ökosysteme selbst nicht frei von Fehlern waren, ist der Anteil derer, die scheitern, mit schätzungsweise 85% weitaus größer als derjenigen, die erfolgreich sind.[2] So wird die Mehrheit dieser Projekte nicht umgesetzt, da sie an fehlender strategischer Gesamtausrichtung, Problemen mit der existierenden Technologie und fehlenden Fähigkeiten im Umgang mit den neuen Herausforderungen scheitern.[3] Viele Unternehmen haben technologische Investitionen sowie kulturelle und prozessuale Optimierungen auf der Basis der prädigitalen Welt durchgeführt.
2
Strategien für eine neue Zeit
Digitale Ökosysteme werden in den kommenden Jahren v.a. in traditionellen Branchen Fuß fassen. Diese sind nicht nur für technologische Innovationen, sondern auch für neue Wettbewerber interessant. Die neue Konkurrenz kann sowohl von Start-ups als auch von Anbietern aus anderen Branchen kommen, die durch die Erweiterung ihres Ökosystems in neue Branchen vordringen. Aber auch für Traditionsfirmen bieten der eigene Markt und die Adaption von Ökosystemen aus strategischer Sicht viele Möglichkeiten, da sich die Kundenerwartung von nahtloser Integration in allen Bereichen ausweitet. Häufig ändert sich das Grundbedürfnis an einem Service nicht. So erwarten Kunden von Versicherungsunternehmen nach wie vor den Verkauf von Versicherungen und von Logistikern wird weiterhin erwartet, Waren zu bewegen. Jedoch steigt die Erwartung, eine Vielzahl von Bedürfnissen über einen Service abzudecken.
Diese Entwicklung wird sich nicht verändern. McKinsey geht davon aus, dass sieben der zehn größten Firmen (hinsichtlich der Marktkapitalisierung) Teilnehmer von Ökosystemen sind und dass bis 2025 neue Ökosysteme bis zu 60 Bio. USD Umsatz generieren werden, was circa 30% aller weltweiten Einnahmen ausmachen wird.[4]
Für die Weiterentwicklung einer Firma muss der strategische Nutzen und das Ziel der Weiterentwicklung klar sein. Firmen müssen ein Verständnis dafür entwickeln, welchen Wert sie für ihre Kunden generieren können. Auf der Basis einer solchen Wertermittlung lässt sich die strategische Weiterentwicklung einfacher entscheiden.
2.1
Strategische Neuausrichtung
Firmenstrategien umfassen meist einen Zeitraum von mehr als drei, in manchen Fällen bis zu zehn Jahren. Die Strategien entstehen aus einem erwarteten Marktumfeld, spezifischen oder gesamtwirtschaftlichen Veränderungen und Trends sowie Visionen für das Unternehmen. Derartige Entscheidungen betreffen wesentliche Veränderungen und Weiterentwicklungen der betrieblichen Aktivitäten, Produkte oder auch gesamtunternehmerische Veränderungen.
Die Entwicklung eines Ökosystems ist eine strategische Entscheidung. Allerdings hat sich mit der rapiden Entwicklung von neuen Technologien auch die Geschwindigkeit der Entwicklung derartiger Strategien verändert. Deshalb müssen strategische Entscheidungen häufiger und schneller angepasst werden, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Beispielsweise war noch vor einigen Jahren das zentrale Geschäftsmodell von Netflix der DVD-Handel; heute ist Netflix nicht nur die größte Streaming-Plattform, sondern produziert auch eigene Filme. Die veränderte Mediennutzung war der Anstoß zum Wechsel des Geschäftsmodells.
Die Entscheidung für ein Ökosystem muss für die gesamte Wertschöpfungskette getroffen werden. Vor der Einführung eines digitalen Ökosystems sollte deshalb klar sein, welches Ziel man mit der Entwicklung eines Ökosystems verfolgt. McKinsey hat drei Archetypen dieser Strategien identifiziert:[5]
Neuer Aufbau eines Ökosystems oder Wachstum im Kerngeschäft durch Aufbau eines Partnernetzwerks,
Erweiterung des bestehenden Netzwerks und Portfolios auf einer Plattform und neuer Umsatz durch neu entwickelte Produkte, sowie
Aufbau einer End-to-End-Lösung zum Verkauf an Geschäftskunden, um deren Effizienz zu verbessern.
2.2
Wichtigkeit einer effizienten Umsetzung
Da für viele Unternehmen der Schritt zur Entwicklung von digitalen Systemen neu ist, ist für viele der erste Ansatz, trendige neue Technologien oder Daten zu integrieren, ohne die Technologien und den Mehrwert für das Unternehmen zu verstehen. Deshalb ist es wichtig, als nächsten Schritt nach der Entwicklung der Strategie eine Roadmap zu entwickeln. Diese definiert die evolutionäre Weiterentwicklung über einen mittelfristigen Zeitraum, um das strategische Ziel zu erreichen.
Diese Roadmap sollte aus spezifischen Use Cases bestehen, die über einen relativ kurzen Zeitraum eine positive Investitionsrendite erreicht. Die Use Cases können Digitalisierungen oder Erweiterungen von bestehenden Produkten oder einzelnen Teilbereichen sowie die Integration von neuen Systemen und Technologien oder eine komplette Neuentwicklung sein. Dabei sollte v.a. bei der Entscheidung darauf geachtet werden, dass das Projekt die gesamte Ökosystem-Strategie unterstützt und der Mehrwert der Use Cases klar definiert ist:
Erweiterung der bestehenden Serviceleistung,
Digitalisierung eines bestehenden Service oder
Produktivitätssteigerung des Ertragsprozesses.
Unabhängig von der gewählten Umsetzung bedeutet der Aufbau eines Ökosystems die Auseinandersetzung mit bestehenden Prozessen oder die Entwicklung neuer Prozesse für das Unternehmen: Für bestehende Serviceleistungen und auch für Produktivitätssteigerungen müssen Prozesse in das Ökosystem integriert werden. Diese zu digitalisieren bedeutet allerdings für viele Organisationen, sich mit ihren Prozessen neu auseinanderzusetzen. Viele Prozesse besitzen keinen einheitlichen Standard, der einfach in ein System integriert werden kann. Häufig wurden manuelle Workarounds um bestehende und eingekaufte Systeme entwickelt, um technologische Defizite auszugleichen.
Des Weiteren decken viele bestehende Prozesse nur einen kleinen Teil des wirklichen Alltags ab und das Management von Abweichungen dieser Prozesse beschäftigt eine Vielzahl der Mitarbeiter. Bevor es an die Auswahl von potenziellen Partnern und Systemen geht, müssen für neue Serviceleistungen neue Prozesse und Definitionen aufgebaut werden. Wenn ein klarer Aufbau besteht, müssen vorhandene Systeme und Technologien mit Automatisierungen und neuen Integrationen kombiniert werden.
2.3
Balanceakt zwischen Standards und Flexibilität
Investitionen in neue Ökosysteme bedeuten allerdings auch einen Balanceakt für viele Unternehmen. Für die operative und unternehmensgewandte Seite bedeuten sie die Öffnung hin zu mehr Standardisierung und dadurch mehr Technisierung im Alltag. Nur mit klar strukturierten Standards kann das Unternehmen Digitalisierungs- und Datenpotenziale in seinen Abläufen erkennen und dabei Fehlinvestitionen verhindern.
Andererseits müssen Unternehmen flexibler werden. Dies bedeutet eine schnellere Erkennung von potenziellen Kooperationspartnern, besseres Anpassen an Kundenbedürfnisse und bessere Adaption von Trends. Allerdings muss auch von systemischer und technischer Seite eine größere Flexibilität und Offenheit entwickelt werden – also die Öffnung hin zu Echtzeitdaten, Cloud-Lösungen und die Abkehr von langwierigen Implementierungen großer Systeme.
Darüber hinaus müssen das Management und verantwortliche Projektteams Ideen und Projekte schneller umsetzen. Langzeitliche Veränderungsprogramme und große Projektapparate in Unternehmen haben den Nachteil, dass sie an ganzheitlichen Veränderungen eines Unternehmens ansetzen. Dazu verändern sich der Markt und die Anforderungen der Kunden zu schnell. Deshalb ist eine schnelle Umsetzung, begleitet von einer ganzheitlichen evolutionären Veränderung, der beste Ansatz.
2.4
Kundenbeziehung als neue Währung
Kundenloyalität und die kontinuierliche Investition in die Kundenbeziehung sind der zentrale Baustein beim Aufbau eines Ökosystems. Je besser die Beziehung zum Kunden, umso geringer ist das Wechselbedürfnis und desto mehr Informationen können über den Kunden gesammelt werden. Der Kunde erwartet eine ganzheitliche Nutzererfahrung. Diese inkludiert nahtlos ineinander übergehende Serviceangebote, bessere Aufbereitung und Darstellung von Daten sowie automatisch ausgeführte Prozesse. Die digitale Erfahrung muss sich dabei an das Leben und die Bedürfnisse des Kunden anpassen und nicht andersrum. Deshalb muss ein Ökosystem Tablets, Smartphones, Laptops sowie alle anderen möglichen Endgeräte unterstützen.
Des Weiteren erwartet der Kunde eine auf sich anpassbare Informations- und Serviceerfahrung. Als Antwort auf diese unterschiedlichen Interessen, die sich dynamisch ändern können, muss das Unternehmen dem Kunden eine personalisierte Anpassbarkeit bieten. Am Ende erwartet der Kunde eine End-to-End-Betreuung. Im B2C-Geschäft machen es Firmen wie Amazon oder Apple vor: Amazon hat sich von einem Online-Versandhändler zu einem Vorreiter in den Themen Ökosystem und Kundenbindung entwickelt. Von Musik- und Video-Streaming über die Plattform bis hin zur Steuerung des Alltags durch Alexa produziert Amazon mithilfe der gewonnenen Daten auch eigene Produkte ganz nach dem Bedürfnis des Kunden (Abbildung 2).
Abbildung 2: Ökosysteme der Digital Giants
Quelle: TME Institut (2018)
Diese Vision wird auch für das B2B-Geschäft an Relevanz gewinnen. So steht die Logistikbranche vor der Herausforderung, neue Technologien zu integrieren, wie beispielsweise Sensoren und Telematik. Gleichzeitig zum Live-Tracking erwarten Kunden die Risikobewertung für Verspätungen, was zu neuen Auswertungen und Integrationen von externen Risikodaten führt: Ein Atlantiksturm kann auf die Ankunft des Frachtschiffs Einfluss nehmen oder eine alternative, längere Route bedeuten.
Weiterhin kann eine Ökosystem-Entwicklung von gesellschaftlichen Trends beeinflusst werden. So sorgt das gesteigerte Interesse am eigenen ökologischen Fußabdruck dafür, dass Logistiker vermehrt Auskunft über den eigenen Treibhausgasausstoß geben. Dabei fordert der Markt und das veränderte Kundeninteresse diese Unternehmen auf, in Ökosystemen zu denken.
3
Neue Architektur von Systemen
Mit der Aufgabe, sich an die digitalen Herausforderungen anzupassen, geht jede Firma anders um. Während manche jahrelange teure Transformationsprojekte in der IT anstreben, versuchen andere, ihre IT durch fragmentierte Implementierung neuer Technologien aufzufrischen. Jedoch haben die meisten Firmen mit der Herausforderung eines digitalen und systemischen Flickenteppichs zu kämpfen. Die fehlende Verbindung von Front-End- und Back-End-Systemen ist nur eines der häufig vorkommenden Probleme.
Ein weiteres Problem ist die Undurchsichtigkeit von Projekten, die dazu führt, dass innerhalb eines Unternehmens verschiedene Abteilungen an ähnlichen Lösungen arbeiten. Während die Grenzen von und zwischen den Branchen weiter verschwimmen und die Anforderungen von Kunden an eine End-to-End-Lösung immer höher werden, bedeutet dies ein Umdenken bei Technologie und Systemen für Organisationen.
3.1
Modulare und flexible Architektur
In vielen Firmen blockieren alte IT-Systeme produktives Handeln. Da die meisten monolithischen Systeme langen und teuren Implementierungsverfahren unterlagen, mussten sie immer wieder angepasst werden, um eine große Anzahl von Funktionen zu erfüllen. Häufig werden sie auch über ihren normalen Nutzen hinaus verwendet und sind deshalb nicht effizient. Die meisten Firmen sind aus Kostengründen darauf angewiesen, diese Systeme zu akzeptieren, anstelle sie durch bedarfsgerechte Maschinen zu ersetzen.
Da Ökosysteme aber einen reibungslosen und automatischen Ablauf zwischen verschiedenen Systemen voraussetzen und Kunden eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten erwarten, müssen Firmen vermehrt flexible, genau zugeschnittene Systeme implementieren.[6] Unternehmen müssen sich flexibel und ohne Aufwand mit mehreren Partnern, Applikationen und neu entwickelten Technologien verbinden können. Dies bedeutet für viele Unternehmen eine Abkehr von der traditionellen IT, die darauf ausgelegt ist, sich auf lange Zeit mit einigen wenigen Partnern zu verbinden und Daten im Tages- oder Wochenrhythmus auszutauschen, anstelle dies in Echtzeit zu tun. Firmen werden sich zu einer Best-of-Breed-IT-Architektur entwickeln. Aus jedem Anwendungsbereich wird die beste Lösung herausgesucht und in die eigene IT-Infrastruktur schnell und unkompliziert integriert.
Diese Umgestaltung ist auch eine Chance, interne Prozesse zu verbessern. Um dem Kunden eine ganzheitliche Erfahrung zu ermöglichen, müssen interne mit spezialisierten externen Systemen verbunden werden. Diese Abkehr von einem traditionellen IT-Aufbau bedeutet auch, eine IT aufzubauen und zu managen, die aus mehreren kleinen Bauteilen besteht. Bezüglich der IT-Systeme bedeutet das, dass die Unternehmen eine modulare IT-Architektur entwickeln müssen. Es wird eine Architektur benötigt, die aus mehreren Schichten besteht und sich expliziten Aufgaben widmet. Die einzelnen Teile und Maschinen sind schnell und flexibel austauschbar. Eine dynamische, offene und funktionale Systemarchitektur ist der Schlüssel. Eine solche Architektur kann auch die digitale Transformation beschleunigen, da sie nicht mehr darauf ausgelegt ist, stetig weiterentwickelt zu werden, sondern dass die besten Systeme extern eingekauft werden.
3.2
Schnelle und reibungslose Integration
Interne Systeme müssen über die Möglichkeit verfügen, sich mit externen Systemen möglichst schnell zu verbinden und sich schnell und ohne großen Implementierungsaufwand in diese integrieren zu lassen. Sie müssen nicht nur von einem zentralen Ort in alle Systeme gelangen, die diese für ihren Ablauf benötigen. Sie müssen auch den direkten Zugriff von Analyseteams erlauben.
Für ein Ökosystem bedeutet dies die Nutzung von Micro-Services und Application Programming Interfaces (APIs).[7] Sie erlauben es, Dienste einfach zu skalieren, und helfen, Daten von verschiedenen externen Lieferanten abzurufen, sie zu verarbeiten und zu speichern. Das ist v.a. wichtig, wenn Services in Echtzeit angeboten werden sollen. APIs sind auch ein guter Ansatz, da sie die Zugriffsrechte limitieren und somit unerwünschte Änderungen oder das unbefugte Abrufen von Daten verhindern.
Die Zusammenarbeit mit neuen Providern und die Integration von neuen Technologien können das Geschäftsmodell einer Firma verändern. Deshalb muss die IT auch mit Innovationen und den Entwicklungen des Marktes Schritt halten, um den Einfluss einer Integration abzuschätzen. Um möglichst schnell den Mehrwert eines neuen Service zu testen, muss die Infrastruktur auf das schnelle Testen von Konzepten und Ideen ausgelegt werden. Das bedeutet für Firmen, dediziertes Personal zu haben, das den Markt beobachtet und Technologien testet.
Bezüglich der Strategie sollte bedacht werden, wie Firmen mit Partnern interagieren wollen und wie sie diese in ihr Ökosystem integrieren.[8] Dabei muss definiert werden, welche Firmen einen Mehrwert bringen, um das eigene Serviceangebot passend zu erweitern. Deshalb muss auch auf oberster Managementebene klar sein, wie sich der eigene Markt verhält, welche Technologien sich innerhalb und außerhalb entwickeln und wie diese die Kundenerfahrung erweitern. Darüber hinaus muss klar sein, wie sich die Interaktion für beide Partner vorteilhaft gestaltet. Dies kann z.B. die Ausarbeitung von Verträgen beinhalten, die auf der Basis von guter Leistung funktionieren.
3.3
Cloud als Standard
Die meisten Unternehmensanwendungen wurden in der Vergangenheit auf benutzerdefinierten Systemen aufgebaut. Traditionell erforderten diese spezifische Konfigurationen, Anpassungen sowie neue Implementierung und viele Personal-Ressourcen. Deshalb ist die Entscheidung, die eigene Systemstruktur zu standardisieren und zu automatisieren, nicht nur mit viel Einsparpotenzial verbunden, sondern erhöht auch die Geschwindigkeit für Neuentwicklungen und Implementierungen sowie den Servicelevel in einem Ökosystem.
Die Voraussetzung für eine solche Umstellung der IT ist die Einführung einer Cloud. Für viele Unternehmen stand die Einführung von Cloud-Lösungen lange nicht auf der Agenda. Sorge um die Abhängigkeit von einzelnen Cloud-Anbietern wie Google oder Amazon sowie die Sicherheit von Daten und der Neugestaltungsaufwand von Traditionssystemen sind die häufigsten Gründe. Trotz dieser Bedenken ist die Cloud-Nutzung mittlerweile ein Muss für eine Ökosystem-Plattform. Die schnelle Skalierung und Integration von neuen Daten, Modellen und Systemen verkürzt den Freigabezyklus.
Die Transformation hin zu einer vollkommenen Cloud-Lösung bedeutet zunächst Vorabinvestitionen und die Bereitschaft, teilweise über mehrere Jahre eine Umgestaltung der eigenen Systemlandschaft in Kauf zu nehmen. Da bestehende Systeme in den bekannten statischen IT-Netzwerken mit wenigen Rechenzentren liegen, ist es deshalb nicht damit getan, die alte Software in die Cloud zu schieben, da das System an sich statisch bleibt. Vielmehr müssen Infrastruktur, Betriebsmodelle und Umsetzungsprojekte mit dezidierten Teams besetzt werden. Häufig bedeutet die Einführung und Nutzung der Cloud auch eine Umschulung oder die Neueinstellung von Arbeitskräften. Die entstehenden Kosten werden später mit geringeren laufenden Kosten aufgewogen, da die spezielle Anpassung der IT bei neuen Implementierungen wegfällt. Dadurch verringert sich der Administrationsaufwand.
3.4
Vorsicht vor dem Datensumpf
Die meisten Firmen besitzen intern genügend eigene Daten. Meist sind diese allerdings in Abteilungen und Systemsilos eingeschlossen. Durch die Integration von zusätzlichen fremden Daten können Firmen in einem Datensumpf versinken. Um dies zu verhindern, sollten sich Firmen mit Datenmanagement auseinandersetzen. Dieses Datenmanagement muss die Herkunft und Nutzung der eigenen Daten klar regeln.
Weiterhin sollten Firmen eine erwartete Datenqualität und Integrität definieren. Dies hilft zu beurteilen, ob ein externer Anbieter auch die relevanten Daten in der nötigen Form liefern kann. Auf diese Weise kann eine Organisation Rückschlüsse auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit dem Datenlieferanten ziehen.
Effizienter Umgang mit Daten ist die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Ökosystem. Deshalb ist eine gut integrierte Datenbasis der Schlüssel für jegliche Art der Weiterverwendung von Daten. Der Großteil der Daten ist hierbei nicht immer strukturiert, sondern setzt sich aus heterogenen, nicht strukturierten Daten zusammen. Diese werden vermehrt aus neuen Datenquellen, wie z.B. Sensoren oder über das automatische Auslesen von Dokumenten, gewonnen.
3.5
Governance und Sicherheit
Auch Daten-Governance und -Sicherheit nehmen einen hohen Stellenwert ein.[9] Durch die Vielzahl an Partnerschaften, Nutzern und Daten sowie Datenweiterverarbeitungen ergeben sich auch Herausforderungen für den Datenschutz. Klare Regeln müssen definieren, wer welche Daten an wen schicken darf, wie diese Daten gespeichert werden und wie sie weiter genutzt werden können.
Strikte Regeln für Privatsphäre, Besitz von Daten und geistigem Eigentum bedeuten eine Herausforderung für Unternehmen. Daraus ergibt sich wiederum eine große Herausforderung für Datenschutzbeauftragte, Anwälte und Verantwortliche für Verhandlungen mit externen Anbietern. Verträge müssen deshalb so ausgestaltet werden, dass jede Eventualität der Nutzung für Firmen klar definiert und abgedeckt ist.
4
Neue Organisation
Firmen scheitern beim Aufbau von Ökosystemen und der Umsetzung von neuen Strategien am häufigsten an der eigenen Organisation. Wie offen ein Unternehmen einer digitalen Transformation gegenübersteht, hat von Anfang an einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg. Der Aufbau eines digitalen Ökosystems bedeutet für die firmeninterne Kultur, eine neue fokussierte Kundenperspektive zu haben, Kundenbedürfnisse zu verstehen und diese in den Mittelpunkt der Entscheidung zu stellen. Damit verändern Ökosysteme auch die tägliche Arbeit und somit auch gelernte und gelebte Routinen.
Eine solche Transformation ist eine gewaltige Aufgabe, besonders für etablierte Unternehmen in Branchen, die bisher weniger von disruptiven Marktveränderungen betroffen waren. Die ganzheitliche Transformation von Organisationen und gelebten Kulturen ist ein langfristiges Verfahren, das in den meisten Fällen von Unternehmen unterschätzt wird oder mit langwierigen, jahrelangen Projekten ohne vordefiniertes Ziel umgesetzt wird. Allerdings gilt hierfür die gleiche Devise wie für Technik und Strategie: Evolution.
4.1
Neues Management
Firmen mit gut verlaufenden Veränderungsprozessen haben ein Top-Managementteam, das die Entscheidung selbst mitträgt und Veränderungen als Teil des täglichen Geschäfts sieht. Weiterhin verändert ein digitales Ökosystem die Anforderungen an Manager auf zwischenmenschlicher und technischer Ebene. Der vorherige Projektmanagement- und Betriebswirtschaftsfokus wird mehr auf Motivation, Unterstützung und Führung von Menschen gelegt. Dazu werden auch vermehrt technische Fähigkeiten gefragt sein, da neue Technologien, verstärkte Datennutzung und moderne analytische Werkzeuge der zukünftige Alltag sein werden.
Dieses technische Verständnis wird benötigt, um sowohl die Anwendung als auch die Potenzialanalyse von Innovationen zu bewerten. Dabei ist wichtig, dass von Veränderung betroffene Manager die Entscheidung mittragen, da diese einen starken Einfluss auf die Anpassung haben. Fehlende Verpflichtung von Führungskräften sowie deren fehlende Unterstützung haben auch einen wesentlichen Einfluss auf die Umsetzung der definierten Use Cases. Führung produziert eine Vision und legitimiert die Veränderungen, die sich durch Prozesse und Aktivitäten im Ökosystem ergeben. Sie definieren die Umwelt, in der die Veränderung stattfindet.
4.2
Funktionsübergreifendes Arbeiten
Digitale Ökosysteme fordern auch eine strukturelle Veränderung von Organisationen. Erfolgreiche Ökosysteme haben einen spezifischen Kundenfokus und evaluieren neue Innovationen kontinuierlich. Um die einzelnen Teile des Ökosystems weiterzuentwickeln, brauchen die Umsetzungsteams direkten Kontakt zum Kunden und zum Markt, um Dinge zu adaptieren. Ebenso ist Wissen über Technologie, System und bestehende Prozesse gefragt. Deshalb sollten die Teams für solche Ökosystem-Projekte am besten mit Vertretern aus den verschiedenen Unternehmensbereichen besetzt werden.
Diese Teams brauchen die Freiheit, neue Möglichkeiten schnell und unbürokratisch zu testen, auszubauen und zu skalieren. Sie brauchen außerdem freien und schnellen Zugang zu internen und externen Servicepartnern und Experten. Für solche Anforderungen sind starre Organisationen und Abteilungssilos hinderlich. Anstelle von einzelnen starren Abteilungszugehörigkeiten wird es in Zukunft mehr um funktionale Rollen gehen und deren Beitrag zum Ökosystem.
Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass Personen selbst ihren Wert in der Wertschöpfungskette erkennen. Es wird klar, was der Einzelne an Fähigkeiten zur Veränderung beitragen kann. Die Zusammenarbeit führt zu der eigenen Erfahrung, dass Veränderungen auch viele Vorteile bringen. Allerdings muss einer Organisation trotzdem bewusst sein, dass Veränderung zunächst mit Widerstand und geringerer Motivation einhergeht – mögen die positiven Auswirkungen auch noch so klar auf der Hand liegen.
Der Vorteil funktionsübergreifender Umsetzungsteams liegt neben der Expertise darin, dass diese Teams den Veränderungsprozess – von anfänglicher Ablehnung bis hin zur Identifikation – früher als das restliche Unternehmen durchleben. Sie können daher Unterstützer der Veränderung sein. Obwohl Veränderungsprozesse schwierig sind, können sie doch einen Vorteil haben, wenn man Menschen auf der Basis ihrer Fähigkeiten daran teilhaben lässt. Eigene Stärken und Fähigkeiten einzubringen, kann dafür sorgen, dass Veränderung schneller zur positiven Erfahrung und zu einem guten Gefühl führt.
4.3
Digitale Kultur, Vertrauen und Fehler
Wie in einem in der Natur vorkommenden Ökosystem gibt es auch im digitalen Ökosystem zwei Komponenten: die Umgebung und die Organismen, die darin vorkommen. Beide leben in einer Wechselwirkung miteinander. Organisationen kreieren und beeinflussen Werte und Überzeugungen der Menschen. Dies hat im Umkehrschluss Einfluss auf die Art und Weise, wie man sich Problemen und Herausforderungen stellt und wie man sie löst. Veränderung der eigenen Verhaltensweisen, Einstellungen und Wahrnehmungen von neuen Themen sind auch immer von der direkten Umgebung geprägt. Subkulturen und Teamdynamiken haben einen besonderen Einfluss auf die Offenheit für Veränderungen, da Mitarbeiter mit diesen im täglichen Kontakt leben.
Deshalb beeinflusst auch die Unternehmenskultur die Offenheit, das Verantwortungsgefühl und den Willen, sich mit einem Ökosystem auseinanderzusetzen. Die Teilnahme an Ökosystemen wird am häufigsten verhindert oder zumindest verlangsamt, weil Firmen daran scheitern, das Verhalten ihrer Mitarbeiter und somit die Firmenkultur kundenfokussierter, technologisch fortschrittlicher und datenfokussierter zu machen. Eine gute, dem Ökosystem aufgeschlossene Kultur erhöht die Wahrscheinlichkeit der Kooperation untereinander und mit dem Kunden. Je mehr die Wahrnehmung entsteht, dass ein Ökosystem die eigene Arbeit bereichert, desto offener werden die Mitarbeiter gegenüber etwaigen Veränderungen durch neue Technologien sein.
Veränderungen im digitalen Zeitalter bedeuten den Aufbruch in unsichere Zeiten. Für die meisten Branchen kann heute noch nicht abgeschätzt werden, wie sie in Zukunft aussehen. Deshalb bedeuten Investitionen in Projekte nicht unbedingt immer eine sofortige Rendite. Manchmal bedeutet es sogar, eher Fehlinvestitionen zu tätigen und Fehler zuzulassen, sie sogar einzufordern. Wenn Firmen die Erwartung haben, Daten in Echtzeit durch ihre Ökosysteme zu verarbeiten, müssen Kulturen eine ähnlich schnelle Interaktion miteinander pflegen: Offenheit für Neues, Risikobereitschaft sowie kollaborativer Austausch sind hierbei die zentralen Erfolgsfaktoren.
Je offener eine Kultur für kontinuierliches Lernen und für Fehler ist, umso mehr diese sogar gewünscht sind, desto empfänglicher und bereiter werden Mitarbeiter sein, sich auf eine solche Veränderung einzulassen. In typischer Start-up-Manier gilt: scale fast, fail fast![10] Digitalisierung – und damit auch der Aufbau von Ökosystemen – ist volatil, ungewiss und komplex. Innovationen erfordern Mut. Auch Fehlinvestitionen helfen zu verstehen, wie man Strategien und Projekte besser umsetzen kann.
5
Fazit
Die Einführung eines digitalen Ökosystems bedeutet eine ganzheitliche Herausforderung für das Unternehmen. Von der Integration neuer Partner über die Neuordnung der eigenen Daten bis hin zu einem neuen Kundenfokus verändert sich entlang der Wertschöpfungskette alles. Dabei können digitale Ökosysteme auf viele Arten Wert für Unternehmen generieren. Bessere Integration von Prozessen sowie Automatisierung können signifikant geringere Kosten für Prozesse bedeuten. Weiterhin können durch die Ausweitung des Partnernetzwerks und durch die Integration einer Vielzahl von Daten neue Umsatzströme generiert werden.
Ein digitales Ökosystem schafft erst dann einen Mehrwert für seine Kunden, wenn es in der Lage ist, die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern barrierefrei in eine Plattform zu integrieren und aus der Vielzahl der Daten neue Möglichkeiten für Services und Produkte zu generieren. Da die Kosten für die Integration von Partnern immens gesunken sind, stellen Transaktionskosten zwischen Partnern kein Hindernis für Integration dar.
Dadurch werden digitale Ökosysteme auch finanziell interessant und viele Firmen beginnen, auswärts nach einer passenden Lösung zu suchen, anstatt alles selbst zu entwickeln. Sich gegen die Teilnahme an einem Ökosystem zu entscheiden und selbst keine Strategie zu haben, eines zu entwickeln, bedeutet in Zukunft, Kunden an Innovatoren zu verlieren, die durch die Verbindungen mit Partnern in ihrem Ökosystem in den Markt drängen.
Literatur
Catlin, T./Deetjen, U./Lorenz, J.T./Nandan, J./Sharma, S. (2020): Ecosystems and platforms: How insurers can turn vision into reality, McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/ecosystems-and-platforms-how-insurers-can-turn-vision-into-reality (letzter Abruf am 14.11.2020).
Dietz, M./Khan, H./Rab, I. (2020): How do companies create value from digital ecosystems?, McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-do-companies-create-value-from-digital-ecosystems (letzter Abruf am 14.11.2020).
Jacobides, M.G./Lang, N./von Szczepanski, K. (2019): What Does a Successful Digital Ecosystem Look Like?, Boston Consulting Group, https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/what-does-successful-digital-ecosystem-look-like (letzter Abruf am 15.11.2020).
Jacobides, M.G./Sundararajan, A./van Alstyne, M.W. (2019): Platforms and Ecosystems: Enabling the Digital Economy, World Economic Forum, https://www.weforum.org/whitepapers/platforms-and-ecosystems-enabling-the-digital-economy/ (letzter Abruf am 15.11.2020).
Lang, N./von Szczepanski, K./Wurzer, C. (2019): The Emerging Art of Ecosystem Management. Boston Consulting Group, https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/emerging-art-ecosystem-management (letzter Abruf am 15.11.2020).
Netzoekonom.de (2018): Die Unwucht der Plattform-Ökonomie, https://www.netzoekonom.de/2018/06/24/wert-der-plattform-oekonomie-steigt-im-ersten-halbjahr-um-1-billion-dollar/ (letzter Abruf am 26.02.2021).
Reeves, M./Lotan, H./Legrand, J./Jacobides, M.G. (2019): How business ecosystems rise (and often fall), in: MIT Sloan Management Review, 60. Jg., Nr. 4, S. 1-6.
Saleh, T./Nadjia, Y./Luers, A./Brock, J. (2013): The Age of Digital Ecosystems: Thriving in a World of Big Data, Boston Consulting Group, https://www.bcg.com/de-de/publications/2013/technology-industries-digital-ecosystems-thriving-world-big-data (letzter Abruf am 15.11.2020).
TME Institut (2018): Ökosysteme der Digital Giants, https://tme-ag.de/whitepaper/vorgehensmodell-zum-aufbau-eines-digitalen-oekosystems/ (letzter Abruf am 26.02.2021).
Trapp, M./Naab, M./Rost, D./Nass, C./Koch, M./Rauch, B. (2020): Digitale Ökosysteme und Plattformökonomie: Was ist das und was sind die Chancen?, in: Informatik Aktuell. https://www.informatik-aktuell.de/management-und-recht/digitalisierung/digitale-oekosysteme-und-plattformoekonomie.html (letzter Abruf am 11.11.2020).
van Alstyne, M.W./Parker, G.G./Choudary, S.P. (2016): 6 Reasons Platforms Fail, in: Harvard Business Review, https://hbr.org/2016/03/6-reasons-platforms-fail (letzter Abruf am 11.11.2020).
Fußnoten:
[1]Vgl. Trapp, M. et al. (2020).
[2]Vgl. Reeves, M. et al. (2019).
[3]Vgl. van Alstyne, M.W. et al. (2016).
[4]Vgl. Catlin, T. et al. (2020).
[5]Vgl. Dietz, M. et al. (2020).
[6]Vgl. Jacobides, M.G. et al. (2019).
[7]Vgl. Catlin, T. et al. (2020).
[8]Vgl. Jacobides, M.G. et al. (2019); Lang, N. et al. (2019).
[9]Vgl. Jacobides, M.G. et al. (2019).
[10]Vgl. Saleh, T. et al. (2013).
Rollenfindung in einer Welt digitaler Ökosysteme – Positionierung von Versicherern und Maklern
Gerrit Böhm
1
Einleitung
2
Positionierung von Versicherungsunternehmen
2.1
Risikoanalyse
2.1.1
Beurteilung anhand der VUCA-Kriterien
2.1.1.1
Volatilität
2.1.1.2
Unsicherheit
2.1.1.3
Komplexität
2.1.1.4
Mehrdeutigkeit
2.1.2
Plattformökonomie und Ökosysteme
2.2
Handlungsempfehlungen
2.2.1
Identifikation der derzeitigen Rolle
2.2.2
Identifikation der Stärken und Gefährdungsanalyse
2.2.3
Schwächenanalyse als Grundlage der Transformation
2.2.4
Mehrdeutigkeit, Ambidextrie und Agilität
3
Maklerunternehmen
3.1
Risikoanalyse
3.1.1
Beurteilung anhand der VUCA-Kriterien
3.1.1.1
Volatilität
3.1.1.2
Unsicherheit
3.1.1.3
Komplexität
3.1.1.4
Mehrdeutigkeit
3.1.2
Plattformökonomie und Ökosysteme
3.2
Handlungsempfehlungen
3.2.1
Kundentypisierung
3.2.2
Identifikation der eigenen Rolle
3.2.3
Monetarisierungsstrategie erarbeiten
4
Fazit und Ausblick
Literatur
1
Einleitung
Die moderne Welt wird in der Literatur als volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig (VUCA[1]) beschrieben.[2] Innerhalb dieser VUCA-Welt werden Versicherer und Makler regelmäßig mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden ihre Geschäftsmodelle nicht schnell und konsequent genug an sich verändernde Umweltzustände anpassen.[3] In der Folge würden sie durch agile Unternehmen, die den digitalen Wandel annehmen und für sich nutzen, verdrängt. Agile Fähigkeiten werden häufig jungen Unternehmen zugeschrieben, während etablierten Unternehmen aufgrund von trägeren Strukturen tendenziell weniger zugetraut wird.
Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Verbreitung von Plattformgeschäftsmodellen, die – eingebettet in digitale Ökosysteme – lineare Geschäftsmodelle zunehmend ersetzen oder ergänzen. Folgt man diesem Narrativ, stehen Versicherer und Makler derzeit vor enormen Herausforderungen.
In diesem Beitrag wird für Versicherer und Makler diskutiert, wie sich diese Unternehmen in einer digitalisierten und zunehmend durch Plattformen und Ökosysteme geprägten VUCA-Welt behaupten können. Die Herausforderungen und Risiken werden zunächst vor dem Hintergrund der genannten Trends analysiert, bevor anschließend Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Die Analyse differenziert sowohl bei der Risikoanalyse als auch bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen nach Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen.
2
Positionierung von Versicherungsunternehmen
2.1
Risikoanalyse
2.1.1
Beurteilung anhand der VUCA-Kriterien
Unsere heutige Geschäftswelt gilt als volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Jede einzelne dieser Eigenschaften ist für sich genommen bereits eine große Herausforderung für Unternehmen. Zusammengenommen, sich überlappend und gleichzeitig auftretend erscheint die Bewältigung dieser Eigenschaften kaum möglich zu sein. Betrachten Unternehmen die genannten Eigenschaften jedoch einzeln, ist eine gezielte Vorbereitung bzw. ein dauerhaft konstruktiver Umgang mit den sich ableitenden Herausforderungen möglich.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Risiken gegeben, die für Versicherungsunternehmen aus der VUCA-Welt entstehen, bevor die einzelnen Aspekte versicherungsspezifisch diskutiert werden.
2.1.1.1
Volatilität
Volatile Situationen zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Ausprägungen bestimmter Parameter (z.B. Preise) unerwartet ändern bzw. instabil sind. Volatile Situationen sind nicht notwendigerweise komplex und es besteht ein ausreichendes Verständnis der Wirkungszusammenhänge. Das genaue Ausmaß der Schwankungen sowie deren Dauer sind hingegen nicht sicher vorhersehbar. Risiken können durch eine mangelnde Vorbereitung auf Schwankungen von Parametern entstehen. Beispielsweise könnte die Nachfrage nach Versicherungsschutz aufgrund externer Schocks plötzlich einbrechen. Ist das Unternehmen auf solche Nachfrageschwankungen nicht vorbereitet, können wirtschaftliche Schäden entstehen, z.B. durch nicht ausgelastete Vertriebs- oder Antragsbearbeitungsmitarbeiter.
Ein weiteres Beispiel sind Großschadenereignisse, die durch Naturkatastrophen hervorgerufen werden. Es ist absehbar, dass wegen des Klimawandels vermehrt Ereignisse mit Starkregen eintreten werden. Es ist ebenso klar, dass Starkregen die Schadenzahlungen beeinflussen wird; auch die Richtung dieser Beeinflussung ist klar. Unklar ist aber, wann genau diese Ereignisse eintreten und wie deren genaue Ausprägung sein wird.
Ein Ansatz, um Risiken aus Volatilität zu mindern, ist – abstrakt formuliert – die Lagerhaltung. So könnte ein Unternehmen z.B. verstärkt Ressourcen beschaffen (z.B. Headsets, Notebooks), um in einer Krisensituation, in der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten müssen, handlungsfähig zu bleiben – also auch dann, wenn es aufgrund des externen Schocks zu Lieferengpässen kommt. Lagerhaltung kann als Lösung ziemlich teuer sein, z.B., wenn man viele hochqualifizierte Talente an sich binden möchte, um nicht in einen Talent-Engpass zu laufen. Daher ist ein Matching von Risiko und Lagerhaltungsmaßnahmen erforderlich.[4]
Alternative Maßnahmen sind das Absichern von Risiken durch Versicherungen, z.B. Swaps am Kapitalmarkt, sowie das Herstellen von Skalierungsfähigkeit, z.B. durch die Unterstützung externer Dienstleister.
2.1.1.2
Unsicherheit
Unsicherheit zeichnet sich dadurch aus, dass man in Bezug auf ein Ereignis zwar dessen grundlegenden Gegenstand und die mögliche Wirkungsweise kennt, man aber nicht sicher sein kann, ob, wann und wie genau das Ereignis eintreten wird. Das Risiko, das aus Unsicherheit entsteht, ist die Möglichkeit, dass das Unternehmen einschlägigen Veränderungen schlecht oder gänzlich unvorbereitet gegenübersteht.
Ein Beispiel ist die unter dem Stichwort „Provisionsdeckel“ diskutierte Einführung weiterer Regeln in Bezug auf Abschlusskosten, Provisionen und Courtagen. Aus Sicht eines Versicherungsunternehmens ist nicht klar, ob überhaupt, wann und in welcher Form derlei Regelungen vom Gesetzgeber eingeführt werden. Gleichwohl gibt es bereits Gesetzesentwürfe, sodass der grundlegende Inhalt etwaiger Regelungen sowie mögliche Instrumente bereits antizipiert werden können.
Versäumt ein Versicherungsunternehmen die rechtzeitige Vorbereitung (z.B. Anpassung von Verträgen oder Überarbeitung von IT-Systemen), kann das schwerwiegende Folgen z.B. für die Neugeschäftsentwicklung haben; insbesondere wenn es den Wettbewerbern gelingt, die notwendigen Arbeiten rechtzeitig durchzuführen.
Unsicherheit kann ein Unternehmen mit zwei Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen, begegnen:
Investition in Informationsgewinnung und
Vorbereitung durch das Planen von Szenarien.
2.1.1.3
Komplexität
Komplexe Situationen zeichnen sich dadurch aus, dass viele Komponenten und Variablen auf verschiedene Weisen miteinander zusammenhängen. Wenngleich es Wissen über einzelne Komponenten, Verbindungen und Wirkungsweisen gibt, ist das Erfassen des Gesamtsystems schwierig bis unmöglich. Aus Unternehmenssicht besteht das Risiko v.a. darin, die Wirkungszusammenhänge nicht richtig zu antizipieren und dadurch kaum wirksame (ineffiziente), gar nicht wirksame (ineffektive) oder gar kontraproduktive (dysfunktionale) Maßnahmen zu planen und durchzuführen.
Ein Beispiel ist eine international agierende Versicherungsgruppe, die ein neues Produkt in verschiedenen Ländern vermarkten möchte. Dabei ist u.a. eine Vielzahl an regulatorischen und länderspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen. Außerdem sind je Vertriebsweg und Land gänzlich unterschiedliche Wettbewerbssituationen zu bewerten. Wird hier versäumt, länderspezifisch exakt zu analysieren, ist eine Fehlallokation z.B. von Werbebudget (z.B. Print statt Social Media) wahrscheinlich.
Im Gegensatz zur Mehrdeutigkeit sind komplexe Situationen grundsätzlich strukturierbar. Daher sollte das Augenmerk hier auf der Analyse und dem Erkennen von Strukturen und Wirkungszusammenhängen liegen, um auf die komplexe Situation nicht mit unterkomplexen Maßnahmen zu reagieren. Im genannten Beispiel sollte sich der Versicherer die Mühe machen, jede Marktsituation länderspezifisch zu analysieren und den Marketingmix entsprechend zu gestalten.
2.1.1.4
Mehrdeutigkeit
Im Gegensatz zu komplexen Situationen handelt es sich bei mehrdeutigen Situationen um solche, in denen man keine sicheren Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge hat. Das Risiko ist vergleichbar mit dem Risiko, das komplexen Situationen innewohnt: der Fehlallokation von Ressourcen. Im Gegensatz zu komplexen Situationen kann man diesem Risiko jedoch nicht wirksam durch verstärkte Analyse begegnen. Man weiß noch nicht einmal, welches Wissen fehlt, weshalb ein lineares, zielgerichtetes Vorgehen zur Risikominderung ausscheidet.
Beispielsweise erkennt ein Versicherungsunternehmen, dass seine bisherige (Kern-)Kompetenz (z.B. Spezialisierung auf ein bestimmtes Versicherungsprodukt in einem bestimmten Land mit einer bestimmten Zielgruppe über einen bestimmten Vertriebskanal) nicht mehr lange gefragt sein wird. Nun versucht es sich mit einem neuen Produkt über einen neuen Vertriebskanal ein zweites Standbein aufzubauen. Aus Sicht des Unternehmens ist diese Situation nicht nur unsicher, sondern auch mehrdeutig (ambiguous). Das Unternehmen kann sich nicht einmal sicher sein, ob es dieses Produkt überhaupt entwickeln kann, geschweige denn, ob es in der Lage sein wird, einen gänzlich neuen Vertriebskanal erfolgreich zu bedienen.
Eine Antwort auf diese Situation kann gezieltes Experimentieren sein, um sich Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge langsam zu erarbeiten. Das Unternehmen könnte sich z.B. zunächst der Frage widmen: Werden wir in der Lage sein, ein andersartiges Produkt zu entwickeln? Es kann dann versuchen, Prototypen zu erstellen, um Sicherheit in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten zu erlangen. Es kann anschließend erste Tests in Bezug auf die Akzeptanz bei den als Zielgruppe definierten Kunden durchführen (z.B. über einen Klick-Dummy, der über Social Media beworben wird). Entscheidend bei diesen Experimenten ist, sie so zu gestalten, dass möglichst klare Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge entdeckt (oder auch verworfen) werden. Die Erkenntnisse sollten möglichst allgemeingültig sein, damit man auf ihnen aufbauen kann.
2.1.2
Plattformökonomie und Ökosysteme
Plattformgeschäftsmodelle (eingebettet in Ökosysteme) bergen ein unglaubliches Potenzial in sich (Google, Apple, Amazon, Facebook (GAFA) im Westen, Baidoo, Alibaba, Tencent (BAT) im Osten). Sie können aber für Unternehmen, die sich nicht anpassen bzw. nicht „mitmachen“, sehr gefährlich sein.[5] Andererseits ist – zumindest in Deutschland – das große Versicherersterben bislang ausgeblieben. Spielen Plattformgeschäftsmodelle für deutsche Versicherer also keine Rolle?
Die Gründe dafür, dass deutsche Versicherer bislang nicht hart getroffen wurden, sind vielfältig und sollen hier nicht ausführlich diskutiert werden. Ein Verständnis über die Entwicklungen, die Plattformgeschäftsmodelle erst ermöglicht haben, ist hingegen entscheidend, um die Risiken für Versicherungsunternehmen analysieren zu können:
Der erste Treiber ist die Deregulierung (Strom, Telekommunikation, Logistik etc.), die dazu führt, dass Kundenbedürfnisse auf neue Art und Weise durch neu in den Markt eingetretene Unternehmen bedient werden können, mithin Wettbewerb forciert wird und zudem neuartige Kooperationen ermöglicht werden.
Der zweite Treiber ist die Verbindung von Produkten und Services (Servitization).[6] Die Möglichkeiten, Produkte und Services miteinander zu verbinden, wurden durch die Digitalisierung erheblich erweitert. Produkte und Services können zudem modular aufgebaut und z.B. mithilfe von Plattformen freier kombiniert werden als zuvor. Dies kann zu neuartigen Produkt-Service-Kombinationen führen.
Der dritte Treiber ist die technologische Entwicklung, die insbesondere durch die Kombination von Internet und mobilen Endgeräten neue Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen hat. Die Risiken und Chancen für Versicherungsunternehmen basieren auf den genannten Entwicklungen.[7]
Die Tatsache, dass die deutsche Versicherungsbranche weiterhin stark reguliert ist, wirkt als Markteintrittsbarriere für neue Konkurrenten. Daher werden entsprechend weniger Unternehmen mit dem Ziel gegründet, den vorhandenen Versicherern in ihrer Rolle als Risikoträger Konkurrenz zu machen. Wettbewerb findet eher rund um vor- und nachgelagerte Teile der Wertschöpfungskette statt (z.B. im Bereich Vermittlung). Eine erhebliche Reduktion dieser Regulierung wäre aus Sicht etablierter Versicherungsunternehmen eine Entlastung; allerdings wäre sie ein Risiko in Bezug auf den in der Folge intensivierten Wettbewerb.
Auch durch die Verbindung von Produkten und Services können Risiken für Versicherungsunternehmen entstehen. Wertschöpfung kann von dem Produkt „Risikoabsicherung“ in Richtung „Services“ abwandern und das Produkt „Risikoabsicherung“ dadurch entwertet werden. Ein Beispiel ist die Kfz-Versicherung in Verbindung mit dem Trend zu Full-Service-Paketen beim Autokauf. Während früher die Versicherungsentscheidung aus Kundensicht getrennt vom Autokauf betrachtet wurde, ist sie heute häufig in den Kaufprozess eingebettet. Das Produkt Auto und das Produkt Kfz-Versicherung werden nicht mehr als getrennte Produkte gesehen. Automobilhersteller versuchen selbst, das Automobil als solches nicht mehr als einzelnes Produkt zu platzieren, sondern bieten Mobilität als Service an.
In Verbindung damit steht, dass Autos geleast oder finanziert werden und somit nicht mehr hohe Einmalbeiträge, sondern regelmäßige Zahlungen durch den Kunden geleistet werden. Aus Kundensicht „mietet“ sich der Kunde die Mobilität und darin eingebettet gleichzeitig den Werkstattservice, den Reifenwechsel und häufig auch die Absicherung durch eine Kfz-Versicherung. Üblicherweise kooperiert der Automobilhersteller mit einem oder wenigen Versicherern, um die Risikoabsicherung anbieten zu können, ohne dass dabei die Marke des Risikoträgers eine Rolle spielt.
Für den Risikoträger, der als Kooperationspartner ausgewählt wird, kann dies ein erfolgreicher Absatzkanal sein. Jedoch verliert man die Schnittstelle zum Kunden zumindest teilweise und die eigene Marke gerät in den Hintergrund. Ein noch größeres Risiko ist eine solche Entwicklung für Versicherungsunternehmen, die nicht als Kooperationspartner ausgewählt werden. Verteilte sich der Absicherungsbedarf in der Vergangenheit auf eine Vielzahl von Anbietern, so konzentriert sich der Absatz nun auf einen oder wenige Risikoträger.
Risiken entstehen auch durch den dritten Treiber (technologische Entwicklung), der eng mit dem zweiten Treiber (Verbindung von Produkten und Services) verbunden ist. Ein Beispiel ist die Herstellung größerer Transparenz durch Technologie. Versicherungsvergleiche sind technisch gesehen auf Knopfdruck möglich und erlauben damit in der Theorie eine nie dagewesene Transparenz aus Kundensicht. Die hohe Komplexität der Versicherungslandschaft und die Tatsache, dass die Mittler eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen, erschweren es für Kunden oft dennoch, Vergleiche anzustellen, die die eigene Bedarfssituation adäquat berücksichtigen. Unabhängig davon, wie valide Vergleiche tatsächlich sind, kann mittelbar über eine beim Kunden erfolgreich vermarktete Vergleichstechnologie für den Mittler eine erhebliche Marktmacht entstehen, die ein Risiko für den Risikoträger sein kann.
Technologie kann auch dafür sorgen, dass sich Risiken, die typischerweise durch Versicherer abgesichert werden, nicht mehr so häufig entstehen und Versicherern in der Folge ihre Geschäftsgrundlage verloren geht. Ein Beispiel sind Feuchtigkeitssensoren im Haus, die automatisch, sobald Feuchtigkeit registriert wird, das Wasser abstellen. Derartige technische Hilfsmittel, die Risiken vermindern, können die Geschäftserwartungen von Versicherungsunternehmen erheblich beeinträchtigen, wenn es den Versicherern nicht gelingt, aktiv an der Problemlösung und der damit verbundenen Wertschöpfung teilzuhaben.
Die Kombination der genannten Treiber hat zur Entwicklung von Plattformgeschäftsmodellen geführt. I.d.R. werden dabei Angebot und Nachfrage auf neue Art und Weise zusammengebracht. Ein erfolgreich betriebenes Plattformgeschäftsmodell tendiert in bestimmten Konstellationen in Richtung einer Monopolstellung. Eine solche Konstellation ist auf sich gegenseitig verstärkende Netzwerkeffekte in Kombination mit großen Skaleneffekten auf der Anbieterseite sowie hohen Wechselkosten auf der Kundenseite zurückzuführen.[8] Beispielsweise machen es mehr Kunden im AppStore für Entwickler interessanter, Apps anzubieten. Mehr Apps machen wiederum den Store für Kunden interessanter. Gelingt es einem Anbieter, diese Spirale schneller zu drehen als andere Anbietern, kann diese Plattform einen kaum noch einholbaren Vorteil erreichen. Erreicht man z.B. über WhatsApp die meisten oder gar alle der eigenen Kontakte, hat man keinen Bedarf mehr, eine zweite Plattform zu benutzen.[9] Aufgrund der Sog-Effekte in Richtung eines Anbieters spricht man in solchen Konstellationen auch von einem Winner-takes-it-all-Markt.
Das Risiko für den Risikoträger ist nun vergleichbar mit dem Risiko aus dem Kfz-Beispiel. Gelingt es einer den Markt dominierenden Plattform, die Kundenschnittstelle konsequent zu besetzen, bleibt einem Versicherungsunternehmen nur noch die Kooperation mit diesem Plattformbetreiber – als Risikoträger im Hintergrund. Die Monopolstellung des Plattformbetreibers fördert somit die Konzentration auf einen oder wenige Risikoträger im Hintergrund. Für einen Versicherer, der Wert auf die eigene Markenbekanntheit und -relevanz legt, kommt das Risiko hinzu, dass die Marke des Versicherers im Schatten der Plattformmarke untergeht.
2.2
Handlungsempfehlungen
2.2.1
Identifikation der derzeitigen Rolle
Für ein Versicherungsunternehmen ist es entscheidend, sich über die eigene Rolle klarzuwerden. Dabei werden im Folgenden drei idealtypische Rollen für Versicherer betrachtet, wobei eine Kombination der Rollen möglich und im Falle der beiden Erstgenannten auch verbreitet ist:
reiner Risikoträger im Sinne eines Produktgebers ohne eigenen Vertriebskanal,
Risikoträger in Kombination mit Versicherungsschutzvermittlung und
Plattformbetreiber.
Um innerhalb der jeweiligen Rolle wettbewerbsfähig zu sein, sind unterschiedliche Fähigkeiten notwendig. Für den reinen Risikoträger ist erstens die Fähigkeit entscheidend, schnell hochwertige und von Vermittlern bzw. anderen Nicht-Makler-Multiplikatoren akzeptierte Produkte entwickeln zu können. Zweitens ist die technische Anbindung der verschiedenen Vertriebspartner und die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen (Servicierung) von großer Wichtigkeit. Versteht sich ein Versicherer nicht nur als Produktentwickler, sondern auch als Produktvermittler, rücken Fähigkeiten der Versicherungsvermittlung in den Vordergrund. Diese wiederum sind abhängig vom gewählten Vertriebskanal. Der Direktvertrieb erfordert andere Kompetenzen als der Ausschließlichkeitsvertrieb.
Als Plattformbetreiber wiederum benötigt man Fähigkeiten, die mit dem klassischen Versicherungsgeschäft nahezu nichts zu tun haben. Produktentwicklung und klassischer Versicherungsvertrieb rücken weitgehend oder vollständig in den Hintergrund. Hingegen sind die technischen Fähigkeiten gefragt, eine digitale Plattform aufzusetzen. Anschließend muss es gelingen, ein Partnernetzwerk rund um eine zu definierende Kerndienstleistung aufzuspannen.
Dabei ist das Henne-Ei-Problem zu lösen: Wie gelingt es, die ersten Kunden und Anbieter auf die Plattform zu bekommen? In der Folge müssen positive Netzwerkeffekte generiert und negative Netzwerkeffekte vermieden werden. Schließlich ist die Frage der Monetarisierung zu klären. Versucht sich ein Versicherungsunternehmen an der Gründung einer Plattform, ist zudem das Vertrauensproblem zu lösen, mithin die Frage zu beantworten: Warum sollen Versicherer, die bislang Konkurrenten waren, jetzt durch ihre Teilnahme an der Plattform dieser zum Erfolg verhelfen?
2.2.2
Identifikation der Stärken und Gefährdungsanalyse
Zu Beginn sollte eine ehrliche Einschätzung der eigenen Fähigkeiten stehen. Wo liegen die Stärken des Unternehmens? Was kann es besser als der Wettbewerb? Diese Stärkeneinschätzung mündet in der Kernfrage: Was ist derzeit die Daseinsberechtigung des Unternehmens? Genau so ehrlich sollte analysiert werden, was das Unternehmen derzeit nicht gut beherrscht. Es wird meist so sein, dass die Stärken des Unternehmens die derzeitige Rolle im Markt widerspiegeln.
Ein Unternehmen, das sich derzeit v.a. auf die Produktgeberrolle fokussiert, wird tendenziell Stärken in der Produktentwicklung haben. Möglicherweise hat dieses Unternehmen im Gegenzug keine starke Endkundenmarke. Ein Unternehmen, das einen starken Ausschließlichkeitsvertrieb hat, wird vermutlich eine hohe Endkundenwahrnehmung als Stärke haben. Die Produktentwicklung muss dann nicht zwingend führend im Markt sein.