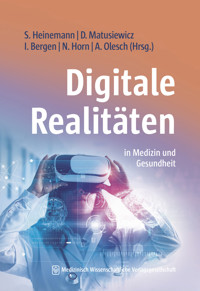
Digitale Realitäten E-Book
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dass Medizin und Gesundheit sich mit steigender Geschwindigkeit für digitale Hochtechnologien öffnen und zunehmend konkrete Anwendungen in den Alltag von Patientinnen und Patienten sowie Fachkräften Einzug halten, ist ein anhaltender Trend der letzten Jahre. Insbesondere Virtualisierung und generative Technologien haben Entwicklungs- und Anwendungsdiskurse ermöglicht, aber auch erzwungen, die noch vor wenigen Jahren irgendwo zwischen ambitionierter Grundlagenforschung und Science-Fiction anzusiedeln waren. In den nächsten Jahren wird ein Großteil der Menschen weltweit mindestens eine Stunde pro Tag im „Metaverse“ leben, arbeiten und auch ihre Gesundheit überwachen. Kurzum: Virtuelle Realitäten sind aus dem Gesundheitswesen der Zukunft nicht mehr wegzudenken. Die Möglichkeiten scheinen kaum begrenzt, die wirtschaftlichen Perspektiven locken Unternehmen in den digitalen Raum und auch die Gesundheitsbranche wird sich in diesem Bereich stark engagieren. Doch wie können Behandelnde und Behandelte von den Metaverse-Technologien profitieren? Welcher Nutzen ergibt sich für Gesundheitsberufe, Pharmaindustrie und Krankenkassen? „Digitale Realitäten“ ist speziell auf die Gesundheitsbranche zugeschnitten. Es stellt die unterschiedlichen immersiven Technologien in Theorie und Praxis vor und zeigt deren Potenziale für die Medizin und das Gesundheitswesen auf - offen, kritisch und enthusiastisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
S. Heinemann | D. Matusiewicz | I. Bergen | N. Horn | A. Olesch (Hrsg.)
Digitale Realitäten
in Medizin und Gesundheit
mit Beiträgen von
E. Arunov | M. Christ | P. Coenen | M. Courage | J. Eschweiler | M. Eschweiler | A. Farfsing | I. Grgic | S. Heinemann | M.A. Heinzle | M. Hirsch | N. Horn | N. Ihne | C. Jäger | T. Jäger | P. Köbe | T. Kölzer | D. Matusiewicz | P. Mehrwald | M. Minoufekr | A. Olesch | V. Puhalac | B. Rath | J. von Repel | L. Rosenberg | B. Salb | N. Schäfer | M. Scholz | B. Staiger | D. Ullmann | I.M. Welpe | R. Wenk
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Das Herausgeber-Team
Prof. Dr. Stefan Heinemann
FOM Hochschule
Essen
Prof. Dr. David Matusiewicz
FOM Hochschule
Essen
Inga Bergen
Visionäre der Gesundheit
Potsdam
Dr. Nikolai Horn
iRights.Lab
Berlin
Artur Olesch
aboutDigitalHealth.com
Berlin
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-901-1 (eBook: PDF)
ISBN 978-3-95466-902-8 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2024
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfassenden haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website
Produkt-/Projektmanagement: Theresa Koch, Anna-Lena Spies, Ulrike Marquart, Berlin
Copy Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout, Satz und Herstellung: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
Coverbild: Adobe Stock/ © ipopba
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Geleitwort
Gesundheitswesen und Digitalisierung galten jahrelang als Gegensätze. Kleinliche Querelen um Nebenthemen wie Digitale Rezepte bestimmten jahrelang die öffentliche Sicht auf das Thema und verstellten den Blick auf echte digitale Innovationen im Bereich der Medizin.
Unter dem Oberbegriff „Metaverse“ schickt sich nun eine ganze Gruppe von Technologien an, das Gesundheitswesen substanziell zu verändern. Die Bandbreite der auch unter dem Begriff „XR“ (Xtended Reality) gesammelten Technologien reicht von Augmented Reality („AR“), bei der die Realität mit digitalen Informationen überblendet wird, bis hin zu „VR“ (Virtual Reality), bei der sich die Nutzer mithilfe einer „Datenbrille“ vollständig in virtuelle Welten begeben und das eigentliche Drumherum vollkommen ausblenden.
Die Grundzüge dahinter sind Jahrzehnte alt, denn bereits Ende der 90er-Jahre versuchten sich Pioniere in ersten technischen Systemen und Anwendungen virtueller Realitäten. Die Erfahrungswelten damals: eher grobschlächtig und mehr „proof of concept“ (Beweis dafür, dass es funktioniert) als massenmarkttauglich.
Heute – ein Vierteljahrhundert später – hat der technologische Fortschritt nicht nur preisgünstige Hochleistungsrechner und die massenhafte Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten wie Laserscanner, Bewegungsdetektoren und hochauflösende Miniaturdisplays gebracht, sondern auch Anbieter von Meta bis Apple, die die Plattformen liefern, auf denen Anwendungen entwickelt werden können.
Es spricht einiges dafür, dass das Gesundheitswesen einer der großen Anwendungstreiber sein wird, denn von der technologischen Unterstützung mit Metaverse-Technologien profitieren Gesundheitsberufe ebenso wie Patientinnen und Patienten. Von der Situation- und Datenerfassung bei der Notaufnahme über die Unterstützung von OP-Teams bis hin zu Therapie-Anwendungen existieren eine Vielzahl von Szenarien, die alle zu einer besseren medizinischen Versorgung beitragen können. Doch bis dato hat niemand auch nur versucht, die Anwendungspotenziale des Metaverse-Technologieuniversums in Medizin und Gesundheitswesen für die Fachwelt zusammenzutragen.
Umso erfreulicher ist es, dass mit dem nun vorliegenden Buch von Stefan Heinemann, David Matusiewicz, Inga Bergen, Nikolai Horn und Artur Olesch nun erstmals ein Standardwerk vorliegt, das mit mehr als nur der notwendigen Gründlichkeit das Thema erschließt und umfassend darstellt.
Dieses Buch halten Sie nun in Ihren Händen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung der darin enthaltenen spannenden Erkenntnisse – zum Wohle Ihrer Patientinnen und Patienten.
Thomas R. Köhler
Experte für Zukunftstechnologien (Autor „Chefsache Metaverse“ im Campus Verlag)
Vorwort
Dass Medizin und Gesundheit sich mit steigender Geschwindigkeit digitalen Hochtechnologien öffnen und zunehmend konkrete Anwendungen in den Alltag von Patientinnen und Patienten ebenso wie der Professionals Einzug halten, ist ein anhaltender Trend der letzten Jahre. Vor allem die Virtualisierung sowie generative Technologien haben Entwicklungs- und Anwendungsdiskurse ermöglicht, aber auch erzwungen, die noch vor wenigen Jahren irgendwo zwischen ambitionierter Grundlagenforschung und Science-Fiction lagen.
XR (Extended Reality) umfasst alle immersiven Technologien, einschließlich Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR). VR schafft vollständig digitale Umgebungen, AR überlagert digitale Informationen in der realen Welt und MR kombiniert Elemente von beiden, indem es reale und virtuelle Welten vermischt und Interaktionen in Echtzeit ermöglicht. Solche Immersionstechnologien bilden die Grundlage für das vielzitierte, aber noch immer wenig greifbare „Metaverse.“
Zu den Spatial Computing Devices gehören AR-Brillen wie Microsoft Holo-Lens, VR-Headsets wie Oculus Rift und HTC Vive, Mixed-Reality-Systeme, Smart Glasses wie Google Glass und räumliche Sensoren wie LiDAR, die in mobilen Geräten und autonomen Fahrzeugen verwendet werden. Diese Geräte erfassen und interpretieren physische Umgebungen und ermöglichen es Benutzern, digital erweiterte oder vollständig virtuelle Welten zu erleben und mit ihnen zu interagieren. Ganz aktuell: Apple Vision Pro mag wie eine Mittelstandsinitiative klingen, ist aber ein hochentwickeltes Spatial Computing Device für immersive Augmented-Reality-Erlebnisse.
GenAI ist – ob nun closed wie die GPT-Familie von OpenAI oder open wie Llama von Meta – ein wohl nicht bloß quantitativ-gradueller Fortschritt, sondern ein qualitativ-struktureller Schritt hin zu semantischer Kontextintelligenz, wie sie bisher Homo Sapiens vorbehalten war. XR kann KIs trainieren helfen (autonomes Fahren, digitale OPs etc.) und KIs werden in XR-Anwendungen embedded (KI-gestützte Computervision, NLP, realitätsnah generierte digitale Zwillinge etc.).
Das US-Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley geht davon aus, dass Virtual Reality die digitale Welt vorantreiben wird, mit einem geschätzten Marktpotenzial von mehr als 1 Billion Dollar Jahresumsatz. Das Gesundheitswesen wird von diesen exponentiell wachsenden Technologien stark beeinflusst. In den nächsten Jahren wird ein Großteil der Menschen weltweit mindestens eine Stunde pro Tag im „Metaverse“ leben, arbeiten und auch ihre Gesundheit überwachen: Virtuelle Realitäten sind aus keiner noch so visionären Betrachtung des Gesundheitswesens der Zukunft mehr wegzudenken. Die Möglichkeiten scheinen kaum begrenzt, die wirtschaftlichen Perspektiven locken Unternehmen in den digitalen Raum und auch die Gesundheitsbranche wird sich in diesem Bereich stark engagieren.
Doch welchen Nutzen haben Patientinnen und Patienten, Gesundheitsberufe wie Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, Pharmaindustrie und Krankenkassen von diesen Entwicklungen? Was im Diskurs fehlt, ist ein Buch, das speziell auf die Potenziale der Gesundheitsbranche zugeschnitten ist, das sowohl von Fachleuten als auch von einem breiteren Publikum im Gesundheitswesen gelesen werden kann und das den Blick über den Tellerrand wagt, in Theorie und Praxis, mit Fokus auf das Gesundheitswesen, aber mit einem weiten, lernenden Blick in verschiedene Felder, auf die aufkeimende Gegenwart und die mögliche Zukunft. Offen, kritisch und enthusiastisch.
Den Autorinnen und Autoren ist für ihr Humanengagement zu danken, sich höchstpersönlich eingebracht zu haben in ein durchaus nicht immer lucides Themenfeld – ohne ihre Expertise wäre es undenkbar gewesen, einen solchen Blick hinein und hinaus zu wagen.
Stefan Heinemann, David Matusiewicz, Inga Bergen, Nikolai Horn und Artur Olesch
Im Juli 2024
Inhalt
1Spatial Computing im GesundheitswesenDavid Matusiewicz und Vladimir Puhalac
2Ohne Daten bleibt es HokuspokusArtur Olesch
3BGM und Gamification – Eine Verbindung mit PotenzialNatalie Ihne
4Generative KI: Ein medizinischer Kopilot – Wie Fachkräfte im Gesundheitswesen ChatGPT nutzen sollten. Interview mit Peter LeeArtur Olesch
5CBDCs im GesundheitsmetaversumTina Jäger, Matthias Eschweiler und Clemens Jäger
6Metaverse und Healthcare Marketing – Gegensatz oder Symbiose?Thilo Kölzer
7Metaverse in der Gesetzlichen KrankenversicherungJoel von Repel
8Chancen und Risiken des Metaverse im deutschen GesundheitswesenMichaela Anna Heinzle
9Metaverse – Das Healthcare-Ökosystem der Zukunft: Chancen und Hürden aus Sicht der Diagnostik und PharmaindustrieAlexandra Farfsing, Marleen Christ, Nadja Schäfer, Bernhard Salb, Pascal Mehrwald und Isabell M. Welpe
10Schulungen mit Virtual Reality im Healthcare- und PharmabereichBenjamin Staiger
11ExoHaptik:PflegeKraft – Ein Mixed-Reality-Simulator für PflegekräfteRobin Wenk
12Augmented Reality in der Orthopädie und UnfallchirurgieJörg Eschweiler, Björn Rath, David Ullmann und Meysam Minoufekr
13Klinische Metaverse-Anwendungen mit dem Einsatz von immersiven TechnologienLouis Rosenberg und Maren Courage
14Besser gewappnet für den Ernstfall – XR-Simulationstraining für Mediziner im Management von NotfallpatientenIvica Grgic
15Die Rolle der Kliniken im MetaversePhilipp Köbe
16Zusammenhang von Patientensicherheit und DigitalisierungPetra Coenen
17Ethik im MetaverseMaike Scholz und Elmar Arunov
18Realität des Virtuellen: Was ist „real“ und wie gehen wir damit um?Nikolai Horn
19KI-generierte digitale Zwillinge als Videoavatare im GesundheitswesenDavid Matusiewicz
20Tiefe Heilung – Ein Kommentar zu ethischen Risiken und Chancen der KIStefan Heinemann und Martin Hirsch
21Geheilt vom Sterben? Überlegungen zur LongevityStefan Heinemann
Die Autorinnen und Autoren
Digitale Realität vs. reale Digitalität – Eine sträflich kurze Geschichte zur Einführung
GPT-40 reimt dazu:
In einem fernen Land, in Zeiten vergangen,
Da lebte ein Volk, tief in Gedanken verfangen.
Sie träumten von Welten, die anders und neu,
Voller Magie und Technik, fernab von Reu.
Inmitten des Dorfes, in einem alten Buch,
Stand von „Digitalen Welten“ ein geheimnisvoller Fluch.
Doch auch von den Wundern, die sie bereiten könnten,
Wenn sie verstanden und richtig entzündet.
Es gab eine Maus, klein und voller Fleiß,
Die hieß Luna, so zart und leis’.
Sie träumte von einer Welt, so groß und weit,
Wo Heilen und Helfen mit Technik vereint.
Die alte Eule, weise und klug,
Sprach: „Hör zu, kleine Luna, ich sag dir genug.
Die digitale Realität und reale Digitalität,
Sind wie Tag und Nacht, in einer endlosen Dualität.
Die digitale Realität ist wie ein Traum,
Voller Farben und Formen, so unendlich im Raum.
Doch vergiss nicht, Luna, die Wurzeln der Zeit,
Denn die reale Digitalität ist unsere Gemeinschaft, soweit.“
Luna lauschte und nickte bedacht,
Sie wusste nun, was in ihrem Herzen erwacht.
Die Zukunft der Medizin, so klar und hell,
Lag in der Vereinigung von Digital und Reell.
So zog sie hinaus, mit ihrem Traum im Sinn,
Die Maus Luna, die nie vergaß, wer sie war und wo sie hin.
Durch Wälder und Täler, sie strebte voran,
Immer getragen von ihrem großen Plan.
Und so erzählt man sich noch heute,
Von Luna, der Maus, so klein und voller Treue.
Von ihrer Reise, die nie endet, so weit,
Im Reich der Digitalität und realen Realität.
1Spatial Computing im GesundheitswesenDavid Matusiewicz und Vladimir Puhalac
1.1Hintergrund
Der Begriff Spatial Computing wurde im Jahr 2003 – also vor mittlerweile über 20 Jahren – von Simon Greenworld geprägt. Hierbei geht es um die die Nutzung digitaler Medien zur Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Es verbindet Elemente der Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality zu einem immersiven und interaktiven Erlebnis (Greenworld 2003). Die Beziehung zwischen Menschen und Computern hat sich in vielen Bereichen verändert. Es gibt immer mehr hybride technologische Infrastrukturen, in denen es verschiedene Konnotationen von Computeraufgaben und die Kopplung oder Entkopplung von Computerressourcen mit der physischen Umgebung gibt. Oftmals geht es hierbei um die Themen Lernen und Kommunikation (Di Scipio 2014).
Große Fortschritte in diesem Bereich haben bisher die Firmen Microsoft, Magic Leap, Meta und Apple gemacht. Dabei werden physische Interaktionen wie Körperbewegungen, Gesten und Sprache als Eingabemedium für interaktive und digitale Mediensysteme genutzt. Mit der Vision Pro setzt das Unternehmen Apple neue Maßstäbe und macht das Thema Spatial Computing massentauglich. Apple nennt die Vision Pro selbst einen revolutionären räumlichen Computer, der digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt verbindet und es den Nutzern erlaubt, präsent und mit anderen verbunden zu bleiben. Vision Pro schafft eine Arbeitsfläche für Apps, die über die Grenzen eines traditionellen Displays hinausgeht, sowie eine vollständig dreidimensionale Benutzeroberfläche, die mit natürlichen und intuitiven Eingabemitteln gesteuert wird – den Augen, Händen und der Stimme der User (Apple 2023). In der Vision von Apple folgt der Spatial Computer auf das Smartphone (wie das iPhone) oder den Personal Computer (PC) bzw. Laptop, mit dem heute die Menschen ihre tägliche Arbeit erledigen. Während heute herkömmliche Eingabegeräte die Tastatur, Maus oder der Touchscreen sind, ermöglicht der „Spatial Computer“ vielmehr eine Interaktion über Sprache, Gesten, Sprache sowie einer Blicksteuerung. Im dreidimensionalen Raum werden die Informationen in das Sichtfeld des Nutzers projiziert (z.B. über eine VR-Brille), so dass im Gegensatz einem PC, die Inhalte nicht mehr zweidimensional auf dem Bildschirm konsumiert werden müssen.
Die Kombination von Virtual Reality mit Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz (KI) verspricht, das Gesundheitswesen in bisher ungeahntem Ausmaß zu revolutionieren. Diese Technologien könnten eine transformative Wirkung auf die Art und Weise haben, wie medizinische Diagnosen gestellt, Therapien durchgeführt und Patienten betreut werden.
1.2XR Übersicht
XR steht für „Extended Reality“ und bezeichnet eine Sammelbezeichnung für verschiedene immersive Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt verschwimmen lassen. Dazu gehören Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR). Diese Technologien haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und beeinflussen verschiedene Bereiche des Lebens. Es folgt eine Abgrenzung zwischen diesen Begriffen:
Augmented Reality (AR)
Definition: Augmented Reality integriert digitale Informationen, Grafiken oder virtuelle Objekte in die reale Umgebung des Benutzers.
Erfahrung: Der Benutzer betrachtet weiterhin die reale oder physische Welt, aber es werden zusätzliche digitale Elemente überlagert oder eingefügt.
Realität: Die reale oder physische Welt bleibt sichtbar, und die digitale Ergänzung erfolgt als Overlay, um zusätzliche Informationen oder Interaktionen bereitzustellen.
Mixed Reality (MR)
Definition: Mixed Reality ist eine erweiterte Form von Augmented Reality, bei der digitale und reale Elemente nahtlos miteinander interagieren und verschmelzen.
Erfahrung: Wie AR ermöglicht MR die Überlagerung digitaler Informationen in der realen Welt, aber im Gegensatz dazu können die digitalen Elemente in MR mit der physischen Umgebung interagieren und reagieren.
Realität: MR schafft eine Umgebung, in der digitale und reale Inhalte miteinander verschmelzen, wodurch eine gemeinsame Realität entsteht, in der beide Elemente gleichzeitig existieren und interagieren können.
Virtual Reality (VR)
Definition: Virtual Reality bezieht sich auf eine computergenerierte Umgebung, die eine immersive, oft dreidimensionale Erfahrung bietet.
Erfahrung: Der Benutzer ist vollständig in eine künstliche Welt eingetaucht und hat das Gefühl, sich physisch in dieser Umgebung zu befinden.
Realität: Die reale oder physische Welt wird vollständig durch die virtuelle Umgebung ersetzt, und der Benutzer interagiert ausschließlich mit dieser künstlichen Welt.
Während AR digitale Elemente zur realen Welt hinzufügt, schafft die MR eine nahtlose Integration von digitalen und realen Inhalten, die miteinander interagieren können. VR bietet hingegen eine vollständige Virtualisierung der Realität und hat den höchsten immersionsgrad bzw. Effekt auf den User.
1.3Gamification und Spatial Computing
„Gesundheit ist etwas Ernstes, das hat nichts mit Spielen zu tun.“ Diesen Satz in Zusammenhang mit Virtual Reality hört man häufiger. Auf den ersten Blick klingt das, als würde man ein ernstes Thema ins Lächerliche ziehen.
Der Unter Gamification (auch Gamifizierung) versteht man zunächst die Integration spielerischer Elemente in einen fremden Kontext. Gamification findet beim Einkaufen statt, indem Punkte wie Payback gesammelt werden, die wiederum gegen Rabatte oder Gratisprodukte (meist minderer Qualität) eingetauscht werden können. Insbesondere bei der Nutzung von Apps wird die Motivation durch kleine Belohnungen wie digitale Pokale, Badges, Sticker, Rankings oder andere Auszeichnungen erhöht. Immer mehr Menschen nutzen auch Smartwatches für Bewegung und Sport, bei denen zusätzlich Ringe geschlossen werden (bei mir ist die Motivationsschwelle eher niedrig eingestellt) oder andere Formen des Anstupsens (Nudging) genutzt werden.
Serious Games sind Spiele mit Mehrwert, die verschiedene Ansätze verfolgen. Es geht um Educational Content, E-Learning und Storytelling. Dazu gibt es unzählige Abbildungen mit ineinandergreifenden Kreisen, die die Schnittmengen definieren. Serious Games haben edukative Ansätze, die dazu führen, dass Gesundheitsinformationen besser verstanden werden. Und so gibt es beispielsweise empirische Studien zur Wirksamkeit von Gesundheits-Apps in der Zahnprophylaxe (Elsenheimer et al. 2020).
Gerade im Bereich des Spatial Computing ist das Thema Gamification von besonderem Interesse. Ein Beispiel ist Pokémon GO und die verstopften Straßenkreuzungen, auf denen die Spieler unterwegs waren, um Pokébälle, Beeren, Entwicklungssteine zu sammeln. Bis heute erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit. Durch Virtual Embodiment (virtuelle Verkörperung) können Nutzer in virtuellen Realitäten die Illusion erleben, einen virtuellen Körper (virtual twin) zu besitzen. Hierzu gibt es bereits experimentelle und klinische Studien, die zeigen, dass dieses Virtual Embodiment zur Schmerzreduktion eingesetzt werden kann. Dabei kann der virtuelle Körper und die Interaktion mit der virtuellen Umgebung auf vielfältige Weise durch Körperillusionen manipuliert werden (Käthner et al. 2019). Und es gibt immer mehr Beispiele über den Einsatz von Avataren in Gesundheit, Medizin und Psychologie (Matusiewicz et al. 2020).
Mit dem Unternehmen Mindzeit ist die erste beeindruckende emotionssensitive und gamifizierte Mental Health App auf den Markt gekommen. Bei dem Unternehmen CUREOSITY hingege geht es um VR-Rehabilitation und Training von Armen, Händen, Oberkörper und Rumpf als kognitives und sensomotorisches Training z.B. nach Schlaganfall oder Querschnittlähmung. Im Pflegebereich gibt es neben verschiedenen emotionalen Robotern wie Pepper und Co. von der United Robotics Group auch gestengesteuerte Spielkonsolen mit digitalen Gesundheitstrainings, die auch speziell für Senioren entwickelt wurden – wie das Unternehmen RetroBrain es vormacht. Der User sitzt auf einem normalen Stuhl, bewegte seinen Oberkörper leicht nach links und rechts und beobachtet, wie auf dem Fernseher vor mir meine Bewegungen kinder- bzw. seniorenleicht von einer 3D-Kamera erfasst wurde. So kann dann beispielsweise Motorrad gefahren werden. Während einer unfallfreien Sonntagsfahrt wurde beobachtet, dass die Bewohner unbedingt einen virtuellen Helm auf ihre Spielfigur programmiert haben wollten und das Rechtsüberholen mit einem Raunen durch den Raum abgemahnt wurde.
Ein anderes Beispiel kommt von einer Krankenkasse. Die DAK-Gesundheit beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Internet- und Computerspielsucht bei Jugendlichen. Es klingt paradox, ist aber eine paradoxe Intervention: Die Krankenkasse hat 2018 die App „Die Retter der Zukunft“ auf den Markt gebracht, die vor exzessivem Spielen und Chatten schützen soll. Eine App gegen zu viel Bildschirmzeit. Es ist eine Art Gaming-Coach für und gegen Spielsucht, der für Android und Apple zum Download bereitsteht (DAK 2018). Nach erfolgreich evaluierten Praxistests wurde das Spiel zusammen mit dem begleitenden Seminarprogramm für Firmenkunden angeboten, differenziert nach Auszubildenden, Führungskräften und Multiplikatoren wie BGM-Beauftragten und Personalleitern. Anschließend wurde eine Wirksamkeitsstudie im Rahmen einer Präventionsdienstleistung angekündigt. Inzwischen scheint das Spiel allerdings vorbei zu sein, zumindest ist im Internet und im Apple Store nichts mehr dazu zu finden.
Gamification, Serious Games und spielerische Elemente im Gesundheitswesen machen Sinn. Warum? Weil sie mit Emotionen und Spaß verbunden sind. Im Vergleich zur Schluckimpfung: Die eigentliche Medizin wird durch Games versüßt. Und es kommt wie immer auf den Kontext an. Zudem macht die Dosis das Gift Gamification kann, da bin ich mir sicher, zu einem echten Gamechanger im Gesundheitswesen werden und durch Spatial Computing weiteren Aufwind erfahren.
Spatial Computing und Serious Games – Potenzial für die „Erlebnismedizin“ bei Kindern mit ADHS
Wir leben heute in einer Zeit, in der personalisierte digitale Therapeutika (die Ihr Arzt verschreiben kann) zur Verbesserung kognitiver Beeinträchtigungen beitragen können. Für Menschen, die sich in diesen Bereichen behandeln lassen und über die Pille hinausdenken, ist das Potential enorm. Dies ist eine neue Art, über Medizin nachzudenken. Es ist mehr als nur ein neues Produkt. In den USA ist der Zugang zu dieser neuen Behandlung für Kinder erhältlich, indem ein Arzt ein Rezept ausstellt. Die FDA hat es für den Anfang sehr eng gefasst, sodass die erste zugelassene Studie für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren bestimmt ist. Die Daten zeigen Vorteile in vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Es dient nicht nur der Behandlung von ADHS, sondern eignet sich auch für Menschen mit Depressionen, Multipler Sklerose und zur Unterstützung autistischer Menschen. Es gibt sogar neue Studien, die Vorteile für Menschen mit Covid-Nebel zeigen. Die Technologie unterstützt jede Bevölkerungsgruppe mit Aufmerksamkeitsdefiziten. Serious Games „Erlebnismedizin“ versus Medikamenten Einnahme, zielt auf den Prozess der Neuroplastizität auf bestimmte Gehirnnetzwerke ab. Die traditionelle Medizin wirkt, wenn sie eingenommen wird, und hört auf, wenn der Patient dieser nicht mehr einnimmt. Der Einsatz digitaler Technologie wie Spatial Computing und Gamification als Behandlung kann zu nachhaltigen und dauerhaften Veränderungen führen. Die auf diese Weise eingesetzte Technologie hat keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die Behandlung ist zeitlich begrenzt, nur 25 Minuten pro Tag, nur 5 Tage die Woche. Die Dosis wird kontrolliert. Sobald Sie die Behandlung erhalten haben, sind Sie für fortlaufendes Feedback verbunden. Es handelt sich um ein geschlossenes Kreislaufsystem, das die traditionelle Medizin nicht bietet. Diese neue Art von Medizin und die Fortschritte wachsen und entwickeln sich weiter.
1.4Einsatzfelder von Spatial Computing im Gesundheitswesen
Bereits im Bereich der medizinischen und pflegerischen Ausbildung könnte Spatial Computing dazu dienen, realistische Simulationen von komplexen chirurgischen Eingriffen oder diagnostischen Verfahren zu erstellen. Ärzte und Pflegekräfte sowie andere Berufsgruppen könnten in einer virtuellen Umgebung trainieren und dabei nicht nur ihre praktischen Fähigkeiten verbessern, sondern auch seltene oder komplexe Fälle simulieren, um besser auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein.
Die Integration von Sprachsteuerung im Kontext von Spatial Computing ermöglicht es den Medizinern, während ihrer virtuellen Erfahrungen natürliche Sprachbefehle zu verwenden. Dies könnte den Workflow verbessern und es Ärzten ermöglichen, sich stärker auf die Patientenversorgung zu konzentrieren, ohne auf physische Eingaben angewiesen zu sein. Durch die Verbindung mit KI kann die VR-Anwendung auch personalisierte Empfehlungen und Feedback basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Nutzers bieten.
Im Bereich der Patientenversorgung könnte VR mit Sprachsteuerung dazu verwendet werden, therapeutische Umgebungen zu schaffen, die die Genesung fördern. Patienten könnten in immersive Welten eintauchen, die nicht nur Ablenkung bieten, sondern auch spezifisch auf ihre Gesundheitsziele ausgerichtet sind. Hierbei könnten KI-Algorithmen die Fortschritte überwachen und Anpassungen vornehmen, um die Effektivität der Therapie zu maximieren.
Die Anwendung von VR in der Telemedizin könnte durch Sprachsteuerung weiter verbessert werden. Ärzte könnten Patienten in virtuellen Konsultationen betreuen, während KI-Algorithmen Daten analysieren und relevante Informationen extrahieren. Dies ermöglicht eine schnellere Diagnose und personalisierte Behandlungspläne, wodurch die Effizienz im Gesundheitswesen gesteigert wird.
Im Bereich der psychischen Gesundheit könnten Spatial Computing für die Behandlung von psychischen Erkrankungen eingesetzt werden. Virtuelle Umgebungen könnten als sicherer Raum für Therapiesitzungen dienen, unterstützt durch KI-gesteuerte Assistenten. In der pharmazeutischen Forschung könnten VR und KI in der Wirkstoffforschung eingesetzt werden, um Moleküle virtuell zu visualisieren und zu analysieren.
Für die Rehabilitation und Physiotherapie könnte Spatial Computing eine entscheidende Rolle spielen, indem Patienten in virtuellen Umgebungen Übungen durchführen und gleichzeitig mit virtuellen Therapeuten interagieren. Im Gesundheitsmanagement könnten personalisierte Plattformen VR, Sprachsteuerung und KI kombinieren, um individuelle Gesundheitspläne zu erstellen.
Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen zwei Bilder aus dem virtuellen Raum zum Einsatz von VR im Gesundheitswesen.
Abb. 1 Ausbildung im digitalen Zwilling einer Intensivstation (XR Human, eigene Darstellung)
Abb. 2 Training (XR Human, eigene Darstellung)
1.5Virtuelle Welten in Kombination mit Künstlicher Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) und Spatial Computing können auch gemeinsam eingesetzt werden, um weitere Potenziale im Gesundheitswesen zu entfachen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es um die Ausbildung bzw. Trainings geht, um die Behandlung von psychischen Erkrankungen, der Patientenaufklärung oder der Rehabilitation. Hier wird zu den aufgeführten Beispielen in Kapitel 1.3 noch das Thema KI hervorgehoben.
Training von medizinischem Personal: Spatial Computing findet erste Anwendung, um medizinisches Personal in einer sicheren und kontrollierten Umgebung zu trainieren, indem Patientenavatare mit bestimmten Symptomen behandelt werden. KI kann dabei die Überwachung des Fortschritts von medizinischem Personal übernehmen und helfen Feedback zu geben, wie gut war das Training und wo liegen noch Schwächen.
Behandlung von psychischen Erkrankungen: Die Technologie wird bereits in Studien bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Angstzuständen, ADHS und posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt in der sogenannten Expositionstherapie (siehe Box in Kap. 1.3). Die KI hilft dabei, personalisierte Behandlungspläne zu entwickeln, die auf den individuellen Bedürfnissen des Patienten basieren.
Patientenaufklärung: Spatial Computing wird bereits in Studien für die Patientenaufklärung eingesetzt, indem es Patienten ermöglicht durch beispielsweise Visualisierung, ihre Krankheit und Behandlung besser zu verstehen. KI hilft unter anderem dabei, personalisierte Informationen bereitzustellen, die auf den individuellen Bedürfnissen des Patienten zugeschnitten sind.
Rehabilitation: Virtuelle Realitäten werden bereits in der Rehabilitation von Patienten eingesetzt, indem es ihnen ermöglicht, ihre Bewegungen und Fortschritte zu verfolgen. KI wird dabei helfen, personalisierte Rehabilitationspläne zu entwickeln, die auf den individuellen Bedürfnissen des Patienten passen und Empfehlungen für weitere Rehabilitationsübungen vorschlägt und ausarbeitet.
1.6Fazit und Ausblick
Die Verknüpfung von Virtual Reality (VR) mit Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Gesundheitswesen in vielfältiger Weise zu revolutionieren. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Weiterbildung von medizinischem Personal über die Bewältigung chronischer Krankheiten bis hin zur Optimierung von Prävention und Gesundheitsmanagement. Dabei sind jedoch stets Datenschutz- und Ethikaspekte zu berücksichtigen. Insgesamt könnten diese Technologien dazu beitragen, das Gesundheitswesen effizienter, personalisierter und patientenzentrierter zu gestalten.
Insgesamt steht die Integration von Spatial Computing im Gesundheitswesen erst am Anfang – selbst die Theorie ist noch ein auszureifendes Feld. Die kommenden Jahre könnten jedoch wegweisend für eine effizientere, personalisierte und patientenorientierte medizinische Versorgung sein. Trotz des enormen Potenzials gibt es jedoch auch Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Datenschutz- und Sicherheitsaspekte. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass sensible Gesundheitsdaten angemessen geschützt sind und ethische Richtlinien eingehalten werden. Das gilt allerdings für alle Technologien im Gesundheitswesen und sollte die Entwicklung in Europa nicht ausbremsen.
Literatur
Apple (2023) Apple Vision Pro – Apples erster räumlicher Computer, URL: https://www.apple.com/de/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/. Stand 2023 (abgerufen am 16.04.2024)
DAK Gesundheit (2018) Felix und Emma retten die Zukunft. URL: https://magazin.dak.de/retter-der-zukunft/ (abgerufen am 16.04.2024)
Di Scipio A (2014) The place and meaning of computing in a sound relationship of man, machines, and environment. In: Georgaki A, Kouroupetroglou G (Eds.) Proceedings ICMC|SMC|2014, 14–20 September 2014, Athens, Greece. URL: https://www.researchgate.net/publication/298981108_The_place_and_meaning_of_computing_in_a_sound_relationship_of_man_machines_and_environment (abgerufen am 16.04.2024)
Elsenheimer L, Lux G, Matusiewicz D (2020) Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen mit Gamification – Wirksamkeit von Gesundheitsapps in der zahnmedizinischen Prophylaxe. In: Monitor Versorgungsforschung (MVF), 13. Jg., Ausgabe 5, 2020, S. 66–70
Greenwold S (2003) Spatial Computing, MIT thesis diss. URL: http://acg.media.mit.edu/people/simong (abgerufen am 16.04.2024)
Käthner I, Bader T, Pauli P (2019) Heat pain modulation with virtual water during a virtual hand illusion. Scientific Reports, 9(1), 1–12. DOI; https://doi.org/10.1038/s41598-019-55407-0
Matusiewicz D, Werner JA, Puhalac V (2020) Avatare im Gesundheitswesen und der Medizin. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York
2Ohne Daten bleibt es HokuspokusArtur Olesch
Die Medizin des 19. und 18. Jahrhunderts war voll von fragwürdigen Therapien und nutzlosen Medikamenten. Viele Behandlungsmethoden waren bizarr oder gar erschreckend. Und genau so werden künftige Generationen das heutige Gesundheitswesen sehen – aus Gründen, die wir kennen. Wir haben das Privileg, heute zu leben: Die Medizin ist human, die Krankenhäuser sind modern und medizinische Fachkräfte haben Zugang zu modernsten Geräten und Technologien und können ihre Kompetenzen stetig weiterentwickeln. Ein Besuch beim Arzt oder eine Betreuung durch eine Pflegefachperson sind für uns selbstverständlich, aber in Wirklichkeit ist es Luxus. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Umstände ganz anders aussahen. Die Medizin war oft hilflos, während Diagnosen und Behandlungen vollkommen willkürlich waren. Im frühen 19. Jahrhundert gab es keine Krankenversicherungen. In den USA lagen die Kosten für chirurgische Eingriffe zwischen 300 und 3.000 USD (umgerechnet auf heutige Kaufkraft) – ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass die Überlebensrate der Patienten aufgrund fehlender antiseptischer Techniken und Anästhesie eher gering war.
In dem Buch „The Mystery of the Exploding Teeth: And Other Curiosities from the History of Medicine“ enthüllt der Medizinhistoriker Thomas Morris die Arbeit hinter den Kulissen von Ärzten vor 150–200 Jahren. Der heutige Leser mag es gar als belustigend emfinden, aber damals hatten die Patienten wahrlich keinen Grund zu lachen.
Zum Glück für uns haben die Innovatoren früherer Generationen – die ihre Ideen oft gegen den gängigen Volksglauben verfolgten – die Medizin zu einer Wissenschaft gemacht. Oder eher einer Halbwissenschaft, denn viele gesundheitsbezogene Entscheidungen und Maßnahmen sind immer noch letztlich voreingenommen und nur wenig datengestützt. Viele Geschichten aus der Vergangenheit weisen in die Zukunft und machen uns klar, warum Daten die nächste Renaissance der Medizin einläuten werden. Hier sind nur einige davon.
2.1Gesundheitliches Analphabetentum: Wussten Sie nicht, dass das Verschlucken von Messern tödlich sein kann?
Die erste Internationale Klassifikation der Krankheiten (International Classification of Diseases, ICD) wurde 1893 veröffentlicht und enthielt 161 medizinische Störungen. In der aktuellen Ausgabe sind 69.000 Diagnosecodes aufgeführt – ein beeindruckender Fortschritt in weniger als 150 Jahren.
Vor der Systematisierung der Krankheiten wurden die Patienten nach dem Zufallsprinzip diagnostiziert und behandelt. Es gab fast keine medizinischen Leitlinien. Die Ärzte kannten sich in der menschlichen Anatomie nicht aus und folgten daher ihren eigenen Erfahrungen, die oft auf falschen Vorstellungen oder Glück beruhten.
Für die Patienten hatte dies oft katastrophale Folgen.
Im Jahr 1861 beschrieb der Zahnarzt W.H. Atkinson (Pennsylvania, USA) ein beunruhigendes Phänomen, das er als „explodierende Zähne“ bezeichnete. Zuerst hatte der Patient starke Schmerzen, dann kam ein lautes Geräusch, das einem Schuss ähnelte. Schließlich brach der Zahn in Stücke und der Schmerz verschwand.
Ein ähnlicher Fall wird in dem 1874 erschienenen Buch „Pathology and Therapeutics of Dentistry“ beschrieben. Diesmal war die Zahnexplosion so stark, dass der Patient vorübergehend taub wurde. Viele machten dafür die in den Füllungen verwendeten Chemikalien und sogar die elektrische Ladung verantwortlich, die sich in den Zähnen ansammelt.
Ein weiteres Beispiel zeigt einen extremen Mangel an Gesundheitskompetenz. Um die Wende zum 19. Jahrhundert beschloss der amerikanische Seemann John Cummings während einer feuchtfröhlichen Party, einen französischen Jongleur beim Messerschlucken zu imitieren. Cummings wusste nicht, dass der Schwertschlucker nur so tat, also verschluckte er tatsächlich die Klappmesser seiner Freunde. Die Geschichte endete mit einem tragischen Tod, wenn auch erst nach dem 35. Messer.
2.2Medizin durch Ausprobieren: Aderlass kann helfen, wenn der Patient nicht stirbt
Wenn wir heute eine Pille aus der Apotheke nehmen, können wir sicher sein, dass sie ein klinisches Prüfverfahren durchlaufen hat, das ihre Wirksamkeit und Sicherheit bestätigt, oder dass sie zumindest gewissen Qualitätsstandards entspricht. In der Vergangenheit wurden Medikamente und medizinische Verfahren auf der Grundlage von Versuch und Irrtum entwickelt und tatsächlich an Patienten getestet. Eine Behandlung war oft gefährlicher als die Krankheiten, die sie heilen sollte.
Wie der Aderlass, der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde. Man glaubte, dass viele Krankheiten allein durch die Entfernung von „schlechtem Blut“ geheilt werden könnten Dafür gab es keinen rationalen Beweis, sondern nur Tradition.
Anfang des 18. Jahrhunderts stürzte Lord Anthony Gray, der Earl of Kent, beim Bowls-Spielen plötzlich. Er atmete nicht und hatte keinen Puls – genug Beweise, um zu dem Schluss zu kommen, dass er tot war. Doch so leicht wollte der Arzt Charles Goodall nicht aufgeben. Um den Toten wiederzubeleben, probierte er einige originelle Methoden aus: Aderlass, Schnupftabak in die Nasenlöcher stecken, metallischen Wein servieren, um Erbrechen auszulösen, den Kopf rasieren und eine entzündungshemmende Lotion auftragen, mit einer heißen Bratpfanne verbrennen und Schafsinnereien auf den Magen legen. Schließlich gab Goodall auf und Lord Gray hatte das Glück, dass er bereits tot war.
Jede Operation war eine Tortur. Bevor 1846 zum ersten Mal Äther zur Anästhesie verwendet wurde, war es das einzige Mittel zur Schmerzlinderung, die Patienten betrunken zu machen. Nein, es hat nicht wirklich geholfen. Aufgrund mangelnder Kenntnisse, antiseptischer Techniken oder Antibiotika endeten Operationen oft tödlich. Daher wurden sie nur bei Bedarf durchgeführt.
Einige Wunder führten zu falschen Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel der Fall von Thomas Tripple. Eines Tages durchbohrte der Deichsel eines Pferdewagens seine Brust und drückte ihn an eine Stallwand. Anstatt zu sterben, ging Tripple nach Hause und erholte sich. Alles, was Tripple brauchte, um weitere 11 Jahre glücklich zu leben, war ein Aderlass. Damals wussten nur wenige, dass eine Ausnahme in der Regel nicht die Regel bestätigt.
2.3Wissenschaftlicher Nachweis: Glaub’ es … oder nicht
Bei der Betrachtung von Chroniken und Artikeln aus dem 19. Jahrhundert fällt es Historikern schwer zu unterscheiden, was eine bewusste Lüge, eine Manipulation zu Werbezwecken und was einfach das Ergebnis grober Unwissenheit ist. Einige Ärzte glaubten an Wunder, weil sie keinen Grund hatten, an ihnen zu zweifeln.
Im Jahr 1746 verfasste der Londoner Arzt Richard Jackson den Artikel „A Physical Dissertation on Drowning“, in dem er die Geschichte eines schwedischen Gärtners beschrieb, der in einen zugefrorenen Fluss fiel und nach 16 Stunden unter Wasser zurückkehrte, um allen zu erzählen, was geschehen war. Zur gleichen Zeit schrieb William Harvey, ein anderer Arzt, einen ernstgemeinten Bericht über einen 152 Jahre alten Mann namens Thomas Parr. Parr war ein so großer Mogler, dass er sogar an den Hof von König Charles I. eingeladen wurde.
Bis zur Entwicklung der modernen Pharmaindustrie wurden Menschen hauptsächlich mit Kräutern behandelt. Viele von ihnen sind lebensrettend und werden bis heute verwendet. Aber einige, wie ein Schmerzmittel aus dem Jahr 1799, das aus übelriechendem Morphium und einer Mischung aus Rabenkotze hergestellt wurde, haben wahrscheinlich nie funktioniert.
2.4Erleichterung: Daten räumen mit Mythen auf
Seitdem hat sich viel verändert. Wir können jedoch sicher sein, dass die heutigen Methoden in 100–200 Jahren ebenfalls veraltet sein werden. Ärzte, die sich von ihrer Erfahrung leiten lassen und nicht von ausgeklügelten KI-basierten Entscheidungsunterstützungssystemen, werden von künftigen Generationen mit Erstaunen aufgenommen werden.
So wie die neuen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts es uns ermöglicht haben, die schrecklichen medizinischen Praktiken zu eliminieren, so bieten heute die Digitalisierung, der Zugang zu Daten und die künstliche Intelligenz die Möglichkeit für nie dagewesene Fortschritte in der Medizin.
Daten sind wie „Zeugen“ der Gesundheit: Es gibt viele von ihnen und jeder von ihnen verfügt zwar über wertvolles Wissen über einen kleinen Teil des menschlichen Körpers, doch keiner hat ein Verständnis für das Ganze. Um ein Gesamtbild von Gesundheit zu erhalten, muss am Ende alles verfügbare Wissen sinnvoll und zielgerichtet kombiniert werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können wir dies erreichen, indem wir interoperable Technologien einsetzen und unsere Bereitschaft zum Datenaustausch stärken.
3BGM und Gamification – Eine Verbindung mit PotenzialNatalie Ihne
Die menschliche Natur ist paradox. Häufig wissen Menschen um die Notwendigkeit eines gesunden und ausgewogenen Lebensstils und den damit verbundenen Parametern, die sich entweder positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirken können. Von Aspekten wie einer gesunden Ernährung, der Wahrung einer angemessenen Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und privaten Interessen bis hin zu dem Wissen der potenziell schädlichen Effekte übermäßiger Mediennutzung erstreckt sich das Spektrum des individuellen Bewusstseins über die Faktoren, die die physische und psychische Gesundheit beeinflussen können.





























