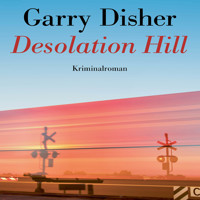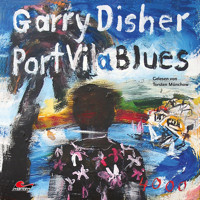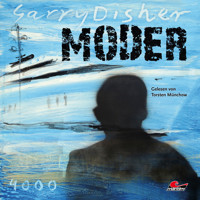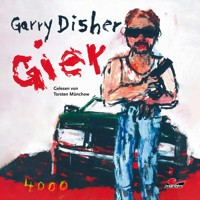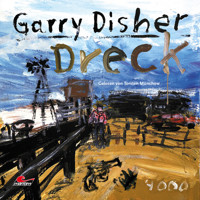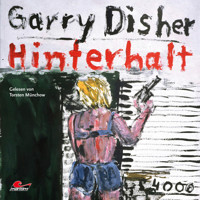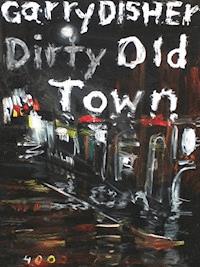
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PULP MASTER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pulp Master
- Sprache: Deutsch
Wyatt muss die Ansprüche zurückschrauben und sich mit Klein-Klein begnügen. Ein Juwelenjob erscheint da ganz nach seinem Geschmack - nichts Extravagantes, nichts Undurchschaubares, bis auf die Tatsache, dass es Eddie Oberins Job ist und nicht nur Oberin darauf besteht, bei dem Überfall mitzumischen, sondern auch seine Exfrau Lydia Stark, von der das Insiderwissen stammt. Wyatt arbeitet lieber allein, gibt aber grünes Licht, denn sein Plan ist wie immer akribisch vorbereitet. Doch keiner ahnt, dass die ins Visier genommenen Juweliere von ihrem französischen Cousin Alain Le Page mit in Europa gestohlenen Uhren und Schmuck versorgt werden, die sie in Australien mit ihrer legalen Ware tarnen ... Disher zeigt eine moralisch verkommene Welt voller Niedertracht und Gemeinheit, wo blindes Vertrauen mit einem Kopfschuss belohnt wird, eine Gesellschaft der reinen Negativität, wo vom Investmentbanker bis zum Kleinkriminellen jedermann der Teufel des anderen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Impressum
Zum Autor
Zu den Übersetzern
Pulpmaster Backlist
Dirty Old Town
Ein Wyatt-Roman
Garry Disher
1
Wyatt wartete darauf, einen Mann um fünfundsiebzigtausend Dollar zu erleichtern.
Es war ein Freitagnachmittag im Frühling und Wyatt stand mit seinem Wagen in der Nähe eines Terrassenhauses in Mount Eliza, fünfundvierzig Minuten von der City entfernt, immer die Bucht entlang. Das Haus gehörte einem Hafenmeister des Port of Melbourne, bot einen Blick aufs Wasser, war aber architektonisch gesehen ein Albtraum — nicht dass es Wyatt interessierte, er hatte schon immer gewusst, dass Reichtum und ein Mangel an Fingerspitzengefühl zusammengehörten. Ihn interessierte nur das Geld.
Bis jetzt war er mit fünfhundert in den Miesen, die Provision, die er Eddie Oberin für den Tipp in Sachen Hafenmeister gezahlt hatte. Nach Eddies Ausführungen waren die Hafenarbeitergewerkschaften mächtig, doch der Hafenmeister war es nicht minder. Es lag im Interesse aller Beteiligten, dass Schiffe festmachten, entladen und beladen wurden und so schnell wie möglich wieder in See stachen, aber einige Verzögerungen waren unvermeidlich — wenn ein philippinischer Seemann sich bei einem Sturz das Genick brach, zum Beispiel, oder eine Razzia durch den Zoll oder ein Streik. Und einige Verzögerungen gingen auf das Konto des Hafenmeisters: Drei- oder viermal im Jahr stellte er ein Schiff unter Quarantäne.
Das Gehalt dieses Burschen war nicht schlecht, aber er hatte Ausgaben — Spielschulden, Unterhaltszahlungen und die Kosten für zwei Wohnungen. Ein Apartment nahe den Docks, wo er fünf Tage die Woche wohnte, und dieses Terrassenungetüm in Mount Eliza. Für den Blick über die Bucht hatte er eine Menge hingeblättert, die Raten für den Kredit fraßen ihn auf und deshalb stellte er von Zeit zu Zeit ein Schiff unter Quarantäne. Oder man konnte es auch als Erpressung bezeichnen: Sie zahlen mir fünfundsiebzig Riesen, Mr. Schiffseigner, und ich stelle Ihrem Schiff ein sauberes Quarantäneattest aus.
Die Zeit verstrich, Wyatt wartete, und er dachte über Eddie Oberin nach. Eddie hatte einen passablen Bankräuber und Fahrer für Fluchtwagen abgegeben — einige Überfälle auf Genossenschaftsbanken, ein Lohnraub —, jetzt aber betätigte er sich hauptsächlich als Hehler und gehörte zu den Typen, die allerlei aufschnappten und das Gehörte verkauften oder anderweitig eintauschten. Fünfhundert Mäuse für etwas Geflüster ins richtige Ohr, dachte Wyatt.
In diesem Moment erklomm ein Lexus die steile Garagenausfahrt des Hafenmeisterhauses, ein silberfarbener, stromlinienförmiger Wagen, so gänzlich anders als der blasse, schwitzende und mit Bier abgefüllte Mann darin, dessen fade Gesichtszüge wie eingepfercht im Zentrum eines großen, kahl werdenden Kopfes saßen. Wyatt war all das nicht neu, schließlich hatte er den Mann mehrere Tage beschattet, und alles an ihm sprach dafür, dass der Hafenmeister keine Gefahr sein würde. Es sei denn, er hätte heute Nachmittag einen harten Kerl als Beifahrer dabei.
Hatte er nicht. Wyatt drehte den Schlüssel im Zündschloss des verbeulten Holden-Transporters, dessen Fahrer- und Beifahrertür mit dem Logo »Pete, der Maler« versehen waren, und folgte dem Lexus. Es gab tatsächlich einen Maler namens Pete, der momentan eine zweijährige Haftstrafe wegen Diebstahls absaß und nicht das genießen konnte, was Wyatt genoss: das Wasser der Bucht, glatt und schimmernd wie Eis, in der Ferne die Hochhäuser Melbournes — eine in Dunst gehüllte Traumlandschaft, die Sonne, deren Strahlen von den Windschutzscheiben der Autos zurückgeworfen wurden, die sich die Senken und Steigungen in Mount Eliza entlangmühten, die Aussicht, fünfundsiebzigtausend Dollar stehlen zu können.
Jetzt fuhr der Hafenmeister Olivers Hill hinunter, dorthin, wo sich Frankston platt und desillusioniert an die Bucht schmiegte. Frankston war die Bestätigung der Ansicht, dass es nie genug Kommerz sein könne, doch es handelte sich um billigen, grellen, verpuffenden Kommerz, war diese Gegend doch eine mit hoher Arbeitslosigkeit und voller sozialer Spannungen. Rund um den Bahnhof hingen heruntergekommene Junkies ab, Scharen übergewichtiger Kauflustiger bevölkerten die Bürgersteige und sechzehn Jahre alte Mütter schleppten sich dahin; gierig eingeatmeten Zigarettenrauch im Mund, nötigten sie ihrem Nachwuchs Cola mit einem Schuss Beruhigungsmittel auf, um ihn gefügiger zu machen. Die Fast-Food-Läden machten ein Bombengeschäft und kleine Mädchen zahlten in einschlägigen Läden überhöhte Preise für Plastikschmuck.
Und so überraschte es Wyatt, dass der Hafenmeister vom Nepean Highway in die Einkaufsmeile abbog. Vielleicht wollte er zum Friseur, vielleicht waren ihm zu Hause Brot und Milch ausgegangen und er war gar nicht hier, um einen Umschlag mit fünfundsiebzigtausend Dollar einzusacken.
Der Lexus bog um die Ecke, dann um die nächste und fuhr schließlich in die Tiefgarage eines Kinokomplexes. Wyatt dachte an eine eherne Regel: Halte dir stets einen Fluchtweg offen. Er wollte nicht in die Tiefgarage fahren. Er wollte nicht von Betonpfeilern behindert werden, von Leuten, die Einkaufswagen vor sich her schoben, von Schranken, die Verzögerung bedeuteten. Er stellte Petes Transporter in einer Parkzone ab, wischte seine Fingerabdrücke vom Lenkrad, vom Schaltknüppel und von den Türgriffen und ging zu Fuß ins Parkhaus.
Der Lexus stand in einer hinteren Ecke. Der Hafenmeister verschloss gerade die Türen mit der Fernbedienung, hielt inne, sah sich unsicher um. Er hatte einen billigen Aktenkoffer dabei. Sollte hier der Ort der Übergabe sein? Wyatt blieb neben einem Pfeiler stehen, wohin sich nur wenig von dem ohnehin schwachen Lichteinfall von außen und dem Licht einer Handvoll Neonröhren an der Decke verirrte. Der Geruch nach Urin und Abgasen hing in der Luft. Irgendetwas klebte unter Wyatts Schuhsohle. Und auch seine Hände fühlten sich klebrig an.
Er wartete. Warten war ein Zustand in seinem Leben. Wyatt wurde nicht unruhig oder verlor die Geduld, er blieb gelassen, aber auf der Hut. Ihm war klar, dass Warten womöglich nichts einbrachte. Er behielt den Hafenmeister im Auge, auf ein Geräusch eingestellt oder einen Geruch oder auf eine Veränderung der Luftbeschaffenheit, die ihm signalisierte, wegzulaufen oder in die Verteidigung zu gehen. Vor allem suchte er nach bestimmten Anzeichen bei Leuten in der Nähe: die Haltung, die ein Mann einnahm, wenn er bewaffnet war, einen Ohrhörer trug oder die Tiefgarage überwachte; Kleidung, die nicht zu den Umständen oder zur Jahreszeit passte, sondern nur etwas kaschieren sollte.
Urplötzlich setzte sich der Hafenmeister in Bewegung. In einigem Abstand folgte Wyatt dem Mann hinaus aus dem Parkhaus und durch die schweren Glastüren, die ins Foyer des Kinos führten. Der Hafenmeister lotste ihn durch den unübersichtlichen Raum und hinaus auf den Bürgersteig. Hier waren Frankstons Extreme am offenkundigsten: das glitzernde neue Multiplex auf der einen Seite, eine Reihe von Billigläden, eine Fleischerei, ein Fotogeschäft und eine Apotheke auf der anderen. Der Mann überquerte die Straße und ging eine kleine Ladenpassage entlang, wo ein Straßenmusikant seine Gitarre stimmte, Ständer mit billiger Kleidung dicht an dicht auf dem Gehweg standen und erschöpfte Kunden an einigen wenigen Tischen über ihren Kaffee gebeugt dasaßen.
Schnell war Wyatt klar, wie die Übergabe ablaufen würde. An einem Tisch saß ein einzelner Mann, einen identischen Aktenkoffer zu seinen Füßen. Der Typ trug einen Anzug und reichlich Widerwillen im Gesicht, also vermutete Wyatt, dass er für die Reederei arbeitete. Der Anzugträger wusste genau, weshalb er hier war. Mit säuerlichem Gesichtsausdruck verfolgte er, wie der Hafenmeister zur Begrüßung mit dem Kopf nickte, seinen Aktenkoffer abstellte und sich einen Stuhl heranzog. Kein Wort wurde gewechselt: Der junge Mann trank seinen Kaffee aus, griff sich den Aktenkoffer des Hafenmeisters und ging.
Das war der Moment, als Wyatt sich einschaltete. Er setzte auf Schnelligkeit und Überrumpelung. Er trug einen weichen Hut aus ausgeblichenem blauem Stoff, eine Sonnenbrille, Jeans, ein mehr als legeres Hawaiihemd und darunter ein weißes T-Shirt. Kleidung, die von seinem Gesicht ablenkte. Während der wenigen Momente, in denen Wyatt lächelte oder wenn Gefühle ihn bewegten, wirkte sein Gesicht anziehend. Sonst aber war seine Miene beherrscht, unbeeindruckt, als durchblicke er alles. Weil er darum wusste, lenkte er stets von seinem Gesicht ab.
Er glitt auf den freien Stuhl und umschloss das Handgelenk des Hafenmeisters mit seinen schlanken Fingern.
Der Hafenmeister fuhr zusammen. »Verdammt, wer sind Sie?«
»Schau’n Sie auf meinen Gürtel«, raunte Wyatt.
Der Mann tat es und wurde noch blasser.
»Die ist echt«, sagte Wyatt, und so war es auch. Eine kleine .32er Automatik.
»Was wollen Sie?«
»Sie wissen genau, was ich will«, erwiderte Wyatt, verstärkte den Druck seiner Finger und beugte sich hinunter zu dem Aktenkoffer. »Ich will, dass Sie fünf Minuten ruhig sitzen bleiben und dann nach Hause gehen.«
Er sprach mit gedämpfter, unaufgeregter, mit beruhigender Stimme. So war seine Vorgehensweise. Die meisten Situationen erforderten das. In den meisten Situationen verhinderte das einen Misserfolg. Er wollte keine Panik, wollte keine Handgreiflichkeiten.
Der Hafenmeister nahm die kräftige Muskulatur von Wyatts Schulterpartie in Augenschein, seine langen Arme und Beine. »Kommen Sie von der Reederei? Ich werde Ihr nächstes Schiff an die Kette legen, Sie dummes Arschloch.«
»Ich werde da sein und auch dieses Bestechungsgeld abfangen«, sagte Wyatt tonlos.
Der Hafenmeister korrigierte sein Urteil über den Mann, der im Begriff war, ihn zu berauben, denn er sah ein entspanntes, unbewegliches Gesicht hinter den dunklen Gläsern, das Gesicht eines Mannes, der ebenso gut allein in einem Raum hätte sitzen können. Er schluckte und sagte: »Dann lass dich nicht aufhalten, Kumpel.«
»Eine kluge Entscheidung«, sagte Wyatt.
Er stand auf, leicht irritiert, weil er zu viel gesagt, weil er das Ganze hinausgezögert hatte. Die kleine Einkaufspassage füllte sich mit Leuten, die ihre Mittagspause machten, und Wyatt war dabei, in der Menge unterzutauchen, als eine Stimme schrie: »Polizei! Auf den Boden! Alle beide! Sofort!«
Sie waren zu dritt — zwei überdrehte junge Kerle in Anzügen und der Straßenmusiker. Vermutlich wurden beide Enden der Einkaufspassage von uniformierter Polizei überwacht. Wyatt rannte auf die beiden Detectives zu, bewegte dabei windmühlenartig seinen Arm samt Aktenkoffer, stieß an die Strebe eines Sonnenschirms, der Aktenkoffer sprang auf und herausflog ein großer, prall gefüllter Umschlag. Wyatt fing ihn geschickt auf, wobei eine recht leise innere Stimme fragte, ob der Umschlag nur Papierschnipsel enthalte, während eine wesentlich lautere ihn vor die Alternative stellte, zu fliehen oder zu sterben.
Leute schrien oder verharrten in Schockstarre, als sie die Detectives mit ihren .38ern im Anschlag sahen, das zerbrochene Geschirr, die Ständer mit billiger Kleidung, die jetzt den Fußweg entlang auf die Straße rollten. Ein augenscheinlich bekiffter Biker feuerte Wyatt an, der Tische und Stühle umstieß und sich in eine Lücke zwischen den Ständern voller Kleider und T-Shirts schob und im Laden daneben verschwand.
Drinnen war es schummrig, beengt und die Luft vibrierte. Wyatt sagte die Musik nichts. Es war keine Musik. Es war Lärm, mehr nicht, Lärm, der Kunden anlocken sollte. Doch kein Kunde weit und breit, nur eine Verkäuferin, die voller Neugier aus dem Schaufenster sah, und eine zweite, die weiter hinten an der Kasse saß und Kaugummiblasen zerplatzen ließ.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie. Sie glaubte nicht wirklich, diesem Mann helfen zu können, der groß war und verschlossen und Wellen geballter Energie aussandte, aber zu fragen war nun mal ihr Job. Er ging ohne Eile an ihr vorbei und ihre Kiefer nahmen das Kauen wieder auf.
Wyatt fand sich in einem schmalen Flur wieder, mit einer Toilette für Angestellte auf der einen und einem Lagerraum auf der anderen Seite. Gelockerte Bodenfliesen, ein Kleiderständer mit abgebrochenen Rädern, ein Behälter voller Kleiderbügel und ein Packen lilafarbener Tüten aus stabilem Plastik mit dem Logo des Ladens. Er stopfte das Bestechungsgeld des Hafenmeisters in eine dieser Plastiktüten und ging durch den Hinterausgang hinaus in eine Gasse.
2
Die Gasse war leer, doch für Wyatt stellte das nur einen schwachen Trost dar. Ihm stand weder der Sinn nach einer Schießerei mit den Frankston-Cops, noch wollte er festgenommen werden, nicht mit der .32er. Also wischte er sie ab und warf sie auf das Dach des Klamottenladens. Er hörte ihr Klappern auf dem verzinkten Eisenblech, dann war Ruhe. Anschließend riss er sich das grellbunte Hemd und den Stoffhut herunter und stopfte beides weiter unten an der Gasse in ein rostiges Abflussrohr. Blieb noch die Sonnenbrille. Auch die wischte er ab, zertrat die Gläser unter seinem Absatz und warf das Teil in eine Abfalltonne. Jetzt erinnerte nichts mehr an den Mann, der das Geld des Hafenmeisters abgegriffen hatte.
Aber er musste weg aus Frankston. Zug, Bus oder Taxi konnte er vergessen. Genau wie das Warten darauf, dass der Sturm sich legte. Die Polizei würde bald flächendeckend im Einsatz sein, in den Straßen, innerhalb und außerhalb des Bahnhofes und an den Busstationen.
Das Geld noch immer in der lilafarbenen Plastiktüte, verließ Wyatt das Gewirr aus Gassen und Straßen und steuerte die Filiale von Aussie Disposals in der Beach Street an. Er kaufte eine Cargohose, eine violett verspiegelte Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt, eine Armeemütze, einen Tagesrucksack, und dabei ging ihm durch den Kopf, um wie viel leichter es Frauen hatten bei diesem Spiel. Kleine Variationen — ein Stirnband, ein Kopftuch, die Haare aufgesteckt oder offen getragen — konnten zu einer völligen Veränderung führen. Das junge Mädchen, das ihn bediente, zeigte sich gleichgültig: Sie kannte das zur Genüge, obdachlose Typen, die an ein paar Dollar gekommen waren, Studenten, die einen neuen Stil ausprobieren wollten. Wyatt in seinen Jeans und dem T-Shirt war nur ein weiterer dieser Typen.
Nachdem er seine alten Klamotten und die lilafarbene Plastiktüte im Rucksack verstaut hatte, setzte sich Wyatt die hässliche Sonnenbrille auf die Nase und machte sich über Seitenstraßen auf den Weg hinunter zur Bucht, etwa einen Block südwestlich vom Nepean Highway. Sobald er den Strand erreicht hatte, wollte er sich im Bummelschritt von der Gefahr entfernen, sich fünf oder zehn Kilometer in nördlicher Richtung der City nähern, was ihn zu den Küstenvororten Seaford, Carrum und Chelsea bringen würde. Dort konnte er es wagen, einen Bus oder den Zug zu nehmen. Doch als er den Nepean Highway überquerte, sah er die Tankstelle.
Sie war wie jede andere Tankstelle an jedem x-beliebigen Highway: Man füllte den Tank nach, prüfte den Reifendruck, kaufte Zigaretten oder einen altbackenen Donut, benutzte die Toilette.
Bei dieser konnte man seinen Wagen für einen Ölwechsel anmelden oder ihn frisieren lassen. Morgens brachte man ihn vorbei, ging zur Arbeit und holte ihn am Nachmittag wieder ab. Die Mechaniker hatten alle Hände voll zu tun: Wollte man nur eine einfache Serviceleistung, erledigten sie die sofort, um die Hebebühnen für anspruchsvollere Arbeiten frei zu machen. Sie stellten den Wagen draußen ab, direkt neben die Mietanhänger und Gasflaschen für Gasgrills. Manchmal verschlossen sie den Wagen und hängten die Schlüssel an einen Haken im Büro. War man den Mechanikern bekannt, ließen sie den Wagen mitunter unverschlossen und deponierten die Schlüssel im Fußraum.
Genau darauf setzte Wyatt und kam so an einen gepflegten Toyota Cressida. Er inspizierte den Fond, weil er das immer so machte, und bevor irgendjemandem etwas auffiel, war er auch schon weg. Während der Fahrt stellte er sich den Besitzer vor, einen Mann mit festen Gewohnheiten. Einen Mann, wie er einer war, nur älter und von einer anderen Fraktion.
Wyatt folgte dem Nepean Highway bis Mentone, nahm dann die Warrigal Road und fuhr anschließend über die Centre Road durch Bentleigh, eine endlose Strecke kleiner Häuser mit Ziegelverblendungen und voller bescheidener, leicht zu zerstörender Hoffnungen. Die Einwohnerschaft dieser Vororte bildete das Rückgrat von Regierungen, die sie steuerlich bis zum Anschlag belasteten und die ihre Söhne zum Sterben in fremde Kriege schickten. Wyatt fuhr die Lithgow Street entlang auf der Suche nach einem ganz bestimmten Haus. Vor allem war er auf der Suche nach der Einliegerwohnung an der Rückseite, wo er vor sechs Jahren eine .38er Smith & Wesson, fünftausend Dollar Bargeld und Papiere auf den Namen Tierney versteckt hatte.
Das Haus gab es nicht mehr. Stattdessen stand dort ein Wohnblock inmitten einer Betonfläche. Wyatt wendete, fuhr weiter und fragte sich, ob man sein Versteck ausgehoben habe. Vielleicht lag alles vergraben auf einer Deponie.
Quer durch die City ging es weiter nach Footscray, zu einem anderen Haus, einer Weatherboardschachtel. Dieses Haus existierte noch. Es hatte sich nicht verändert. Auch die Straße hatte sich nicht verändert. Nur die Bewohner waren andere. Zwei Streifenwagen standen vor dem Haus, ein dritter in der Einfahrt, Signalleuchten blitzten auf, und darum herum drängte sich ein Dutzend junger Somalis, die die Cops beschimpften, weil die ihre Freunde festnahmen. Wyatt fuhr weiter.
Er mühte sich mit dem starken Verkehr und fuhr schließlich auf einen Parkplatz hinter einem Pub an der Sydney Road, wo er das Bestechungsgeld des Hafenmeisters in Augenschein nahm. Er hatte teilweise richtiggelegen, was den Inhalt des Umschlags betraf. Acht feste Bündel mit grünen Hundertdollarnoten an Ober- und Unterseite, sodass der Hafenmeister auf den ersten Blick sieben Bündel mit je zehn und eins mit fünf Riesen gezählt und der Polizei so Zeit gegeben hätte, zuzugreifen und ihn festzunehmen. Doch zwischen den echten Scheinen steckte nur Papier. Also war Wyatt lediglich um eintausendsechshundert Dollar reicher und um eine Waffe ärmer geworden.
Auf die Waffe kam es an. Sie war in seinem Metier ein unentbehrliches Werkzeug. Wyatt ließ den Wagen stehen und fuhr mit der Straßenbahn zurück in die City. Es war kurz vor fünf am Nachmittag. Er wollte Ma unbedingt antreffen.
Sofern sie noch lebte.
Sofern sie noch mitmischte.
3
Zum selben Zeitpunkt war es in London acht Uhr morgens und ein für seine Arbeit mit der Klinge bekannter Franzose verfolgte einen unscheinbaren Mann von der U-Bahn-Station Blackfriars die Queen Victoria Street entlang Richtung Bishopsgate. Alain Le Page hielt Abstand, jedoch nur so viel, dass er den Mann nicht verlor, der mit einem dunklen Anzug bekleidet war, mit einem strahlend weißen Hemd, der eine Krawatte trug, die vage an die einer Schuluniform erinnerte, und glänzend schwarze Schuhe. Und einen Mantel, um sich vor der prickelnden Kühle des Herbstes zu schützen.
Als die Zielperson an einem Fußgängerübergang nach rechts und links blickte, sah Le Page die Brille aus Fensterglas, einen Teint, der seit geraumer Zeit keinem Strahl Sonne ausgesetzt gewesen war, ordentliches, kurz geschnittenes Haar, das auch einen Windstoß überstand, und einen einfachen Aktenkoffer aus Leder.
Jung, aber wie viele junge Männer in der City wirkte er wie ein Mann in den mittleren Jahren. Ein ausdrucksloses Gesicht, mittelgroß, steif in der Körperhaltung. Auf den ersten Blick hätte man nicht zu sagen vermocht, ob bei seinem Werdegang Oxford/Cambridge oder eine der neueren Fachhochschulen in den ehemaligen Arbeiterstädten eine Rolle gespielt hatten oder Eton/Harrow, ob er aus einer der elenden, weitläufigen Sozialbausiedlungen stammte, aus London kam oder aus der Provinz, ob er Banker war oder Angestellter bei der Post.
Nichts an ihm deutete darauf hin, dass es sich lohne, ihn umzubringen.
Es sei denn, man wusste, was Le Page wusste.
Als ihm zu Ohren gekommen war, dass die Zielperson ihre Fühler ausstrecke, hatte Le Page schnell den Hintergrund recherchiert. Es schien, als sei der Mann nicht mehr als ein Laufbursche. Er sah wie ein Geschäftsmann aus, weil die Banken, die Anwaltskanzleien und Versicherungsfirmen Wert darauf legten, dass ihre Boten angemessen ausstaffiert waren. Also keine Fahrradkuriere in rotem Lycra und mit lila gefärbtem Haar. Keine Gossensprache. Kein Schweißgeruch oder die Bewegung kaugummikauender Kiefer in Fahrstühlen und Foyers. Keine Rucksäcke oder Dokumentenmappen aus Plastik. Die Geschäftsleute der City wollten Verträge, Schecks, Emissionsprospekte und Testamente in ledernen Aktenkoffern transportiert wissen.
Doch dieser Typ arbeitete für Gwynn’s, eine kleine Privatbank, und hatte behauptet, er überbringe mitunter Inhaberobligationen und Schatzanweisungen der Bank of England, also grub Le Page tiefer.
Da war als Erstes die Bank selbst. Laut einer dezenten Hinweistafel neben dem Haupteingang war Gwynn’s seit 1785 im Geschäft. Per »Royal Appointment« durch verschiedene Monarchen. Träge, wenn es darum ging, sich den modernen Zeiten anzupassen. Geleitet von Sonderlingen, jungen und alten. Ein Gentleman steht zu seinem Wort, solche Dinge eben. Es mochte durchaus Haie in der Finanzwelt geben, Männer und Frauen, die einen Vertrag brachen, Gelder unterschlugen oder sich auf Insidergeschäfte einließen, aber mit solchen Leuten machte man keine Geschäfte. Was Vergewaltiger, Mörder und Taschendiebe betraf, das hier war die City, nicht irgendeine dieser fürchterlichen Hauptstraßen.
Gwynn’s war nie ausgeraubt worden, also kümmerte sich die Bank nicht um Sicherheitstransporte, nicht um bewaffnete Wachleute. Vielmehr hatte einer der Seniorchefs zu Bedenken gegeben, dass die Präsenz von Transportern und Wachleuten geradezu ideal sei, um die Aufmerksamkeit von Dieben zu erregen.
Außerdem, man bedenke die Kosten, diese plumpe Zurschaustellung.
Und so bediente man sich eines Boten, der aussah wie ein Banker. Und dieser Bote hinterging sie.
In einem zweiten Schritt kümmerte sich Le Page um den Hintergrund des Mannes, fand heraus, dass der seit zwei Jahren als Bote arbeitete und man ihn angeheuert hatte, weil er Soldat gewesen war. Kein Dummkopf, sondern jemand, der auf sich aufpassen konnte und mit Anzug, Mantel und Aktenkoffer den Anforderungen genügte. Die Arbeit war einfach, die Bezahlung kümmerlich, aber für anspruchsvollere Aufgaben waren seine Nerven zu zerrüttet. Er war im Irak gewesen, hatte Männer schreckliche Tode sterben sehen und geglaubt, er könne der Nächste sein. Er hatte überlebt, war jedoch nicht als Held zurückgekehrt. Er war nicht einmal als Held dorthin gegangen. Nur der damalige Premierminister hatte das geglaubt.
Le Page zählte eins und eins zusammen. Zwei Jahre hatte der Bote die beschissene Bezahlung und die Blasiertheit feister, verweichlichter Männer ertragen. Eines Tages dann war ihm mit absoluter Klarheit bewusst geworden, dass sein Weg ins Nichts führte, also hatte er seine Fühler ausgestreckt. Als Alexander, der Russe, Wind davon bekam, schickte er Le Page.
Das war jetzt eine Woche her. Le Page erstattete Bericht, bekam grünes Licht von Alexander und kontaktierte den Mann. Der Kurier von Gwynn’s wollte keine Namen wissen, keine Details. Er wusste nur, dass es ihm fünfundzwanzigtausend Pfund einbrachte und vielleicht ein paar Schrammen und Blutergüsse, damit es für die Cops echt aussah.
Es war Le Pages Absicht, es für die Cops richtig echt aussehen zu lassen.
Er lungerte neben einem Zeitungskiosk herum und verfolgte, wie die Zielperson Gwynn’s betrat. Er wartete, überhörte das triste Klappern der Absätze von Büroangestellten auf dem Weg zur Arbeit. Dann tauchte der Bote wieder auf, angespannt sah er der Übergabe entgegen. Es war ein frischer Morgen im Herbst und Le Page erstach den Mann, ließ ihn sterbend zurück, zwischen Müllsäcken hinter einer Filiale von Waterstones, in deren Schaufenstern gedruckte Ratgeber für den schnellen Reichtum lagen.
4
Ma Gadd vertickte Waffen an Männer wie Wyatt.
Sie wickelte ihre Deals in einem Blumenkiosk am Victoria Market ab. Ihr Verkaufsstand war keiner von den vielen behelfsmäßigen Marktständen auf der riesigen Freifläche des Marktes, wo Händler Obst und Gemüse, Kisten mit Socken, billigen Schmuck oder T-Shirts auf Bocktischen präsentierten und ihren Nachschub in ihren Toyota-Transportern aufbewahrten. Zu offen, zu gefährlich. Ma gehörte zu den alten Hasen, war eine der Glücklichen mit einer Marktbude, einem kleinen, abgeschlossenen Raum zwischen ähnlichen Buden entlang eines schmalen Ganges. Links von ihr bot ein Mann antiquarische Bücher an, rechts von ihr verkaufte eine Frau zahme Kaninchen, junge Katzen und Wellensittiche. Wollte jemand Blumen bei Ma Gadd kaufen, erschien er an ihrer heruntergeklappten Ladentheke und deutete auf die Blumen, die in den voll gestopften Eimern zu seinen Füßen oder im Bereich hinter Ma standen. Wollte man eine Waffe oder Munition, ging man nach hinten an die Tür. War man für Ma ein fremdes Gesicht oder kannte man weder die richtigen Leute noch den richtigen Spruch, dann war es das.
Nicht Ma reagierte auf Wyatts Klopfen, sondern ein Typ um die dreißig, schlank, drahtig, einer, der eher durchtrieben als gescheit aussah. Seine tätowierten Unterarme spannten sich. »Ja?«
»Ist Ma da?«
»Wer will das wissen?«
»Ist Ma da?«, wiederholte Wyatt.
Der Typ kniff leicht die Augen zusammen. Wyatt durchschaute ihn sofort: Knasterfahrung — Erwachsenenvollzug, vielleicht auch Jugendstrafe — und jetzt gehörten Misstrauen und Streitlust zu seinen natürlichen Eigenheiten. Wyatt fragte sich, ob Ma observiert werde, und war im Begriff, den Rückzug anzutreten.
»Wie ich sehe, hast du Bekanntschaft mit meinem Neffen gemacht«, ertönte die Stimme einer alten Walküre. »Lass dich nicht von ihm vergraulen.«
Hinter dem Neffen erschien eine hünenhafte Gestalt: Gesichtsbehaarung, Overall, Ausmaße wie ein großer Tank. Ob Sommer oder Winter, Ma trug stets einen Schal des Collingwood Football Clubs um den Hals und dazu eine spöttische Miene zur Schau. Die Zigarette in ihrem Mund wippte unter dem keuchenden Atem und die Augen über den aufgeblasenen Wangen erinnerten an zerbrochene Knöpfe. Sie war hässlich und sah aus, als wäre sie kurz vor dem Abtreten, wie immer. Wyatt hatte nur einmal bei ihr gekauft, eine Glock, doch das war zwölf Jahre her und diese Jahre waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. In der Zwischenzeit hatte Ma jede Menge anderer Kunden gehabt und dennoch erkannte sie Wyatt sofort.
»Ma.«
»Hab gehört, dass du wieder im Lande bist. Arbeitest mit Eddie Oberin, stimmt’s?«
Wyatt fluchte innerlich. Es gefiel ihm nicht, wenn irgendjemand irgendetwas über ihn wusste. Aber in diesem Spiel war immer einer beeindruckt oder pikiert und vermochte seine Klappe nicht zu halten. Wyatt konnte niemals völlig von der Bildfläche verschwinden. Momentan sowieso nicht. Er wollte nur einen großen Job durchziehen und wieder untertauchen.
»Willst du was kaufen?«, fragte Ma.
Die ganze Zeit über trat der Neffe von einem Bein aufs andere, als hoffe er, endlich auf jemanden einprügeln zu können; ein Eindruck, den sein Haar unterstrich, das in Büscheln in alle Himmelsrichtungen wies. Vermutlich das Werk eines Friseurs, doch für Wyatt sah es aus, als hätte der Typ versucht, sich die Haare auszureißen. »Ty«, sagte Ma, »kümmer dich um den Laden. Ich hab mit Wyatt was Geschäftliches zu bereden.«
Wyatt holte tief Luft, aber es war zu spät. Dieser Ty war sofort alarmiert. Sein Kiefer klappte herunter. »Das ist Wyatt?!«
»Tyler«, sagte Ma, als sie bemerkte, dass Wyatt dichtmachte.
»Ja, ja, schon gut«, sagte Ty, bemüht, gleichgültig und nicht ehrfürchtig zu wirken.
»Mein Neffe, was soll man da machen?«, meinte Ma.
Wyatt hatte weder Interesse an Ma oder ihrer Familie noch an irgendjemandem sonst. »Was hast du im Angebot?«
»Ich schließe gleich.«
Der gesamte Markt war kurz davor, zu schließen. Händler priesen Sonderangebote an, versuchten, ihre letzten Tomaten und Kohlköpfe loszuschlagen. Rollläden rasselten herunter. Jede Menge Kunden — Studenten aus der Innenstadt, Akademiker, Yuppies, Künstler, junge Fachkräfte und Immigranten — machten sich auf den Weg nach Hause. Wyatt sagte: »Bis tausend kann ich gehen.«
Ma strahlte und bewegte ihre Massen von der Tür weg. »Komm rein.«
Ihr Lagerraum war eng und dunkel, ein Ort mit Düften in der Luft und voller Blumen, die bündelweise in Eimern mit Wasser standen. »Hier«, sagte sie und knipste die Blüte einer Rose ab. Die Blütenblätter waren bereits etwas schlapp und Wyatt fing einen Hauch von Verfall ein.
Der auch von Ma hätte ausgehen können. Es gab einen Haufen anderer Gerüche in diesem voll gestopften Raum. »Na dann schau’n wir mal«, keuchte sie, schob Pappkartons zur Seite und nahm einen Packen Einwickelpapier hoch, um an eine Metalltruhe zu gelangen. Der mächtige Oberkörper versperrte Wyatt die Sicht, als Ma an dem Kombinationsschloss herumfummelte und schließlich den Deckel öffnete.
»Such dir eine aus«, sagte sie und trat zur Seite.
Tyler kam herein und jetzt konnte sich in dem Raum niemand mehr rühren. »Hast du abgeschlossen?«, fragte Ma.
»Jo.«
»Die Kasse leer gemacht?«
»Jo.«
»Wenn du willst, kannst du jetzt nach Hause gehen, Schatz.«
Doch Tyler behielt Wyatt im Auge. Der Neffe war ein unsympathischer Typ, getrieben von Impulsen und negativen Gefühlen, die er vermutlich nicht hätte benennen können, die Wyatt jedoch erkannte: Neid, Konkurrenzdenken, Verfolgungswahn, Hass. Ein geringes Selbstwertgefühl, im Clinch mit einem Ego, das unberechtigterweise riesengroß war.
»Jetzt noch nicht«, sagte Tyler zu seiner Tante.
»Wie du willst, Schatz.«
Unter Ächzen nahm Ma einen Einsatz heraus, auf dem Pistolen und Revolver lagen. Wyatt beobachtete sie und fragte sich, was um alles in der Welt sie bewog, ihren Neffen in ihre Nebengeschäfte einzuweihen. Er schrieb es der blinden Liebe zur Familie zu. Er hatte sie nie selbst erlebt, wusste aber, dass es so etwas gab.
»Du willst ’n Ding drehen«, sagte Tyler so provokant, als hätte er von den legendären Beutezügen gehört, sich aber nicht davon beeindrucken lassen.
Wyatt beachtete ihn nicht, sondern sah sich die Waffen an. Ma bewahrte sie geölt in Plastiktüten auf: zwei kurzläufige Revolver Kaliber 38, einen .357er Magnum, eine .32er Automatik, eine, wie er sie in Frankston hatte zurücklassen müssen, und eine schlanke Pistole, die sein Interesse weckte.
Ma nickte. »Hübsch«, schnurrte sie mit ihrer von Zigaretten und Whisky geschwängerten Stimme. »Gute Mannstoppwirkung.«
Tyler trat wieder von einem Fuß auf den anderen. »Was denn für ’n Ding? ’ne Bank? Gepanzerter Wagen? Ich kenn da diese Genossenschaftsbank in Geelong, scheiß auf die Sicherheitsleute, in zwei Minuten sind wir da rein und wieder raus, Maximum.«
»Darf ich?«, fragte Wyatt.
»Tu dir keinen Zwang an«, erwiderte Ma.
Es sprach einiges für diese Pistole, eine Steyr GB 9mm. Wyatt zog sie aus dem Beutel und hob sie an. Ungeladen wog sie etwas weniger als ein Kilo und das Magazin mit seinen achtzehn Schuss plus der einen zusätzlichen Patrone in der Kammer würde das Gewicht nur unwesentlich erhöhen. Er betrachtete sie eingehender und stellte fest, dass der Magazinentriegelungsknopf hinter dem Abzug keinerlei Spuren von Abnutzung aufwies.
»Fabrikneu«, sagte Ma.
Wyatt ersparte sich einen Kommentar. Er kaufte kein Auto. Er war nicht auf eine günstige Gelegenheit aus. Er kannte die Steyr und sie sagte ihm zu, mehr nicht. Anderen Selbstladern fehlte die Zuverlässigkeit der Steyr, sie neigten zu Fehlzündungen, Ladehemmungen oder machten Probleme beim Entladen. Eine Steyr GB konnte man in weniger als zwanzig Sekunden auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, und genau das tat Wyatt jetzt.
»Wie viel?«, fragte er.
»Zweitausend«, sagte Tyler.
»Halt die Klappe, Ty«, fuhr Ma ihn an. »Tausend.«
»Okay, einen Riesen plus eine Schachtel Patronen«, sagte Wyatt.
»Abgemacht.«
Tyler schnippte mit den Fingern. »Die Kohle.«
»Ty, Schatz.«
»Ich trau ihm nun mal nicht, verdammt noch mal.«
Wyatt zählte zehn Scheine vom Geld des Hafenmeisters ab. Ma beförderte die Steyr zurück in den Plastikbeutel und wickelte sie zusammen mit einem Strauß vielblättriger Rosen in mehrere Lagen rotes Seidenpapier. Wyatt zog los wie ein Mann auf dem Weg zu seiner Freundin. Er ließ eine dicke, alte Frau mit einer dicken Marie und einem Möchtegerngangster zurück, dem die Galle hochkam.
An der Elizabeth Street verdrückte er sich in einen McDonald’s, versenkte die Rosen in einem Abfallbehälter auf der Toilette, steckte die Steyr hinten in den Hosenbund und zog das T-Shirt darüber. Dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Bevor er anderweitig aktiv wurde, musste er die Pistole wegschließen.
Wyatt wohnte am Südufer des Yarra, in Southbank, einer Gegend mit neuen Apartmenthäusern, die sich hinter den Cafés, den Geschäften und Spazierwegen entlang des Flussufers erhoben. Westlake Towers, das waren vier Gebäude, um einen Hof gruppiert und in fußläufiger Entfernung zum Fluss und dem Melbourne CBD, dem City Business District. Jedes Gebäude verfügte über sechs Apartments pro Etage, eine eigene Tiefgarage, einen Swimmingpool auf dem Dach und einen Fitnessraum im Keller. Wyatt besaß zwei Apartments. Das eine war ein Unterschlupf im obersten Stockwerk. Seine Wohnung »für alle Tage« befand sich im ersten Stock am Ende eines schwach beleuchteten Flurs, wo nur er Grund hatte, sich aufzuhalten. Er ging unverzüglich hinein und deponierte die Steyr in einem Safe im Fußboden.
Er war kribbelig, stellte sich an das Fenster seines Wohnzimmers und blickte hinaus. Kurze Zeit später ging er zurück auf die andere Seite des Flusses, hinein in das Getümmel des frühen Freitagabends, streifte die spiegelnden Fassaden und Oberflächen mit kurzen Blicken und überlegte sich die nächsten Schritte. Tyler Gadd war ein Angeber, aber würde er es auf eine Konfrontation ankommen lassen?
In der Elizabeth Street regierte die Hektik: Scharen von Kauflustigen, Schulkindern und Büroangestellten, die zu Bussen und Straßenbahnen hasteten, nichts anderes im Sinn, als schnell nach Hause zu kommen.
Autos standen Stoßstange an Stoßstange, Straßenbahnen bimmelten, Hupen ertönten und die Luft war voller Abgase. Niemand nahm Notiz von dem kleinen Drama vor der Tür eines vollen Fotogeschäftes, als Wyatt herumfuhr und Gadd in den Schwitzkasten nahm. Es hätte ebenso gut eine rustikale Begrüßung unter alten Freunden sein können.
Gadd entfuhr ein Röcheln. Wyatts Unterarm drückte ihm die Luft ab. Wyatt drückte schwächer zu, dann wieder stärker, schließlich lockerte er den Druck. Der Blick seiner Augen war eisig, seine Stimme aber war sanft, als er sagte: »Du bist mir nach Hause gefolgt.«
»Du Profi hast gar nicht mitgekriegt, dass ich da war, oder?« Gadd keuchte und rieb sich den Hals.
Dem war so. Für Wyatt gab es keine Entschuldigung: Er hatte den Verfolger nicht bemerkt. Aber völlig im Stich gelassen hatten ihn seine Sinne nicht, und er bearbeitete Gadds Luftröhre noch einmal. »Halt dich von mir fern.«
»Hör doch, ich hab Ideen, prima Ideen.«
Wyatt wandte sich ab. »Kein Interesse.«
»Wie wär’s mit ’nem Bier? Oder ’nem Kaffee? Ich geb einen aus.«
»Ich geh jetzt. Komm mir nicht hinterher«, sagte Wyatt.
»Warte!«
Wyatt setzte sich in Bewegung. Er sah sich nicht um. Er marschierte vorwärts, bis sein Körper sich entspannt hatte, dann ging er den ganzen Weg zurück und bog rechts in die Collins Street ein. Kurz bevor er die Spitze der Steigung erreicht hatte, ging er links in eine Gasse, die an der Rückseite der Zentrale einer Bank entlangführte, und schließlich ein paar mit Pissflecken verunzierte Stufen hinunter und betrat die schmuddelige Souterrainwerkstatt eines Uhrmachers, bei dem er ein Schließfach gemietet hatte. Der Besitzer war noch derselbe, nur eben etwas älter geworden und kurzsichtiger, gebückter, mit zerkratzter, verschmierter Brille und Händen, die aussahen wie ein Flickwerk aus Rissen, Kratzern, Knochen und gegerbter Haut. Er erkannte Wyatt wieder, auch nach all den Jahren.
Wyatt verließ die Werkstatt mit seinen letzten fünftausend Dollar.
5
Le Page nahm den nächsten Zug von der Waterloo Station nach Paris, Tragetaschen von Harrods in der Hand und die Papiere in einem Pappzylinder des Souvenirladens der National Gallery. Er hasste diese Bahnfahrt, so eingezwängt unter dem Ärmelkanal.
Gegen Mittag an diesem Freitag mietete er ein Zimmer in einer kleinen Pension nahe den Tuilerien. Einer von Alexanders Gorillas kam wegen der Papiere vorbei, knurrte nur: »Er trifft Sie morgen«, aber in Alexanders Geschäftswelt wusste die rechte Hand nicht, was die linke tat, also folgte Le Page dem Gorilla und observierte Alexanders Apartment. Im Laufe des Nachmittags beobachtete er, wie ein Mann und drei Frauen eintrafen und das Haus wieder verließen, getrennt und mit Aktenkoffern in der Hand. Le Page heftete sich dem letzten weiblichen Kurier an die Fersen, verfolgte sie bis zum Abflugbereich des Flughafens und sah, dass sie an Bord einer Maschine nach Toronto ging. Er vermutete, dass die anderen Kuriere Ziele wie die Vereinigten Staaten, Südafrika und Süd- oder Lateinamerika angesteuert hatten.
Le Page kehrte zurück in seine Pension und hatte reichlich Zeit totzuschlagen. Er ließ seinen Laptop hochfahren und verschaffte sich einen Überblick über die neuesten Nachrichten im Netz. Ein Video zeigte eine Pressesprecherin von Gwynn’s, die dick auftrug und ihr Bedauern über den Tod des Mannes zum Ausdruck brachte — und Verwirrung, schließlich habe der Bote lediglich Hypothekenbriefe dabeigehabt. Eine dieser unerklärlichen Tragödien, sagte sie, ein spontaner Raubüberfall, der entsetzlich schiefging.
Die Geschichte wäre vielleicht im Sande verlaufen und der Dreizeiler unten auf Seite fünf desEvening Standardgeblieben, hätte der Exsoldat nicht etwas mit einer Angestellten aus der Sicherheitsabteilung angefangen, die wusste, wann Dinge unter den Teppich gekehrt wurden. Empört darüber, dass ihr Freund Gefahr lief, Teil der Statistik zu werden, steckte sie der Presse, dass er zweihundert Millionen Pfund in Inhaberobligationen in Form von Einlagenzertifikaten und Schatzanweisungen der Bank of England bei sich gehabt hatte.
Gwynn’s murrte zwar und beklagte sich, lehnte es aber ab, zu bestätigen oder zu dementieren. Le Page verzog den Mund. Er wusste, wie es laufen würde. Die Bank würde am Markt bleiben, immerhin gab es Gwynn’s seit 1785, und außerdem tritt man niemanden, der bereits am Boden liegt.
Am nächsten Morgen gegen zehn Uhr ließ Alexander ihn mit dem Wagen abholen. Der Russe gab sich unterkühlt und weltgewandt, sein Apartment hingegen war warm, voller Ikonen und Samoware. Kaffee, eine gelangweilt geführte Unterhaltung, dann überreichte Alexander ihm einen Stapel Effekten in einem braunen Briefumschlag. »Das werden Sie nächste Woche meinen Leuten in Mexico City übergeben.«
»Nicht jetzt?«
»Fahren Sie nach Hause. Ruhen Sie sich aus. Sie haben es sich verdient.«
Le Page fuhr mit dem Taxi zum Flughafen Charles de Gaulle. Auf der Herrentoilette verschaffte er sich einen Überblick über die Wertpapiere. Sie beliefen sich insgesamt auf einen Wert von fünfundzwanzig Millionen Pfund, in Nennwerten von hunderttausend bis zu fünf Millionen Pfund. Verglichen mit dem, was die anderen Kuriere mit sich führten, ein Taschengeld, vermutete Le Page. Während des Fluges dachte er darüber nach. Sein Haus lag in der Nähe von Toulouse, eigentlich nur ein Katzensprung Richtung Süden, dennoch flog er über Frankfurt. Er holte seinen BMW ab und fuhr nach Boussac, in die zwei Stunden entfernte Ortschaft im Südwesten, wo sich die gewundene Straße irgendwann zwischen den Schatten der Berge und den einfallenden Sonnenstrahlen hindurchschlängelte. Eine Welt der terrassierten Felder, der Mauern aus Gesteinen, der Wanderer und bimmelnden Schafsglocken, der Hühner, die entlang der abschüssigen Straße Futter aufpickten.
Und der einsam gelegenen Häuser, wie die umgebaute Scheune aus dem achtzehnten Jahrhundert, die Le Pages Zuhause war und die auf einer erhabenen Bergfalte lag, mit Blick auf alle Zufahrtsstraßen. Über einen holperigen Pfad, der vor einem Stahltor mit Gegensprechanlage endete, gelangte man zum Haus. Le Page hatte zusätzlich Sicherheitskameras am Tor installiert und auch an jeder Ecke des Hauses. Alarmanlagen und Scheinwerfer. Vier Kurzwaffen und eine Flinte waren an strategisch wichtigen Aussichtspunkten deponiert. Für den Fall, dass ein Fremder oder eine wenig vertrauenerweckende Bekanntschaft es überhaupt bis hierher schaffte: Jeder Besucher musste durch das Dorf, das ebenfalls Teil von Le Pages Frühwarnsystem war. Der Taxifahrer, der Bahnhofsvorsteher, der Gendarm, der Automechaniker, der Leiter des Postamtes und einige der Kinder, die auf ihren Rädern den Ort unsicher machten und jedermann hier kannten, ihnen allen hatte Le Page ein nettes Sümmchen gezahlt.
Er stellte seinen Wagen ab, entlud das Gepäck, machte sich einen Drink, setzte sich in das schwindende Licht und blickte hinüber zu den weißen Spitzen der Pyrenäen auf der spanischen Seite der Grenze. Die Mauer in seinem Rücken war einen Meter dick und hatte die Wärme der Sonne gespeichert. Er schloss die Augen und dachte an Alexander.
Das Ganze lief folgendermaßen:
Eine der legalen Geschäftszweige Alexanders war der Handel mit wertvollen Edelsteinen und Juwelen, und Le Page war der legale Kurier für das internationale Geschäft. Diamanten aus Amsterdam, Schweizer Uhren, australische Opale, Smaragde aus Thailand, Ringe, Broschen und Halsketten aus Frankreich und Italien. Eingedenk der Tatsache, dass ein Mann, der derlei Gegenstände in einem per Handschellen fest mit seinem Handgelenk verbundenen Titankoffer transportiert, Gefahr läuft, dass ein Dieb mit Machete ihm die Hand abhackt, trug Le Page stets ein Korsett mit eingearbeiteten Klettverschlussfächern. Während seiner Flüge nach New York, Quebec, Kapstadt, Auckland oder Melbourne zog er es aus und streifte es erst wieder über, kurz bevor er durch den Zoll ging und mit den erforderlichen Papieren wedelte.
Er war schon als Dieb ins Leben gestartet. Aufgewachsen war Le Page in einem Vorort von Marseille, als Sohn eines Buchhalters, der später wegen Unterschlagung ins Gefängnis wanderte. Scham, Not und Planlosigkeit zwangen Le Page, seine Mutter und die Schwestern zum Umzug in einen Problembezirk der alten Hafenstadt, wo der Junge lernte, mit dem Messer umzugehen und sich an einer Fassade bis zu einem im zweiten Stock gelegenen Fenster hochzuhangeln.
Stiehl oder stirb — oder um es weniger melodramatisch auszudrücken, sitz deine Zeit in einem unterbezahlten Job ab.
Die bei seinen Einbrüchen in zweite Etagen erzielte Beute brachte Le Page zu seinem ortsansässigen Hehler (einem Friseur in einer kleinen Seitenstraße, der stundenlang in einem seiner Stühle saß und dabei rauchte und las) und strich fünfzehn oder zwanzig Prozent des Wertes ein. Ein TAG Heuer Chronograph, den der Hehler für fünfhundert Euro losschlug, brachte Le Page um die einhundert Euro, je nachdem in welcher Geberlaune der Friseur gerade war, und an einem besonders glorreichen Tag hatte er eine Rolex im Wert von zwanzigtausend Euro mitgehen lassen können. Doch in den Vororten, wo er aktiv war, ging es für gewöhnlich bescheiden zu, und er besaß nicht die Fähigkeiten, um in den besseren Gegenden in eine hochgesicherte Villa oder ein entsprechendes Landhaus einzusteigen.
Le Page hatte sich darüber so seine Gedanken gemacht und war zu dem Schluss gekommen, dass die Lösung Masse statt Klasse lautete. Er kannte Leute.
Schon bald hatte er ein Netzwerk von Dieben am Start, das in und um Marseille herum Diebstähle für ihn beging. Er verschob Ringe, Halsketten, so manche Rolex Prince, eine Queen Victoria Gothic Crown, die eine oder andere Acht Reales Philip IV aus dem Jahre 1652 im Werte von eintausendfünfhundert Euro. Er zahlte zwölfeinhalb und der Friseur zahlte ihm fünfzehn Prozent.
Aber unter seinen Dieben waren Drogenabhängige. Sie wurden geschnappt. Der alte Friseur war immer weniger bereit, Le Page so viele Stücke abzunehmen. Hausbesitzer und Polizei wurden wachsamer. Also machte Le Page sich ans Sondieren, knüpfte in umliegenden Städten Kontakte zu Einbrechern, Pfandleihern, Altwarenhändlern und passionierten Besuchern von Fitness-Studios.
In Toulouse spazierte er eines Tages mit einer Omega Speedmaster in das Hinterzimmer eines Juweliers, weil er wusste, der Inhaber wollte sie haben, und zwar für die Ecke seines Schaufensters, die den Angeboten aus Nachlässen vorbehalten war, und er sah, dass der Juwelier nicht allein war. Der Unbekannte richtete eine Glock auf Le Page und sagte mit ausländischem Akzent: »Sie betreten unerlaubt mein Terrain.«
Die Russenmafia, dachte Le Page, schloss die Augen und wartete darauf, zu sterben. Als nichts geschah, öffnete er die Augen wieder. Der Juwelier schmunzelte. »Mr. Davidoff möchte ... «
»Alexander«, sagte der Russe.
»Alexander möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten.«
Le Page wartete, innerlich noch immer zitternd.
»Eine Omega Speedmaster in Nizza zu stehlen, um sie in das Schaufenster eines Ladens in Toulouse zu legen, ist dumm«, sagte Alexander.
Le Page unterdrückte den Impuls, den Mund zu verziehen. Er war hier, um mehr zu erfahren. »Warum?«
»Die Polizei in der einen Stadt spricht mit der Polizei in der anderen. Sie sprechen mit den Versicherungen. Diese Uhr«, sagte der Russe und deutete auf die Omega, »taucht in irgendeiner Datenbank auf, mit Bild und Seriennummer.«
»Also?«
»Also werden wir sie in Berlin oder in Amsterdam oder in Melbourne oder in Kapstadt verkaufen«, sagte Alexander.
Alexander wusste viel über Le Page. »Ich bewundere Ihre Fähigkeiten. Sie haben gute Nerven und sind intelligent.« Er musterte den geschmeidigen, asketisch wirkenden Dieb von oben bis unten. »Sie haben Ausstrahlung.«
Er bildete Le Page zum Kurier aus. Der überwiegende Teil der Aufgabe war legal. Le Page flog mit seinem Korsett voller Ringe, Halsketten, Armbänder und Uhren in eine Stadt wie Chicago und übergab Juwelieren und Schmuckfabrikanten die Lieferungen wie abgesprochen. Alles getreu den Buchstaben des Gesetzes, wenn man davon absah, dass einer der Juweliere eventuell eine gestohlene Tiffany-Brosche abnahm, der andere eine Patek Philippe. Das Finanzielle war bereits geregelt; Le Page hatte lediglich einzufliegen, zu liefern und wieder auszufliegen. Was spielte es schon für eine Rolle, wenn sich Beschreibungen gestohlener Wertgegenstände in den Datenbanken von Polizei und Versicherungen befanden? Wie wahrscheinlich war es, dass ein Kripobeamter aus Berlin während seines Urlaubs in San Francisco in einem Schaufenster eine Rolex als die wiedererkannte, die in einer Wohnung in Kreuzberg gestohlen worden war? Oder dass ein Ermittler aus Melbourne eine Datenbank in Toulouse durchforstete?
Auf diese Weise machte Le Page fünfzigtausend Euro extra im Jahr, doch er geriet ins Grübeln. Im Rahmen einer Reise hatte er ein Perlencollier mit Perlen aus Broome im Werte von zweihunderttausend Euro abgeliefert, ein anderes Mal eine Blaue Mauritius von 1847. Seinerzeit hatte er sich gefragt, was so besonders sei an diesem kleinen Fetzen Papier. Nachdem er dahintergekommen war, dass die Marke mehr als eine halbe Million wert war, fing er an zu träumen. Es stellte sich auch Frust ein. Er fühlte sich verschaukelt.
Und so hatte Le Page während der letzten achtzehn Monate eigene Omega Speedmasters und Rolex Oysters auf diesen internationalen Reisen dabeigehabt und sie innerhalb eines eigenen Netzwerkes verkauft, an einen sorgfältig aufgebauten Kundenstamm.
Darunter auch seine Cousins in Australien.
Henri und Joseph Furneaux waren schon im Kindesalter mit ihren Eltern nach Melbourne ausgewandert. Inzwischen um die vierzig, waren beide Brüder in der Schmuckherstellung tätig und als Inhaber eines exklusiven Geschäftes in einem der östlichen Vororte verkauften sie ihre Kreationen an andere Juweliere. Jedes Jahr unternahmen sie ihre Verkaufstouren zu Kunden in Melbourne und Umgebung, anschließend dann ging es Richtung Osten und Norden, also war es ein Leichtes für sie, Le Pages TAG Heuer Chronographen und Queen Victoria Gothic Crowns sozusagen unter der Hand zu verkaufen.